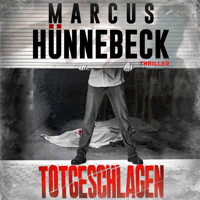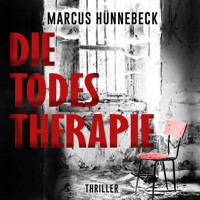0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zeilenfluss
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Erbarmungslos zwingt der Mörder sein Opfer, sich die Schlinge um den Hals zu legen. Minuten später ist der Mann tot.
Die Soko um den Fallanalytiker Hannes Stahl steht vor einem Rätsel. Rächt sich der Täter für erlittenes Leid, oder treibt ihn etwas anderes an? Die Polizisten handeln unter Zeitdruck. Der Mörder hat nicht zum ersten Mal zugeschlagen, und weitere Opfer drohen.
Zur gleichen Zeit versucht Gregor Brandt, den Unfalltod seiner Ehefrau zu verarbeiten. Der beurlaubte Staatsanwalt geht fieberhaft jedem Hinweis auf den Unfallverursacher nach, der die Schwangere sterbend zurückließ.
Schon bald finden Stahl und seine Kollegen eine Gemeinsamkeit der Mordopfer. Sie alle haben bei Gericht als Schöffen gedient – unter anderem bei einem Prozess, in dem Brandt die Anklage vertrat. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Morden und der Fahrerflucht?
Während Brandt und Stahl Stück für Stück der Wahrheit näherkommen, hat der Mörder bereits das nächste Opfer ins Visier genommen.
"Im Namen der Vergeltung" ist der erste gemeinsame Thriller der Bestseller-Autoren Marcus Hünnebeck und Chris Karlden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Im
Namen
der
Vergeltung
Thriller
Marcus Hünnebeck
Chris Karlden
1
Als Gregor Brandt am Nachmittag heimkam, stellte er die beiden Taschen, in denen sich seine nach der Arbeit getätigten Einkäufe befanden, in der Küche ab und legte eine Schallplatte von Charlie Parker auf.
Nachdem er sich frischgemacht und Anzug und Krawatte gegen legere Kleidung getauscht hatte, lehnte er sich in seinen Lieblingssessel im Wohnzimmer zurück, schloss die Augen und genoss die Jazzmusik, die aus den Boxen drang. Die chaotisch anmutenden Bebop-Klänge, die die meisten Menschen als stressig empfanden, beruhigten ihn ungemein. Und Entspannung hatte er dringend nötig.
Der Mordprozess, bei dem er die Anklage vertrat, machte ihm zu schaffen. Auch der heutige letzte Verhandlungstag für diese Woche war nicht so gelaufen, wie er es sich vorgestellt hatte. Ein Zeuge, der den Angeklagten in der Nähe des Tatortes gesehen haben wollte, räumte ein, dass er zum besagten Zeitpunkt betrunken gewesen sei, und meinte auf einmal sogar, dass er sich geirrt haben könnte. Ein gefundenes Fressen für den Anwalt des Angeklagten, der die Aussage des Zeugen genüsslich zerpflückt hatte. Nächste Woche standen zwar noch drei weitere Verhandlungstage und die Schlussplädoyers an, doch Gregor ließ das Gefühl nicht los, dass seine ansonsten nur auf Indizien beruhende Anklage für eine Verurteilung nicht ausreichen würde.
Er seufzte und versuchte das Thema beiseitezuschieben. Es war Freitagabend. Das Wochenende stand vor der Tür, und er war mit seiner Traumfrau verheiratet. In einer Woche würden sie nach Lissabon fliegen und sechs Nächte in dem luxuriösen Hotel logieren, in dem sie vor einem Jahr ihre Flitterwochen verbracht hatten.
Die Erinnerungen an die Zeit und die Vorfreude darauf, bald in die portugiesische Metropole zurückzukehren, erfüllten ihn augenblicklich mit einem Glücksgefühl. Beschwingt von der Musik erhob er sich aus dem Sessel und begab sich in die Küche.
Etwa eine Stunde später war er mit den Vorbereitungen für das Viergangmenü, mit dem er Rabea zum Abendessen überraschen wollte, so gut wie fertig. Nur den Hauptgang, ein Gemüse-Curry, musste er noch zubereiten.
Als das Telefon klingelte, legte er schnell das Messer beiseite, mit dem er gerade die Paprika schnitt, wischte sich die Finger an einem Küchentuch ab und nahm den Anruf entgegen. Es war Rabea.
»Hallo, mein Schatz«, begrüßte er sie.
»Schön, deine Stimme zu hören. Ich wollte dir nur sagen, dass ich jetzt Feierabend mache. Wie war dein Tag?«
»Nicht der Rede wert. Hast du deinen Artikel fertigbekommen?«
»Es fehlen ein paar Fakten, aber die recherchiere ich nächste Woche.«
»Gut so! Du bist schwanger und musst dich schonen.«
Sie lachte auf. »Du machst Scherze. Wir sind erst in der zehnten Woche. Sag mir lieber, ob du eine Idee hast, was wir zu Abend essen könnten. Ich habe wahnsinnigen Hunger. Soll ich uns etwas mitbringen?«
»Das brauchst du nicht. Ich habe schon was vorbereitet.«
Sie seufzte erleichtert. »Du bist der Beste. Was gibt es denn?«
»Lass dich überraschen.«
Rabea war Vegetarierin. Dies hatte ihn mit der Zeit ebenfalls dazu veranlasst, auf Fleisch und Fisch zu verzichten. Was er anfangs aus Solidarität getan hatte und ihm nicht leichtgefallen war, war nach den anderthalb Jahren, in denen sie ein Paar waren, zur Gewohnheit geworden. Inzwischen konnte er den ethischen Gründen, aus denen Rabea sich hauptsächlich fleischlos ernährte, durchaus etwas abgewinnen.
Als Vorspeise hatte er eine Karottencremesuppe und einen Rucolasalat mit Schafskäse zubereitet. Zum Nachtisch würde er Mousse au Chocolat mit Eis servieren. Nur auf den dazu passenden Wein würden sie wegen Rabeas Schwangerschaft verzichten müssen.
Die Zutaten für die aus dem Internet stammenden Rezepte hatte er nach dem Ende der heutigen Verhandlung frisch in einem Bio-Supermarkt gekauft. Er sah schon vor sich, wie Rabea aus dem Häuschen geriet, denn normalerweise war sie die Köchin. Er wagte sich nur selten an den Herd und hatte es noch nie in diesem Umfang getan.
»Es ist jetzt sieben Uhr. Wann, denkst du, wirst du zu Hause sein?«, fragte er.
»Der PC fährt gerade herunter. So in zwanzig Minuten.«
»Perfekt.« Wenn er sich beeilte, konnte er das Curry bis dahin zubereitet haben. »Ich liebe dich.«
»Ich liebe dich auch.« Bevor sie auflegte, gab sie ihm einen Kuss durch die Leitung.
Zwanzig Minuten später köchelte das Curry in der Pfanne, und ein Duft von gebratenem Gemüse, Ingwer und Kokosmilch lag in der Luft.
Gregor zog sich noch einmal um, da er Rabea nicht mit der nach Essen riechenden Kleidung in die Arme schließen wollte. Er schaffte es sogar, den Tisch zu decken, klassische Musik aufzulegen und Kerzen anzuzünden, sodass in seinen Augen alles perfekt war.
Als er anschließend auf die Uhr sah, war Rabea bereits eine Viertelstunde überfällig. Das Curry, das auf einer niedrigen Stufe vor sich hin köchelte, wurde langsam zu weich, und die Soße verkochte.
Es war nicht auszuschließen, dass sie auf dem Heimweg in einen Stau geraten war. Im Gegensatz zu ihm besaß Rabea einen Wagen, damit sie bei ihren tagesaktuellen Berichten schnellstmöglich zum Ort des Geschehens oder zu ihren Interviewpartnern gelangen konnte. Aber Stau gab es auf dem Weg von ihrem Büro aus nur selten, und wenn, dann zu einer früheren Uhrzeit. Wahrscheinlicher war, dass sie von einem Arbeitskollegen aufgehalten worden war.
Er nahm das Telefon und wählte ihre Handynummer. Nach dem fünften Klingeln hatte er jedoch nur die Stimme ihrer Mailboxansage in der Leitung. Allmählich trübte sich seine gute Laune ein. Musste das sein? Warum ließ sie ihn warten?
Er setzte sich vor den Fernseher und sah sich die Aufzeichnung der letzten Viertelstunde eines Fußballspiels vom vergangenen Wochenende an. Dann versuchte er erneut, Rabea zu erreichen. Als er über das Handy wieder keinen Erfolg hatte, wählte er ihre Büronummer. Auch dort hob sie nicht ab.
Das Curry war mittlerweile verkocht. Er stellte die Herdplatte ab und blickte missmutig auf das Essen, auf das ihm der Appetit erst einmal vergangen war. Aber dann machte er sich klar, dass es einen Grund für Rabeas Verspätung geben musste. Normalerweise rief sie an, wenn sie aufgehalten wurde. Rabea wusste nicht, dass er etwas Warmes vorbereitet hatte. Vermutlich ging sie davon aus, dass er – wie schon so manches andere Mal – Antipasti gekauft und frisches Brot und Käse aufgeschnitten hatte. Vielleicht hatte sie beschlossen, doch einen Zwischenstopp bei ihrem Lieblingschinesen einzulegen, um von dort etwas mitzubringen. Das wäre zwar überflüssig, aber sagte man schwangeren Frauen nicht nach, dass sie ganz plötzlich bestimmte Essensgelüste überkamen, von ihrem Heißhunger ganz zu schweigen?
Weitere zehn Minuten vergingen, in denen er sich eine wissenschaftliche Sendung anschaute, die sich mit dem Nutzen und den Gefahren von künstlicher Intelligenz beschäftigte. Als er auf die Uhr sah, verwandelte sich sein Unmut und das seltsame Rumoren in seiner Magengegend in ein sehr genau bestimmbares Gefühl: Verunsicherung.
Er schaltete den Fernseher aus. Es war nun vollkommen ruhig in ihrer neunzig Quadratmeter großen Wohnung am Prenzlauer Berg. Zuvor hatte Rabea allein hier gelebt. Als sie drei Monate zusammen gewesen waren, war er aus seiner kleinen Zweizimmerkiste in Friedrichshain zu ihr gezogen.
Zwei Stehlampen, die sie auf einem Antikflohmarkt erstanden hatten, tauchten das Wohnzimmer in ein schummrig warmes Licht. Hier konnte man sich wohlfühlen, und im Allgemeinen tat er das auch. Doch nun schnürte ihm ein unsichtbares Band allmählich die Kehle zu, und das Blut rauschte in seinen Ohren.
Es war einfach zu viel Zeit vergangen seit ihrem Telefonat. Niemals würde Rabea ihn so lange im Ungewissen lassen.
Das Klingeln an der Wohnungstür riss ihn aus der Umklammerung seiner düsteren Gedanken. Das musste sie sein. Endlich. Er sprang aus seinem Sessel auf, als wäre das Läuten der Startschuss für einen Hundertmeterlauf.
Während er zur Wohnungstür eilte, machte sich schlagartig Erleichterung in ihm breit. Gleichzeitig schossen ihm verschiedene Gedankenfetzen durch den Kopf. Warum klingelte Rabea? Sie hatte doch einen Schlüssel. Aber klar, sie musste ihn verloren haben. Und den Autoschlüssel und ihr Handy gleich noch dazu. Das war die Erklärung für ihre Verspätung. Oder ein Dieb hatte ihr beim Verlassen des Bürogebäudes die Handtasche samt Inhalt gestohlen.
Bevor ihm Zweifel an seinen hastig entwickelten Theorien kommen konnten, riss er die Tür auf. Das breite Lächeln auf seinen Lippen erstarb, seine Mundwinkel sackten nach unten. Mit zusammengezogenen Augenbrauen musterte er den Mann und die Frau, die mit betretenen Mienen im Hausflur standen.
Die Sneakers des Mannes waren abgenutzt. Seine Steppjacke war aus der Mode gekommen. Gregor schätzte ihn auf Ende fünfzig. Vielleicht ließen ihn aber die dunklen Ringe unter den Augen, die aschfahle Gesichtsfarbe und das schüttere Haar nur älter wirken.
Die Frau hatte ihre Haare zu einem Zopf zusammengebunden. Sie hatte etwas Verletzliches in ihren Zügen und war in eine enganliegende Daunenjacke gehüllt. Ihre schwarze Jeans passte zu ihren wie neu aussehenden schwarzen Stiefeln.
»Wir sind von der Kriminalpolizei«, sagte der Mann. Er senkte den Kopf und massierte sich mit Daumen und Zeigefinger die Stirn.
Auf Gregors Ohren legte sich augenblicklich ein unangenehmer Druck, der sein Gehör fast vollständig blockierte. Er wandte sich der Frau zu, doch auch sie hatte nun die Augen niedergeschlagen und gab ihm erst gar nicht die Möglichkeit zu einem Blickkontakt.
Als der Mann wieder zu ihm aufsah und weitersprach, glaubte Gregor, dass dieser ihm seinen Namen und den der Frau nannte. Aber genau wusste er es nicht, denn er nahm die Worte des Polizisten wie lang gedehnt und unnatürlich tief moduliert wahr, als ob jemand einen Film inklusive des Tons in Zeitlupe abspielen würde.
Gleich darauf konnte Gregor wieder normal hören – als hätte jemand die Korken, die den Schall zuvor absorbiert und verändert hatten, aus seinen Ohrmuscheln gezogen.
»Sind Sie Staatsanwalt Gregor Brandt?«
Gregor merkte, dass sein Mund leicht geöffnet war. Seine Zunge war rau wie Sandpapier, sein Hals staubtrocken.
»Ja.« Es war kaum mehr als ein Hauchen. Seine Beine wurden weich. Er hielt den Atem an und begann kaum merklich zu zittern.
»Ich bedauere sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, dass es einen Unfall gegeben hat. Ihre Frau Rabea ist dabei ums Leben gekommen.«
Gregors kalte Hand rutschte von der Türklinke ab, die er bis jetzt umklammert hatte. Seine Beine gaben nach. Der Mann machte einen Schritt nach vorne, packte ihn stützend am Oberarm und half ihm, sich wieder aufzurichten. Wie in Trance strauchelte Gregor zurück ins Wohnzimmer bis zu dem breiten Fenster, von dem man auf die Straße und die gegenüberliegenden Häuser sehen konnte. Er neigte den Kopf nach unten, und sein Blick fiel auf das gerahmte Hochzeitsfoto, das neben ein paar Urlaubsfotos auf der Fensterbank stand und auf dem Rabea ihm ein vor Glück strahlendes Lachen zuwarf. Er empfand eine ungeheure Leere.
»Das kann nicht sein. Ich habe eben noch mit ihr telefoniert«, flüsterte Gregor mehr zu dem Foto seiner Frau als zu den beiden Beamten.
Er spürte einen sanften Druck auf seiner Schulter. In der reflektierenden Fensterscheibe erkannte er, dass der Kriminalpolizist hinter ihn getreten und es seine Hand war, die auf seiner Schulter ruhte. Mit etwas Abstand zu ihnen stand die junge Frau. Sie sah mitgenommen aus.
»Es tut mir wirklich sehr leid«, sagte der Mann.
Gregor drehte sich um. Sein Atem ging flach, ihm war speiübel, und er hatte Tränen in den Augen. Trotzdem versuchte er sich einen Ruck zu geben und die Tatsachen nicht kampflos hinzunehmen.
»Rabea wollte Feierabend machen und dann sofort nach Hause kommen. Sie ist eine besonnene Autofahrerin. Insbesondere jetzt, wo sie schwanger ist. Es muss eine Verwechslung vorliegen.« Seine Stimme klang wimmernd und hell. Er erkannte sie selbst kaum wieder.
Die junge Polizistin schloss kurz die Augen und biss sich auf die Unterlippe.
Der Kripobeamte musste schlucken und massierte sich mit der rechten Hand die Schläfe. »Leider ist ein Irrtum ausgeschlossen«, sagte er dann. »Wir konnten sie anhand ihrer Papiere zweifelsfrei identifizieren. Ihre Frau wurde beim Überqueren der Straße vor dem Nebeneingang des Berliner Boulevardblatt von einem Auto erfasst und dabei tödlich verletzt. Vermutlich wollte sie zu ihrem Wagen, der auf der anderen Straßenseite geparkt war.«
Er konnte sich nicht mehr daran erinnern, was im Anschluss daran geschehen war. Die folgenden Tage glichen einem Albtraum, der zwar echt wirkte und ihn in seiner Grausamkeit mitten ins Herz traf, dem er aber dennoch nur als Zuschauer beizuwohnen glaubte. Es hatte etwas Surreales.
Er sah sich gemeinsam mit Rabeas Mutter die Beisetzung organisieren, und gleichzeitig fühlte es sich an, als ob seine Frau nur verreist wäre und jeden Moment wieder nach Hause und zur Wohnungstür hereinkommen würde. Vielleicht lag es an den Beruhigungsmitteln, die er – ohne auf die zulässige Dosis zu achten – eingenommen hatte und die über seine Wahrnehmung einen nebulösen Schleier legten.
Erst ein paar Tage nach Rabeas Beerdigung begriff er allmählich, dass er den Rest seines Lebens ohne sie verbringen musste, dass er sie tatsächlich nie wiedersehen, spüren und mit ihr reden würde. Dass ihr gemeinsames Kind mit ihr gestorben war und er niemals ihr Baby in den Armen halten würde. Die Trostlosigkeit dieser Erkenntnis ließ sein Innerstes zersplittern. Trauer und Angst vor der Zukunft bohrten sich wie Dolche in seine Brust und Eingeweide.
Der Wagen, der Rabea frontal und ungebremst niederschmettert hatte, war kurz zuvor gestohlen worden und laut Augenzeugen mit viel zu hoher Geschwindigkeit herangerast. Rabea hatte keine Chance gehabt auszuweichen. Nachdem der Wagen sie überrollt hatte, hatte der Fahrer angehalten, war zu ihr gegangen und hatte sie leicht gerüttelt. Vermutlich um festzustellen, ob sie noch lebte. Dann war er wieder ins Auto gestiegen, ohne von irgendjemandem daran gehindert zu werden, und weitergefahren, als ob nichts geschehen wäre. Später hatte die Polizei den Unfallwagen ausgebrannt auf einem verlassenen Industriegelände vorgefunden. Etwa dreißig Meter von dem Wagen entfernt konnte ein Lederhandschuh mit Rabeas Blut an den Fingern und Hautpartikeln des Handschuhträgers im Inneren sichergestellt werden. Möglicherweise war der Handschuh dem Fahrer unbemerkt aus der Jackentasche gefallen, als er sich von dem brennenden Auto entfernt hatte. Doch trotz dieses Beweisstücks konnte der Unfallverursacher bisher nicht ermittelt werden.
Als Staatsanwalt hatte er mit vielen Angehörigen von Opfern von Gewaltverbrechen gesprochen. Die Begegnungen hatten ihn jedes Mal zutiefst erschüttert. Dabei war er sich immer bewusst gewesen, dass er niemals in der Lage sein würde, deren Leid nachzuempfinden. Nun spürte er selbst diesen unerträglichen Schmerz, der, wie es schien, niemals enden würde.
2
Dreizehn Monate später
Montag
Gustav Freund legte den Kopf in den Nacken und streckte sein Gesicht der warmen Herbstsonne entgegen. Mitte Oktober, und man gewann jetzt am Nachmittag den Eindruck, es wäre noch immer Hochsommer. Herrlich!
Er lächelte zufrieden. Gut, dass er genügend Überstunden angesammelt hatte, um eine Stunde früher nach Hause zu gehen, ohne schief angeschaut zu werden. So konnte er ohne schlechtes Gewissen einen Umweg über den Park wählen und ein bisschen Sommergefühle tanken. Der Berliner Winter würde wieder grau und lang sein und die Gemüter der Einwohner quälen – daran zweifelte Freund nicht. Spätestens, wenn sich der erste Schnee in Matsch verwandelte, würde seine Laune – genau wie die seiner Mitmenschen – noch tiefer im Keller sein als die Temperaturen.
In fünfzig Metern Entfernung, unweit eines kleinen Spielplatzes, stand ein Eisverkäufer mit seinem Wagen. Davor warteten ein paar Kinder. Deren Eltern beobachteten die Sprösslinge oder hatten sich gleich an ihre Seite gestellt. Ein Vanilleeis wäre jetzt genau das Richtige. Vielleicht noch eine Kugel Stracciatella dazu? Bei Eissorten mochte er es klassisch. Freund reihte sich in die Schlange ein. Möglichst unauffällig beäugte er die Kinder. Die meisten waren im Vorschulalter, von bezaubernder Unschuld. Sie lachten, plapperten oder zappelten unruhig herum.
Freund liebte Kinder.
Oh ja, er liebte sie!
Fast wäre er aus der Reihe geflüchtet, doch in diesem Moment fragte ihn der Verkäufer nach seinen Wünschen.
»Vanille und Stracciatella«, antwortete er. »In der Waffel.« Er musste sich zwingen, dem Eisverkäufer in die Augen zu schauen.
Der lächelte ihm zu und holte eine Waffel aus dem Vorratsbehälter. Nun schweifte Freunds Blick doch umher. Am Rand des Spielplatzes waren ausschließlich Frauen zu sehen. Hatte die Gleichberechtigung ausgerechnet in diesem Viertel noch keine Fortschritte erzielt? Die meisten Mütter waren jung, höchstens Mitte zwanzig. Zwischen ihnen ein paar ältere Frauen – wie Sommersprossen auf einem sonst makellosen Gesicht.
»Bitte sehr. Das macht zwei Euro vierzig.« Der Verkäufer hielt ihm das Eis entgegen.
Freund griff nach seinem Portemonnaie und zahlte den Betrag passend, dann nahm er die Waffel in die Hand. »Danke.«
»Bis zum nächsten Mal.«
Freund strebte eine der Parkbänke an, die um den Sandkasten gruppiert waren. Einige der Mütter musterten ihn misstrauisch, doch es war sein gutes Recht, hier eine Pause einzulegen. Immerhin stand nirgendwo ein Schild, das den Aufenthalt für Erwachsene ohne Kinderbegleitung untersagte.
Er leckte an dem Stracciatellaeis und schloss die Augen. Im Gegensatz zu manch anderen Gesellen liebte er die Geräusche der spielenden Kleinen. Sie hatten eine sehr beruhigende Wirkung auf ihn.
Freund bedauerte es zutiefst, dass seine Ehe mit Veronika ungewollt kinderlos geblieben war. Ob die Partnerschaft besser verlaufen wäre, wenn sie einem Jungen oder Mädchen das Leben geschenkt hätten?
Er dachte an den Streit von gestern Abend, der sich an einer Kleinigkeit entzündet hatte. Wie so oft. Ständig genügten unwichtige Bemerkungen, um eine lautstarke Diskussion zu provozieren.
Freund seufzte.
»Geht’s Ihnen nicht gut?«
Er drehte seinen Kopf zur Seite und öffnete die Augen. Unbemerkt hatte sich eine junge Frau Mitte zwanzig neben ihn gesetzt, die ihn leicht besorgt musterte.
»Alles in Ordnung, danke.«
»Sie haben gestöhnt«, informierte sie ihn.
»Eher geseufzt«, korrigierte er. »Ich habe an meine Frau gedacht. Wir haben jahrelang versucht, Nachwuchs zu bekommen. Hätte es geklappt, würde ich jetzt wahrscheinlich mit meinem Sohn hier sitzen.«
»Oder Ihrer Tochter. Das tut mir sehr leid.«
»Mir auch.« Er erhob sich. Obwohl das Eis bereits leicht tropfte, unterband er den Impuls, es abzulecken, solange ihn die Frau musterte. »Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.«
»Ebenso.«
Plötzlich kam er sich wie ein Störfaktor in einer heilen Welt vor. Schnellen Schrittes verließ er den Spielplatz. Diesen Umweg sollte er in nächster Zeit wohl nicht mehr wählen, bevor ihn die hiesige Mutterbrigade auf die Liste potenzieller Kinderschänder setzte.
***
Fünfhundert Meter von der Haustür entfernt hatte der Mann den perfekten Beobachtungsposten gefunden. Er parkte unter einer Eiche, deren Zweige noch genügend verfärbtes Blattwerk zierte. Sein Wagen stand komplett im Schatten. Bestimmt würde sich später bei Befragungen der Nachbarschaft niemand an ihn erinnern.
Um nicht der Stille ausgeliefert zu sein, hatte er das Radio eingeschaltet. Unterbrochen von nervigen Jingles und der hektischen Stimme der Moderatorin dudelten aktuelle Hits und dasBeste der Neunziger aus den Lautsprecherboxen. Nach jedem Lied schaute er auf seine Armbanduhr.
Normalerweise war Freund jeden Nachmittag ein bis zwei Stunden allein zu Hause, ehe seine Frau heimkehrte. Der Job in der Berliner Baubehörde, den der Beamte bekleidete, ließ deutlich regelmäßigere Arbeitszeiten zu als die Führungsposition seiner Ehefrau. Nur selten kamen sie zeitgleich heim. Das hatte er in den letzten Wochen bei seinen Observationen herausgefunden.
Als ihn ein Jingle des Senders zum wiederholten Mal darüber in Kenntnis setzte, dass er dem zuverlässigsten Verkehrsservice der Stadt lauschte, wechselte er die Frequenz. Fast im gleichen Moment sah er seine Zielperson die Straße entlanglaufen. Unbeirrt steuerte Gustav Freund das Einfamilienhaus an.
Er blickte zur Uhr. Freund hatte pünktlich Feierabend gemacht. Vielleicht sogar etwas früher als sonst. Falls dessen Ehefrau nicht eher nach Hause kam, blieb ihm genügend Zeit, um seinen Plan auszuführen.
Er griff nach seinem Handy und aktivierte den Countdown, den er auf fünfzehn Minuten einstellte. Ungefähr die Länge von vier radiotauglichen Songs.
Dreieinhalb Lieder und einige vermeintlich witzige Moderatorensprüche später gab das Handy einen sich langsam steigernden Dreiton von sich, der das Ende des Countdowns ankündigte. Er deaktivierte ihn und atmete tief durch. Im Fußraum des Beifahrersitzes stand ein Rucksack, in dem alle Utensilien steckten, die er benötigen würde. Er packte den Tragegriff und deponierte sein Arbeitsgerät kurz auf dem Nebensitz. Aus einer Seitentasche holte er einen Stromschocker heraus, den er einsetzen würde, sobald Freund die Haustür öffnete. Der wanderte in die rechte Jackentasche. Als Rechtshänder käme er so am schnellsten daran.
Bevor er den Wagen verließ, schaute er sich unauffällig um. Niemand zu sehen, der ihn beobachtete. Er stieg aus, warf die Tür zu und verriegelte sie per Funk. Rasch lief er zum Haus der Familie Freund und klingelte.
»Hallo?«, erklang durch die Gegensprechanlage eine müde Stimme.
»Herr Freund? Hier spricht Hauptkommissar Schlenz. Es geht um Ihre Ehefrau.«
»Was ist mit ihr?«
»Machen Sie mir bitte auf?«
Es dauerte nur Sekunden, bis Freund die Tür öffnete.
»Ist Veronika etwas passiert?«
In einer fließenden Bewegung zog er den Stromschocker aus der Tasche. Bevor Freund die Gefahr wittern konnte, drückte er ihm das Gerät an den Hals und verpasste ihm einen starken Stromschlag. Der Mann schrie vor Schmerz, wankte und stürzte ohnmächtig zu Boden.
Er betrat über Freund hinweg den Hausflur. Ohne nach hinten zu blicken, schloss er die Tür. Nun musste er sich beeilen. Er nahm die Beine des Bewusstlosen und schleifte ihn ins Wohnzimmer.
Freund erwachte. Seine Augenlider flatterten, bevor sie aufgingen. Er stöhnte. Hektisch schaute er sich um, bis er seinen Peiniger erkannte, der eine Waffe in der Hand hielt.
Instinktiv krabbelte Freund ein paar Meter zurück. »Was wollen Sie?«
»Die Wahrheit!«, antwortete der Mann. »Du wirst sie mir geben.«
»Worüber?«
»Das weißt du genau.«
Freund schaute den Eindringling an. »Wovon sprechen Sie?«
Der Mann erkannte in den Augen Freunds, wie sehr der sich bemühte, ihn zu identifizieren. Doch selbst wenn es ihm gelänge, würde es ihm nicht weiterhelfen.
Er zeigte nach links. »Du stellst dich auf den Stuhl und legst dir die Schlinge um.«
»Was?«, erwiderte der Beamte verzweifelt. Sein Kopf ruckte zur Seite. Erst jetzt bemerkte er den Esstischstuhl, der nicht mehr an seinem Platz, sondern unter der Wohnzimmerlampe stand. An der Deckenhalterung der Lampe war ein Seil befestigt, an dessen Ende eine Schlinge baumelte.
»Nein«, flehte Freund verzweifelt.
»Entweder das, oder ich schieße dir in die Hoden.«
Instinktiv hielt der Beamte seine Hände schützend vor den Unterleib. »Wieso?«
»Weil ich die Wahrheit hören will.«
»Worüber?«
»Das erfährst du früh genug. Letzte Chance. Eins. Zwei.« Der Mann visierte den Unterleib an.
»Aufhören!« Mühsam rappelte Freund sich auf. Er packte den Rand des Stuhls und zog sich daran hoch.
»Die Schlinge um den Hals!«
Freund schluchzte. Tränen liefen ihm aus den Augen. »Bitte nicht!«
»Flenn nicht rum! Los jetzt! Sonst kommt deine Frau nach Hause, und ich muss sie deinetwegen erschießen. Dir wird nichts passieren, wenn du mir verrätst, was ich wissen will. Euch wird nichts passieren. Ich kann verschwinden, bevor Veronika heimkehrt.«
Freund war anzusehen, dass ihm der Gedanke Hoffnung gab. Er kletterte auf die Sitzfläche. Wegen der drei Meter hohen Decke war er noch ein gutes Stück von der Lampenbefestigung entfernt. Zögerlich legte er die Schlinge um seinen Hals.
»Am Knoten zuziehen, bis die Schlinge eng sitzt«, befahl der Mann. Freund folgte dem Befehl. Zufrieden nickte sein Gegenüber. »Warum hast du die Drohung nicht ernst genommen?«
»Welche Drohung?«, erwiderte Freund.
»Falsche Antwort!«
Ohne Vorwarnung trat er den Stuhl beiseite, der polternd zu Boden stürzte. Freund sackte kurz nach unten, bis das Seil den Sturz aufhielt. Seine Beine zappelten, und die beigen Chinos verfärbten sich im Schritt, als sich die Blase des Todgeweihten entleerte.
Gefühllos schaute er Gustav Freund beim Sterben zu. Er wartete, bis die letzte Zuckung versiegte.
»Du hättest es ernst nehmen sollen«, flüsterte er.
Bevor er das Wohnzimmer verließ, blickte er sich gewissenhaft um. Er hatte nicht ein Möbelstück ohne Handschuhe berührt. Die Bullen könnten ihn nicht durch solch einen einfachen Fehler überführen. Er holte sein Handy heraus und schoss ein Foto des Toten. Dann ging er hinaus.
3
Das Ehepaar Freund nannte ein schönes Haus sein Eigen. Dem Fallanalytiker Hannes Stahl fielen die zahlreichen liebevoll gestalteten Details ins Auge. Die Holzmöbel im Wohnzimmer passten perfekt zusammen und schienen zu einer Möbelserie zu gehören. An den Wänden hingen Gemälde, bei denen es sich um Originale angesagter Berliner Künstler handelte. Die Läufer am Boden wirkten hochwertig.
Für einen Zwei-Personen-Haushalt besaß das Ehepaar viel Platz. Von der Haustür führte eine Art Vorraum zu dem Wohnbereich. Keines der Zimmer maß weniger als fünfundzwanzig Quadratmeter.
Veronika Freund hatte Hannes Stahl und seinen beiden Kollegen – Hauptkommissarin Natalie Schrader und Hauptkommissar Benno Reiland – kurz Rede und Antwort gestanden und davon berichtet, wie sie ihren Mann gefunden und den Notruf gewählt hatte. Dann hatte sie ein Weinkrampf überwältigt. Stahl hatte die Witwe zwischen zwei Schluchzern um den Namen des Hausarztes gebeten, und der war innerhalb einer halben Stunde hergekommen. Momentan kümmerte er sich im Schlafzimmer um seine Patientin.
»Finanzprobleme scheinen die Freunds nicht zu haben.« Reiland deutete zu einem der Ölgemälde. »Ist das ein echter Mischer?«
Stahl erstaunte es, dass Reiland den Künstler kannte, der die Berliner Kunstszene seit zwei Jahren aufmischte – ein beliebtes Wortspiel im Feuilleton aufgrund seines Nachnamens.
»Ja, aus der Frühphase. Meine Frau und ich waren letztes Jahr auf einer Ausstellung. Da hab ich es gesehen. Entweder haben die Freunds das Bild für die Ausstellung verliehen oder es damals erwor…«
»Könnten wir zur Sache kommen?«, fragte Schrader ungeduldig. »Spart euch die Kunstgespräche für die nächste Vernissage auf. Zwei Morde in fünf Wochen. Beide nach dem gleichen bekannten Muster. Und wir wissen alle, wer der Mörder ist.«
»Nicht so voreilig«, wandte Stahl ein.
Schrader runzelte die Stirn. »Du zweifelst nicht wirklich daran.«
»Heiko Frost hatte für die erste Tat ein Alibi«, schlug sich Reiland auf Stahls Seite.
»Ein schwaches Alibi.« Schrader wurde sichtlich ungeduldig. »Er tötet vor vier Jahren einen alten Stasifunktionär, indem er ihm eine Schlinge um den Hals legt. Zufälligerweise ist dieser Funktionär sein Pflegevater, bei dem Heiko gelebt hat, seitdem er drei Jahre alt war. Anstatt dafür lebenslänglich zu bekommen, tischt er dem Gericht eine unfassbare Lüge auf, die ihm Richter und Schöffen abnehmen. Kaum kommt er ein halbes Jahr später unter Bewährungsauflagen frei, sterben zwei weitere Menschen unter ähnlichen Umständen. Zufall? Ganz sicher nicht.«
»Wir sollten uns nicht darauf versteifen«, widersprach Stahl. »Das erste Mordopfer, Valerie Niebach, war für eine große Immobilienfirma in leitender Position tätig. Gustav Freund arbeitete als Beamter für die Baubehörde. Könnte ein Zusammenhang sein. Vor allem, wenn man an die Bestrebungen denkt, Immobilienfirmen zu enteignen.«
Schrader stöhnte, doch sie hatte Stahls Argumenten nichts entgegenzusetzen. Als erfahrene Hauptkommissarin wusste sie, dass sie gerade am Anfang von Ermittlungen in alle Richtungen denken musste.
Das Öffnen einer Tür unterbrach ihre Diskussion. Aus dem Schlafzimmer kam der Arzt heraus. Er wirkte besorgt.
»Ich habe Frau Freund ein Beruhigungsmittel gegeben. Sie wird vermutlich gleich einschlafen.«
»Können wir sie vorher befragen?«, erkundigte sich Schrader.
Der Arzt verzog den Mund. »Höchstens einer von Ihnen. Nicht länger als fünf Minuten.«
»Ich mache das.« Stahl ging rasch in Richtung Schlafzimmer.
Schrader sollte diese Vernehmung nicht verderben, indem sie den Namen Heiko Frost ins Spiel brachte. Aus dem Augenwinkel sah er, dass sie ebenfalls aufgestanden war, sich nun jedoch wieder hinsetzte.
Er klopfte an die Schlafzimmertür, wartete einen kurzen Moment und betrat den Raum. Die Frau des Opfers schaute ihn mit verweinten Augen an.
»Hallo«, sagte er leise. »Darf ich mich zu Ihnen setzen?«
Veronika Freund nickte.
Neben der Tür stand ein Stuhl. Stahl trug ihn ans Bett und nahm darauf Platz.
»Ich würde Ihnen das am liebsten ersparen«, begann er, »aber die ersten Stunden sind in einer Ermittlung immer sehr wichtig.« Absichtlich vermied er das Wort Mord.
»Was wollen Sie wissen?«, fragte die Witwe.
Stahl gingen hunderte Gedanken durch den Kopf, doch besonders Fragen nach Eheproblemen erschienen ihm vorläufig unangemessen. Außerdem hatte der Arzt ihm maximal fünf Minuten eingeräumt. Er musste sich auf einen Ermittlungsansatz konzentrieren. Sollte er Schraders Vermutung ansprechen und den Namen Heiko Frost doch erwähnen? Sein Bauchgefühl riet ihm davon ab.
»Ist Ihr Mann jemals bedroht worden?« Die Frage ließ verschiedene Möglichkeiten offen.
»Wer sollte Gustav bedrohen?«, erwiderte sie leise.
»Vielleicht wegen seiner beruflichen Stellung?«, entschied sich Stahl für eine Stoßrichtung. »Wir haben in der Zwischenzeit ein bisschen nachgeforscht. Ihr Mann hat bei der Vergabe großer städtischer Grundstücke eine wichtige Rolle gespielt, oder?«
»Ja.«
»Wenn man an die aufgeheizte politische Stimmung denkt ...«
Sie starrte zur Wand. »Ich glaube nicht, dass ihn deswegen jemand bedroht hat. Obwohl er nie mit seiner Meinung hinter dem Berg gehalten hat.«
»Welche Meinung?«
»Er hält nichts davon, wenn Kommunen die Hauptverantwortung bei großen Bauprojekten tragen. Gustav meint, private Investoren würden kostengünstiger bauen. Er findet ...« Plötzlich hielt sie inne und führte eine Hand an den Mund. »Er fand. Oh Gott!«
Stahl umfasste ihre andere Hand. »Sie schaffen das«, versprach er. »Helfen Sie uns jetzt zu begreifen, was geschehen ist.«
»Ich fühle mich gerade so gar nicht stark.« Tränen traten ihr aus den Augen.
Stahl beschloss, die Vernehmung zu beenden. Sie würden in den nächsten Tagen zwangsläufig noch öfter miteinander sprechen, aber heute hatte eine Fortsetzung keinen Sinn mehr.
»Ich lasse Sie jetzt in Ruhe. Sollen wir jemanden anrufen, der herkommen könnte?«
»Meine Schwester Julia. Ihre Nummer ist ...« Veronika Freund runzelte die Stirn.
»Ich finde sie heraus. Keine Sorge.« Er erhob sich, stellte den Stuhl zurück und verließ den Raum.
Um einundzwanzig Uhr standen die Polizisten bei Heiko Frost vor der Wohnung. Der Mann lebte in einem Hochhaus in der fünften Etage.
Schrader klopfte energisch gegen die graue Tür. »Herr Frost, Polizei!«
Hinter ihrem Rücken verdrehte Stahl die Augen. Ein solches Vorgehen verkomplizierte die Situation unnötig.
Trotz ihres polternden Auftritts öffnete ihnen niemand. Ungeduldig drückte Schrader die Klingel. In diesem Moment erreichte der Fahrstuhl ihre Etage. Automatisch drehte sich Stahl um.
»Das könnte er sein.«
Der sechsunddreißigjährige Heiko Frost verließ den Aufzug. In der rechten Hand trug er einen schwarzen Rucksack. Für eine Sekunde hielt er bei ihrem Anblick inne.
Schrader hatte ihn sofort erkannt und rannte in seine Richtung. Tatsächlich wirkte der Mann so, als würde er den Rückzug antreten wollen. Dann straffte er seine Schultern und kam ihnen entgegen.
»Was wollen Sie hier?«
»Zeigen Sie mir Ihren Rucksack«, verlangte Schrader.
»Haben Sie einen richterlichen Beschluss?«
Die Hauptkommissarin griff nach dem Rucksack, den er jedoch außer Reichweite brachte. »Wagen Sie es nicht! Ich kenne meine Rechte.«
»Natalie!«, ermahnte Reiland seine Kollegin. »Vorsicht!«
Schrader besann sich ihrer Pflichten und trat zwei Schritte zurück. »Wo kommen Sie gerade her?«
Frost musterte sie kalt. »Wieso sollte ich ausgerechnet Ihnen das verraten?«
»Es hat einen weiteren Toten gegeben. Er ist genauso gestorben wie Ihr Vater.«
Frost ging an ihr vorbei. »Werner war nicht mein Vater.«
Aus der Hosentasche zog er einen Schlüsselbund.
»Herr Frost, können wir uns kurz mit Ihnen unterhalten?«, bat Stahl.
Der Angesprochene führte den Schlüssel ins Schloss. »Mit Ihnen würde ich sogar sprechen. Ihre Kollegen müssen draußen warten.«
»Einverstanden«, sagte Stahl.
»Von wegen!«, widersprach Schrader.
Stahl warf ihr einen finsteren Blick zu. Er ahnte, dass es ihr nicht gefiel, bloß die zweite Geige zu spielen. Offiziell war Schrader in ihrem Dreierteam die Hauptverantwortliche. Doch was hatte es für einen Sinn, jeglichen Kooperationswillen Frosts im Keim zu ersticken?
Reiland sah das zum Glück ähnlich. Er packte ihren Arm. »Wir warten im Auto.«
Er zog sie ein Stück zurück. Unterdessen betrat Frost die Wohnung.
»Darf ich?«, fragte Stahl.
»Meinetwegen.«
In dem schmalen Flur öffnete Frost einen Wandschrank und stellte den Rucksack hinein. »Gehen wir ins Wohnzimmer.«
»Wo waren Sie?«, wollte Stahl wissen.
»In Hamburg.« Frost betrat den großen Raum, in dem es leicht muffig roch. Er ging zur gegenüberliegenden Wand und öffnete zwei der drei Fenster.
»Wie lange?«
»Nur für eine Nacht. Was ist passiert?«
Frost setzte sich an den Tisch, Stahl nahm ihm gegenüber Platz.
»Kennen Sie Gustav Freund?« Der Fallanalytiker achtete genau auf verräterische Zeichen in Frosts Gesicht.
Der war entweder ein guter Pokerspieler oder hatte mit der Sache nichts zu tun. »Nie gehört.«
»Heute ist jemand bei ihm eingebrochen und hat ihn an der Lampenaufhängung aufgeknüpft. Seitdem Sie entlassen worden sind, ist Freund das zweite Mordopfer, das wie Ihr Pflegevater gestorben ist.«
Frost schloss die Augen. »Ein einziger Fehler! Ich habe einen einzigen Fehler begangen! Wissen Sie, wie es ist, wenn man von seiner Mutter auf ihrem Sterbebett erfährt, dass man gar nicht aus der Familie stammt? Nein, natürlich nicht. Wie könnten Sie auch! Werner mauerte total. Aber ich fand trotzdem ein paar Sachen heraus. Mein Pflegevater war ein Stasioffizier. Ich bin Systemgegnern weggenommen und zu meiner Familie gebracht worden. Frost ist nicht einmal mein richtiger Name. Ich trage ihn bloß noch so lange, bis ich die Wahrheit kenne.« Er öffnete die Augen. »Ich wollte Werner nicht umbringen. Aber nachdem ich erfahren habe, dass er wohl selbst für die Folter von Regimekritikern zuständig war, hab ich seine Methoden angewandt.« Frost erhob sich und trat ans Fenster. »Der Stuhl ist versehentlich umgekippt. Ich habe eine Viertelstunde versucht, ihn zu halten. Dann bin ich ins Straucheln geraten. Werner sollte nicht sterben.«
Damit wiederholte Frost genau die Erklärung, die er vor Gericht abgegeben hatte.
»Haben Sie seit Ihrer Entlassung weitergeforscht?«, wechselte Stahl das Thema.
»Deswegen war ich in Hamburg. War leider ein Fehlschlag.«
»Wo haben Sie geschlafen?«
Frost drehte sich zu ihm um und verschränkte die Arme vor der Brust. Nach kurzem Zögern nannte er den Namen des Hotels.
»Wie sind Sie nach Hamburg gekommen? Mit Ihrem Auto?«
»Mir wäre es lieber, wenn Sie jetzt gehen.«
»Herr Frost, im Gegensatz zu meiner Kollegin Schrader glaube ich Ihnen. Helfen Sie mir, Ihr Alibi zu untermauern.«