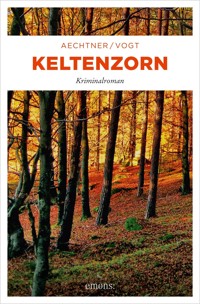Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Leinpfad Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In 18 Morden um die Welt Kriminelle Kurzgeschichten von fünf Kontinenten Zwanzig Autorinnen erzählen als Hommage an Jules Vernes von Tatorten aus der ganzen Welt. Da geht es um den Ravenmaster, der sich um die Raben im Londoner Tower kümmert. Um Sarah, die mit einem Katamaran in der indonesischen Inselwelt kreuzt. Oder um zwei schwarz-weiße Paare in Ghana. Dann um einen Schönheitschirurgen und seinen Patienten in Neu-Dehli. Um die Silvesterreise eines Paares nach Rio de Janeiro. Kann man sich vorstellen, dass es im Wiener Burgtheater hinter der Bühne leidenschaftlicher zugeht als auf ihr? Und schließlich: Was ist der berühmteste Cold Case Australiens? Es gab nur diesen einen Schlüssel und den besaß sie. Dieser Stollen war ihr Geheimnis. Alle anderen, die davon wussten, waren längst tot. Sie war die Einzige, die Zugang zur Hölle hatte. (Aus: "Dem Himmel so fern" von Thea Lehmann) Eine Reise rund um den Erdball, infiziert vom Lese-Virus, aber völlig Corona-frei!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gefördert im Rahmen des Kulturförderprogramms„Hessen kulturell neu eröffnen“
Fenna Williams und Petra K. Gungl (Hg.)
IN 18MORDENUM DIEWELT
Kriminelle Kurzgeschichtenvon fünf Kontinenten
Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und liegen nicht in der Absicht der Autorinnen – es sei denn, es handelt sich um einen historischen Stoff.
© Leinpfad Verlag
2021
Alle Rechte, auch diejenigen der Übersetzung, vorbehalten.
Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung des Leinpfad Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag und Layout: Ursula S. Kosa, Ingelheim
Leinpfad Verlag, Leinpfad 5, 55218 Ingelheim,
Tel. 06132/8369, Fax: 896951
E-Mail: [email protected]
www.leinpfadverlag.com
eISBN 978-3-945782-72-9
INHALT
Am Ticketschalter. Vorwort der Herausgeberinnen
Grußwort der Hessischen Ministerin für Wissenschaft und Kunst Angela Dorn
Grußwort der Präsidentin der Mörderischen Schwestern e.V. Carola Christiansen
EUROPA
Großbritannien – Meister der Raben – Pia O‘Connell
Italien, Südtirol – Das schlechte Gewissen der Stadt – Heidi Troi
Griechenland – Die grüne Göttin – Ingrid Werner
AFRIKA
Äthiopien – Wie Sokrates – Laura Gambrinus
Ghana – Ghana in schwarz-weiß – Carola Christiansen
Namibia – Dem Himmel so fern – Thea Lehmann
ASIEN – VORDERER ORIENT
Israel – Reisewarnung? Für die Katz‘ – Regina Schleheck
Iran – Wüstenkälte – Uli Aechtner
ASIEN – SÜDOSTASIEN
Indien – Schön und tot – Edda Minck
Indonesien – Wie Feuer und Meer – Jennifer B. Wind
AUSTRALIEN
Australien, Queensland – Totgesagt – Christiane Geldmacher
SÜDAMERIKA
Peru – Ein unerwartetes Geschenk – Ursula Schmid-Spreer
Brasilien – Weiß und Rot – Gitta Edelmann
Französisch-Guayana – Grenzgänge – Fenna Williams
NORDAMERIKA
USA, North Carolina – Alles im Fluss – Carly Martin
Kanada – Nimmerland – Mareike Fröhlich
ZURÜCK NACH EUROPA
Island – Johannistagstod oder zwei Fliegen mit einem Schlag – Ivonne Keller
Ungarn – Die Nacht des Schamanen – Cornelia Rückriegel
Österreich – Wiener Masken – Petra K. Gungl
Deutschland, Hessen – Ei Sischää Blues – Nellie Elliot
Ein Buch geht durch viele Hände – von der Idee bis zum großen Worte ENDE. Dank der Herausgeberinnen
Die Schreibtischtäterinnen. Kurzbiografien
Die Unterstützer*innen
Am Ticketschalter
Sie können oder wollen gerade nicht auf Reisen gehen, haben aber übermächtiges Fernweh?
Dann kommen Sie mit uns auf einen abenteuerlichen Trip rund um den Globus: Fliegen wir gemeinsam auf Rabenschwingen vom Tower of London zu einer dramatischen Shakespearevorstellung im Wiener Burgtheater, mischen uns unter Schmuggler in Französisch-Guayana, erleben einen mörderischen Jahreswechsel in Rio und essen Jaleb in Neu-Delhi oder Meerschweinchen in Peru.
Denn »Wer zum Hängen geboren wurde, stirbt nicht durch Ertrinken …«, sagte einst Jules Verne, der Autor von IN 80 TAGEN UM DIE WELT.
Von den Abenteuern dieser Reise inspiriert, sind Sie auf den kommenden Seiten 18 Morden auf der Spur – es gibt allerdings auch Überlebende! In welchen Ländern? Finden Sie es heraus! Das Ticket halten Sie bereits in Händen.
Gefördert und unterstützt von der Hessischen Kulturstiftung, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst sowie den Mörderischen Schwestern e.V., lassen Sie uns gemeinsam aufbrechen und das Flair fremder Länder genießen …
Gute Reise wünschen Ihnen im Namen aller AutorinnenFenna Williams & Petra K. Gungl
Grußwort der Hessischen Ministerin für Wissenschaft und KunstAngela Dorn
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es war eine dunkle und stürmische Nacht. Die Turmuhr schlug eins, doch in Wirklichkeit war es erst Mitternacht über dem mittelenglischen Moor: Der Gärtner des Pfarrers hatte die Zeiger verstellt, um zusammen mit der vertauschten Bahnkarte sein Alibi für den Mord …
Na gut, ich überlasse es doch lieber anderen, spannende Geschichten zu Papier zu bringen. Den Autorinnen dieses Bandes zum Beispiel. Sie reisen mit 18 Morden um die Welt – in den Fußstapfen von Phileas Fogg, der bei Jules Verne 80 Tage für die Strecke hatte und seine Wette nur dank der Zeitverschiebung beim Überqueren der Datumsgrenze gewann: Es war knapp.
Knapp ist es in den Corona-Zeiten, in denen der vorliegende Band entstanden ist, auch für viele Künstlerinnen und Künstler – dessen bin ich mir sehr bewusst. Gerade die Kultur lebt von Konzerten, Theateraufführungen, Museumsbesuchen und Lesungen, vom direkten Kontakt zwischen Menschen. Deshalb ist sie so besonders verwundbar. Ich bin froh, dass die Arbeits- und Projektstipendien meines Ministeriums einen Beitrag dazu geleistet haben, dass Künstlerinnen und Künstler weiterarbeiten können.
Neben vielen anderen großartigen Werken ist daraus auch dieses Buch entstanden. Das freut mich besonders: Das Schmökern und auch das Hörbuch mit passender Musik ermöglichen es uns, dem leider in der Realität mörderischen Virus mit Geschichten zu entfliehen, die nur in der Fantasie mörderisch sind.
Viel Spaß und Spannung wünschtAngela DornHessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst
Grußwort der Präsidentin der Mörderischen Schwestern e.V.Carola Christiansen
Liebe Leserinnen und Leser,
die Hessische Kulturförderung hat mit dieser Anthologie (und dem dazugehörigen Programm) ein reines »Frauenpower-Projekt« gefördert. Obwohl alle natürlich (insgeheim) auf eine Zusage gehofft hatten, waren unsere Überraschung und Begeisterung doch riesengroß. Besonders gefreut hat es mich als Präsidentin der Mörderischen Schwestern e.V., denn unser Vereinsziel ist »die Förderung der von Frauen geschriebenen Spannungsliteratur«.
Die Bereitschaft des Leinpfad Verlages, diese Anthologie trotz augenblicklich angespannter Lage zu verlegen und damit Vertrauen in unser Projekt zu beweisen, war zweifellos ein entscheidender Schritt.
Ferner freut mich die Beteiligung anderer Kulturschaffender an diesem Projekt: der Harfenistin Esther Groß, der Mezzosopranistin Stefanie Tettenborn und des Duos BIEN SÛR. Durch eine Kooperation zwischen unterschiedlichen Kulturformen stärken wir nicht nur die Kultur im Allgemeinen, sondern bringen auch uns und unser Publikum zusammen.
Dass alle an diesem Projekt Beteiligten so weit gekommen sind, liegt in erster Linie am Fleiß, der Professionalität und der Unterstützung unserer Herausgeberinnen Fenna Williams und Petra K. Gungl – dafür ein fettes Dankeschön von uns!
Vielleicht können wir gemeinsam andere Autorinnen und Autoren motivieren, in diesen herausfordernden Tagen den Mut aufzubringen, etwas auf die Beine zu stellen. Das wäre ein ganz besonderer Erfolg dieser Anthologie!
Genießen Sie nun die Geschichten und lernen Siedabei Land und Leute auf eine völlig neue Weise kennen.Gute Reise!
EUROPA
GROSSBRITANNIEN
Pia O’ConnellMeister der Raben
»Ich muss hier raus«, sagte Jess und hielt ihre bandagierte Hand schützend gegen das Sonnenlicht, das durch die historischen Butzenscheiben fiel. Mit einem Ruck setzte sie sich im Bett auf.
»Ich halte diesen Zirkus nicht mehr aus.« Demonstrativ hielt sie sich beide Ohren zu. Bauarbeiter waren seit Tagen damit beschäftigt, ein Gerüst am Weißen Turm im Tower of London hochzuziehen. Der metallene Klang ihrer Hämmer drang bis in die entlegensten Winkel und vermischte sich mit dem aufgeregten Schnattern der Schulklassen und Touristen, die sich schon in aller Frühe vor den Toren des Towers versammelt hatten.
Harry Hancock sah auf seine Frau hinunter und stellte eine dampfende Tasse Tee auf ihren Nachttisch. Er war bereits in Uniform. Der dunkelblaue Rock mit der roten Paspelierung, der roten Krone und den Buchstaben E II R auf der Brust verlieh ihm eine mittelalterlich anmutende Würde. Seine schwarzen Schuhe waren auf Hochglanz poliert.
»Wir sprechen heute Abend darüber«, sagte er beschwichtigend. »Ich muss mich jetzt um die Raben kümmern.«
»Die Raben! Die Raben! Immer nur die Raben«, beklagte sich Jess. »Hauptsache, den Raben geht es gut. Wie es mir geht, ist dir scheißegal.«
Sie rutschte im Bett nach unten und zog sich die Decke über ihren zerzausten Blondschopf. Jesses rotgetigerte Katze Riana sprang zu ihr hinauf und fauchte Harry an.
»Schatz, jetzt sei doch nicht so, das stimmt doch gar nicht.« Harry warf einen Blick auf die Uhr, setzte sich dann seufzend auf die Bettkante, schubste die Katze hinunter und gab seiner Frau einen Kuss auf die Locken, die unter der Decke hervorspitzten.
»Der heutige Abend gehört nur uns beiden. Du und ich, im Restaurant, bei Kerzenlicht.« Harry strich seiner Frau sanft über die Hand. »Champagner, unser Hochzeitstags-Menü«, er küsste ihre Finger, »du in deinem neuen Kleid, das dir so gut steht.«
Langsam kam Jess unter der Decke hervor, drehte sich um und sah ihren Mann mit zusammengezogenen Brauen an. »Harry Hancock, das eine sage ich dir: Wenn du nicht pünktlich um sechs Uhr hier auf der Matte stehst, dann kannst du mit deinen elenden Raben Hochzeitstag feiern.« Damit rollte sie sich zur Seite und zog sich die Decke wieder über den Kopf. »Verdammte Rabenbrut«, hörte er sie leise fluchen.
»Immerhin bin ich der verdammte Rabenmeister«, brummte Harry, ging aus dem Schlafzimmer und ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen. Im Flur nahm er den ballonartigen dunkelblauen Hut vom Haken und setzte ihn auf.
Seit er vor drei Jahren den Dienst nach langer aktiver Militärzeit quittiert hatte, arbeitete er im Tower von London als Yeoman Warder. Von manchen Leuten wurden er und seine Kollegen Beefeaters genannt, doch Harry Hancock bevorzugte den Titel Yeoman Warder. Vor zwei Jahren war er vom amtierenden Ravenmaster als Nachfolger auserwählt worden. Seitdem kümmerte er sich um die sieben Raben, die im Tower lebten.
Harry liebte seinen Job. Und er schätzte es, gemeinsam mit den anderen Yeoman Warders und ihren Familien im Tower zu leben. Wenn nur Jess sich besser eingewöhnt hätte. Doch seit einem Jahr lag sie ihm nun fast täglich in den Ohren damit, dass er sich eine andere Stelle suchen sollte. Harry versuchte, sie hinzuhalten, und hoffte dabei insgeheim, dass Jess sich irgendwann doch noch an das Leben im Tower gewöhnen würde. Aber sie tat es nicht. Stattdessen sprach sie immer öfter davon, dass sie sich beobachtet fühlte, und behauptete, die Raben würden sie verfolgen.
Gedankenverloren begann er, die über die Grünflächen des Towers verteilten steinernen Wasserschüsseln der Raben zu reinigen und mit frischem Wasser aufzufüllen. Dann ging er zu den Volieren, in denen die Vögel die Nacht verbrachten. Raben gehen lebenslange Partnerschaften ein und werden deshalb paarweise in ihrem Nachtquartier untergebracht. Beim Öffnen der Gitter musste er immer streng darauf achten, die Hackordnung unter den Raben zu befolgen. Corb und Cora durften als Erste jeden Morgen ihren Nachtplatz verlassen. Sie hatten ihren Stammplatz im Nordosten des Towers. Dann Gharrab und Wuya, die zum South Lawn flogen. Schließlich Kraai und Kala. Kraai und Kala waren das dominante Paar und durften deshalb immer erst als Letzte ihre Voliere verlassen. Harry achtete darauf, dass die anderen Raben unbehelligt ihr Territorium erreichen konnten und nicht unterwegs von Kraai und Kala gestellt wurden.
Harry genoss das Schauspiel am frühen Morgen, wenn der Nebel noch über der Themse hing und die Raben die Flügel ausbreiteten, einen kurzen Hüpfer machten und mit einem einzigen Flügelschlag in der Luft waren. Er schaute ihnen nach, wie sie lautlos zu ihren Stammplätzen im Tower glitten.
Harry seufzte. Wie sehr würde er dieses Morgenritual vermissen, falls Jess ihren Kopf durchsetzen würde. Schweren Herzens machte er sich auf den Weg zum Tower Green, wo Mara, der letzte seiner Raben, ihren Stammplatz ganz in der Nähe seines Hauses hatte. Sie weigerte sich, mit den anderen Raben in der Voliere zu schlafen, und mochte sich nicht einsperren lassen.
Harry verharrte kurz und blickte über die Themse zur Tower Bridge. Auch nach all der Zeit im Tower hatte er sich noch nicht sattgesehen an diesem Ausblick. Mara hatte ihn von ihrem Ausguck am Beauchamp Tower erspäht und krächzte ihm ein »Guten Morgen« zu. Zumindest redete Harry sich ein, dass sie das tat, denn sie war sein Lieblingsrabe. Störrisch wie ein Maulesel folgte sie nur ihrem eigenen Kopf. Trotzdem war sie der einzige Rabe, der mit ihm eine innige Beziehung pflegte. Die anderen Raben duldeten Harry nur. Sie ließen sich von ihm füttern, ihre Wasserschüsseln auffüllen und sich am Abend in ihren fuchssicheren Volieren einsperren. Mara aber hatte sich Harry anscheinend als ihren Lebenspartner erwählt. Wenn sie nicht gerade Touristen bestahl, Mäuse jagte oder Tauben angriff, suchte sie Harrys Nähe und verbrachte viel Zeit mit ihm, während er seinen Pflichten im Tower nachging. Wenn er es sich genau überlegte, musste er sich eingestehen, dass Mara sich Jess gegenüber tatsächlich seltsam verhielt. Fast so, als wäre sie eifersüchtig auf seine Frau. Sobald ihm Jess zu nahe kam, hackte Mara auf sie ein. Dass sie Jess den Finger gebrochen hatte, hatte er trotzdem als Unfall hingestellt. Aber wenn er es sich genau überlegte …
Auch heute kam Mara sofort angeflogen, nachdem sie Harry erspäht hatte, und begrüßte ihn mit lautem »Klock-Klock«.
»Mara, meine Schöne.« Harry hielt ihr einen mit Blut getränkten Hundekeks vor den Schnabel. Vorsichtig nahm Mara den Keks mit ihrem kräftigen, scharfen Schnabel aus Harrys Hand, hüpfte auf den Rasen und vertilgte ihn genussvoll. Dann flog sie in die Äste einer Eiche, unter der sich eine Schulklasse versammelt hatte. Die Rabendame hatte eine Schwäche für Kartoffelchips. Sie wusste aus Erfahrung, dass bei den Schulkindern meistens welche zu holen waren. Harry überließ Mara ihrem Tagwerk und machte sich daran, die Ratten, die er über Nacht im Kühlschrank der Rabenküche auftauen ließ, an die anderen Raben zu verteilen.
Harry stand im Schlafzimmer seines Hauses und mühte sich vor dem Spiegel mit seiner Krawatte ab. Er war in Hochstimmung und beglückwünschte sich, dass er überpünktlich zu Hause gewesen war. Jess war bereits fertig angezogen und sah hinreißend aus. Sie hielt die Augen gesenkt und beobachtete ihn durch ihre langen Wimpern hindurch. Harry ging auf sie zu, zog sie vom Hocker hoch und küsste sie. »Du bist wunderschön«, murmelte er und vergrub seinen Kopf in ihrer Halsbeuge. »Und du riechst so gut.« Weiter kam er nicht, weil sein Handy klingelte. »Ja«, meldete er sich knapp, um dem Anrufer zu bedeuten, dass er nicht gestört werden wollte. Die panische Stimme seines Assistenten am anderen Ende überschlug sich fast.
»Fuchsangriff«, hörte er, »zwei Vögel tot; von Mara keine Spur.« Harry wurde bleich.
»Was ist los«, fragte seine Frau.
»Ich muss noch mal weg.« Harry war schon auf dem Weg zur Haustür. »Ein Notfall!«
»Harry! Du kannst doch jetzt nicht …!«
Harry schlug die Tür hinter sich zu. Er hörte noch, wie etwas gegen die geschlossene Eichentür klirrte.
Beim Rabengehege angekommen, sah er das ganze Ausmaß der Zerstörung. Gharrab und Wuya lagen mit zerbissener Kehle blutüberströmt vor dem Gatter ihrer Behausung. Schwarze Federn stoben auf bei jedem Schritt, als Harry und sein Assistent Shay näherkamen.
»Wie zum Teufel ist der Fuchs hier hereingekommen?« Harry suchte das Gehege nach möglichen Schwachstellen ab.
»Er hat sich hier durchgequetscht«, sagte Shay und deutete auf den schmalen Spalt zwischen Wand und Schiebetür. »Ich war auf meinem Kontrollgang, als ich ihn davonlaufen sah.«
»Was ist mit Mara?« Besorgt sah Harry seinen Assistenten an.
Der zuckte die Achseln. »Sie ist nicht in ihrer Schlafbox und auch sonst habe ich sie nirgends gesehen.«
»Räum du die Sauerei hier auf, ich geh und suche Mara.«
Harry sah auf seine Armbanduhr. Er hatte eine gute halbe Stunde Zeit, um Mara zu finden. Jess würde ihn auf kleiner Flamme rösten, wenn sie an ihrem Hochzeitstag nicht wie versprochen pünktlich um zwanzig Uhr im Restaurant wären.
Harry lief so schnell er konnte zum Queen’s House, wo Mara ihr Nachtquartier hatte. Der Rasen war von dem leichten, aber ausdauernden Nieselregen matschig geworden. Harry wäre beinahe ausgerutscht und der Länge nach hingeschlagen, wenn er sich nicht in letzter Sekunde an einer Straßenlaterne hätte festhalten können. Da hörte er das vertraute »Klock-Klock«, Maras Ruf nach ihm. Harry suchte mit den Augen die Gebäude ab. Die Dämmerung hatte eingesetzt, und er wetterte laut, weil er nicht daran gedacht hatte, seine Taschenlampe mitzunehmen. Maras Ruf klang gedämpft durch den Nieselregen. Harry rief ihren Namen, wartete, und als das »Klock-Klock« endlich erneut ertönte, eilte er den Lauten nach.
Vor dem White Tower blieb er stehen und lauschte. Maras Rufe schienen aus dem mit weißen Planen umhüllten Gebäude zu kommen. Die Bauarbeiter hatten das Gerüst am Turm mit einer rabensicheren Hülle umgeben. Nicht sicher genug für Mara. Offensichtlich hatte sie einen Weg hinein gefunden, kam aber nicht mehr heraus.
»Mara, du kleines Biest«, schimpfte Harry und machte sich daran, das Gerüst zu erklimmen. Der Nieselregen hatte sich zu einem satten Septemberregen ausgewachsen und Harry war inzwischen nass bis auf die Knochen. Er bewegte sich mit äußerster Vorsicht. Die Holzbretter des Gerüstes waren glitschig vom Regen. Endlich sah er Mara auf einer Querstrebe des Baugerüstes sitzen. Wenn er jetzt einen blutgetränkten Hundekeks bei sich hätte, würde Mara ihm ohne viele Umstände hinaus ins Freie folgen. So aber … Harry versuchte, sie mit leisen Rufen anzulocken. Zu seiner Überraschung hüpfte Mara ihm entgegen und ließ sich brav auf seinem ausgestreckten Unterarm nieder. Ihre scharfen Krallen bohrten sich durch seinen Ärmel, doch er spürte es kaum, so froh war er, sie gefunden zu haben.
»Mara, meine Schöne, gleich haben wir es geschafft. Jetzt aber schnell, Jess wartet schon auf mich«, flüsterte Harry, als er mit seinem Schützling auf dem Arm die letzte Leiter hinabsteigen wollte.
Völlig überraschend breitete Mara die Flügel aus und stieß sich so kräftig von ihm ab, dass Harry das Gleichgewicht verlor, seine Hand von der nassen Strebe abrutschte und er kopfüber von der Leiter fiel. Als er wieder zu Bewusstsein kam, leuchteten die Sterne bereits über ihm am Firmament.
Am nächsten Morgen saß Jess schon am Esstisch, als Harry in die Küche kam.
»Tee?« Jess stand auf und nahm die Teekanne vom Gasring. »Toast?« Sie knallte einen Teller mit zwei gerösteten Scheiben Weißbrot vor Harry auf den Tisch. Schweigend sah sie ihm dabei zu, wie er Milch in seine Teetasse goss.
Harry räusperte sich. »Es tut mir leid wegen gestern Abend.«
Jess fiel ihm ins Wort. »Schön, dann beweis es mir! Beweise mir, dass es dir leidtut, dass ich hier den ganzen Abend lang vergeblich auf dich gewartet habe, während du einem Raben hinterhergejagt bist. An unserem zwanzigsten Hochzeitstag!« Sie legte eine Visitenkarte vor Harry auf den Tisch. »Die Firma gehört einem Bekannten. Sie suchen erfahrenes Sicherheitspersonal.«
»Aber …« Harry verstummte, als er den Namen las.
»Du kennst ihn. Er war mit dir in der Grundausbildung.«
»Wo, ich meine, wann hast du ihn getroffen?«
Jess stieg eine leichte Röte ins Gesicht. »Ich bin ihm zufällig unter dem Traitors Gate in die Arme gelaufen. Er war mit Kunden aus China da.« Angriffslustig fügte sie hinzu: »Er hat sich fast schiefgelacht, als ich ihm gesagt habe, dass du jetzt ein Beefeater bist.«
»Yeoman Warder«, verbesserte er sie mechanisch.
»Egal, du hast bis Ende des Jahres Zeit, einen neuen Job zu finden. Ich werde am ersten Januar aus dem Tower ausziehen. Mit oder ohne dich.« Jess stand auf und ging zur Tür. Riana strich um ihre Beine, als sie sagte: »Du musst dich entscheiden, Harry. Die Raben oder ich.«
Harry saß in seinem Kabuff und drehte die Visitenkarte in seiner Hand hin und her. »PVM International« stand in seriösem Blau auf hellgrauem Grund. Er holte sein Smartphone aus der Hosentasche und fing an, die Firma zu googeln. Wie befürchtet, handelte es sich um einen Fernüberwachungsdienst.
»Pro-aktives Video-Monitoring (PVM) bietet Live-, Fernüberwachungs- und Experteninterventionsdienste zum Schutz Ihrer Objekte. Durch den Einsatz führender Erkennungs- und Überwachungstechnologien erfüllt PVM International die Mission, eine angstfreie Umgebung an tausenden Standorten weltweit zu schaffen.«
Er seufzte tief. Jess hatte ihm ein Ultimatum gestellt. Entweder er verließ den Tower oder Jess verließ ihn. Er steckte das Smartphone zurück in die Hosentasche. Harry hatte genug gesehen. Er streckte die Hand nach Mara aus, die neben ihm vor sich hindöste. Die Sonne schien durch das Glas auf ihr Gefieder und ließ die rabenschwarzen Federn blau, grün und violett schillern. Sie öffnete die Augen und sah ihn neugierig an.
»Meine schöne Mara.« Er strich sanft über ihren Schnabel. »Bald wird sich ein neuer Rabenmeister um dich kümmern müssen.« Er ließ seine Hand sinken.
Mara sah ihn mit schief gelegtem Kopf an. Auffordernd pickte sie seine Finger, um weiter gestreichelt zu werden.
Ein schwerer Seufzer entrang sich seiner Brust. »Du wirst mir fehlen«, flüsterte er kaum hörbar. »Aber ich habe keine Wahl. Ich will Jess nicht verlieren.«
Harry erhob sich und trat vor seinen Unterstand. Es war Zeit für seinen Kontrollgang. Mara breitete die Flügel aus und flog zur nächsten Wasserstelle. Harry ging langsam über das Tower Green, dabei sog er den Anblick der Gebäude regelrecht in sich auf. Jede Kleinigkeit, jeden Mauervorsprung, jedes Fenster, jeden Stein, er würde den ganzen Tower fest in seinem Gedächtnis speichern. Warum sah Jess nicht, wie schön es hier war?
Er beobachtete, wie Mara das Sandwich stahl, das eine Besucherin unvorsichtigerweise neben sich auf die Bank gelegt hatte. Er sah den anderen Yeoman Warders zu, wie sie die Besucher umherführten und Geistergeschichten zum Besten gaben. Viele seiner Kollegen waren so talentiert, dass man glauben könnte, man hätte ausgebildete Schauspieler vor sich und nicht ehemalige Soldaten, die in Afghanistan und in anderen Krisengebieten weltweit im Einsatz gewesen waren. Harry war sein Beruf ebenso wichtig wie das Zusammentreffen mit Menschen aus aller Herren Länder, um ihnen Geschichten über seinen Tower of London zu erzählen. Aber das Wichtigste war für ihn, sich um ›seine‹ Raben zu kümmern.
Er zog die Visitenkarte von PVM International aus der Hosentasche und drehte sie unschlüssig zwischen den Fingern. Vor der Hinrichtungsstelle, wo Anne Boleyn von einem als Edelmann verkleideten französischen Henker mit einem einzigen Schwerthieb der Kopf abgeschlagen worden war, blieb er stehen. Maras »Klock-Klock« war von Weitem zu hören. Harry blickte sich suchend um und wartete. Schließlich segelte sie direkt vor ihm herab und legte ihm eine tote Maus vor die Füße. Sie sah ihn mit ihren schwarzen Augen prüfend an und legte den Kopf schief.
»Du willst mich wohl aufheitern.« Harry wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte. Nur eines wusste er genau: Er musste versuchen, Jess umzustimmen.
Jess hievte den Wäschekorb auf die Hüfte und zwängte sich damit durch ihre schmale Küche. Alles an diesem Haus ging ihr auf die Nerven. Die engen Zimmer, die niedrigen Decken, die altertümlichen Fenster, durch die ständig ein Luftzug zu wehen schien, und die dicken Steinwände, die den Geruch der Jahrhunderte ausströmten. Jess sehnte sich so sehr nach ihrem alten Haus auf dem Land in Sussex, dass ihr der Verlust fast körperliche Schmerzen bereitete.
Vorsichtig spähte sie durch den Spalt ihrer Haustür, bevor sie diese ganz öffnete und ins Freie trat. Sie wollte den Nachbarinnen aus dem Wege gehen. Man konnte nicht jede gut gemeinte Einladung auf eine Tasse Tee ausschlagen, ohne unhöflich zu wirken. Ihre Katze Riana folgte ihr zum Wäscheplatz, setzte sich neben den Korb und begann, sich zu putzen.
Argwöhnisch hielt Jess nach den Raben Ausschau. Die verdammten Biester schienen sie zu verfolgen. Dann ging sie zurück ins Haus, um den Beutel mit den Wäscheklammern zu holen. Als sie zurückkam, erblickte sie zwei Raben, die mit ihren Schnäbeln gnadenlos auf Riana einhackten. Jess sah ein blutiges Fellknäuel, das kreischend auf sie zugeschossen kam, und die geflügelten Teufel, die laut krächzend in die Luft stiegen. Es klang, als würden sie lachen.
Als Harry zum Mittagessen nach Hause kam, fand er Jess beim Packen vor.
»Was ist denn los?«, wollte er wissen. Er spähte in die Küche in der Hoffnung, dort sein Mittagessen auf dem Herd zu sehen.
»Ich ziehe zu meiner Freundin Patsy.« Jess kam mit einem Bündel Kleider auf dem Arm aus dem Schlafzimmer. »Mir reicht es endgültig.« Sie deutete auf Riana, die in ihrem Körbchen lag und ihre Wunden leckte. »Deine Raben haben Riana angegriffen. Wenn ich nicht dazugekommen wäre, hätten sie Riana umgebracht!«
Harry sah auf die Katze. Die scharfen Schnäbel der Raben hatten tatsächlich tiefe Wunden gerissen. »Katzen pirschen sich nun mal gern an Vögel heran«, versuchte er, Jess zu beruhigen, »aber gegen die Raben haben sie keine Chance. Das sollte deine Katze langsam wissen.«
Jess fuhr herum. »Meine Katze saß brav neben dem Wäschekorb. Deine Raben haben sie ohne jeden Grund angegriffen.« Jess warf ihre Kleider über einen Sessel und hob ihre bandagierte Hand. »Genau wie damals, als dieses verrückte Rabenweibchen mir den Finger gebrochen hat, als ich dich in deinem Häuschen besucht habe.«
»War Mara bei dem Angriff auf deine Katze dabei?«
»Woher soll ich das wissen?«
»Hatte einer der Raben einen lila Fußring?« Harry versuchte, ruhig zu bleiben.
»Kann sein.«
Harry nahm sie in die Arme und strich ihr beruhigend über den Rücken. Jess versteifte sich, ließ die Umarmung dann aber zu und legte den Kopf an Harrys Brust. »Du machst das Ganze jetzt aber nicht schlimmer, als es ist, um einen Grund zu haben, von hier wegzugehen?«, fragte er leise.
Jess riss sich von ihm los. »Du hast das Mitgefühl einer Planierraupe«, schimpfte sie. »Wenn du heute Abend nach Hause kommst, bin ich weg.« Sie knallte die Tür hinter sich zu.
Harry straffte die Schultern, ging in die Küche und nahm eine Handvoll Kekse aus der Dose. Seine nächste Führung ging bald los und sein Magen knurrte. Hastig trank er ein Glas Milch, schob einen Apfel in die Hosentasche und verließ sein Haus in den Casemates. Ausgerechnet an diesem Tag war er an der Reihe, die Schulklassen herumzuführen. Mara wartete schon auf ihn und flog auf seine Schulter, auf der sie während der ganzen Führung zu sitzen pflegte. Die Kinder waren begeistert, den großen Vogel aus der Nähe sehen zu dürfen.
»Ihr könnt sie euch ansehen, aber wenn ihr eure Finger noch ein bisschen behalten wollt, dann fasst sie nicht an«, ermahnte er sie.
Mara plusterte sich auf und krächzte. Die Kinder lachten. Die Show konnte beginnen. Nach der ersten Führung flog Mara zum Wasserbecken und wusch das Gewürz von den Kartoffelchips, die sie von den Schülern bekommen hatte. Harry verabschiedete die Klasse gerade, als sein Telefon läutete. Er sah auf das Display: »Jess.«
»Harry!« Hektisches Schnaufen. »Harry, du musst mir helfen.«
»Jess! Was ist los?«
»Riana ist weggelaufen!« Jess holte tief Luft. »Patsy ist hier und wir wollten gerade meine Koffer in ihr Auto laden, als Riana aus der Haustür gelaufen ist.«
»Beruhige dich, ich komme, so schnell ich kann.«
»Harry, ich will nicht, dass sie wieder von den Raben angegriffen wird.« Jess weinte fast.
»Ist ja gut, beruhige dich. Mara ist bei mir und die anderen Raben sind auf dem Rasen vor dem White Tower.«
Harry sah zum Wasserbecken, doch Mara war verschwunden. Er fluchte leise und sagte dann: »Jess, hör mir zu. Ich suche einen Kollegen, der meine nächste Führung übernehmen kann, dann helfe ich dir, die Katze zu finden. Wir treffen uns beim Eingang Waterloo Block.«
Harry eilte zum Workshop in der Hoffnung, dort einen Kollegen zu finden, der seine Schicht übernehmen konnte, fand jedoch niemanden.
Vor dem Waterloo Block wartete Patsy. »Jess ist schon mal zur Hinrichtungsstelle losgelaufen«, sagte sie. »Du sollst nachkommen.«
»Patsy, ich habe noch niemanden gefunden, der meine nächste Tour übernehmen kann.« Harry sah auf seine Armbanduhr. »Die geht in fünf Minuten los.«
Er zog sein Smartphone aus der Hosentasche, rief die Zentrale an und bat um eine Ablösung. Der diensthabende Kollege erklärte ihm geduldig, dass er niemanden zur Verfügung habe. Harry solle mit der Führung beginnen. In der Zwischenzeit würde er sich um einen Ersatz für ihn kümmern. Sie könnten dann während der Führung wechseln, falls er jemanden fände. Was denn so dringend sei, wollte er noch wissen, doch da hatte Harry schon aufgelegt. Harry hatte keine Lust, seinem Kollegen zu erklären, dass er die Katze seiner Frau suchen musste. Auslachen mochte er sich nicht lassen.
Harry ging zum Sammelplatz und begann mit der Führung. Er war abgelenkt und ging nicht wie sonst auf die Fragen der Kinder ein. Suchend sah er sich nach Riana, der Katze, um. Voller Unbehagen bemerkte er, dass die Raben nicht an ihren Stammplätzen aufzufinden waren. »Vielleicht sind sie in ihr Vogelhaus geflogen«, dachte er und sah hinauf zum Himmel. Ein leichter Nieselregen hatte eingesetzt. Bei schlechtem Wetter zogen sich die Vögel manchmal früher in ihre Volieren zurück. Es ist wieder an der Zeit, ihnen die Flügel ein kleines bisschen zu stutzen, dachte Harry, der es als erster Rabenmeister durchgesetzt hatte, die Schwingen der Vögel so wenig wie möglich zu stutzen. Er vertrat die Ansicht, dass die Vögel im Tower bleiben sollten, weil sie sich hier wohlfühlten und weil sie artgerecht gehalten wurden, und nicht, weil ihre Flügel sie nicht hinaustrugen. Die Prophezeiung »The Tower will crumble and the Kingdom will fall, if the ravens leave the Tower«, also dass das britische Empire untergehen würde, sobald die Raben den Tower für immer verließen, hatte manchen seiner Vorgänger dazu bewogen, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.
Sein Handy läutete. Ohne auf das Display zu sehen, nahm er ab. »Wo bleibst du, verdammt!« Jess schrie in den Hörer. »Riana ist in das Gerüst am White Tower geschlüpft. Ich kann die Raben darum herumkreisen sehen.«
»Jess, ich kann noch nicht weg. Ich bin mitten in einer Führung.«
»Dann klettere ich eben selbst hinauf«, brüllte Jess. Dann war die Leitung tot.
Die Schüler hatten sich um Harry geschart, um nur ja kein Wort zu verpassen, als er die Geschichte der zwei Boy Princes erzählte, die vom eigenen Onkel, dem künftigen König Richard III., im Bloody Tower gefangen gehalten und vermutlich dort getötet worden waren. Von seinem Standort aus konnte Harry gut zum White Tower hinüberblicken. Das Gerüst mit der weißen rabensicheren Einhausung umgab das Gebäude vollständig. Nur die golden glänzenden Wetterhähne auf den vier Türmen waren noch zu sehen. Wegen einer Intervention der Denkmalschutzbehörde hatten die Bauarbeiter die Baustelle verlassen. Der Nieselregen hatte aufgehört und die Sonne kam zaghaft hinter den Wolken hervor. Harry sah sich nach den Raben um, konnte sie aber nirgends entdecken.
Jess steigert sich da in etwas hinein, dachte er. Die verdammte Katze kann sehr gut auf sich selbst aufpassen. Er riss sich zusammen und beantwortete die Fragen der Schüler.
Jess stand an der Absperrung und rief nach Riana. Ein mobiler Bauzaun versperrte den Eingang und war mit einer schweren Eisenkette ordnungsgemäß gesichert. Wegen der weißen Plane konnte sie nicht in das Gerüst hineinsehen. Sie trat ein paar Schritte zurück und sah an der Fassade des Turmes hinauf. Dann nahm sie ihr Mobiltelefon aus der Hosentasche und schrieb eine SMS an Harry: »Bin im White Tower. Komm schnell!!!« Als sie wieder von ihrem Handy aufsah, bemerkte sie den Raben, der plötzlich vor ihr auf dem Bauzaun am Eingang des Gerüsts hockte.
Der Rabe sah sie direkt an, dann drehte er sich um, machte einen kleinen Hüpfer und flog in die Einhausung hinein. Jess wurde kreideweiß. Ihre Katze! Hektisch wählte sie Harrys Nummer, bekam aber nur die Sprachbox. Panik überrollte sie. Jess spürte, wie sich das Adrenalin vom Kopf bis in die Zehen ausbreitete, als sie gegen ihre Höhenangst ankämpfte. Sie rannte zur Absperrung, sprang hoch, klammerte sich an den Bauzaun und zog sich unter Aufbietung ihrer ganzen Kraft hoch, bis es ihr gelang, ein Bein über die Brüstung zu schwingen. Schließlich saß sie rücklings auf dem Zaun und ließ sich auf der anderen Seite zu Boden gleiten. Sie stöhnte. Ihr Handy war ihr bei der Aktion aus der Hosentasche gefallen und lag mit zerborstenem Display auf der anderen Seite der Absperrung. Ihr geschienter Finger brannte wie Feuer.
Jess fluchte leise. »Verdammte Rabenbrut.« Dann eilte sie dem Raben hinterher. »Riana! Riana!« Jess wurde langsamer, je höher sie den White Tower erklomm. Von Riana und dem Raben fehlte jede Spur. Mit einer Hand hielt sie sich an der Absturzsicherung fest und ging langsam weiter. Hier oben blies der Wind und zerrte an der weißen Plane. Ein ständiges Knarren und Knarzen begleitete jeden ihrer Schritte.
»Riana!« Jess meinte, ein heiseres Krächzen gehört zu haben. Sie blieb stehen. »Riana!« Da war es wieder. Ein Krächzen und ein leises Wimmern. Jess beschleunigte ihren Schritt. Sie sah den Himmel und den glänzenden Wetterhahn über sich. Auf dem Wetterhahn saß der Rabe – gleich darunter, in einem Spalt am Mauervorsprung, kauerte Riana. Jess rannte die letzten paar Meter.
»Hau ab!«, rief sie und wedelte mit den Händen. »Verschwinde!« Der Rabe neigte den Kopf und sah sie mit schwarzen Augen durchdringend an. Jess erschauderte.
»Mara!« Jess sah den lila Fußring um den schwarzen Rabenfuß mit den spitzen Krallen. Ihre Katze miaute jämmerlich. Jess versuchte, sie zu erreichen, doch Riana war zu weit hinaufgeklettert. Jess breitete die Arme aus, um sie aufzufangen. Doch die Katze sprang nicht. Der Rabe hüpfte von seinem Platz am Wetterhahn auf den Mauervorsprung unter sich und ging auf die Katze zu. Die zog sich tiefer in den Spalt zurück. Jess setzte mit dem Mut der Verzweiflung einen Fuß auf die Absturzsicherung und einen Fuß gegen die Mauer. So stemmte sie sich Stück für Stück in die Höhe und erreichte endlich den Vorsprung, in dem ihre Riana sich in Sicherheit gebracht hatte. Mit ihrer gesunden Hand krallte sich Jess in die Wand, packte ihre Katze mit der anderen Hand am Genick und zog sie aus dem Versteck. Sie stand jetzt mit einem Fuß auf der obersten Stange der Absturzsicherung, mit den Fußspitzen des anderen Fußes in der Mauerfuge, klammerte sich mit den Fingern an der Mauer fest und hatte eine fauchende, panisch spuckende Katze in der anderen Hand. Schmerzen schossen wie Blitze von ihrem verletzten Finger bis in den Ellbogen. Sie sah über die Brüstung und erstarrte. Sie konnte sich nicht mehr bewegen. Keinen Zentimeter.
Auf diesen Moment schien Mara gewartet zu haben. Sie breitete ihre Schwingen aus, umkreiste den Wetterhahn und bohrte ihre ausgestreckten scharfen Klauen mit Wucht in Jesses Gesicht. Jess schrie auf, riss die Arme hoch, um sich vor Maras Angriff zu schützen, und stürzte in die Tiefe.
Harry hatte gerade die Schulklasse verabschiedet, als Mara auf seiner Schulter landete.
»Na, meine Schöne, wo warst du denn so lange?« Er strich ihr sanft über den kräftigen Schnabel. Dann holte er die kleine Tupperdose aus seiner Hosentasche, nahm einen mit Blut getränkten Hundekeks heraus und fütterte sie damit.
»Braver Vogel«, sagte er.
ITALIEN, SÜDTIROL
Heidi TroiDas schlechte Gewissen der Stadt
»Zu viel des Guten ist meist von übel.« Hat schon der gute alte Tom Borg gesagt. Wer Tom Borg ist? Keine Ahnung. Ein deutscher Autor, dessen schriftstellerische Tätigkeit sich auf das Kreieren mehr oder weniger brauchbarer Zitate konzentriert hat, von denen ich mir von Zeit zu Zeit eines aus›borge‹. Zum Beispiel das hier: »Mancher blöde Hund hat mehr Charakter als sein kluges Herrchen.« Kennen tu ich die Zitate auch von einem blöden Hund. Von meinem Freund, dem Willi. Der normalerweise immer mit mir auf dieser Bank vor der kleinen evangelischen Kirche in Brixen sitzt und der verschwunden ist. Spurlos. Nicht dass er sonst nie verschwunden wäre. Der Willi hat Hummeln im Hintern. Sagt er selbst immer. Aber bisher hat er es mir immer gesagt. »Dreckskathi«, hat er zu mir gesagt, »ich bin dann mal weg. Der Süden ruft.« Oder der Norden. Oder der Berg …
Und dann war er weg und ich hab den leeren Platz neben mir verteidigt, weil ich gewusst habe, dass er dann irgendwann wieder neben mir sitzen wird. Und jetzt ist er verschwunden. Ohne dass er mir was gesagt hat. Und ich hab ein ganz komisches Gefühl. Weil er nämlich nicht der Einzige ist, der verschwunden ist. Auch die Gosch-Tina ist seit Tagen nicht mehr in der Stadt gewesen, genauso wie der Präsident wie vom Erdboden verschluckt ist. Nicht ein richtiger Präsident, sondern Gigi, der stundenlang auf dem Platz steht und wirre Reden schwingt. Manchmal kommen da richtig gute Sachen. Manchmal halt auch nicht. Und der Willi, der ist jetzt auch fort. Ohne ein Wort. Und ich hab das Gefühl, dass das alles mit diesem Platz zusammenhängt. Mit dem kleinen Platz zwischen der evangelischen Kirche und dem Sonnentor, das eigentlich nicht Sonnentor, sondern Kreuztor heißt, und der eine heiß umkämpfte Zone unter uns, dem Abschaum von Brixen, ist.
Hier betreten die Tagestouristen zu Stoßzeiten in Prozessionen die Stadt und hier verlassen sie sie wieder. Davor sammeln sie die Souvenirs wie Profisportler die Trophäen – im Brotgeschäft die ›Brixner Nussen‹, in der Tabaktrafik Kühlschrankmagneten, im Haushaltswarengeschäft Trinkflaschen mit aufgedruckten Bergsprüchen oder ›Bergluft zum Mitnehmen‹. Danach kehren sie durch das alte Stadttor in ihre eigene Wirklichkeit zurück. Wieder durch das Tor zur Stadt Brixen, wo sie das doppelte Erlebnis genossen haben. ›Das doppelte Erlebnis.‹ Das ist der Werbeslogan des Stadtmarketings und wir Bettler schauen, dass die Touristen auch wirklich das doppelte Erlebnis haben. Dass sie nämlich neben dem ganzen Prunk und Kitsch, den unsere Stadt zu bieten hat, auch ein bisschen Armut sehen, Mitleid empfinden können, ihr Gutmenschentum herauskehren. Hier heben wir uns ab, hier stechen wir ins Auge. Und das ist unsere Marketingstrategie. War unsere Marketingstrategie. Von dem ganzen Gesocks bin nämlich nur noch ich übrig. Ich, die Dreckskathi. Und ich bin wild entschlossen, herauszufinden, was mit dem Willi geschehen ist. Und mit der Gosch-Tina und mit dem Präsidenten. Aber vor allem mit dem Willi.
»Städter, die aufs Land ziehen, sind manchmal eine rechte Landplage.« Der Spruch ist auch von Tom Borg. Der gefällt mir von all seinen dummen Sprüchen am besten und ich hab ihn für Brixen ein kleines bisschen umgewandelt. »Städte, die das ganze Land anziehen, haben manchmal eine ziemliche Landplage.« Ich schmunzle in meinen dreckstarrenden Rolli und wiederhole den Satz in Gedanken. Nichts könnte besser auf die Brixner zutreffen als dieses abgekupferte Zitat von Tom Borg.
Grade eben zieht wieder so eine zweibeinige Schafsherde durch das Kreuztor. Silberfüchse in Gesundheitsschuhen und den Klamotten aus Ottos Katalog, in der rechten Hand sich an den Gehstock klammernd, in der linken Hand einen Fotoapparat. Sie nähern sich. Die Ersten bemerken mich. Ich setze meine weinselige Miene auf, strecke die Hand aus, lalle etwas von wegen »schöne blonde Maid«, obwohl jede von ihnen das letzte Mal allerhöchstens vor dreißig Jahren blond war, notiere ihre angeekelten Gesichter.
Eine von ihnen drückt mir doch einen Euro in die Hand. »Aber nicht gleich in Alkohol investieren, junge Frau«, sagt sie, Augenbrauen tadelnd hochgezogen.
»Ich sag danke, für dein Verständnis jeden Tag«, intoniere ich eine Freddy-Quinn-Schnulze, absichtlich die Töne verfehlend, nehme innerlich grinsend ihren Abscheu zur Kenntnis und lasse den Euro in meiner Manteltasche verschwinden.
Ich seufze. Kurz überlege ich, das Geld zum Trotz in Alkohol zu investieren, lasse es dann aber bleiben. Bei der Hitze schmeckt der Fusel nicht. Mein Blick fällt auf die Stadtaktivistin, die seit ein paar Tagen mit einem Schild auf dem kleinen Platz auf und ab marschiert. »Besichtigungsgebühr für Tagestouristen« steht liebevoll darauf gemalt. Darunter ein Cartoon, der Touristen wie die Sardinen unter den Laubenbögen gestapelt darstellt, jämmerlich schwitzend und mit schmerzerfüllter Grimasse. Niemand bleibt bei der Stadtaktivistin stehen, traurig spielt sie auf ihrem Handy herum. Sie tut mir irgendwie leid. »Soll ich dich fotografieren?«, frage ich. Vielleicht will sie ja ihr Insta-Profil puschen oder wie die jungen Leute das sonst noch nennen. #stadtretten oder #wenigertouris oder so.
Sie rümpft die Nase. Der verächtliche Blick legt ihre Gedanken frei: Du Pennerin hast es doch nur auf mein iPhone abgesehen und wenn nicht, krieg ich den Gestank deiner versifften Hände nie mehr runter von dem Ding. »Nein … danke«, sagt sie.
Ich zucke die Achseln. Lehne mich zurück, freue mich über die Sonnenstrahlen, die mein Gesicht streicheln. Wer nicht will, der hat schon, denke ich. Könnte auch von Tom Borg sein, der Spruch. Ist er aber nicht.
Aus dem kleinen Souvenirshop am Eck kommt die Inhaberin. Ihr Blick schweift kurz von der Stadtaktivistin zu mir und wieder zurück. Ihr Kopf schießt vor wie bei einem Falken im Sturzflug, der Körper folgt langsamer nach. Ihre Beute: die Aktivistin.
Ich greife nach meiner Wasserflasche, trinke einen Schluck und beobachte neugierig, was da passiert.
»Können Sie nicht woanders stehen?«, keift sie die Aktivistin an.
Leben kommt in die junge Frau. »Ich stehe, wo ich will.«
»Ja, aber nicht hier!«
»Wie gesagt, wo ich will.«
»Zeigen Sie mir Ihre Genehmigung!« Der Kopf der Geschäftsinhaberin ruckt vor und zurück. Auf ihrem Hals haben sich rote Flecken gebildet. Andere Geschäftsleute schauen neugierig aus ihren Läden. »Die muss doch nicht immer nur uns das Geschäft vermasseln, oder?«, rechtfertigt sie sich ihren Kollegen gegenüber.
Zustimmendes Kopfnicken.
Nur die Inhaberin des Geschäfts für Haushaltswaren macht eine wegwerfende Handbewegung. »Geh, lass sie doch«, will das heißen, doch das Falkenweibchen fühlt sich von der Zustimmung der anderen beflügelt. »Also: Hopp, hopp! Weg hier! Es gibt auch noch andere Plätze in Brixen.«
Die Aktivistin verschränkt die Hände. »Aber bei keinem sonst müssen alle Tagestouristen vorbei.«
»Als ob Ihnen einer von denen seine Unterschrift auf diese lächerliche Liste setzen würde!«
Die beiden Frauen messen sich mit Blicken. Zwischen ihnen sprühen die Funken. Würde mir jetzt jemand eine Wette anbieten, ich würde auf die Geschäftsinhaberin setzen. Sie hat die unverhohlene Zustimmung der anderen Geschäftsleute. Aber die Außenseiterin gewinnt. Mit einem Wutschnauben dreht das Falkenweibchen ab und verschwindet in dem Geschäft für Souvenirs.
Die Siegerin bleibt mit einem triumphierenden Lächeln zurück. Als sie meinen Blick sieht, fragt sie: »Unterschrift?«
Ich hebe abwehrend die Hände. »Kann nicht schreiben.« Ich muss mein Image wahren. Mein abgeschlossenes Philosophiestudium geht sie nichts an. Außerdem will ich sehen, was passiert. Ich hab da nämlich einen Verdacht.
Die Aktivistin steht sich weiter die Beine in den Bauch.
Das Falkenweibchen wirft hin und wieder einen Blick durch die Scheibe ihres Schaufensters. Ich warte.
Ein junger Mann in Sandalen, der sich vor zehn Wochen das letzte Mal die Haare gewaschen hat, schmeißt seine Unterschrift auf das Klemmbrett der Aktivistin, dann versinkt sie wieder in ihrem Smartphone.
Als ich schon aufstehen will, schwingt die Tür des Haushaltswarengeschäfts auf, die Inhaberin wirft einen Blick in die Sonne, dann schaut sie zur Aktivistin. Dann zu mir. Langsam kommt sie auf uns zu. »Mögen Sie einen Kaffee?«
Es gibt halt doch noch Menschen. Sogar hier in Brixen. Ich wehre trotzdem ab. Kaffee bei der Hitze? Muss ich nicht haben.
Doch die Aktivistin nickt dankbar und dackelt hinter der netten Frau in das Innere des Geschäfts.
»Zeigen Sie mir Ihre Genehmigung«, gellt es da in meine Ohren. Das Falkenweibchen.
Ich weiß natürlich, wo ich den Wisch habe, suche aber trotzdem umständlich in allen meinen Manteltaschen. Die Sonne brennt auf uns herunter. Ich lasse einen lauten Furz entwischen. Grinse, als das Falkenweibchen empört das Gesicht verzieht. Das doppelte Erlebnis eben.
Ein paar Silberfüchse betreten den Souvenirladen, ich suche weiter. Als sie ihn wieder verlassen, ziehe ich den Zettel heraus. Mit unschuldigem Gesicht.
»Hmpf«, macht das Falkenweibchen, als es sieht, dass meine Genehmigung in Ordnung ist. Ich habe die amtliche Erlaubnis, auf der Bank zu sitzen und das Mitleid der Menschen auf mich zu lenken. »Hmpf«, macht sie noch einmal. »Können Sie nicht woanders rumlungern?«
Ein neuer Menschenstrom lenkt mich ab. Franzosen diesmal. Sich gegenseitig überschreiend, als gehöre das Städtchen ihnen, folgen sie einer Dame, die einen roten Regenschirm hoch in die Luft reckt und es tatsächlich schafft, ihre Erklärungen über dem Klangteppich schweben zu lassen. Einer von ihnen stößt meinen Rucksack im Vorübergehen um, brummt irgendwas von einem Clochard und geht ohne ein Wort weiter. Wie schon Tom Borg gesagt hat: eine Landplage …
»Wenn die Leute Sie sehen, kaufen sie nichts mehr«, zischt sie.
Mir fallen gleich zwei Antworten ein. »Dann bleiben zumindest ein paar Euro für mich« und »Den Müll, den du verkaufst, braucht eh kein Schwein.« Ich behalte beide für mich, mache dafür ebenso gekonnt »Hmpf« wie sie und verschweige ihr, dass soeben wieder zwei Silberfüchse ihren Kramladen voller Plüschmurmeltiere, Tiroler Schürzen und Wanderstabplaketten verlassen haben und vermutlich hundert Meter weiter in den nächsten Neppladen fallen. So gesehen hat sie recht.
Sie macht erneut »Hmpf« und ich frage mich, wie lange wir diese gehmpfte Unterhaltung wohl weiterführen könnten, bevor es seltsam wird.
Da verlässt die Inhaberin des Geschäfts für Haushaltswaren den Laden und geht eiligen Schritts Richtung Innenstadt. Die Stadtaktivistin hat ihren Kaffee wohl schon intus und für heute aufgegeben. Ich verlasse meinen Posten nicht. Nicht, als die Sonne untergeht. Nicht, als die Geschäfte schließen und nicht, als die Stadt immer leerer wird und irgendwann die Straßenlaternen ein feierliches Licht auf das dunkle Pflaster werfen. Heute bleibe ich hier. Ich knete mein Bündel zurecht und bette meinen Kopf darauf. Diese Bank tut es als Schlafplatz genauso gut wie eine Bank im Park.
Mitten in der Nacht trippeln sich leise Füße in meinen Traum, Krallen wetzen übers Pflaster. Ich will mich aufsetzen, wissen, was da um mich passiert. Aber ich sehe nichts. Meine Augen sind verklebt. Erfolglos rüttle ich an meinen Fesseln. Ein gellender Schrei ertönt hoch in der Luft. Ein Sausen wie eine Peitsche, die durch die Luft fährt. Dann hacken sich Krallen in mein Fleisch.
»Verschwinde, Drecksgesindel«, höre ich die Stimme des Falkenweibchens. Dann hackt ihr Schnabel wieder in mein Fleisch. »Verschwinde.« Hack. »Verschwinde.« Hack. Prometeus‘ Tochter.
»Betrunken«, höre ich eine Stimme. »Stockbesoffen«, eine andere.
Plötzlich ist das Falkenweibchen weg, keine Krallen haben sich in mein Fleisch gegraben, sondern Hände. Menschenhände. Freundliche Hände von Menschen, die sich sorgen.
Ich richte mich auf. »Schon gut«, sage ich. »Mir geht’s gut. Ich bin nicht besoffen. Nur eingeschlafen. Alles gut.«
Die Blicke, die die beiden Carabinieri wechseln, sagen, dass sie nichts gut finden. »Sie sollten hier nicht schlafen«, sagt der eine, der mich wachgerüttelt hat. Er hat ein klitzekleines Muttermal unterm linken Auge. Ein Fliegenschiss. »Haben Sie‘s nicht gehört?«
»Was gehört?«, frage ich.
»Dass Leute verschwinden in Brixen. Leute …« Er zögert, überwindet sich, fährt entschuldigend fort. »… wie Sie.«
»Gesindel«, sage ich, um zu signalisieren, dass ich verstanden habe. »Ich weiß. Deswegen bin ich hier.«
Sie wechseln wieder einen Blick. Die ist doch nicht ganz klar im Kopf, heißt der Blick. Sollen wir sie nicht doch besser mitnehmen aufs Revier? Vor allem der eine mit dem Muttermal zögert sichtlich.
»Es ist alles gut«, sage ich. »Glauben Sie mir. Alles gut. Und jetzt gehen Sie heim in Ihr weiches Bett. Ab hier übernehme ich.«
Am nächsten Tag ist es noch heißer als gestern. Zwischen den Mauern der mittelalterlichen Stadt staut sich die Hitze, man kann kaum atmen. Willi ist noch immer nicht aufgetaucht. Genauso wenig wie die Gosch-Tina und Gigi, der Präsident. Auch die Stadtaktivistin ist heute nicht mehr da. Ich vermute mal, dass der Grund nicht darin liegt, dass sie bereits Massen an Unterschriften hat, und überlege, ob ich ihr Verschwinden in meine Ermittlungen aufnehmen soll. Die im Übrigen bis jetzt erfolglos waren. Bis jetzt. Aber heute wird mein Tag. Ich spüre das. Auf dem kleinen Platz vor dem Kreuztor nur ich und der Straßenverkäufer der Zebrazeitung. Beide drücken wir uns in die winzigen Fleckchen Schatten. Ich auf meiner Bank vor der kleinen Kirche, er steht neben dem Schaufenster des Haushaltswarengeschäfts.
Ein Schwall deutscher Touristen, die aussehen, als wären sie die Zwillinge der gestrigen Gruppe, schlapft matt durch das Tor. Ihr Stadtführer schafft es genauso wenig, mit seinen Informationen ihre Aufmerksamkeit zu fesseln, wie der arme Kerl, der im Rahmen der mittelalterlichen Erlebnisführungen in einer Rüstung vor ihnen herumkaspert. Ihre Gesichter werden dafür wie magisch von dem kleinen Brunnen angezogen, dessen Plätschern Abkühlung verspricht, und das Restaurant dahinter ein kühles Blondes oder vielleicht einen Eisbecher, und einer nach dem anderen löst sich von der Gruppe und steuert das Restaurant an.
Eine Dame, deren weiße Haare in verführerischem Blau schillern, kauft dem Kerl von der Straßenzeitung ein Exemplar ab. Er entblößt die weißen Zähne in seinem sonst kohlrabenschwarzen Gesicht zu einem freundlichen Lächeln, wünscht einen schönen Tag und hat damit seine Deutschreserven aufgebraucht.
Ich errate mehr, als dass ich es höre, wie die Dame zu ihm sagt: »Für Ihre Kinder.«
Der Straßenverkäufer grinst weiter, sucht wieder im Schatten Zuflucht. Da schwingt die Tür des Souvenirladens auf, das Falkenweibchen schießt heraus, die Touristen mit einem Fünf-Sterne-Lächeln bedenkend. » Via«, sagt sie zu dem Straßenverkäufer.
Er schaut sie verständnislos an.
»Via. Piazza Duomo.«
Er lächelt weiter. In seinem Gesicht geht die Sonne auf. Reckt ihr den Stapel Zeitungen entgegen.
Sie wischt mit beiden Händen vor seinem Gesicht hin und her. »No. Via!«, wiederholt sie.
Das Lächeln verschwindet aus seinem Gesicht. Umständlich sucht er in seinen Taschen, schließlich zieht er einen zerknautschten Zettel heraus. »Permesso«, sagt er.
»Ist mir scheißegal, dass du die Erlaubnis hast«, zischt das Falkenweibchen, nimmt ihm aber doch den Zettel aus der Hand und studiert ihn. Die anderen Ladenbesitzer lehnen hinter ihren Türen in ihren klimatisierten Räumen und beobachten emotionslos den Kampf des Falkenweibchens. »Wozu zahlen wir hier eigentlich die Steuern, wenn die Stadtverwaltung dieses Drecksgesindel dann doch in die Stadt lässt? Was denken die sich dabei? Hä?«
Obwohl die Türen zu sind, scheinen die anderen Kaufleute zu verstehen. Zucken die Achseln.
»Feige Hunde. Allesamt«, zischt sie. Dann knüllt sie das Dokument zusammen und wirft es zu Boden.
»No!« Der Zeitungsverkäufer erschrickt. »No! Permesso.«
»Scheiß drauf, auf deinen permesso. Fort jetzt! Verschwinde. Via!« Ihr Zeigefinger deutet irgendwo hinter sich.
Der Straßenverkäufer schaut sie mit schreckgeweiteten Augen an. Zu einer Salzsäule erstarrt. Ich bin sicher, wenn ich näher wäre, könnte ich Tränen in seinen Augen schimmern sehen.
Eine Türglocke gibt ein leises Bimmeln von sich. Die Tür des Haushaltswarengeschäfts öffnet sich. »Probleme?«, fragt die Inhaberin.
»Ja. Schon wieder so einer. Und wenn man was sagt, ziehen sie den permesso heraus und man ist machtlos. Und die Touristen schauen nur, dass sie vorbeikommen an diesem Gesindel, und kaufen tun sie nix.«
Die Inhaberin des Haushaltswarengeschäfts nickt verständnisvoll. »Ich klär das«, sagt sie, nickt Richtung Souvenirladen. »Da gehen grad zwei rein bei dir.«
Das Falkenweibchen ruckt seinen Kopf nach hinten und schießt ohne ein weiteres Wort zu ihrem Geschäft. Beinahe ist mir, als könnte ich seinen hellen Schrei durch die flirrende Luft hören.
Die Kauffrau schaut den Straßenverkäufer vor ihrem Geschäft an. »Tutto bene?«, fragt sie mit einem aufmunternden Lächeln.
Er nickt. Verbeugt sich. Verbeugt sich noch einmal. »Grazie.«
»Caffè?«, fragt sie. »Aria climatizzata.«
Wieder ziehen sich die Mundwinkel des Straßenhändlers nach oben. »Sì, caffè«, sagt er, faltet die Hände vor der Brust und verneigt sich. Dabei klemmt er den Zeitungsstapel mit seinem Arm an den Körper. Selig lächelnd folgt er der Inhaberin in den Laden.
Den Kaffee gönne ich ihm. Mir selbst wäre so ein Gesöff auch heute viel zu heiß, aber es ist ja nicht nur ein Kaffee. Es ist eine Versöhnungsgeste und vielleicht der Beginn einer langen Freundschaft zwischen zwei verschiedenen Kulturen, einem Mann und einer Frau, einem Armen und einer … na ja … zumindest einigermaßen wohlhabenden Geschäftsfrau. Oder es ist das, was ich denke. Meine Augen heften sich auf die Ladentür. Diesmal werde ich mich nicht ablenken lassen. Ich lehne mich wieder zurück an die Wand und sinniere vor mich hin. Plötzlich spüre ich eine Hand auf meiner Schulter.
»Posso fare una foto?