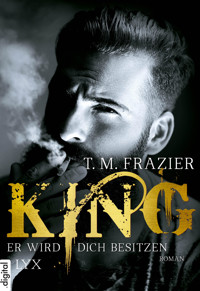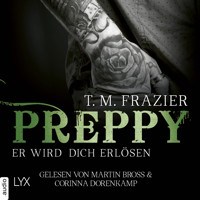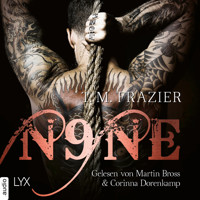6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: King-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wir alle tragen Dunkelheit in uns. Nur manche mehr als andere ...
Abby Ford hat alles verloren. Ihr Zuhause, ihren Job, alle Hoffnung. Der alte Wohnwagen ihrer Großmutter ist alles, was sie noch hat. Doch dann begegnet sie Jake Dunn. Der attraktive Biker berührt etwas in Abby, was sie längst vergessen glaubte. Doch spürt sie bald, dass Jake Geheimnisse hat. Geheimnisse, die Abby niemals herausfinden soll. Dabei hat sie längst ihr Herz an ihn verloren ...
"Abby und Jake haben mein Herz gefangen genommen!" Read more sleep less
Sequel zur Dark-Romance-Reihe KING von USA-TODAY-Bestseller-Autorin T. M. Frazier
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Prolog
Abby
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Vier Jahre später
21
22
23
24
25
26
27
28
Epilog
Die Autorin
Die Romane von T. M. Frazier bei LYX
Impressum
T. M. FRAZIER
Jake
ER WIRD ALLES VERÄNDERN
Ins Deutsche übertragen von Silvia Gleißner
Zu diesem Buch
Abby Ford hat alles verloren. Ihr Zuhause, ihren Job, alle Hoffnung. Der alte Wohnwagen ihrer Großmutter ist alles, was sie noch hat. Doch dann begegnet sie Jake Dunn. Der attraktive Biker berührt etwas in Abby, was sie längst vergessen glaubte. Doch spürt sie bald, dass Jake Geheimnisse hat. Geheimnisse, die Abby niemals herausfinden soll. Dabei hat sie längst ihr Herz an ihn verloren …
Triggerwarnung
Dieses Buch enthält explizite Szenen, derbe Wortwahl, Gewalt und die Schilderung von schweren sexuellen Übergriffen. Leser:innen, die derart heftige Darstellungen nicht lesen möchten oder durch sie an ein Trauma erinnert werden könnten, wird hiermit geraten, diesen Roman nicht zu lesen. Alle sexuellen Handlungen zwischen Held und Heldin sind einvernehmlich.
Für Logan
Prolog
Jake
Der Schmerz in meinem Kopf wurde stärker und pochte im Takt zum langsamen Schlag meines Herzens. Mein Blick war verschwommen, und wenn ich blinzelte, sah ich immer wieder doppelt. Ich befühlte meinen Hinterkopf, von dem der Schmerz ausging: warmes klebriges Rot bedeckte meine Finger. Durch mein dünnes T-Shirt spürte ich die Kälte des Fliesenbodens.
Ich lag auf dem Boden und blickte auf in die irren blutunterlaufenen Augen eines Mannes, den ich schon mein Leben lang kannte – oder zumindest hatte ich gedacht, ich würde ihn kennen. Unvermittelt war ich wieder klar, der Nebel lichtete sich, und mein Herz raste. Er war drauf und dran, zuzuschlagen, bereit zu töten. Dicke Adern traten an seinem Hals hervor, und ich konnte sie mit jedem seiner angestrengten Atemzüge pulsieren sehen. Dann blickte ich an ihm vorbei auf die Axt, die er hoch über den Kopf erhoben hatte. Ohne zu zögern schwang er sie nach unten, um mir den Schädel zu spalten. Kurz bevor sich die Axt in meine Stirn bohren konnte, befreite ich mich aus seinem harten Griff und rollte mich zur Seite, nur Zentimeter entfernt von der Axt – und unendlicher Finsternis.
Ich rappelte mich wackelig auf und versuchte, Luft zu bekommen, während ich mich umdrehte und auf den nächsten Angriff gefasst machte. Doch zu meiner Überraschung sah ich den Mann, der gerade noch ein Monster gewesen war, zusammengesunken mit dem Gesicht auf dem Fußboden aus Mexiko-Fliesen kauern. Er öffnete die Hand, und die Axt fiel aus seinem Griff. Seine Schultern bebten.
Er weinte.
»Dad?«, fragte ich. Ich hatte alles versucht, was ich konnte, um ihm den Schmerz zu nehmen, und dafür hatte er sein Möglichstes getan, mich dessen volles Ausmaß spüren zu lassen.
»Sieh zu, dass du verschwindest!«, brüllte er unter seinen Schluchzern in den Boden.
»Dad, lass mich dir helfen!«, flehte ich und kickte die Axt aus seiner Reichweite.
»Verlass dieses Haus und komm nie wieder zurück!« Er richtete sich auf die Knie und hob langsam den Kopf, um mich anzusehen. Sein Mund stand offen, und seine Augen glitzerten nass. Wenn er sprach, drang mir der Gestank von Alkohol in die Nase. Ich hatte meinen Vater schon in üblem Zustand gesehen, aber das hier war noch mal etwas ganz anderes. »Ich will dich nie wieder in diesem Haus sehen.«
»Dad, lass dir doch von mir helfen«, beharrte ich. Ich konnte das, ihm eine Entzugsklinik besorgen oder eine Trauerberatung – was immer nötig war, damit er nicht länger das Gefühl hatte, dass sein Leben vorbei sei.
Ich beugte mich vor und griff ihn am Arm, um ihm aufzuhelfen. »Fass mich ja nicht an!« Er riss sich los. »Du bist es … es hätte dich treffen sollen. Du bist der Grund, warum sie fort sind.« Seine Worte taten weh, aber es war nicht das erste Mal, dass ich sie von ihm hörte. Hinter mir lagen zwei Wochen, in denen ich seine Kotze aufgewischt und ansonsten versucht hatte, ihm in seiner besoffenen Wut aus dem Weg zu gehen. »Ich wünschte, es hätte dich getroffen«, sagte er, diesmal leiser.
»Dad, du bist betrunken. Du meinst das nicht so.«
»Doch, tue ich. Ich habe gerade versucht, dich umzubringen, Jake, und in aller Ehrlichkeit: Ich wünschte, ich hätte es getan.« Er blickte mir direkt in die Augen, und in diesem Augenblick wirkte er ganz im Vollbesitz seiner Sinne. »Es hätte dich treffen müssen. Du solltest tot sein. Nicht sie. Ich wollte es nur richtigstellen, dich für sie eintauschen. Machen, dass alles so ist, wie es sein sollte.« Seine Stimme wurde zu einem Flüstern. »Von jetzt an bist du für mich tot, Junge.«
Etwas in mir zerbrach.
Wenn ich einen Augenblick nennen müsste, in dem ich wusste, dass mein Leben von da an anders wäre – dass ich von da an anders wäre – dann wäre es dieser.
Es war genau dieser Moment, in dem mir tief in der Seele klar wurde, dass ich fähig war, zu töten.
Ich hob die Axt auf, richtete mich auf und marschierte an den umgeworfenen Wohnzimmermöbeln vorbei direkt auf ihn zu. Ich packte die Axt mit beiden Händen und hob sie hoch über meinen Kopf. Der Blick voller Angst und Überraschung in den Augen meines Vaters war mir willkommen. Ich genoss ihn. Ich wollte mich an diese Angst erinnern, sie immer wieder in meinem Kopf abspielen. Er versuchte nicht mal auszuweichen. Ich schwang die Axt kraftvoll – und stoppte die Klinge weniger als zwei Zentimeter vor seiner Brust ab.
Der reine Ausdruck von Entsetzen in seinem Gesicht machte mich kein bisschen nervös. Ich war fertig damit, ihm helfen zu wollen. »Vergiss niemals, dass ich diesmal gestoppt habe. Denn sollte ich dich jemals wiedersehen, reiße ich dir das verdammte Herz heraus, alter Mann.« Ich warf die Axt weg und spuckte ihn an, um ihm unmissverständlich klarzumachen, dass er ebenso ein Nichts für mich war wie ich für ihn. Ich ließ ihn zitternd auf dem Boden zurück und blickte nicht einmal mehr zurück, bevor ich die Haustür aufriss und hinaus in die Nacht trat.
Auf der Veranda zündete ich mir eine Kippe an und marschierte dann in die Schatten der Einfahrt, um auf mein Motorrad zu steigen. Ich hielt mich nicht damit auf, eine Tasche zu packen.
In diesem Haus gab es nichts mehr, was ich brauchte oder wollte.
Als ich den Motor startete und hochjagte, hätte ich schwören können, dass ich meinen Vater über das Motorengeräusch hinweg aufheulen hörte. Aber es war zu spät.
Ich war weit über den Punkt hinaus zurückzukehren.
Auf mehr als nur eine Weise.
Das war vor vier Jahren.
Sechs Tage waren vergangen, seit ich zuletzt jemanden getötet hatte, und jetzt fuhren mein Motorrad und ich zurück an genau den Ort, den ich am meisten hasste.
Es war nicht einmal mehr das Geld, das mich zu dieser Arbeit antrieb. Wenn ich den Job nicht machte, dann machte ihn jemand anders. Vielleicht dachte ich mir, dass ich, auf meine ganze eigene Weise, irgendeinem armen Trottel das Leben ersparte, für das ich besser geeignet war.
Ich war nicht größenwahnsinnig. Wo andere Typen anscheinend auf schnelle, teure Autos standen, bevorzugte ich die Freiheit meines Motorrads. Ein Haus zu kaufen bedeutete, Wurzeln zu schlagen, was das Letzte war, das ich wollte, also lebte ich nirgendwo länger, als nötig war, um den Job zu erledigen. Und ich hasste Langeweile, also verkaufte ich jedes Mal, wenn ich nach einem Mord, der öffentliche Aufmerksamkeit erregt hatte, den Kopf unten halten musste, ein wenig Gras – gerade genug, um nicht untätig bleiben zu müssen.
Müßiggang tut des Teufels Werk, Jake, hatte Mom immer gesagt.
Wenn sie wüsste.
Meine Hände waren nie untätig. Wenn mich die vergangenen Jahre eins gelehrt hatten, dann dass des Teufels Werk genau das war, wofür sie geschaffen waren.
Ich hatte nie vor, je an den Ort zurückzukehren, den ich einst mein Zuhause genannt hatte. Nicht mal dann, als Reggie, Chefmechaniker in Dads Werkstatt und der einzige Mensch aus meiner Heimatstadt, mit dem ich gelegentlich Kontakt hielt, mich anrief und mir erzählte, dass Dads nächster Saufexzess sein letzter sein konnte. Dad hatte sich sein Bett in der Hölle gemacht, und ich war mir ziemlich sicher, dass es vollgemüllt war mit Asche, Kotze und leeren Flaschen Jameson. Aber als Reggie mir erzählte, dass das Haus, in dem ich aufgewachsen war – das Haus, das meine Mutter geliebt hatte, bis zu dem Tag, an dem sie darin gestorben war – Gefahr lief, an die Steuereintreiber zu fallen, da sagte etwas in mir, dass ich kommen und es retten musste. Nicht für ihn.
Für sie.
Ich musste der einzigen Frau helfen, die mich je geliebt hatte. Das Einzige, was ich bis dahin für sie getan hatte, war, ihr in ein frühes Grab zu helfen.
In meiner Heimatstadt Coral Pines – einer winzigen Insel vor der Südwestküste Floridas – standen alle auf höhergelegte Trucks mit großen Reifen, und ihre Gewehrständer aus Chrom glänzten heller als Sonnenlicht an einem Sonntagmorgen durch Buntglasfenster. Wenn man Städte wie New York und Chicago als Betonwüste bezeichnete, dann konnte man Coral Pines locker als Strandgefängnis oder tropisches Irrenhaus bezeichnen. Oder, mein Lieblingsname: verdorbene Fischtopiehölle.
Nichts als Touristen, Rednecks und Geister.
Ich war nicht sicher, was von allem ich mehr hasste.
Der Lebensstil eines Herumtreibers, den ich mir angeeignet hatte, seit ich dieses Dreckloch von Insel verlassen hatte, passte mir ganz gut. Ich fuhr von einer Stadt zur nächsten, blieb nie länger als eine Tankfüllung reichte, und erledigte die Jobs, die mich über vorübergehend eingerichtete Postfächer und nicht verfolgbare Handys erreichten. Ich blieb nie lange genug an einem Ort, um eine Beziehung aufzubauen, die wirklich etwas wert war.
Genau so wollte ich es haben.
Ich verriet kaum jemandem meinen richtigen Namen, was ganz anders war als zu Hause. In Coral Pines wusste jeder, wer ich war, denn dort kannte jeder jeden – mit Lebensgeschichte, Mädchennamen der Mutter und allen schmutzigen Familiendetails, die die meisten Menschen mit so viel Mühe ganz tief in ihren Kellern verstecken. In Coral Pines blieben Geheimnisse einfach nicht geheim.
Aber ich hatte nun einige, die es wert waren, gehütet zu werden.
Die Leute mochten den Jake Dunn gekannt haben, der mal ein verkorkstes Kind gewesen war, aber sie hatten keine verdammte Ahnung, wer ich heute war. Ganz zu schweigen davon, wozu ich fähig war.
Die zweispurige Brücke über den Matlacha Pass brachte einen entweder nach Coral Pines hinein oder aus Coral Pines heraus. Es war der einzige Weg zu und von der Insel, und während der ganzen zweiundzwanzig Jahre, die ich auf der Welt war, war sie eine Baustelle gewesen. Das war auch so an dem Tag, als ich sie – widerwillig – zum ersten Mal seit Jahren überquerte. Die dichte Hitze hüllte mich ein, während ich fuhr, als würde ich meine Maschine durch eine Wand aus Wasser steuern. Und mit dem vertrauten salzigen Wind kam jedes bisschen Unbehagen zurück, das ich von mir abfallen gefühlt hatte an dem Tag, als ich diesem gottverlassenen Ort den Rücken gekehrt hatte.
Auch Erinnerungen an das Begräbnis meines Bruders vor vier Jahren warteten hier auf mich. Ich hatte nicht damit gerechnet, danach meine Mutter zu finden, immer noch in dem kurzärmligen schwarzen Kleid vom Gottesdienst, mit dem Gesicht nach unten in der Badewanne, einer abgesägten Schrotflinte neben ihr und dem, was der größte Teil ihres Kopfes gewesen war, über die rosa Fliesenwände verteilt. Sie hatte keine Sauerei hinterlassen wollen. So hatte sie es in ihrem Abschiedsbrief geschrieben, aber Mom wusste nicht genug über Gewehre, um zu erkennen, dass sie gerade die von Dads Gewehrstand genommen hatte, die die größte Sauerei garantierte.
Dad war beim Begräbnis meines Bruders eine Katastrophe gewesen. Bei dem meiner Mutter war er in der psychiatrischen Klinik zwei Städte weiter. Er gab mir immer die Schuld – nicht nur an Masons Tod, sondern auch an dem von Mom. Mehr als einmal sagte er, dass ich an jenem Morgen mit Mason in dem Boot hätte sein müssen, und es sei meine Schuld, dass er am Ende im Coral Pines River trieb. Der wahre Grund, warum Dad mich hasste, war der, dass er der Ansicht war, dass an jenem Tag niemals sein perfekter Sohn, Einserschüler, Stipendiumgewinner, Baseballcaptain und Angelexperte hätte sterben sollen. Sondern sein unnützer Sohn von Grasdealer, Schürzenjäger, Schläger und Schulschwänzer.
Es hätte mich treffen müssen.
In mancher Hinsicht war ich seiner Meinung. Wäre ich gestorben anstelle von Mason, wäre Mom noch am Leben. Dad würde nicht versuchen, sich in billigem Whiskey zu ertränken, und es gäbe noch ein paar Menschen mehr im Lande der Lebenden. Ich gab nichts und nahm alles. Aber um fair zu sein, erwartete ich auch nichts von der gottlosen Welt, die mich auf Schritt und Tritt auseinanderriss.
Ich erwartete nichts – bis zu der Nacht, als ich einem gewissen Rotschopf mit Haltung begegnete.
In der Nacht, als ich Abby Ford begegnete, veränderte sich mein Leben für immer.
Abby
1
Ich wusste, dass etwas nicht stimmte, als ich am Tag der Abschlussfeier über die Bühne ging und dazu nur das lustlose langsame Klatschen der wenigen Anwesenden hörte. War nicht so, dass ich eine Standing Ovation erwartete. Ich hatte mich nicht gerade toll mit meinen Mitschülern vertragen. Die Anzahl echter Freunde, die ich hatte, hätte ich an einer Hand abzählen können. Oder genau genommen an keiner Hand. Was ich zu hören erwartete, war Nans übliches Rufen und Jubeln, aber davon war nichts zu hören.
Wo war sie?
In meinem Kopf schrillte eine Alarmglocke los, als unsere Konrektorin Miss Morgan in die Aula platzte und die schweren Metalltüren hinter sich zuschlagen ließ. Ihre Absätze klapperten eilig über den glänzend gelben Boden. Auf ein Krümmen ihres Fingers in meine Richtung stand ich von meinem Sitz auf. Ihr Blick war zu Boden gerichtet, als sie mich schweigend zum Büro des Rektors führte.
Als ich eintrat, saß anstelle des Rektors Sheriff Fletcher an dem überladenen Schreibtisch.
Oh Shit.
Ich ging hastig im Geiste durch, ob ich in letzter Zeit irgendetwas getan hatte, um mir die Ehre seines Besuchs zu verdienen. In der hinteren Tasche meiner Shorts unter dem goldenen Abschlussgewand hatte ich ein kleines Grasbeutelchen stecken, aber da die Einstellung des Sheriffs zu Gras grundsätzlich hieß: wenn du was hast, gib was ab, war ich da nicht übermäßig besorgt. Obwohl der Besitz auf Schulgelände dazu führen konnte, dass der Sheriff irgendeine krank doppelmoralige Polizeimaßnahme oder Gesetzesregel anwandte. Seit ich hier lebte, hatte es in Coral Pines nicht eine einzige Verhaftung wegen Marihuana gegeben. Wäre nur typisch mein Glück, wenn ich die Allererste wäre, die dafür hinter Gitter wanderte. Dazu hatte ich einen unglücklichen Vorfall hinter mir, mit dem Zaun zum Baseballfeld und einem Geländewagen, den ich mir geliehen hatte – ohne Wissen des Eigentümers – aber ich war mir ziemlich sicher, dass der Sheriff keinesfalls wissen konnte, wer den Schaden verursacht hatte.
»Sheriff?« Ich versuchte lässig zu bleiben, aber meine knappe Begrüßung klang wie eine Frage. Trotz seiner laschen Einstellung und lockeren Interpretation der Gesetze konnte ich den Mann nicht ausstehen. Coral Pines gehörte praktisch seiner Familie, daher war ich mir recht sicher, dass Sheriff Fletcher seine Polizeiausbildung per Telefonanruf absolviert hatte. Das einzige einigermaßen anständige Mitglied der Familie Fletcher war Owen, ein halbwegs netter Kerl, falls man auf hübsche männliche Fuckboys stand.
Das Hemd des Sheriffs stand drei Knöpfe zu weit offen, als wolle er sichergehen, dass man ihn nicht mit einem professionellen Gesetzeshüter verwechseln konnte. Aus dem Kragen quoll eine Menge schwarzes krauses Brusthaar, das bis an den Halsansatz reichte. »Setzen Sie sich, Miss Ford.« Er deutete mit einem fetten haarigen Finger auf die Stühle vor dem Schreibtisch. Miss Morgan stand neben ihm, die Hände vor sich gefaltet, fast wie eine Nonne. Ihre hochgewachsene schlanke Gestalt und der taillierte Bleistiftrock ließen sie neben der untersetzten Figur des Sheriffs wie eine Giraffe aussehen. Ihr ungleichmäßig geschnittener Pony hing über ihre Wimpern und streifte ihre milchweiße Haut. Als Rotschopf hatte ich ziemlich helle Haut, und das konnten nicht einmal die tödlichen Strahlen der Sonne des südlichen Floridas ändern. Aber irgendwie schaffte sie es, noch blasser zu sein als ich.
Ich setzte mich und hoffte, dass das hier, was immer es war, bald vorbei wäre.
Es war erst vier Jahre her, in einem anderen Bundesstaat an einer anderen Schule und in einem gefühlt anderen Leben, dass der Rektor mich aus meinem Klassenzimmer heraus auf den Flur gerufen hatte, um mir mitzuteilen, dass mein Vater an einer Überdosis gestorben war. Damals war ich seit über zwei Jahren im Pflegesystem gewesen und hatte meinen Vater seit vier Jahren nicht mehr gesehen. Aber die da oben hatten gedacht, sein Tod wäre wichtig genug, um mich aus dem Unterricht zu holen, also hatte ich das Gefühl, ich sei es ihnen schuldig, die Trauer vorzutäuschen, die man, wie ich wusste, von mir erwartete.
In Wirklichkeit hatte ich lachen wollen über die Befriedigung, die Gerechtigkeit darin.
Glücklich war nicht einmal annähernd eine Beschreibung dafür, wie ich mich fühlte, als man mich von seinem Tod unterrichtete.
Nan hatte immer gesagt, dass Gott den Menschen nach seinem Bild erschaffen habe. Soweit es meinen Vater betraf, war Gott entweder ein kranker, sadistischer Wichser oder eine Wahnsinnslüge, die die Menschen sich als Wahrheit einredeten.
Den Gedanken behielt ich in Nans Gegenwart für mich.
Dad war bei der Arbeit gewesen, als man ihn in einer der Toilettenkabinen gefunden hatte, die Hose unten an den Knöcheln und eine Spritze noch im abgebundenen Arm hängend. Ich war mehr überrascht, zu hören, dass er tatsächlich bei der Arbeit gewesen war, als darüber, dass er tot war. Zumindest hatte er, als es passierte, das Einzige bei sich, das er im Leben je wirklich geliebt hatte: seine Nadel.
Dad war ein echter Gewinner.
Der Sheriff sah mir nicht in die Augen. Sein Blick richtete sich auf irgendwo über meinem Kopf, um welche Neuigkeiten auch immer hinauszuzögern, die er zu überbringen hatte. Die Zeit verging, und jeder seiner Atemzüge klang mehr nach angestrengtem Schnarchen. Ich wurde ungeduldig. »Vielleicht können Sie mir einfach mal sagen, warum ich hier bin«, platzte ich heraus.
»Sweetheart?« Das Wort kam aus seinem Mund, als hätte er es noch nie zuvor ausgesprochen. »Wer ist Ihr nächster Verwandter?« Mir wich alles Blut aus dem Gesicht, und zuerst antwortete ich gar nichts. Ich konnte die Worte nicht finden. Mir drehte sich alles vor Augen, als würde ich ihn durch ein Kaleidoskop hindurch sehen.
Nächster Verwandter?, dachte ich. Meine einzige Verwandte ist Nan …
»Abby!« Miss Morgan schnippte direkt vor meinem Gesicht mit den Fingern. Ich hatte gar nicht gesehen, dass sie sich vor mich hingekniet hatte, aber da war sie. Der Sheriff hinter ihr schwitzte heftig und nervös. »Abby«, wiederholte sie, jetzt leiser. »Nan hatte einen Unfall.« Sie betonte jedes Wort, als unterrichte sie eine Englischklasse.
»Wie?«, fragte ich. »Ihr Truck fährt doch gar nicht. Der steht schon seit September auf dem Schrottplatz und ist seitdem nicht mehr bewegt worden«, antwortete ich, als würde diese Tatsache irgendwie die Wahrheit verändern.
»Kein Autounfall, Liebes.« Miss Morgan sah aus, als hätte sie körperliche Schmerzen. »Es war … eine Explosion.«
Sie drückte meine Hand, aber ich zuckte bei der Berührung zusammen und zog sie sofort aus ihrem Griff. »Was zur Hölle …?«, flüsterte ich. Ich hörte meinen Herzschlag in den Ohren hämmern und fühlte das Blut in meinen Adern zu Säure werden. Meine Haut wollte sich schier von meinen Knochen brennen.
»Das reicht jetzt mit Kraftausdrücken, junge Dame.« Sheriff Fletcher hatte doch echt die Kühnheit, mich zurechtzuweisen. Er räusperte sich. »Ich verstehe gut, dass dies eine schwierige Situation für Sie ist, und es tut mir sehr leid.« Oh ja, klar. Genauso hörte er sich an. »Ich muss etwas fragen: Hat Ihre Nan zufällig mal erzählt, dass sie Geld für irgendetwas bräuchte? Wissen Sie, ob sie irgendwelche finanziellen Probleme hatte?«
Ich schüttelte den Kopf. Wir lebten ganz und gar nicht wie die Könige, aber ihr Sozialhilfescheck und das Geld, das sie sonntags mit dem Verkauf ihrer Marmeladen auf dem Handwerksmarkt verdiente, reichte aus, um die Hypothek zu bezahlen und mich mit Essen und Kleidung zu versorgen. »Nein«, antwortete ich. »Nicht dass ich wüsste.«
Sheriff Fletcher stöhnte. »Wir haben Grund zu der Annahme, dass Ihre Nan in Aktivitäten fragwürdiger Natur involviert war.« Er kratzte über seine Bartstoppeln. »Sie befand sich in einem Wohnwagen mitten im Naturschutzgebiet, als der explodierte.«
Das konnte auf keinen Fall sein.
Sie mussten sich irren.
Der Sheriff fing wieder zu reden an, und Ms Morgan setzte sich neben mich. Sie streckte die Hände aus in einem weiteren Versuch, sie auf meine zu legen. Aber ich zog meine Hände weg, bevor sie konnte.
»Sheriff Fletcher denkt, der Wohnwagen sei als Drogenküche benutzt worden.« Ihre Worte klangen so unbehaglich wie sie aussah.
»Nein, das muss ein Irrtum sein.« Ich fing zu schwafeln an, als würden meine Worte in einem Tornado herumgewirbelt. »Nan hat nichts mit Drogen zu tun. Ich rufe sie gleich an … dann können Sie sich selbst davon überzeugen.«
Keine Chance, vor allem nicht bei der beschissenen Abhängigkeit meiner Eltern, dass Nan je mit so etwas zu tun hätte. Sie nahm nicht einmal Hustensaft, wenn sie erkältet war.
Ich griff nach dem Telefon auf dem Schreibtisch, aber bevor ich es erreichte, legte der Sheriff seine schwitzige Bärenpranke auf den Hörer. »Leider ist es kein Irrtum. Ihre Großmutter starb heute Morgen bei einer Explosion in einer bekannten Methküche.« Mir blieb der Mund offen stehen, als ich ihn anstarrte. Er gab mir sonst keine Informationen, sondern fragte wieder: »Wer ist Ihr nächster Angehöriger, Miss Ford? In Ihrer Akte ist niemand aufgeführt. Ich weiß, dass es keine Eltern mehr gibt, aber gibt es eine Tante oder einen Onkel, die wir benachrichtigen können?«
»Nein«, antwortete ich leise. Es gab niemanden.
»Dann ältere Geschwister oder vielleicht Cousins oder Kusinen?«
Ich schüttelte den Kopf und verlor mich in dem langsamen Drehen des Zimmers um mich herum.
Wieso in aller Welt sollte Nan sich in einer Methküche aufhalten?
Dafür gab es keinen Grund, es sei denn …
Da traf es mich wie ein Amboss, wofür Nan das Geld brauchte: Collegegebühren. Sie redete die ganze Zeit davon, mich aufs College zu schicken. Ich ignorierte es, wann immer sie das Thema ansprach. Meine Pläne für die Zukunft reichten nie weiter als bis zum Wochenende. Meistens lächelte ich nur und nickte. Oft wechselte ich einfach das Thema. Ich würde nicht aufs College gehen. Ende der Geschichte.
Offenbar hatte Nan das anders gesehen.
Aber dass sie sich mit Meth abgab, ergab einfach keinen Sinn.
»Es gibt nur mich … und sie.« Meine Stimme versagte. Innerlich weinte ich, schrie und tobte gegen welche höhere Macht auch immer an, die so grausam war, mir erst eine Kostprobe auf ein normales Leben zu geben und mir das dann wegzunehmen. Nach außen hin war ich ein Roboter.
»Wie alt sind Sie, Miss Ford?«, frage Sheriff Fletcher. Er knackte ungeduldig mit den Fingerknöcheln, als könne er es nicht erwarten, das hier hinter sich zu bringen und dann zu Sally’s zum samstäglichen All-You-Can-Eat-Fish-Fry zu fahren.
»Siebzehn«, antwortete der Roboter.
»Wann wirst du achtzehn, Liebes?«, fragte Miss Morgan sanft in dem Versuch, mir ein wenig Trost zu spenden.
»Dauert noch eine Weile.« Zehn Monate, um genau zu sein. Ich hatte meinen Abschluss ein volles Jahr früher gemacht. Als ich Nan erzählte, dass ich von der Highschool abgehen wollte, hatte sie mir die einzige Alternative geboten, der sie zustimmen würde. »Wenn du so unbedingt raus willst, Abby«, hatte sie gesagt, »dann halt dich eben ran und mach deinen Abschluss früher.«
Als wäre das so einfach wie die Post am Nachmittag reinzuholen.
Es war harte Arbeit, aber ich hatte es gemacht. Und Nan hatte mir das Gefühl gegeben, als würde ich den Abschluss einer Eliteschule machen und nicht an einer öffentlichen Highschool in Coral Pines.
Ich sah mein Spiegelbild im Fenster hinter dem Sheriff. Ich trug immer noch Gewand und Hut. Es war, als würde das glückliche Ich, das ich sein sollte, das bedauernswerte Ich an seiner Stelle verspotten – das Ich, dem gerade in einer kurzen Unterhaltung die Welt unter den Füßen weggerissen worden war.
Sheriff Fletcher räusperte sich wieder. »Miss Ford, mein Büro ist gezwungen, Minderjährige ohne Angehörige an das Jugendamt zu übergeben. Bis der Papierkram erledigt ist und der Fall an eine Sozialarbeiterin übergeben wird, müssten Sie nur ein paar Monate im System verbringen, bis Sie volljährig werden und nicht länger Betreuung benötigen.« Er rutschte auf seinem Sitz, sehr offensichtlich, um seine Genitalien unter dem Tisch zu richten. Er fuhr fort: »Dies hier ist eine kleine Stadt. Wir haben solche Mittel nicht griffbereit, also wird es eine Weile dauern. Fürs Erste hat Miss Morgan sich bereiterklärt, von Zeit zu Zeit bei Ihnen nach dem Rechten zu sehen. Wenn Sie wirklich wollen, können wir Sie auch gleich nach Norden zum Jugendamt schicken, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht das ist, was Sie wollen, stimmt’s?« Es war eine Feststellung, keine Frage. Er wirkte gereizt, weil er echten Papierkram zu erledigen hatte, und weniger betroffen, weil ich gerade den einzigen Menschen verloren hatte, dem ich je wichtig gewesen war.
Er grinste und legte den Kopf schief, als warte er darauf, dass ich ihm dankte. Klar, danke für die kaum gewürdigte Tatsache, dass Nan tot war. Vielen Dank auch, Sir, für das freundliche Angebot, mich nicht mit der Nachmittagspost wegzuschicken, zurück in die Hölle des Pflegesystems. Bevor die kamen, um mich abzuholen, würde ich abhauen. Ich würde nie wieder zurück in dieses System gehen.
Sheriff Fletcher stand auf und gab mir eine Visitenkarte mit der Telefonnummer von Reverend Thomas darauf. »Der Reverend kann Ihnen helfen, alle Vorkehrungen zu treffen.« Er sagte es sachlich, als hätte er mir gerade einen Coupon gegeben für dreimal Autowaschen, zweimal zahlen. »Ich bedaure Ihren Verlust, Miss Ford«, rief er noch über die Schulter, während er hinausging. Das Echo seiner schweren Schritte folgte ihm, als er pfeifend durch den Korridor ging und verschwand.
Miss Morgan wollte mich in eine Umarmung ziehen. Ich zuckte zusammen, als sie mich berührte und trat einen hastigen Schritt rückwärts, wobei mir der Hut vom Kopf fiel.
Keine Tränen, kein Schluchzen. Kein Beten zu einem imaginären Gott, der mich schon vor langer Zeit vergessen hatte. Ich flehte die vertraute Taubheit an, über mich zu kommen.
Ich hatte so was schon durchgemacht. Ich brauchte nichts außer meinen Schutzschilden.
Nan war tot, und wahrscheinlich war das meine Schuld. Ich wusste das.
Fall gelöst. Nicht nötig, auf etwas herumzureiten, das ich nicht ändern konnte.
War doch so, oder?
Miss Morgan bückte sich, hob meinen Hut unter dem Schreibtisch auf und klopfte ihn ab. Sie achtete sorgfältig darauf, mich nicht zu berühren, als sie ihn mir wieder auf den Kopf setzte. Sie versuchte auch nicht noch eine peinliche Wie-tröste-ich-verzweifelte-Teenager-für-Anfänger-Umarmung. Stattdessen musterte sie mich eindringlich, als suche sie nach Antworten auf Fragen, die sie nicht laut zu stellen wagte. Ich stellte mir vor, dass dazu so was gehörte wie: Was ist mit dir passiert, Kleines? Wo willst du jetzt hin? Ich brauchte ihr Mitleid nicht.
Ich brauchte gar nichts von ihr oder sonst irgendwem.
Ich wandte mich zum Gehen.
»Abby!«, rief Miss Morgan und hielt mich auf, bevor ich davonstürmen konnte. Vorsichtig griff sie nach der Quaste, die von meinem Hut hing, und schob sie von der rechten auf die linke Seite.
2
Die darauf folgenden Tage verschwammen ineinander. Tag in Nacht. Permanente Dämmerung. Eine Mischung aus Tagträumen und Albträumen.
Die Gestalt, die unsere Lieben aus dieser Welt fortnimmt, nennt man Todesengel, aber in Wirklichkeit ist er doch nur ein verdorbener Botenjunge, der sich tief unter seiner Kapuze versteckt, wenn er kommt, um Seelen auf die andere Seite zu führen. Es ist nicht wirklich ein schlechter Job. Wahrscheinlich fühlt er nichts und trauert nicht.
Er war mir ähnlicher, als mir klar gewesen war.
Ich beneidete ihn. Nehmen ohne Gefühle. Menschen von einer Welt in die nächste zu führen, ohne die Überraschung oder den Schock, der immer mit unerwartetem Tod zu kommen scheint.
Warum bezeichnet man Menschen, die man verloren hat, als liebe Entschlafene? Sie sind nicht entschlafen. Das Wort schlafen bedeutet »einschlafen«. Sie sind nicht nur eingeschlafen. Sie wurden aus diesem Leben gezerrt von einem seelenlosen Skelett im Hausmantel seiner Mutter, das sie zu ihrem Lebensende geschleppt hat.
Nan musste diese Welt schreiend und um sich schlagend verlassen haben. Ich weiß, sie muss nach mir gerufen haben, als er ihre Seele in seine Tasche stopfte.
Sie brauchte mich, um sie zu retten, und stattdessen könnte ich gerade der Grund für ihren Tod sein.
So verliefen die Albträume Nacht für Nacht: Nan, die in einer Hölle aus finsterem Wasser ertrank, sich zu mir zurückzukämpfen versuchte, aber kein bisschen näher kam, sosehr sie es auch versuchte. Oft wachte ich mitten in der Nacht auf, leichenblass und schweißnass, mit einem lauten Schrei, der mir aus der Kehle drang, als ich nach dem einzigen Menschen in meinem Leben rief, der mich je vor mir selbst hatte retten wollen.
Die Erinnerungen an die Tage nach Nans Begräbnis spielten sich immer wieder in verschwommener Zeitlupe in meinem Kopf ab. Ich aß nicht. Ich schlief nicht. Ab und an kamen irgendwelche Nachbarn vorbei, um mir den üblichen Auflauf für Hinterbliebene zu bringen. Sie klopften nicht einmal an die Tür – wahrscheinlich, weil sie wussten, dass ich nicht aufmachen würde. Am Ende fing Irma von nebenan damit an, die Aufläufe für mich einzusammeln und bei der Kirche abzugeben. Die ungegessenen Gerichte wurden zu viel für Nans alten avocadofarbenen Gefrierschrank. Ich fing an, die Haustür zu verriegeln, was beispiellos in unserer Kleinstadt war. Ich versuchte nicht unbedingt, andere Menschen auszusperren. Ich versuchte eher, mich selbst einzusperren. Je mehr ich der Zivilisation fern blieb, umso näher fühlte ich mich Nan.
Ich fühlte das Bedürfnis, mich selbst zu bestrafen, indem ich mich mit allem umgab, was Nan war. Ich versprühte ihr Parfum in der Luft. Ich trug ihren alten bodenlangen Fuchspelzmantel, den sie nie getragen hatte, und für dessen Besitz in einer so tropischen Stadt sie nie einen Grund gehabt hatte. Ich schlief in ihrem alten roten Fernsehsessel mit Cordbezug, und ich trank jeden Abend – und manchmal jeden Morgen – ihren Lieblingsscotch, bis das Brennen in meiner Kehle sich in meinen Adern ausbreitete und ich in das Vergessen glitt, das ich suchte.
Nans Zuhause – mein Zuhause – war mehr Häuschen als Haus. Die verblasste rosa Außenverkleidung brauchte einen neuen Anstrich, und die hellgrauen Dachschindeln waren durchzogen mit den Spuren der täglichen schweren Nachmittagsstürme im Sommer. Mit zwei Schlafzimmern und nur einem Bad war es in jeder Hinsicht klein. Der Linoleumboden mit Holzmuster und die grauweißen Schränke waren nicht modernisiert worden, seit Paps das Häuschen vor über dreißig Jahren für Nan gebaut hatte.
Die kurze Schottereinfahrt führte zu einer Straße mit Muschelbelag, und das Häuschen selbst stand auf einem mickrigen Achtelmorgen Fläche, auf Armlänge entfernt von Lee’s Oriental Cuisine auf der einen und Irma’s Beauty Salon auf der anderen Seite. Nan hatte es nie etwas ausgemacht, dass die Grünfläche so klein war, denn hinten im Garten hatte sie den Coral Pines River.
Mit einem Glas Scotch in der Hand blickte ich mich in dem Häuschen um, das Nan so geliebt hatte. War es wirklich erst vier Jahre her, dass ich so widerwillig gewesen war, es mein Zuhause zu nennen? Nur ein paar kurze Jahre, seit ich in Nans Leben geplatzt war, ständig reizbar und mit einer Zunge, die schärfer war als eine Schublade voller Messer?
Ihre Worte, nicht meine.
Nan hatte mich in ihr Leben willkommen geheißen. Sie hatte Geduld mit mir gehabt, auf jedem qualvollen Schritt des Weges, und sie liebte mich ohne Fragen und ohne Ausnahme.
Als eine Sozialarbeiterin in einem drei Nummern zu großen Hosenanzug damals mein dreizehnjähriges Ich die Auffahrt hochführte, um die Großmutter zu treffen, die ich nie gekannt hatte, war ich mehr als verängstigt gewesen. Sie war die Mutter meines Vaters. Was, wenn sie genau wie er war? Was, wenn sie mir Versprechungen machte, die sie nie zu halten gedachte, genau wie er? Und damit meinte ich nicht Spielzeug und Geburtstagspartys. Sondern Versprechungen, dass etwas zu essen da war und dass der Strom anblieb. Das Versprechen, dass ich sicher wäre. Die Drecksäcke, die mein Vater als Freunde gehabt hatte, hatten mich jedes Mal lüstern angestarrt, wenn ich ins Zimmer kam – dieselben Freunde, die mich fragten, ob ich wüsste, was ein Schwanz sei, und ob ich wüsste, was man damit machte. Als Sechsjährige sagte ich dem johlenden Haufen dann, sie sollten sich selbst ficken. Sie lachten noch mehr, und Dad wurde noch wütender.
Es dauerte zwei Tage, bis er mich vom Küchenstuhl losband und mir ein kaltes Stück Pizza auf den Boden vor die Füße warf.
Dad mochte gedacht habe, seine Art der Disziplinierung hätte mir irgendeine kranke Lektion erteilt. Das Einzige, was er damit wirklich erreichte, war, dass ich dadurch kalt und gefühllos wurde. Er und meine Mutter übten ihre drogengeprägte Form von elterlicher Gerechtigkeit genauso aus, wie sie abwechselnd durch die sich immer drehenden Tore des Staatsgefängnisses ein und aus gingen.
Es stellte sich heraus, dass Nan ganz und gar nicht so war wie mein Vater. Sie fand es tatsächlich aufregend, mich hier zu haben, aber ich konnte sehen, dass sie genauso nervös war wie ich. Sie war vorsichtig, aber liebevoll.
Als Nan an jenem ersten Tag herausgekommen war, um uns auf der Veranda zu begrüßen, rannte sie nicht los und umarmte mich. Sie achtete darauf, mich nicht mit der Liebe zu überwältigen, die ihr schon übers ganze Gesicht geschrieben stand. Sie zeigte mir mein Zimmer, das ganz in Weiß war – oder noch besser, wie sie mir sagte, leer. Das war es wirklich. Weiße Wände, weiße Bettdecke und Kissen, und ein weißer Schreibtisch und Stuhl. »Ich wusste nicht, was dir gefällt, also dachte mich mir, ich lasse mir von dir erzählen, wie du ein Zimmer einrichten und was du darin haben willst.«
»Ich kann egal was haben?«, hatte ich gefragt.
»Sicher, Liebes, egal was.« Nan achtete immer sorgfältig darauf, ihre ausgestreckte Hand zurückzuziehen, bevor sie meinen Kopf oder meine Schulter berührte … oder meinen Arm.
Meine Abneigung gegen Körperkontakt musste wohl in meiner Akte gestanden haben.
Das Einzige, worum ich Nan an jenem ersten Tag gebeten hatte, war ein Riegel an meiner Schlafzimmertür. Sie zögerte nicht und stellte keine Fragen. Ein Handwerker kam ins Haus und hatte innerhalb einer halben Stunde meinen Riegel angebracht. Sie machte mir eine Halskette für den Schlüssel und sagte, ich solle ihn mir umhängen. Ein paar Wochen, nachdem ich bei ihr eingezogen war, hörte ich auf, den Riegel zu benutzen, aber die Kette mit dem Schlüssel hatte ich nie abgenommen.
Und dann hatte Nan mir ihr Brathähnchen mit Kartoffelbrei gemacht. Zum Nachtisch gab es Pfirsichauflauf. Sie redete nur, um mich zu fragen, ob es mir schmeckte. Ich nickte. In Wahrheit war es das Beste, was ich je gegessen hatte. Nach dieser ersten Mahlzeit wurde der Dienstagabend zu unserem Brathähnchenabend.
Nan wollte keine Antworten von mir. Sie wollte nur ihr Enkelkind – ihr reizbares, scharfzüngiges und manchmal gewalttätiges Enkelkind. In meinem ganzen Leben hatte mich nie jemand auch nur an meinem besten Tag mit meinem allerbesten Benehmen haben wollen.
Nan wollte mich auch mit meinen schlechtesten Seiten, und manchmal war das genau das, was sie bekam.
In meinen vier Jahren mit Nan hatte ich es so weit gebracht. Und nach nur ein paar kurzen Wochen ohne sie war es so, als wäre sie überhaupt nie in meinem Leben gewesen.
3
Als das hartnäckige Klingeln an der Tür nicht aufhören wollte, war ich drauf und dran, die Knarre aus dem Schrank im Flur zu holen, erst zu schießen und dann zu fragen.
»Verschwindet!«, rief ich in mein Kissen und zog mir die Decke über den Kopf. Ich hatte keine Ahnung, wie spät es war, und es war mir auch egal. Ich wusste nur, dass es früh war, und ich war noch nicht bereit, meinen Winterschlaf zu beenden.
Das Klingeln änderte sich von zweimal in dreißig Sekunden zu permanentem Drücken, wie jemand, der ungeduldig auf einen Aufzug wartet.
Das reicht, dachte ich. Jetzt hole ich die Knarre.
Ich sprang aus dem Bett, riss die Haustür auf und hatte fast Mitleid mit der armen Seele auf der anderen Seite, die sich meinem Zorn gegenübersehen würde.
Ein Weibsbild in einem marineblauen Anzug mit dem Körperbau eines Linebackers füllte fast den ganzen Türrahmen aus. Ich musste den Kopf heben, um ihr ins Gesicht zu sehen. Sie sah aus wie Dan Aykroyd in Frauenkleidung. Ihr Haar war dünn, schwarz mit silbernen Strähnen und zu einem festen Dutt im Nacken zusammengebunden. Sie hielt eine Akte und ein Klemmbrett in der Hand.
»Abby Ford?«, fragte sie, ohne mich anzusehen, voll konzentriert auf ihr Klemmbrett. Ihre Stimme war tief und vibrierte beim Sprechen in ihrem Brustkorb.
»Hä?«, fragte ich zurück und wischte mir den Schlaf aus den Augen. Meine Wut wurde zu einem Gefühl müder Verwirrung.
Das Mannweib seufzte. »Sie sind Abby Ford – habe ich recht?« Sie klopfte mit ihrem Stift auf das Brett.
»Ja?« Meine Antwort klang mehr wie eine Frage.
Sie schnaubte, und hätte ich ihre Augen irgendwo da oben im Himmel erkennen können, wo ihr Kopf war, dann hätte ich bestimmt sehen können, wie sie sie verdrehte. »Versuchen wir es noch einmal. Sind Sie oder sind Sie nicht Abby Ford, die Minderjährige, die sich in der Obhut von Georgianne Ford befand, bis zu ihrem Tod vor drei Wochen?«
»Ich bin fast achtzehn«, platzte ich heraus, »also können Sie jetzt gehen.«
Ich wollte die Tür schließen, aber sie stellte sofort ihren Fuß in die Tür. »Nun ja, Sie sind noch keine achtzehn, und mit siebzehn Jahren sind Sie minderjährig. Daher sind Sie gegenwärtig eine Schutzbefohlene des Bundesstaates Florida, und ich nehme Sie heute in Schutzgewahrsam. Man wird Sie in Pflege unterbringen bis zu dem Tag, an dem Sie achtzehn werden.« Sie blätterte eine Seite auf ihrem Klemmbrett um. »Was, wie ich sehen kann, erst in neun Monaten oder so der Fall sein wird.«
Ich hatte gewusst, dass eine Unterbringung in Pflege möglich war. Ich hatte nur nicht erwartet, dass Sheriff Fletcher tatsächlich den Papierkram erledigen und so schnell jemand auftauchen würde. Außerdem hatte ich gehofft, dass es keinen interessieren würde, nachdem ich so kurz vor achtzehn war.
»Darf ich reinkommen, Miss Ford?«, fragte das Mannweib.
»Nein!« Ich stellte mich vor sie und blockierte die Tür. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich irgendwelche arrestwürdigen Delikte auf dem Wohnzimmertisch liegen hatte, die sie nicht sehen musste.
»Wie bitte?«, fragte sie. Offensichtlich war sie ein Nein nicht gewohnt.
»Meine Tante mag keine Fremden im Haus, und Sie haben mir nicht einmal Ihren Namen genannt.« Ich hörte die Lüge aus meinem Mund kommen, noch bevor ich überhaupt registrierte, was ich da sagte.
»Miss Thornton«, antwortete sie. »Mein Name ist Miss Thornton.« Ich wollte ihr am liebsten den ständig klopfenden Stift aus der Hand nehmen und in den Fuß rammen – den, der die Tür offen hielt.
Zum ersten Mal nahm sie den Blick von ihren Papieren und sah mich tatsächlich von oben bis unten an. Ich trug noch meinen Pyjama, bestehend aus langärmligem hochgeschlossenen T-Shirt und Shorts, und ich war sicher, dass meine Haare aussahen wie frisch aus dem Bett und ich dunkle Ringe unter den Augen hatte. Bei all den Albträumen war Schlaf keine einfache Sache. Miss Thornton fragte sich wahrscheinlich, wieso ich an einem Montagnachmittag um eins noch schlief. »Wir haben keine Unterlagen zu dieser Tante, von der Sie sprechen. Wie ist ihr Name?«
Ich schaute mich nervös im Wohnzimmer um. Mein Blick landete auf dem alten Quilt, den Nan immer über die Couch gelegt hatte. Der bunte Patch in der Mitte zeigte Elvis am Tag seiner Hochzeit mit Priscilla. Sie schnitten gerade die Hochzeitstorte an, und Priscillas hochtoupiertes schwarzes Haar war fast höher als der Kuchen.
»Priscilla«, sagte ich und drehte mich wieder zu Miss Thornton um. »Priscilla … Perkins.« Das doppelte P würde es mir leichter machen, mir die Lüge zu merken.
»Wo ist diese Tante Priscilla?« Sie schob ihre dicke schwarze Brille nach unten auf die Nasenspitze und sah mich an.
»Ähm, sie ist auf dem Rückweg von Atlanta. Sie musste noch ihre restlichen Sachen holen, damit sie hier einziehen kann.« Ich schaute an ihr vorbei, um Augenkontakt zu vermeiden. Ihre Augen waren wie kleine Lügendetektoren; ich konnte die Nadeln förmlich ausschlagen sehen, als mein Herzschlag losjagte und dann wieder langsamer wurde. »Sie ist die Schwester meiner Mutter. Ich habe sie tatsächlich erst vor Kurzem kennengelernt.«
Ich musste echt aufhören, Mist von mir zu geben.
»Okay. Also, wann erwarten Sie die Schwester Ihrer Mutter zurück?« Miss Thornton schnaubte schon fast. Außerdem schwitzte sie, und das nicht wenig. Die Schweißtropfen auf ihrer Stirn rannen ihr übers Gesicht und sammelten sich am zu engen Kragen ihrer Bluse. Sie lenkten meine Aufmerksamkeit auf den kleinen gelben Fleck auf dem weißen Stoff, der mit jeder Sekunde, die sie auf der Veranda stand, größer wurde.
»Morgen Nachmittag«, erklärte ich mit so viel Zuversicht wie ich konnte. Ich täuschte ein Gähnen vor, um lässiger zu wirken.
»Kennt sonst noch jemand diese Tante? Jemand, mit dem ich sprechen könnte?« Sie schob einen Finger in ihren Kragen und zog ihn vom Hals weg, der darüber herausquoll. Ich schwöre, dass ich Dampf daraus entweichen sah. Und ich war sicher, dass sie außer mir noch eine Menge anderer Kinder verschleppen musste. Keine Ahnung, warum sie meinetwegen so besorgt war.
»Klar. Jeder kennt Tante Priscilla. Sie können im Laden an der Ecke fragen, oder im Motel die Straße hoch. Alle kennen sie.«
»Okay, Miss Ford«, erklärte Miss Thornton. »Folgendes wird passieren: Ich muss sicherstellen, dass Sie nicht allein leben, also muss ich sichergehen, dass diese ›Tante Priscilla‹« – dabei machte sie mit den Fingern Anführungszeichen in der Luft – »existiert und in der Lage ist, sich um Sie zu kümmern. Ich beabsichtige, im Laufe dieses Nachmittags mit den Leuten zu sprechen, von denen Sie behaupten, dass sie sie kennen. Wenn sie ›Tante Priscilla‹ tatsächlich kennen und für ihre Existenz bürgen können, komme ich morgen Nachmittag wieder, um sie bezüglich des Verfahrens, Ihr gesetzlicher Vormund zu werden, zu befragen. Bis dahin, hier ist meine Karte.«
Sie gab mir eine unscheinbare weiße Karte mit dem Siegel des Staates Florida in der Ecke. »Sollte sie zufällig früher hier sein, sagen Sie ihr bitte, dass sie mich anrufen soll.«
Ich streckte die Hand aus und nahm ihre Karte. Sie drehte sich um und wollte die Stufen hinuntersteigen.
Dann drehte sie sich wieder zu mir um. »Und Miss Ford? Sollte ›Tante Priscilla‹ aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sein, sich um Sie zu kümmern, müssen Sie mit mir kommen.« Zum ersten Mal seit ihrem Klingeln an der Tür lag etwas in ihrer Stimme, so etwas wie Besorgnis, als hätte ihr Job ihr früher einmal etwas bedeutet, aber im Laufe der Zeit hätte sie vergessen, wie das ging.
Die Besorgnis verschwand so schnell, wie sie gekommen war. »Sind Sie sicher, dass Sie mir nicht etwas Zeit und Mühe in dieser Hitze ersparen und einfach gleich eine Tasche packen wollen?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Okay, na dann. Ich komme wieder, Miss Ford«, versicherte sie. Sie öffnete die Autotür, manövrierte sich hinter das Lenkrad ihres silbernen Prius, der viel zu klein für ihre massige Figur war, und fuhr auf die Straße, in Richtung Laden an der Ecke und Motel.
Ich rannte zurück ins Haus, noch bevor der Staub, den ihre Reifen aufwirbelten, sich gelegt hatte. Ich öffnete meinen Schrank und riss Kleidungsstücke von den Bügeln, zog Schubladen auf und stopfte so viel wie möglich in meinen Rucksack. Sie würde nicht lange brauchen, um nachzuweisen, dass niemand diese ausgedachte Tante Priscilla kannte. Ich musste zusehen, dass ich hier wegkam, bevor sie zurückkam und mich in eine weitere Pflegefamilie schleppte.
Bezahlte Kinderbetreuung, nur ohne Betreuung. Das war es, was Pflegeunterbringung für mich immer gewesen war. Damit finanzierten sich Drogensucht und Mieten.
Dahin würde ich auf keinen Fall zurückgehen.
Meine Erfahrungen im System bewegten sich davon, dass ich mir ein Zimmer mit einem Jungen teilte, der Katzen häutete – und ich war überzeugt davon, dass er mich im Schlaf ersticken würde – bis dahin, dass ich Greg, dem älteren Jungen, der im unteren Etagenbett unseres Zimmers mit insgesamt vier Etagenbetten schlief, dabei zuhörte, wie er jede Nacht wütend masturbierte und seine Eltern verfluchte, wenn er kam.
Und dann war da noch Sophie, die einzige Freundin, die ich je im Pflegesystem gefunden hatte. Sie war klein und still mit dunklem Haar und großen braunen Augen. Ihre Haut sah immer wie natürlich gebräunt aus. Sie sah aus wie eine Puppe, zumindest nach dem, was ich über Puppen gehört hatte. Ich hatte in der Tat nie selbst eine gehabt. Sophie hatte denselben leeren, hoffnungslosen Blick wie ich. Ihre Familiengeschichte und ihr Aufwachsen unterschieden sich nicht sehr von meinen.
In ihr erkannte ich eine verwandte Seele.
Eines Morgens hatte ich sie nackt auf der Couch gefunden, ihre Augen leblos und unfokussiert. Blutergüsse verunstalteten jeden Zentimeter ihres kleinen zwölfjährigen Körpers. Ihre zuvor braune Haut war wie durchsichtig. Ich konnte alle blauen Adern unter der Oberfläche sehen. Ihre Handgelenke waren hinter dem Rücken mit einer langen schmutzigen Socke gefesselt, und in einem Aschenbecher neben ihr lag eine Spritze. Blut tropfte von der Nadelspitze und sammelte sich auf dem Boden des durchsichtigen Glases. Dick und Denise, unsere Pflegeeltern, hatten sie als Unterhaltungsobjekt des vergangenen Abends benutzt. Sie hatten sie mit Drogen vollgepumpt, gekauft mit dem Geld, das sie vom Staat für ihre Betreuung erhalten hatten, und danach hatten sie sie als Spielzeug für ihre sadistischen Sexspielchen missbraucht.
Wahrscheinlich wussten sie noch gar nicht, dass sie tot war, und bemerkten es erst später am Tag.
Bis dahin war ich längst weg.
Es war das erste Mal, dass ich aus einer Pflegefamilie wegrannte. Und es war ganz sicher nicht das letzte Mal.
Nachdem ich die Füße in meine alten abgewetzten Cowboystiefel gesteckt und nach dem Messer gesehen hatte, das ich innen im rechten Stiefel versteckt hatte, zog ich die Gurte des Rucksacks auf meinen Schultern fest und rannte in Nans Zimmer, um ihr Bettelarmband vom Nachttisch zu holen. Dann nahm ich mein Gras vom Wohnzimmertisch und schlüpfte zur gläsernen Hintertür hinaus.
Und dann rannte ich los zum Strand.
Wahrscheinlich würde es eine Weile dauern, bis Miss Thornton mich aufgab und ihre Aufmerksamkeit anderen, würdigeren Degenerierten zuwandte. Bis dahin dachte ich mir, war es das Beste, wenn ich wenigstens ein paar Tage lang von zu Hause wegblieb. Mein Plan war einfach: Kopf unten halten und unsichtbar werden. Ich hatte ein paar Dollar, aber ich wusste, dass die nicht lange reichen würden. Ich hatte geplant, ein paar von Nans nicht so geliebten Sachen zu verkaufen, aber das würde warten müssen, bis die Luft rein war.
Ich beschloss, bei Bubba’s Bar vorbeizuschauen, kurz bevor sie zumachte, um zu sehen, ob die mich vielleicht anheuern würden, um den Boden zu wischen oder um zu kellnern. Ich bezweifelte sehr, dass Miss Thornton an einem Montagabend in einer Bar nach mir suchen würde.
Danach musste ich mich darauf konzentrieren, für ein paar Nächte einen Platz zum Schlafen zu finden. Ein Hotel kam nicht infrage. Es war Hochsaison im Sommer, und alle Zimmer in der Stadt waren ganz sicher von Touristen gebucht. Abgesehen davon würde eine Nacht in jedem Hotel mehr als das Zehnfache von den zwanzig Dollar in meiner Tasche kosten. Der Strand war auch nicht sicher. Die Gezeiten waren unvorhersehbar und konnten einen überraschen, wenn man es am wenigsten erwartete. Mehr als einmal waren Touristen, die ein Nickerchen nach zu viel Bier machten, hinaus in den Golfstrom gezogen worden.
Ich ließ mich zwischen den Decken der Touristen in den heißen Sand fallen und nutzte meinen Rucksack als Kissen. Ich versteckte mich vor aller Augen. Eine Weile beobachtete ich Leute, die ihre gemieteten Jetskis abwürgten und sich an Windsurfen versuchten. Mütter und Väter jubelten ihren Teenagern zu, während sie zusahen, wie die endlich den Dreh rausbekamen und ein wenig Wind erwischten, der sie ein paar Zentimeter weiter brachte, bevor sie die Kontrolle verloren und wieder im Wasser landeten. Die Mütter und Väter jubelten weiter, selbst wenn die Kinder ihren neuen Sport aufgaben und ihre müden, niedergeschlagenen und erschöpften Körper an den Strand schleppten. Es war doch nur Windsurfen. Worauf waren sie so stolz? Wieso das ganze Gejubel? Abgesehen von meinem Highschoolabschluss und dem Gesicht meiner Nan, als ich mein Gewand und den Hut anlegte, hatte es nie jemanden gegeben, der stolz auf mich war.
Wenn ich etwas lernen wollte, brachte ich es mir selbst bei. Es gab niemanden, der über die bedeutenden Dinge jubelte, ganz zu schweigen von den kleinen Dingen.
Ich blieb bis Sonnenuntergang am Strand und sah zu, wie die Haut der Touristen von käsig weiß zu hummerrot wurde, bis Sonne und Mond die Plätze tauschten. Über Nebenstraßen ging ich zurück zu Bubba’s und zündete mir auf dem Weg einen Joint an. Auf der finsteren Straße hinter mir tauchten Scheinwerfer auf. Ich wich zur Seite aus, um das Auto vorbeizulassen, damit ich nicht so endete wie das Opossum, über das ich gerade hinwegsteigen hatte müssen. Statt vorbeizufahren wurde der höhergelegte Truck in Supermanblau langsamer und hielt neben mir. Er war so hoch, dass mein Kopf gerade bis zum oberen Rand der Reifen ging.
»Allein an einer finsteren Straße?« Ich konnte Owen Fletcher da oben nicht sehen, aber ich erkannte seine Stimme. »Entweder willst du von Kojoten angegriffen werden, oder du dröhnst dich gerade zu.«
Er steckte den Kopf aus dem Fenster des Trucks. Er hatte seine schwarze Baseballkappe verkehrt herum auf, und dunkles unordentliches Haar spähte unter dem Rand hervor. Die Ärmel seines weißen T-Shirts waren hochgerollt, und eine Packung Marlboro Reds – das Logo war durch den dünnen Stoff hindurch zu sehen – steckte in einem Ärmel.
Owen war immer freundlich gewesen, und er hatte es sich immer zum Prinzip gemacht, ein paar Worte mit mir zu wechseln, falls wir mal zur selben Zeit am selben Ort waren. Aber andererseits machte er das mit jedem. Ich nahm an, es lag zum Teil daran, wer seine Familie war. Vielleicht bauten sie ihn für eine Karriere in der Politik auf. Wenn man Verwandte hat, die in jeder Machtposition sitzen, die es in einem County gibt, ist es nicht so üblich, dass man nur Hausmeister an der Schule wird.
Ich hob meinen Joint hoch, damit er sehen konnte, dass ich auf den Teil mit Zudröhnen aus war und nicht auf den mit Kojotenangriff. Ich blies den Rauch aus meinen Lungen in die Luft. Es brannte, aber ich hustete nicht. Owen lachte. »Ich hatte gehofft, dass es das wäre.« Er stellte den Truck auf Parken, beugte sich hinüber und öffnete die Beifahrertür. »Steig ein, Mädel, und reich das Zeug rüber.«
Ich würde Owen nicht gerade meinen Freund nennen, aber ich hätte ihn auf die kurze Liste der Leute setzen können, bei denen ich mich nicht vor Angst oder Wut innerlich krümmte, wenn sie etwas sagten. Zumindest nicht allzu sehr. Ich beschloss, in seinen Truck zu steigen, als der hundertste Moskito der Stadt anfing, durch den dünnen Ärmel hindurch meinen Arm als Festmahl zu nutzen. Wenn die mich weiter so malträtierten, hatte ich bald kein Blut mehr.
Owen streckte die Hand nach unten aus, um mir hochzuhelfen. Ich schüttelte den Kopf und sprang ohne seine Hilfe hoch in den Truck, als würde ich auf ein Pferd steigen. Ich stellte einen Fuß unten auf den Reifen und schwang den anderen Fuß darauf, bevor ich mich seitwärts drehte und meinen Hintern auf den Schalensitz schwang.
»Beeindruckend«, meinte Owen in Anerkennung meiner nutzlosen Fertigkeit. Ich war eher beeindruckt von meiner Fähigkeit, einmal mehr Körperkontakt zu vermeiden. »Sogar Willy Ray braucht immer noch meine Hilfe, um hier hochzukommen. Andererseits hat der Fettsack über dreißig Kilo mehr, die der Schwerkraft nicht so leicht entkommen.«
Ich gab ihm den Joint, und er nahm einen langen Zug und blies den Rauch aus Nase und Mund in die Luft.
Owen stellte den Truck wieder auf Fahren und fuhr weiter die dunkle Straße entlang. Das Brummen der riesigen Reifen auf dem geflickten Asphalt hallte in der Kabine des Trucks wider. Das Armaturenbrett vibrierte, und das blaue Licht der Uhr wurde verschwommener, als Owen beschleunigte.
»Onkel Cole hat mir erzählt, was mit deiner Granny passiert ist. Tut mir leid«, meinte Owen und gab mir den Joint zurück. Der plötzliche Themenwechsel erwischte mich unvorbereitet. Owens Beileid klang aufrichtig, aber die Erwähnung von Nan brachte das klamme Gefühl in meinem Bauch zurück. Ich verdrängte es und zuckte mit den Schultern.
»Danke«, sagte ich und wechselte dann das Thema. »Was machst du eigentlich hier draußen? Hast du nicht irgendwelchen Mädchen nachzujagen?«
Owen lachte. »Abby, Abby.« Er drückte sich die Hand aufs Herz und tat so, als sei er verletzt. »Du weißt doch, dass die Damen zu mir kommen, nicht umgekehrt. Der einzige Rock, dem ich je nachgejagt bin, war deiner. Zehnte Klasse, und ich erinnere mich gut, wie du sagtest – ich zitiere – ›Du bist nicht mein Typ, Owen, und wirst es nie sein!‹« Er zitierte meinen Teil mit einer hohen Frauenstimme, aber sein Versuch, mich nachzuahmen klang mehr nach Julia Childs Stimme als nach meiner.
»Das habe ich gesagt?«, fragte ich, obwohl ich genau wusste, dass ich das gesagt hatte. Ich erinnerte mich auch daran, dass ich ihm gesagt hatte, er solle sich verpissen, und er stand nur da und lachte, als hätte er noch nie einen Korb bekommen und meine Abweisung würde ihn amüsieren.
»Oh ja, hast du. An dem Tag hast du mir mein armes kleines Hillbillyherz gebrochen.« Er schob die Unterlippe zu einem gespielten Schmollen vor.
»Okay. Kann sein, dass ich das gesagt habe, aber ganz sicher klinge ich nicht so.«
»Stimmt. Deine Stimme ist viel tiefer und sehr viel wütender.« Dieses Mal zitierte er meine Ablehnung mit einer Stimme, die mehr nach Krümelmonster klang.
»Na schau, das hat sich doch zum Besten gewendet, denn hier sind wir und immer noch … Freunde?« Ich benutzte den Begriff ›Freunde‹, da mir kein anderes Wort einfiel zur Beschreibung für »eine Person, die mich nicht so anwidert wie die anderen.«
»Natürlich sind wir Freunde, Abby.« Owen warf mir sein breites strahlendes Lächeln mit geraden blendend weißen Zähnen zu. Ich konnte sehen, warum ihm die Mädchen zu Füßen lagen. Also, Mädchen, die sich für Jungs interessierten. Ich gehörte ganz sicher nicht dazu – nicht dass ich auf Mädchen stand oder so. Manchmal dachte ich, dass ich einfach nicht so gemacht war wie alle anderen. Und manchmal dachte ich, dass ich genauso gemacht war wie alle anderen, nur dass die ganz geblieben waren, während ich immer wieder auseinandergerissen und wieder zusammengeflickt worden war.
Die meisten in meiner Highschool standen auf Cheerleading und Football, auf Trucks und Angeln und auf Rodeo. Und vor allem standen sie aufeinander.
Das Einzige, worauf ich stand, war Selbsterhaltung.
Aber wenn man ein normaler Teenager war, würde man auf jeden Fall denken, dass Owen ein gut aussehender Typ war. Seine smaragdgrünen Augen waren so strahlend, dass sie wie farbige Kontaktlinsen aussahen. Seine gebräunte Haut kam daher, dass er den größten Teil des Tages draußen auf seinem Fischerboot verbrachte. Den ganzen Tag Fischernetze auswerfen war zweifellos der Grund für seine kräftigen Bizepse und Unterarme, deren Muskeln beim Lenken spielten.
Die Straßen waren so dunkel, dass anscheinend nicht einmal die Scheinwerfer viel ausrichten konnten. Owen war in Coral Pines aufgewachsen und kannte diese Straßen bestimmt wie seine Westentasche. Wahrscheinlich hätte er ohne jedes Licht fahren können.
Wir nahmen beide noch ein paar Züge, dann löschte ich die Glut zwischen Daumen und Zeigefinger und steckte den Joint zurück in die vordere Reißverschlusstasche meines Rucksacks.