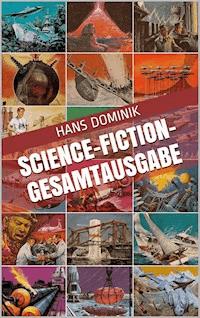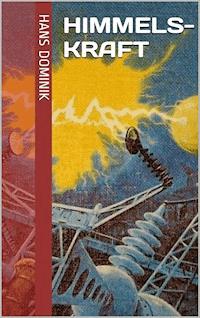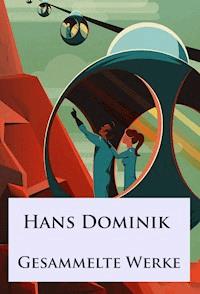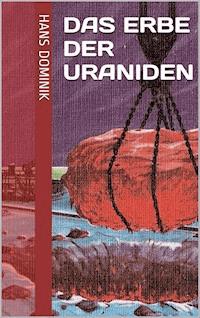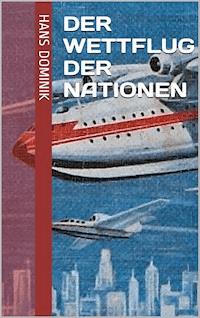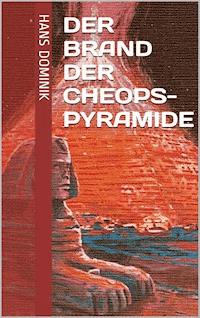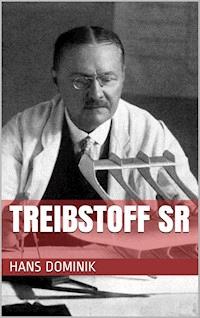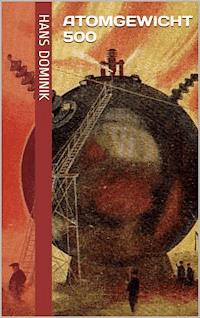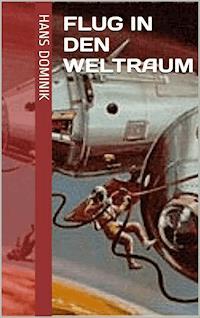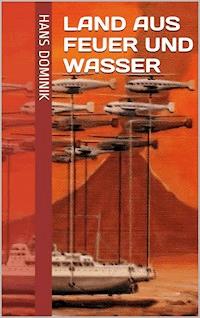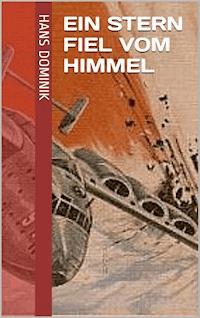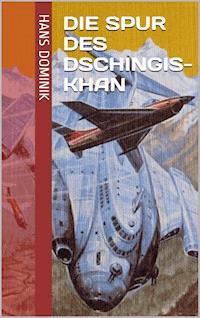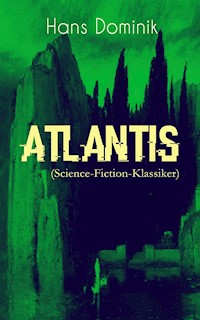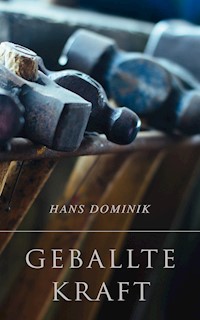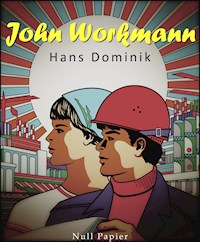
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Kinderbücher bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Hans Dominik erzählt die typische amerikanische Erfolgsgeschichte: vom Tellerwäscher – Pardon - Zeitungsjungen zum Millionär. In dieser spannenden Jugendgeschichte quer durch den amerikanischen Kontinent, erleben wir wie John Workmann zunächst als bitterarmer Zeitungsjunge eine Gewerkschaft gründet, später Journalist wird, Unternehmer, Lebensretter, Abenteurer und sogar Goldgräber. Grundlage dieser überarbeiteten Fassung ist die deutsche Erstausgabe von 1925. Der Verleger hat die Geschichte mit Fußnoten versehen, um Unstimmigkeiten aufzuklären oder Fakten zu vertiefen. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 726
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Dominik
John Workman
Kommentierte und illustrierte Fassung
Hans Dominik
John Workman
Kommentierte und illustrierte Fassung
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-954187-31-7
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Über dieses Buch
Der Autor
Hinweis für den Leser
Band 1: Im Reiche des Zeitungsriesen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Band 2: Wanderjahre im Westen
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Band 3: Neue Wunder der Großindustrie
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
Band 4: Lehr- und Meisterjahre im Süden
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Kinderbücher bei Null Papier
Der Struwwelpeter oder lustige Geschichten und drollige Bilder (HD)
Heidi
Der kleine Lord
Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen
Pinocchio
Das Dschungelbuch
Die Abenteuer des Huckleberry Finn
Der Trotzkopf - Vollständige und illustrierte Fassung
John Workman
Maja
und weitere …
Über dieses Buch
Hans Dominik erzählt die typische amerikanische Erfolgsgeschichte: vom Tellerwäscher – Pardon - Zeitungsjungen zum Millionär.
In dieser spannenden Jugendgeschichte quer durch den amerikanischen Kontinent, erleben wir wie John Workmann zunächst als bitterarmer Zeitungsjunge eine Gewerkschaft gründet, später Journalist wird, Unternehmer, Lebensretter, Abenteurer und sogar Goldgräber.
Dominik, der selbst mehrere Jahre in den USA lebte, bringt hier dem deutschen Jugendlichen der Kaiserzeit den »American Way of Life« bei: gewitzt und fleißig sein, niemals aufgeben und bei Erfolg nicht die Zurückgebliebenen aus den Augen verlieren. Manchmal erfolgt diese Vermittlung auch mit dem kleinen Holzhammer, aber niemals aufdringlich oder unsympathisch – und immer unterhaltsam. Man merkt dem Autor seine Liebe zur Technik und zum Fortschritt an.
Hans Dominik, ein Pionier der deutschen Science-Fiction-Literatur versucht sich hier erstmalig (und überaus erfolgreich) als Jungendbuchautor. Als erstem deutschsprachigen Autor gelingt es ihm, eine spannende Abenteuer- und Reisegeschichte mit historischen, politischen und technischen Fakten anzureichern.
Der Autor
Hans Dominik war der Pionier des utopischen Romans in Deutschland und einer der erfolgreichsten deutschen Populärschriftsteller des 20. Jahrhunderts. Er wurde 1872 in Zwickau geboren und starb 1945 während des Kriegsendes in Berlin. Neben Science-Fiction hat Dominik auch Sachbücher und Artikel mit technisch-wissenschaftlichen Inhalten verfasst.
Seine Jugendjahre wie auch den größten Teil seines Lebens verbrachte er in Berlin. Am Gymnasium in Gotha begegnete er dem Lehrer Kurd Laßwitz, selbst ein früher Verfasser utopischer Romane. Man kann davon ausgehen, dass diese Begegnung nicht ohne Einfluss auf Dominik und sein späteres Werk blieb.
Ab 1893 studierte Hans Dominik an der Technischen Hochschule Berlin Maschinenbau und Eisenbahntechnik. Später war er für mehrere Unternehmen im Bereich der Großindustrie und des Bergbaus tätig, u.a. auch für Siemens.
Nach 1901 machte er sich als Fachautor selbständig. Für Auftraggeber aus der Industrie verfasste er Werbebroschüren und Prospekte. Seine Leidenschaft galt aber der aufkommenden Science-Fiction Literatur oder besser den »technischen Abenteuerromanen«, wie diese in Deutschland noch genannt wurden. Dominik war auch abseits der Literatur sehr umtriebig, er gründete ein Unternehmen und erhielt mehrere Patente auf dem Gebiet der Automobiltechnologie.
Sein erster utopischer Roman »Die Macht der Drei« erschien 1922 als Fortsetzungsgeschichte und wurde kurz darauf als Buch veröffentlicht. Ab 1924 widmete sich Dominik ganz der Schriftstellerei, in Jahresabständen erschienen weitere Romane.
Neben den reinen Abenteuergeschichten für eine erwachsene Leserschaft veröffentlichte er auch die (immer noch sehr stark vom technischen Fortschritt eingefärbten) Jugendgeschichten um den Aufstieg des John Workman vom Zeitungsjungen zum Millionär: »John Workmann, der Zeitungsboy« (1925).
Die wichtigsten Werke:
Die Macht der Drei, 1921
Die Spur des Dschingis-Khan, 1923
Atlantis, 1924/25
Der Brand der Cheopspyramide, 1925/26
Das Erbe der Uraniden, 1926/27
König Laurins Mantel (Alternativtitel: Unsichtbare Kräfte), 1928
Kautschuk, 1929/30
Befehl aus dem Dunkel, 1932/33
Der Wettflug der Nationen. Prof.-Eggerth-Serie. Teil 1, 1932/33
Ein Stern fiel vom Himmel. Prof.-Eggerth-Serie. Teil 2, 1933
Das stählerne Geheimnis, 1934
Atomgewicht 500, 1934/35
Himmelskraft, 1937
Lebensstrahlen, 1938
Land aus Feuer und Wasser. Prof.-Eggerth-Serie. Teil 3, 1939
Treibstoff SR. (Alternativtitel: Flug in den Weltenraum oder Fahrt in den Weltraum.) 1939/40
Hinweis für den Leser
Grundlage dieser überarbeiteten Fassung ist die deutsche Erstausgabe von 1925.
Der Verleger hat die Geschichte mit Fußnoten versehen, um Unstimmigkeiten aufzuklären oder Fakten zu vertiefen.
Band 1: Im Reiche des Zeitungsriesen
1. Kapitel
Ein eisiger Abendwind fegte durch die Straßen New Yorks und trieb die Menschen zu größerer Eile als gewöhnlich an.
Während sonst zu jeder Tages- und Abendstunde vor den mächtigen Spiegelscheiben des Maschinenhauses der größten Zeitung Amerikas, des ›New York Herald‹,1 Hunderte von Personen durch die großen Scheiben einen bewundernden Blick auf die ungeheuren Druckpressen warfen, standen heute nur einige Zeitungsboys in der Säulenhalle vor dem Maschinenhause und warteten auf die Ausgabe der letzten Abendnummer.
Um sich die Zeit zu vertreiben, spielten sie mit Centstücken Kopf oder Adler: einer von ihnen nahm ein Centstück, welches auf der einen Seite einen Indianerkopf, auf der anderen einen Adler zeigt, und warf es in die Luft, und je nachdem, ob die Mitspielenden richtig geraten, welches der beiden Zeichen nach oben lag, hatten sie gewonnen oder verloren.
Man sah es diesen Jungens nicht an, dass sie in ihrer abgetragenen, dünnen Kleidung unter dem Einfluss der Kälte litten. Ihre Augen strahlten, ihre Gesichter waren frostgerötet, und sie schienen durch das tägliche von morgens bis abends auf der Straße Verweilen gegen die Unbill der Witterung gefeit zu sein.
Abseits von der spielenden Gruppe stand ein schmächtiger, blondlockiger Knabe von 12 Jahren, presste sein Gesicht dicht an eine der mächtigen Spiegelscheiben und schaute mit weit geöffneten Augen auf die große Dreifarbenpresse, welche ununterbrochen wie ein märchenhaftes Ungeheuer große, farbige Zeitungsblätter mit mathematischer Genauigkeit aus seinem Innern heraus beförderte.
Im Gehirn des Knaben nahm diese bunte Farbenpresse das größte Interesse ein.
Mit aller Kraft seiner kindlichen Intelligenz versuchte er, sich den Vorgang klarzumachen und das Wunderwerk der modernen Technik zu verstehen.
Sein sehnlichster Wunsch war es, auch einmal eine solche Maschine zu bedienen, ja, in seinem kühnen Traume sah er sich sogar als Besitzer solcher Maschinen, und wenn er auf dem ›Broadway‹ als einfacher ›Zeitungsboy‹ seine Zeitungen verkaufte, dann hatte er das Gefühl, als stünde er im Dienste eines den Menschen unbekannten, ungeheuren, mechanischen Riesen. – Ein Gefühl von Stolz und Selbstbewusstsein erfüllte dann den einfachen Zeitungsboy, das ihn weit über seine Käufer hinaushob.
Die Uhr auf dem Zeitungsgebäude schlug mit hellen, durchdringenden Tönen sieben Schläge. Der Boy wandte den Kopf von den Maschinen und lauschte.
Er kannte die Uhr.
Ein Wunderwerk, wie alles in dem Gebäude des Zeitungsriesen. Zwei in Erz gegossene doppelt lebensgroße Arbeitsmänner traten nach jeder vollendeten Stunde über das Haupttor des Zeitungsriesen und schlugen mit großen erzenen Hämmern auf eine metallene Platte so oft, wie es die Zeit ansagte. Der erzene Hammerschlag durchdrang den tollen Lärm der Straße und ließ die Menschen ihre Köpfe zu dem Gebäude des Zeitungsriesen hinwenden.
Kaum war der letzte Klang verhallt, als der zwölfjährige Boy seinen spielenden Kameraden zurief:
»Kommt, Jungens, es ist Zeit.«
Dann schritt er, von seinen Kameraden gefolgt, zu einem Seitentor, aus dem in fast endloser Reihe kleine hochbepackte Karriolwagen2 und Automobile in einem Eiltempo, das fast unnatürlich erscheinen musste, mit der letzten Abendausgabe in die Stadt fuhren.
An ihnen vorbei drängten sich die Zeitungsboys und gelangten in einen kleinen Hof vor ein Schalterfenster, hinter dem der weißbärtige Kopf eines Mannes sichtbar war.
Einer der Boys nach dem andern trat an das kleine Fenster, sagte kurz eine Nummer, mit welcher er die gewünschte Anzahl von Zeitungsexemplaren bezeichnete, warf das Geld auf das Schalterbrett und erhielt eiligst die geforderten Exemplare hinausgereicht.
Sobald ein Boy seine Zeitungen erhalten, eilte er in derselben Hast wie die Karriolwagen und Automobile, und knapp zehn Minuten nach sieben Uhr erfüllten die gellenden Rufe der Zeitungsjungen den ›Broadway‹ und schreckten die Menschen durch den Ausruf der neuesten Verbrechen oder sonstiger sensationeller Nachrichten aus ihren Gedanken.
Bereits um acht Uhr hatten die meisten Boys ihre Zeitungen verkauft und begaben sich nach Hause, so sie ein Zuhause besaßen. – Aber nur wenige unter den zehn- bis zwölfjährigen Jungen hatten ein Heim. –
Wie nestlose Vögel, wie die Spatzen, krochen sie in irgendeinen versteckten Winkel, der sie etwas gegen Kälte und Regen schützte. – Dort schliefen sie – ein Paket alter Zeitungen unter dem Kopf – mit einer alten Decke, wie sie von den großen Auswandererdampfern im Hafen verschenkt wurden, zugedeckt oder, wer eine solche nicht besaß, wickelte sich in die großen Zeitungsblätter. – Wieder andere, die nicht so sparsam waren, bezahlten in einem der verrufenen 10-Cent-Hotels ein schmutziges, hartes Lager. –
Hart und unerbittlich ist der Weg der meisten unter den Zeitungsboys und doch – mit Stolz betrachtet der Amerikaner die wetterharten, zielbewussten, flinken Burschen und nennt sie: die Finanzgarde. –
Denn aus diesen Reihen, aus dieser harten Schule kommen die leitenden großen Männer Amerikas – die Fürsten des Goldes. – Die strenge Lebensschule stählte die Boys zu felderprobten Soldaten. –
Es war ein kleines, ärmliches Heim von Stube und Küche in einem Hinterhause der 32. Straße auf der Ostseite in New York, welches der blondlockige zwölfjährige Zeitungsjunge aufsuchte.
In scharfem Trab machte er den Weg nach Hause. – Gewandt wie eine Eidechse, schlängelte er sich durch den Wagenverkehr, mit lustigem Hoppla vor Pferden und Autos oftmals so scharf vorbeispringend, dass man an ein Wunder glauben konnte, wenn er mit heiler Haut auf dem Bürgersteig ankam.
Aber er war an das sinnverwirrende Treiben und Jagen der Wagen auf dem Broadway gewöhnt. –
Mit sicherem Blick prüfte er die ihm zur Verfügung stehende Öffnung zwischen Straßenbahnwagen und Fuhrwerk – mochten Kutscher und Wagenführer über seine turnerische Kühnheit schelten – er war bereits davon und hörte nichts.
Als er vor dem schmucklosen, nüchternen Mietshaus ankam, in dem seine Mutter wohnte, ließ er einen gellenden Pfiff ertönen – einen Kunstpfiff auf zwei Fingern, den er erlernt. – Das war jedes Mal sein Freudensignal für die wartende Mutter.
In lebensfroher, knabenkräftiger Laune hopste er, fidel pfeifend, durch den Flur, sprang mit zwei Sätzen über den Hof und jagte – zwei Stufen mit einmal nehmend – die Treppen hinauf.
Im vierten Stock zog er die über dem Türschild angebrachte Klingel; nur wenige Sekunden brauchte er zu warten, als sich die Tür öffnete und eine schlanke, blondhaarige Frau mit dunklen Augen ihn umarmte und in die Wohnung zog.
»Bist du endlich da, John«, sagte sie mit mütterlicher Zärtlichkeit und streichelte ihm das kalte Gesicht. »Ich war schon recht in Sorge um dich, es ist heute bitterlich kalt!«
»Das stimmt, Mutter«, antwortete John Workmann. »Dafür haben wir Winter und ich habe mich schon ordentlich gefreut, bei dir zu Hause zu sein. Hier ist es fein warm.«
»Bist ein tapferer Junge. Komm, ich habe bereits Tee, Rührei und Speck, deine Lieblingsgerichte, auf dem Tisch stehen und hoffe, dass du einen guten Appetit mitbringst.«
»Ei ja, Mütterchen, ich bringe einen Wolfshunger mit. Wenn es so recht kalt ist, kann man für zwei essen. Und da –«
Er griff in die Taschen und holte mehrere Hände voll Cent- und Nickelstücke heraus. – »Ich habe heute ein so gutes Geschäft gemacht, wie seit langem nicht! Weißt du, Mütterchen, bei der Kälte da geben die Menschen gerne ein Trinkgeld. Viele lassen sich auf ein Fünf-Centstück nichts herausgeben. Ich glaube, ich habe heute so viel zusammen, dass ich dir ein schönes neues Winterjackett kaufen kann.«
»Nein, nein«, wehrte seine Mutter, »dir tut ein Winterüberzieher viel nötiger. Mein altes Jackett, das mir noch Vater kaufte, wird diesen Winter noch gut genug sein.«
John Workmann war zu einer Waschschüssel gegangen, welche seine Mutter für ihn hingestellt.
Er hätte niemals mit den von Straßenschmutz verunreinigten Händen sein Essen angerührt.
Als er sich gesäubert, trat er zu dem mitten in der Küche stehenden sauber gedeckten Tisch und sagte mit unmutigem Ton:
»Immer verdirbst du mir meine Freude. Für mich suchst du stets etwas Gutes, aber für dich darf ich das nicht. Da habe ich mich schon seit vierzehn Tagen darauf gefreut, dir ein warmes Jackett, so wie es die Damen jetzt tragen, kaufen zu können, und nun willst du nicht?! Weshalb arbeite ich denn?«
»Aber John!«, beruhigte ihn die Mutter. »Du arbeitest, damit wir unsere Wohnung haben, und dein Mütterchen ein warmes Zimmer und Essen und Trinken. Ist das nicht etwa genug?«
Das Gesicht des kleinen John glättete sich bei den liebevollen Worten seiner Mutter. Er setzte sich und begann zu essen.
Mit leuchtenden Augen blickte ihn seine Mutter an und freute sich, wie tapfer er dem Abendbrot zusprach.
Nachdem er seinen Hunger gestillt und, wie es seine Gewohnheit war, aufstand, um seiner Mutter für das Abendbrot zu danken, sagte sie:
»Warte einmal, John, ich habe noch etwas sehr Schönes für dich!«
Sie öffnete einen Korb und holte ein halbes Dutzend rotwangiger Äpfel heraus.
Kaum aber hatte der kleine Blondlockige die Äpfel erblickt, als sich seine Augenbrauen von neuem zusammenzogen und er sagte:
»Eine Pelzjacke willst du dir nicht kaufen, aber solche unnötigen Dinge wie Äpfel, die stellst du mir auf den Tisch!«
»Aber, John, ich meine es doch gut mit dir!«
»Das weiß ich! Aber du meinst es nicht so gut mit mir, wenn du mir Äpfel kaufst.«
Da sah er, dass sich die dunklen Augen seiner Mutter, in welchen stets ein eigener, trauriger Glanz lag, mit Tränen füllten. Im nächsten Moment war aller Unmut aus dem Gesicht des Kleinen verschwunden. Hastig sprang er auf seine Mutter zu, umarmte sie, küsste ihr den Mund und die Wangen und rief: »Nicht traurig sein, Mütterchen! Ich bin ein böser Junge, ich seh’ es ein. Aber sieh’ mal – ich brauche wirklich keinen Überzieher – ich habe noch nie einen getragen. Das Geld wäre direkt fortgeworfen.«
»Aber du musst doch frieren!«
»Unsinn!«, lachte John Workmann, »wir Zeitungsboys frieren nicht! Sieh’ mal, Mütterchen, wir haben nicht eine Sekunde Zeit, stille zu stehen. Das geht immer vorwärts im Galopp! Jetzt auf einen Straßenbahnwagen hinauf, dann wieder hinunter, auf einen nächsten, dann durch die Menschen, und das geht so vorwärts, bis man seine letzte Zeitung verkauft hat; ich sage dir, da kann die Kälte nochmal so stark sein, uns ist so warm, als wäre es mitten im Sommer.«
»Willst du wirklich keinen Apfel essen, John?«
Energisch schüttelte er den Kopf, dann aber kam in sein Gesicht ein freudiger Ausdruck. Er nahm einen Apfel und sagte:
»Die Äpfel sollen einen guten Zweck haben. Ich bitte dich, pack sie mir in einen Korb und gib mir eine Flasche Spiritus mit. Ich will noch fort.«
»Wo willst du hin?«, fragte die Mutter besorgt.
John Workmann, welcher bereits nach seiner Mütze griff, antwortete:
»Der kleine Charly Beckers ist heute nicht zum Broadway gekommen. Ich hörte von einem Jungen, der in seiner Nachbarschaft wohnt, dass er krank sei. Er klagte schon gestern Abend über Kopfschmerzen und hustete stark. Da will ich nun nachsehen, was ihm fehlt. – Pack mir auch Tee und Zucker ein. Du weißt, er hat keine Eltern. Und ich glaube, da ist niemand, der sich um ihn kümmert.«
»Schrecklich«, flüsterte die Mutter. »Was für arme Jungens unter deinen Kameraden sind!«
»Pack nur alle sechs Äpfel ein«, sagte jetzt John Workmann, welcher bemerkte, dass die Mutter drei beiseitelegen wollte. »Ich weiß, der kleine Charly isst Äpfel sehr gern.«
Die Mutter errötete, als sie die fehlenden Äpfel in den Korb hineinlegte. Dann küsste sie ihren Jungen auf die Stirn und sagte: »Bleibe nicht zu lange, John, du weißt, ich sorge mich um dich!«
»Sei unbesorgt, Mutter«, rief John Workmann, »wir Zeitungsboys sind wie die Tropfen im Wasser, wir schwimmen.«
Damit nahm er den Korb, gab seiner Mutter einen Kuss und verließ eiligst die Wohnung.
»Puh!«, rief er, als er jetzt auf die kalte Straße trat. »Jetzt spürt man erst die Kälte! – Hallo, dagegen ist Laufschritt gut!«
Lustig pfeifend setzte er sich in Bewegung und durchquerte im Laufschritt die immer dunkler werdenden Straßen, die nach dem Hafen von New York führten.
Es war eins der ärmlichsten und schmutzigsten Viertel von New York, in das er sich begab. Pferdeställe und Automobilschuppen, Wagenspeicher, Lagerplätze und vereinzelte hohe Häuser, alles nur notdürftig erleuchtet.
Vor einem Stallgebäude, aus dessen offenem Tor feuchte, warme Luft und das Schnauben und Scharren von Pferden auf die Straße drangen, blieb John Workmann stehen.
Vorsichtig tastete er sich auf einem dunklen Seitengang neben dem Stallgebäude zum Hofe und kletterte dann eine an der äußeren Wand befestigte schmale Holzstiege empor.
Oben am Ende der Treppe stieß er eine Art Lattentür auf und, indem er sich bückte, trat er in einen niedrigen, kammerartigen Verschlag – die Wohnung des kleinen Charly Beckers.
Kein Licht erhellte den Raum, und da auf dem Hofe keine Laterne brannte, so blieb John Workmann in der Öffnung des Verschlages stehen und rief:
»Hallo, Charly, bist du hier?«
Aus dem Dunklen antwortete die dünne, heisere, vom Husten unterbrochene Stimme eines Knaben:
»Ja, John, ich liege hier.«
»Hast du kein Licht?«
»Ja – gleich neben der Tür steht eine Laterne. Ich war zu schwach, mich aufzurichten und sie anzuzünden.«
John Workmann kramte aus seiner Tasche eine Schachtel mit Streichhölzern, zündete ein Hölzchen an und steckte die neben der Tür stehende Stalllaterne an, welche statt Glas mit Ölpapier beklebt war.
Jetzt konnte er den Raum notdürftig übersehen.
Im hinteren Winkel gleich unter dem Dach lag auf einem Haufen von Papier, Stroh und Lumpen der kleine sechsjährige Charly Beckers. Eine alte Pferdedecke und ausrangierte Futtersäcke deckten ihn bis an den Hals zu.
Mit fieberglänzenden Augen schaute der kleine Knirps auf seinen Kameraden, welcher neben dem Lager niederkniete und ihm die Hand auf die glühende Stirn legte.
»Sag’ mal, Junge, wie fühlst du dich?«, fragte John Workmann.
»Ich weiß nicht«, erwiderte mit matter Stimme der kleine Charly Beckers, »ich habe so furchtbaren Durst und nichts zu trinken. Es ist nur gut, dass du gekommen bist. – Ich glaubte schon, ich müsste sterben.«
»Rede doch nicht solchen Unsinn, Charly. Wir Zeitungsboys haben doch ein Leben wie die Katzen, sagte neulich der Maschinenmeister unserer Zeitung. Du wirst schon wieder durchkommen! – Hast du denn Schmerzen?«
»Ja, hier –« Der kleine Charly Beckers zeigte auf seine Brust.
»Ich habe dir Äpfel mitgebracht, willst du einen essen?«
Ein müdes Lächeln huschte über das schmale Gesicht Charly Beckers: »Ich mag nicht, ich habe gar keinen Appetit! Aber bitte, gib mir etwas zu trinken.«
John Workmann nickte und begann für den kranken, kleinen Kameraden auf einem Spirituskocher Wasser heißzumachen, damit er Tee bereiten konnte.
»Weißt du, John«, begann der Kleine nach einigen Minuten Stillschweigens, »ich möchte ja ganz gerne noch leben, denn ich habe mir doch vorgenommen, als Millionär zu sterben. Weißt du, wie der Harriman,3 dem alle Eisenbahnen gehören.«
»Ja, ja«, stimmte John Workmann bei, »Millionär muss eine feine Sache sein. Da liegt man, wenn man krank ist, in einem seidenen Bett, hat Ärzte um sich und kann reisen und wohnt in der Fifth Avenue. Aber – du – ich glaube, wenn ein Millionär krank ist, dann nutzen ihm die Millionen auch nichts. – Sieh’ mal, der Rockefeller darf bloß Milchsuppe essen und der Harriman konnte überhaupt nichts mehr essen. – Da hilft für alles Geld kein Doktor mehr.«
»Du hast recht, aber er hätte sich eben früher heilen lassen sollen und nicht warten, bis es zu spät ist. – Weißt du, der Eisenbahnkönig Harriman war auch Zeitungsboy. Ich habe sein Bild an die Wand genagelt. – Wenn ich sterben sollte, dann sollst du das Bild haben. Es ist fast neu. Ich habe es für fünf Cent gekauft.«
»Rede doch nicht in einem fort vom Sterben, Charly, du bist doch noch jung und kein alter Mann wie der Harriman.«
»Es sterben auch Jungens«, meinte Charly Beckers. »Und ich weiß nicht, seitdem ich hier liege, habe ich eine mächtige Angst vor dem Sterben. – Hör’ mal zu, wenn ich tief atme, dann pfeift es hier drin gerade so, wie draußen der Wind vom Fluss. Da muss was kaputt sein! – Und furchtbare Schmerzen habe ich auch. Ich kann mich gar nicht bewegen.« –
John Workmann blickte mit ernsten Augen auf den Kleinen, dann horchte er auf die pfeifende Brust und sagte:
»Du bist wirklich krank, Charly. – Soll ich dich in ein Krankenhaus bringen lassen?«
Mit angstvoll aufgerissenen Augen blickte Charly Beckers ihn an.
»Nein – nein, John. – Bitte, tu das nicht. – Lass mich zu Hause. – Hier ist es viel schöner als in einem Krankenhaus. – Da darf ich meine Sachen doch nicht mitnehmen.«
»Das darfst du allerdings nicht. Aber sag’ mal, hast du gar keine Verwandten in der Stadt?«
Der Kleine schüttelte den Kopf.
»Niemand, John. – Seit meine Mutter tot ist – vor einem Jahre – habe ich niemand mehr. – Damals wollten sie mich durch die Polizei ins Waisenhaus bringen lassen und – du weißt ja – ich rückte aus und fand diese Wohnung.«
»Hast du denn keinen Vater?«
»Nein, John – meine Mutter sprach nie von meinem Vater.« – »Niemals?«
»Nein – niemals, John.«
Und John Workmann saß erschrocken da, starrte in das flackernde Stalllicht und wusste nicht, was er sagen sollte. – Ein Frösteln überlief ihn, als ob ein ihm unbekanntes schwarzes Gespenst, das ihm Furcht einflöße, durch den Raum schlich. – Er versuchte, sich das Nichtvorhandensein eines Vaters zu erklären. – Seine Mutter erzählte ihm stundenlang aus dem Leben seines Vaters. – Nach langen Sekunden fragte er:
»Du hast kein Bild von deinem Vater?«
»Keins.«
»Ist er schon gestorben?«
»Ich weiß nicht.«
»Du hast nie etwas von ihm gehört?«
»Niemals, John.«
Da packte John Workmann die fieberheiße Hand seines todkranken, kleinen Kameraden und sagte:
»Du – Charly – das ist sehr traurig.«
Charly Beckers wusste nicht, wie John Workmann das meinte. Währenddessen war der heiße Tee abgekühlt und er reichte Charly Beckers den Blechtopf, in welchem er den Tee aufgebrüht hatte. Eine Tasse war nicht vorhanden.
Dann stützte er ihn im Rücken und mit hastigen Zügen trank der Fiebernde den Tee.
»Ach, das tat gut«, sagte der Kleine und legte sich wohlig auf sein ärmliches Lager zurück. »Jetzt möchte ich schlafen.«
»Fühlst du dich etwas besser?«, fragte John Workmann.
Aber vergebens wartete er auf eine Antwort. Der Kleine hatte die Augen geschlossen und lag ermattet im Schlaf. –
Noch mehrere Sekunden lauschte John Workmann auf den hastig arbeitenden Atem seines Kameraden, dann löschte er die qualmende Laterne, öffnete leise die Lattentür, an deren innere Seite als notdürftiger Schutz gegen den Wind von Charly Beckers altes Sackleinen genagelt war, und glitt die Leiter zum Hof hinunter. – Im Lauftempo kam er zu Hause an. Auf sein schrilles Klingeln öffnete die Mutter ängstlich die Tür.
Aber ohne sie sonderlich zu beachten, stürmte John Workmann zu seiner Kommode, riss den oberen Kasten auf und nahm ein Leinwandbeutelchen, das alle seine Ersparnisse enthielt, heraus.
Die Mutter hatte kaum noch Zeit, zu rufen:
»Was gibt es, John, wo willst du noch hin?«
Da war er schon wieder aus der Wohnung verschwunden.
Mehrere Straßen durcheilte er, bis er das fand, was er suchte, ein Messingschild, auf dem zu lesen stand:
DR. HARPER ARZT FÜR INNERE UND ÄUSSERE KRANKHEITEN.
»Was willst du?«, fragte ein Negerboy, mit geringschätzigem Blick John Workmanns einfache Kleidung musternd.
»Ich will den Doktor sprechen!«
»Jetzt sind keine Sprechstunden!«, erwiderte der Neger.
»Ach was!«, rief John Workmann, »danach frage ich dich nicht. Melde deinem Herrn, dass ich ihn sprechen will.«
Der Negerboy, welcher einen Kopf größer war als John Workmann, ärgerte sich über den herrischen Ton und wollte, ohne etwas zu erwidern, die Türe zuschlagen.
Aber John Workmann sah das voraus und stellte seinen Fuß zwischen die Tür, so dass der Negerboy sie nicht schließen konnte.
Als er ihn jetzt mit Gewalt aus der Tür drängen wollte, flammte es in den dunklen Augen John Workmanns auf, seine kleine harte Faust ballte sich zusammen, und bevor der Negerboy sich verteidigen konnte, gab ihm John Workmann einen regulären Boxerhieb vor den Magen.
Da öffnete sich auf der rechten Seite des Flures eine Tür. Dr. Harper, den der Lärm angelockt, erschien.
»Was gibt es hier?«, fragte er mit missmutigem Gesicht. Freimütig trat John Workmann zu ihm und sagte:
»Ich habe Ihrem schwarzen Boy Anstand beigebracht, er scheint sich nicht für Ihr Geschäft zu eignen, Doktor.«
Dr. Harper wusste nicht, was er erwidern sollte. Endlich fragte er: »Ja, was willst du denn eigentlich von mir!?«
John Workmann blickte ihn starr an, dann rief er:
»Sie scheinen wohl nicht zu wissen, dass Sie ein Geschäft als Doktor haben.« –
Bevor sich der Arzt von seinem Erstaunen erholt, war John Workmann wie ein Wiesel aus dem Hause verschwunden und lief die Straßen hinunter, um einen anderen Doktor zu finden.
»Ist das ein Narr«, sprach er zu sich selbst. »Fragt die Menschen, was sie bei ihm wollen. Er scheint wirklich nicht zu wissen, dass er Doktor ist. Ich möchte nicht von dem behandelt werden!«
Jetzt blieb er vor einem Schild stehen, auf dem ein Arzt namens »Walter« verzeichnet war.
Als er ihm gegenüberstand und ihn bat, mit ihm zu kommen, sagte der Doktor kurz:
»Der Gang kostet fünf Dollar. Hast du das Geld bei dir?«
John Workmann maß den Arzt mit einem stolzen Blick und erwiderte:
»Das ist selbstverständlich.«
Er knüpfte den Leinwandbeutel auf und begann dem Doktor in kleiner Münze den Betrag von fünf Dollar auf den Tisch zu zählen. Es war eine stattliche Reihe von Centstücken, bis die fünf Dollar auf dem Tische aufgezählt lagen, und über die Hälfte vom Inhalt des Leinwandbeutelchens war verschwunden.
Behutsam, als fürchtete er sich schmutzig zu machen, zählte der Arzt die Münzen durch.
John Workmann ärgerte sich darüber und sagte:
»Ich bin Zeitungsboy, Doktor, und das Geld ist ehrlich erworben! Sie brauchen sich nicht zu genieren, es zu nehmen!«
Ohne weitere Worte zu verlieren, folgte ihm der Doktor zu der Wohnung des kleinen Charly Beckers.
Es kostete John Workmann alle Überredungskünste, um ihn zu bewegen, die steil emporgehende einfache Leiter zu besteigen.
Fluchend und brummend vollführte endlich der Doktor das turnerische Kunststück und musste tief gebückt, da er sich sonst den Kopf gestoßen hätte, zu dem Lager des kleinen Charly Beckers hinkriechen.
Charly Beckers fantasierte, als ihn der Arzt untersuchte.
»Ist das dein Bruder?«, fragte er, nachdem die Untersuchung beendet war.
»Nein, Doktor. Es ist mein Kamerad. Es ist der jüngste unter uns Broadwayboys.«
»Soso –«, erwiderte der Doktor. »Dann kann ich dir ja die Wahrheit sagen. Mit dem Boy wird nichts mehr anzufangen sein. Er ist schwindsüchtig und hat eine Lungenentzündung dazubekommen. Es hätte nicht einmal Zweck, ihn noch in ein Krankenhaus bringen zu lassen. Wer weiß, ob er noch bis morgen Abend lebt.«
»Armer Charly«, flüsterte John Workmann und Tränen füllten seine Augen. »Nun ist es nichts mit dem Millionärswerden.«
»Nein«, sagte der Doktor und musste lächeln, »damit ist es für den vorbei.«
Dann verschrieb er einige Tropfen, um die Schmerzen des Kranken zu lindern, und begab sich wieder nach Hause.
Vergebens wartete voll Unruhe und Sorge die Mutter in dieser Nacht auf John, dass er nach Hause käme.
Erst am frühen Morgen, um die Zeit, als sie ihm wie sonst vor seinem Weggang den Kaffee machte, kam er an, setzte sich mit verstörtem, blassen Gesicht an den Tisch und sagte:
»Ich war bis jetzt bei Charly Beckers. Der Doktor sagte, bis zum Abend stirbt er. Ich werde heute Mittag nicht nach Hause kommen, sondern zu ihm gehen.«
»Hol’ dir nur keine ansteckende Krankheit!«, sagte die Mutter.
»Ich weiß«, nickte Workmann. »Eine ansteckende Krankheit kann ich auch sonst überall bekommen; sorge dich nicht um mich.«
Damit ging er durch die dunklen Straßen zu seinem Arbeitsplatz – zum Broadway.
Der New York Herald war eine auflagenstarke Zeitung mit Sitz in New York City, die zwischen dem 6. Mai 1835 und 1924 existierte. Nach Tod des Herausgebers ging der New York Herald 1922 im Konkurrenzblatt New York Tribune auf. <<<
einspännige Kutschen <<<
Edward Henry Harriman; 1848-1909; amerikanischer Eisenbahnunternehmer, der auf Grund von Börsenspekulationen weltweit (sogar in den USA) als Raubtierkapitalist und Ausbeuter verschrien war <<<
2. Kapitel
An dem dunkelgrauen Wintermorgen versammelten sich die Zeitungsboys vor dem Gebäude des Zeitungsriesen und, wie alle Morgen, standen die meisten von ihnen bei dem Küchenwagen des Zeitungsriesen, welcher jedem Armen New Yorks, der es wünschte, des Morgens an dieser Stelle eine Blechtasse mit heißem Kaffee und ein Stück Brot umsonst verabreichte.
Entsetzliche Reihen des Elends kamen frostbebend aus dem Dunkel zu dem Wagen.
Fadendünn umschlossen schmierige Lumpen die Entgleisten, oftmals durch große Löcher die kältegerötete Haut zeigend.
Mit gierigen Augen spähten sie auf den Moment, wo sie den ersehnten heißen Trank, das ersehnte Stück Brot erhielten. –
In ihre müden, ausgehungerten Gesichter trat ein Schimmer von neuer Lebenshoffnung, so sie mit zitternden Händen den Blechnapf voll heißen Kaffee zum Munde führten und in das Brot hineinbissen. –
Kein Laut wurde unter ihnen hörbar.
Schweigsam tauchten sie, wie Schatten einer Welt des Grauens, aus dem halbdunklen, nebelbrütenden Broadway, schweigsam verschwanden sie in demselben Nebelgrau. –
Und doch – falls sie sprechen wollten – sie konnten das Grauen verkünden.
Als John Workmann zu dem Platz seiner Kameraden kam, beantwortete er ihren lauten Gutenmorgengruß mit einem stillen Nicken des Kopfes. Dann winkte er ihnen mit der Hand zum Zeichen, dass sie ihm folgen sollten.
Die Boys waren gewohnt, John Workmann zu folgen.
Er war unter ihnen unzweifelhaft der Intelligenteste, und manch einer der Boys hatte sich von ihm schon Rat und Auskunft geholt.
Er war unter den Boys das, was die Amerikaner mit dem Namen »Boss« bezeichnen, d. h. auf Deutsch ein »Führer«.
Die Zeitungsboys folgten ihm unter die Halle, welche von dem strahlenden Licht aus dem Maschinenraum erleuchtet war. Indem sich John Workmann gegen eine der mächtigen Spiegelscheiben lehnte, sagte er mit lauter Stimme, damit die Boys jedes Wort trotz der polternden und stampfenden Maschine hören konnten:
»Wenn einer von euch Charly Beckers noch einmal sehen will, dann kann er heute Mittag nach der Schule mit mir kommen. Charly Beckers wird heute sterben.«
Es war, als ob plötzlich die Winterkälte sich auf diese Schar lebensfrischer und lebensmutiger Jungens mit ihrem eisigen Hauch gelegt hätte.
Das frohe blitzende Lächeln aus den frischen Gesichtern war verschwunden. Die Augen blickten ernst, und keiner von ihnen vermochte John Workmann etwas zu antworten.
Sie wussten ja alle, dass Charly Beckers krank geworden, aber dass er so jung sterben sollte, war für sie etwas Unfassbares.
»Kommt ihr mit?«, fragte John Workmann.
Da nickten alle Jungens mit dem Kopf, als Zeichen, dass keiner von ihnen zurückbleiben würde. –
An diesem Morgen mochten sich die New Yorker darüber wundern, dass keiner der Zeitungsboys mit dem gewöhnlichen gellenden Indianergeheul die Zeitungen ausrief, sondern dass die Jungens mit merkwürdigem Ernst ihr Geschäft ausübten.
John Workmann hatte nur die Morgenausgabe besorgt, dann war er, so schnell ihn seine Füße trugen, zum kleinen Beckers geeilt.
Als er in dessen Schlafraum kroch, lag der Kleine mit Fieberwangen und weit geöffneten Augen auf seinem Lager. Er war so schwach, dass er kaum den Kopf emporheben konnte, um zu sehen, wer zu ihm hereinkam.
»Ich bin’s, Charly«, sagte John Workmann und hockte sich ganz dicht an das Lager des Kranken. – »Erkennst du mich?«
»Ja«, hauchte Charly Beckers, »ich habe schon gewartet auf dich. Kurz bevor du kamst, träumte ich von einem goldenen Engel, der durch die Tür hereinkam und mich mit sich nehmen wollte. – Und dann bekam ich wieder furchtbare Angst und wachte auf. – – Gut, dass du da bist.«
John Workmann nahm die neben dem Bett stehende Medizinflasche und flößte Charly Beckers einige Tropfen zwischen die Lippen.
»Hast du noch Schmerzen?«
»Nein«, flüsterte Charly Beckers, »mir tut gar nichts weh. Ich glaube, ich werde jetzt wieder gesund.«
John Workmann versuchte, zu lächeln.
»Natürlich wirst du wieder gesund, und jetzt probier’ mal, ob du einen von den Äpfeln essen kannst, die ich dir mitgebracht habe.«
Er gab Charly Beckers in jede Hand einen Apfel, was der aber nicht beachtete.
»Ich habe mir schon Sorge gemacht«, flüsterte er, »was aus meinen Sachen werden sollte. Weißt du, hier unter meinem Kopfkissen habe ich sieben Dollar liegen, die ich mir erspart habe. – Und dann in der kleinen Kiste dort in der Ecke habe ich allerlei Dinge, die ich gesammelt. – Da ist eine Tabakspfeife, die ich am Broadway fand. – Auch ein Notizbuch und ein Taschenmesser und sonstige Kleinigkeiten. Ich will das später alles einmal, wenn ich reich werde, gebrauchen. Sieh mal, John, dann ist es doch ganz gut, wenn man ein Taschenmesser und ein Notizbuch schon besitzt. Da braucht man es sich nicht erst zu kaufen. Und reiche Leute haben solche Sachen! – Ich denke mir, wenn man das hat, kann man auch Millionär werden. Nicht wahr?«
»Ganz gewiss, Charly. – Du wirst ein Millionär.«
»Weißt du, John«, flüsterte Charly weiter, »am meisten hätte ich mich gefürchtet, wenn man mich wie die armen Leute in ein Massengrab geworfen hätte. Ich habe es mir immer am schönsten vorgestellt, wie der reiche Harriman in einem eigenen Grabe zu liegen, und ein großer Stern muss auf dem Hügel stehen, dass alle Leute sagen: Hier liegt Charly Beckers, der Millionär.«
John Workmann streichelte ihm die Stirn und sagte:
»Das wirst du alles haben, mein lieber Charly! Sprich nur nicht so viel, der Doktor hat es verboten.«
»War denn ein Doktor hier?«
»Ja, Charly!«
»Ein wirklicher Doktor?«
»Ein wirklicher Doktor!«
»Aber wer hat ihn bezahlt?«
»Ich habe ihn bezahlt.«
»Wie viel hat das gekostet?«
»Fünf Dollar, Charly.«
»Hm –« nachdenklich sah der kleine Knirps auf die Decke aus Sacktüchern. Dann hob er den Kopf ein wenig, blickte John Workmann dankbar an und sagte:
»Du bist ein guter Junge, John, ich schulde dir demnach fünf Dollar. Schade, den Doktor hättest du sparen können, da ich nun wieder gesund werde!«
Dann legte er sich mit dem Kopf zur Wand und schloss vor Erschöpfung die Augen.
John Workmann aber saß still neben dem Lager seines Kameraden, lauschte auf die unregelmäßigen Atemzüge und bekam Herzklopfen, wenn der Atem einmal längere Zeit ausblieb.
So kam der Mittag heran und die Zeit, wo die anderen Boys vom Broadway noch einmal Charly Beckers sehen wollten.
Wohl an die hundert Jungens waren es, die sich auf dem Hofe hinter dem Stall versammelten und lautlos einer nach dem andern zu dem engen Verschlag emporkletterten.
Und der kleine Sterbende wachte auf und freute sich, dass alle seine Freunde gekommen waren, ihn zu besuchen.
Jeder der Boys schüttelte ihm die Hand und hatte ein Trostwort für ihn. –
Und Charly Beckers fühlte sich, als sei er der Präsident, mit lächelndem Munde flüsterte er:
»Sorgt euch nicht. – Morgen bin ich wieder gesund –«
Immer matter wurde sein Lächeln, ein müder Schatten legte sich vor seine Augen, er erkannte nichts mehr und mit einem letzten Aufflackern seiner Lebenskraft flüsterte er sterbend:
»Morgen – gesund.«
Dann versank das graue Licht des Wintertages in ewige Nacht vor seinen Augen.
Charly Beckers war schon lange tot, als seine Kameraden immer noch nicht wussten, dass er nicht mehr unter ihnen weilte.
Erst als John Workmann merkte, dass die Hand des kleinen Charly, welche er hielt, kälter und kälter wurde, und die Augen sich nicht mehr öffneten, beugte er sich über ihn und rief:
»Charly, willst du etwas trinken?«, und nachdem er es mehrmals gerufen, ohne Antwort zu bekommen, bemächtigte sich John Workmanns eine unerklärliche Furcht.
Mit zitternden Händen nahm er die Medizinflasche und versuchte in Charly Beckers festgeschlossenen Mund einige Tropfen zu gießen. – Umsonst.
Charly Beckers kleiner Mund, der so fröhlich plaudern konnte, war für immer verschlossen.
»Er ist sehr kalt«, flüsterte John Workmann seinen Kameraden zu, »ich werde ihn in den Arm nehmen und ihn wärmen.«
»Es wird nichts nutzen«, sagte Harry Tomson, »als meine kleine Schwester starb – wir schliefen immer in demselben Bett – war sie auch ganz kalt. – Ich glaube, Charly Beckers ist nun im Himmel.«
Da wurde es ganz still unter den Boys wie in einer Kirche. – Als einer von ihnen mit dem Fuß das Strohlager Charly Beckers berührte, dass es raschelte, fuhren sie erschreckt zusammen und schlichen zu ihren auf dem Hof weilenden Kameraden.
Dort standen sie eng zusammengedrängt, als brüte ein schweres Unheil über ihren Köpfen.
»Boys!«, sagte John Workmann mit tränenfeuchten Augen, »der kleine Charly ist tot. Sein letzter Wunsch war, so begraben zu werden, wie unsere Millionäre. Ich denke, wenn wir alle mal drei Tage lang hungern und unseren Verdienst zusammenschmeißen, dann wird es dafür ausreichen, dass wir dem kleinen Charly auf einem Kirchhof in Long Island einen festen Platz kaufen und ihn in einem schönen Sarg zu Grabe tragen. Seid ihr alle damit einverstanden?«
In die ernsten Mienen der Boys brachten die Worte John Workmanns wieder Sonnenschein. Jetzt hatten sie eine Pflicht an dem kleinen Charly Beckers, ihrem Kameraden, zu erfüllen!
Fast zufrieden verließen sie den Hof und begaben sich wieder zu ihrem Arbeitsplatz, zum Broadway.
John Workmann aber ging in den Raum des Toten zurück. Nachdem er nochmals einige bange Minuten vergeblich auf ein Lebenszeichen von ihm gelauscht, begann er die Habseligkeiten – das Erbe des kleinen Charly Beckers – zusammenzupacken.
Mit fast frommer Scheu fasste er die wertlosen und doch für Charly Beckers einstmals so kostbaren Dinge an.
Wie hatte der kleine Knirps an den Sachen gehangen!
John Workmann erinnerte sich, mit welch stolzen Augen ihm Charly Beckers die Tabakspfeife und das Taschenmesser gezeigt. – Vor allem aber das Notizbuch! – Das sollte Charly Beckers Wegweiser zum Reichtum werden.
Mit Tränen in den Augen schlug John Workmann das kleine Buch auf.
Da stand auf der ersten Seite mit ungelenken Knabenbuchstaben: »Charly Beckers« und darunter mit roter Tinte: »Millionär« – auch seine Wohnung war genau angegeben.
Dieser ärmliche Stallverschlag unter dem Dache war in Charly Beckers Fantasie sein Millionärspalast.
Dann stand auf den nächsten Seiten genau angegeben, was Charly Beckers verausgabt und wie viel er verdient.
Mit roter Tinte hatte er auf jeder Seite seine Ersparnisse unten ausgeschrieben. – Sieben Dollar waren es auf der letzten Seite – und nun?
John Workmann schaute auf den stillen Schläfer – in seiner Kehle würgte es – am liebsten hätte er laut aufgebrüllt, dass der kleine tapfere Kerl nun tot war.
Dann erinnerte er sich, dass niemand bis jetzt bei dem Toten ein Gebet gesprochen. – Es zwang ihn förmlich, das zu tun; und so kniete er bei Charly Beckers nieder und betete mit halberstickter Stimme:
»Lieber Gott – der kleine Charly war ein guter Junge. – Du weißt das besser als ich, und auch, dass er keinen Vater besessen. – Nun ist er bei dir, lieber Gott. – Amen!«
Dann nahm er die Hände des Kleinen und, als ob er noch hören könne, sagte er:
»Charly, du brauchst dich nicht zu sorgen, du sollst ein schönes Grab haben.«
Leise verließ er jetzt den Raum, schloss ihn fest ab, und als er auf der Straße war, wich die Traurigkeit von ihm und sein Gehirn begann, sich praktisch für Charly Beckers zu beschäftigen.
Bereits am Abend hatte er das nötigste Geld zur Hand, und als zwei Tage vergangen waren, fehlten eines Nachmittags auf dem Broadway die gesamten Zeitungsboys, um Charly Beckers die letzte Ehre zu erweisen.
Ein prachtvoller Leichenwagen, wie ihn die dunkle Ostseite von New York, in welcher das größte Elend und die bitterste Armut herrschten, nie gesehen, führte den Sarg des kleinen Charly Beckers durch die Straßen zum Broadway.
Ein Musikkorps, welches einen feierlichen Trauermarsch spielte, schritt dem Sarg voran. Dicht hinter ihm ging John Workmann, dem in langem Zuge die Zeitungsboys vom Broadway folgten.
Starr hingen die Augen von John Workmann an den mächtigen weißen Schleifen eines Lorbeerkranzes, die wie ein Banner von dem Sarg fast bis zum Boden hinabreichten und auf dem in großen Goldlettern gedruckt stand:
»Ihrem toten Kameraden Charly Beckers Seine Kameraden vom Broadway!«
Und die New Yorker stauten sich zu beiden Seiten der Straßen, welche der Zug passierte und blickten mit scheuer Bewunderung auf die ärmlich gekleideten Zeitungsboys, welche ihrem Kameraden ein so glänzendes Begräbnis zuteilwerden ließen.
Als der Zug vor dem Gebäude der Zeitung langsam vorüberkam, machte der Zeitungsriese in seinen kostbaren Arbeitsminuten eine Pause.
Die Arbeiter verließen die Maschinen, die unermüdlichen riesigen Werke standen still.
Dreimal neigte sich die Flagge am Fahnenmast des Zeitungsriesen vor dem Sarg seines Zeitungsboys, als wäre er ein Fürst.
Vom Broadway bis zu dem Fährboot, das den Sarg des kleinen Charly Beckers nach Long Island hinübersetzen musste, standen die Menschenmassen dicht gedrängt, und zum ersten Male flüsterten sie sich den Namen eines späteren Gewaltigen unter ihnen von Mund zu Mund:
»John Workmann.«
Wie ein Lauffeuer ging es durch die Menschenmassen, dass John Workmann es war, der das Begräbnis zustande gebracht hatte. Tausende von Augen sahen neugierig auf das blasse Gesicht des blondlockigen zwölfjährigen Knaben, der hinter dem Sarg schritt.
Und die wirklich Sehenden konnten auf dem Antlitz John Workmanns den Adel seiner Intelligenz wie ein prophetisches Leuchten für eine große Zukunft liegen sehen.
Als der begleitende Prediger das Gebet über der Grube gesprochen, trat John Workmann an das Grab und warf als letzte Liebestat drei Hände voll Erde auf Charly Beckers letzte Ruhestätte.
Dann sagte er:
»Boys! – Wenn Charly Beckers bei uns stehen würde, dann könntet ihr sehen, wie sehr er sich über das schöne Begräbnis freute, das wir ihm gegeben haben. – Für Charly Beckers danke ich euch und wünsche, dass ihr einmal ein ebenso schönes Grab bekommt wie unser Charly Beckers.«
Als John Workmann am Abend still und schweigsam seine Wohnung aufsuchte, empfing ihn seine Mutter zum ersten Male mit einer scheuen Ehrfurcht, als sei es nicht ihr Junge, sondern ein Fremder.
Eine Stunde, bevor er gekommen, hatten ihr Nachbarinnen die Abendzeitungen gebracht, und an erster Stelle konnte sie den Namen ihres Jungen lesen mit großen Buchstaben, wie sie die Zeitungen nur bei Königen, Fürsten oder großen Ereignissen gebrauchten. Und darunter die Beschreibung vom Begräbnis des kleinen Charly Beckers nebst Bildern.
Wie eine Heldentat priesen die Zeitungen John Workmanns Tat.
Die Augen voll Tränen umarmte ihn seine Mutter und rief immer wieder:
»John, mein lieber guter John!«
John Workmann aber wehrte seine Mutter sanft ab und sagte:
»Weißt du, Mutter, seit drei Tagen habe ich kaum gegessen noch geschlafen. Schaffe mir jetzt Abendbrot und dann will ich mich zu Bett legen.«
Als John Workmann im Bett lag, atmete er erleichtert auf.
Er dachte an den kleinen Charly Beckers, der nun doch nach seinem Tode wie ein Millionär in einem vornehmen Grabe in Long Island lag. – Nicht unter den Sanddünen draußen am Ozean, wo man die Grabstätte statt eines Namens nur mit einem Holzpfahl bezeichnet, auf dem eine Nummer geschrieben – Charly Beckers konnte zufrieden sein!
Auf sein Grab kam ein Stein, auf dem ein jeder lesen konnte, dass hier Charly Beckers letzte Ruhestätte war.
Als John Workmann am nächsten Tage erwachte, begab er sich, wie stets zur gewohnten Zeit, zu seinem Arbeitsplatz.
Als er an den Schalter trat, um seine Zeitungen in Empfang zu nehmen, schob ihm der alte Beamte einen Brief zu und sagte:
»Lies den, John. Ich glaube, man kann dir gratulieren!«
Erstaunt nahm John Workmann den Brief, welcher seinen Namen trug und in einem Kuvert steckte, wie es der Zeitungsriese gebrauchte.
Aber erst, nachdem er seine Morgenausgabe in den Hoch- und Untergrundbahnen verkauft, nahm er sich die Zeit, den Brief zu öffnen. Mit erstaunten Augen las er:
Dear Sir!
Im Auftrage des Mister Bennett1 habe ich Ihnen mitzuteilen, dass Sie heute zwischen 2 und 3 Uhr sich in seinem Büro einfinden möchten.
Hochachtungsvoll George Tyler, Sekretär.
Zweimal las John Workmann den Brief. Dann wurde er glühend rot.
Scheu steckte er das Schreiben in seine Brusttasche und benutzte zum ersten Mal in seinem Leben die Straßenbahn, um schneller nach Hause zu kommen. Er wollte seinen Anzug wechseln.
Zum ersten Male auch geschah es, dass er als »Herr« angeredet wurde.
Und derjenige, der ihn als Herr anredete, war einer der Mächtigsten der Welt, einer der ersten Millionäre: der Besitzer der ungeheuren Maschinen, der Arbeitgeber von Tausenden von Menschen, ein König in seinem Reiche.
James Gordon Bennett junior, 1841-1918; amerikanischer Zeitungsverleger, Sohn und Erbe des gleichnamigen Gründers und Herausgebers des New York Herald, James Gordon Bennett Sr. übernahm 1866 die Verantwortung für den Verlag. <<<
3. Kapitel
Als John Workmann die breite Marmortreppe im Gebäude des Zeitungsriesen zu dem im ersten Stockwerk befindlichen Empfangsraum emporstieg, erschien es ihm gar nicht so außergewöhnlich, trotzdem er noch nie in seinem Leben über mit roten Samtläufern belegten Marmorstufen geschritten war.
Auch der dunkel getäfelte Empfangssaal mit den mächtigen, mit grünem Tuche bespannten Tischen, auf denen Zeitungen und Bücher aus aller Herren Länder zur Ansicht lagen, imponierte ihm nicht.
Als sei es etwas Selbstverständliches, nahm er in einem der bequemen, rotledernen Sessel Platz und wartete der Dinge, die nun kommen mussten.
Es dauerte nicht lange, so näherte sich ihm ein vornehm galonierter1 Diener, welcher die Besucher nach ihren Wünschen zu fragen hatte.
Von dem Empfangsraum gingen wohl ein Dutzend Türen nach den verschiedenen Richtungen des Zeitungspalastes und brachten die Besucher zu den verschiedenen Redaktionen.
Da war ein ewiges Kommen und Gehen.
Hunderte von Menschen kamen tagtäglich in den Saal, um mit ihren Anliegen die Redaktionen des Zeitungsriesen aufzusuchen.
Es gab vielleicht keine Nation in der Welt, die nicht täglich hier vertreten war: Beturbante Inder, Türken mit dem Fez, Perser mit Lammfellmützen, Chinesen mit blauseidenen Kaftanen und ebenholzschwarze Neger; Kaukasier, Franzosen, Italiener, Deutsche und Engländer. – Ja, selbst die Eskimos der letzten Nordpolexpedition hatten den Raum schon betreten.
Alle Sprachen der Welt durchschwirrten den mächtigen Saal. Kein zweiter Platz der Welt konnte eine derartig interessante Gesellschaft aufweisen wie der Empfangsraum des Zeitungsriesen.
Aber nicht nur Ausländer waren hier zu treffen, sondern auch viele Mitbürger John Workmanns, um sich Rat und Auskunft oder auch Hilfe zu holen.
Und für alle wusste der gigantische Apparat des Zeitungsriesen Rat zu schaffen!
Da kamen arme Leute, welche keine Feuerung besaßen, und erhielten von ihm für den ganzen Winter das Brennmaterial. Da waren im heißen Sommer Leute, welche bei der tropischen Glut, die in New York herrschte, kein Eis hatten, und sie erhielten welches.
Da waren andere, welche um ein Freibett in einem Krankenhaus baten, um einen Rechtsanwalt in schwierigen Fällen, um ein bares Darlehen, um Schutz gegen Feinde, um einen Arbeitsplatz.
Und wie Hārūn ar-Raschīd, der mächtige Herrscher aus dem Märchen von ›Tausendundeine Nacht‹, erschien allen den Hilfesuchenden der ihnen selbst nicht zu Gesichte kommende Zeitungsriese, und die wenigsten wussten sich selbst ein Bild von ihm zu machen.
Fast wie der liebe Gott, so unsichtbar und so mächtig war er für Tausende von Menschen.
Es gehörte auch zu den größten Seltenheiten, dass ihn irgendein Mensch zu Gesicht bekam. Selbst seine Untergebenen sahen ihn jahrelang nicht.
Nur sein Vertrauter, seine rechte Hand, sein Sekretär, George Tyler, war der Mittelsmann, dessen er sich bediente, um seine kurzen und bündigen Befehle zu erteilen.
Als der Saaldiener zu John Workmann trat, um ihn zu fragen, zu wem er wünsche, antwortete John Workmann:
»Zu Mister Bennett.«
Der Saaldiener, welcher diese Antwort wohl hundertmal am Tage hörte, antwortete jedes Mal dasselbe:
»Mister Bennett ist nicht zu sprechen. – Falls Sie mir sagen, was Sie wünschen, werde ich Sie zu seinem Vertreter senden.«
»Erlauben Sie mal«, erwiderte John Workmann und zog seinen Brief aus der Tasche, »ich glaube nicht, dass Mister Bennett zu den Leuten gehört, welche sich einen Spaß mit einem anderen erlauben. Überzeugen Sie sich, Mister Bennett hat mich um diese Zeit herbestellt.«
Der Saaldiener nahm den Brief und während er ihn las, veränderte sich sein freundlich herablassender Gesichtsausdruck zu einer respektvollen und strengen Miene:
»Entschuldigen Sie, Sir«, sagte er mit einer höflichen Verbeugung, welche sonst nicht zu seinen Gewohnheiten gehörte. »Das ändert allerdings die Sachlage! Sie werden verstehen können, dass ich Ihnen erst die Antwort erteilen musste. Bei den vielen Besuchen, die hier einlaufen, würde Mr. Bennett keine Zeit zu irgendwelchem Geschäft mehr besitzen, wenn er sie alle selbst empfangen wollte. Bitte, haben Sie die Güte, mir zu folgen.«
Er schritt zu einer kleinen Ebenholztür und drückte auf einen Klingelknopf. Kaum eine Sekunde verging, so öffnete sich die Tür, ein Negerboy trat aus einem Lift heraus, lüftete sein Käppi vor John Workmann und der Saaldiener bedeutete ihm, den Lift zu betreten.
Er schloss hinter ihm die Tür, der Negerboy trat an das Handrad, setzte den Lift in Bewegung und langsam und geräuschlos stieg er in die Höhe.
Fast endlos deuchte John Workmann die Zeit, welche der Lift zum Emporsteigen gebrauchte. Endlich hielt er.
Der Negerboy öffnete die Tür des Lifts, zog wiederum sein Käppi respektvoll vor John Workmann und ließ ihn in ein dunkel getäfeltes Zimmer eintreten, in welchem an einer Schreibmaschine eine junge Dame saß.
Höflich fragte diese John Workmann nach seinem Begehr und ersuchte ihn dann, vorläufig Platz zu nehmen, da Mister Bennett sich noch in einer Konferenz befände.
John Workmann nahm in nächster Nähe des breiten mächtigen Fensters Platz und blickte mit kindlichem Entzücken auf die ungeheuer weite Fernsicht über die mächtige Stadt.
Es war das höchste Geschoss, der 36. Stock des Zeitungspalastes,2 in welchem sich fern von allem Getöse der Großstadt der Privatraum des Zeitungsriesen befand. Nur ganz dumpf, wie ein weit entfernter Donner, tönte der Lärm aus der Tiefe empor.
Weit über die Häuser fort zum Hafen, wo die Freiheitsstatue golden aufblinkte, über die grüne Insel von Staten Island fort reichte der Blick zu dem blaugrün schimmernden Ozean.
Ganz deutlich konnte John Workmann soeben in der Hafeneinfahrt einen der Riesenpassagierdampfer aus Deutschland erkennen, trotzdem er nicht größer wirkte als eine Nussschale.
Auch die ungeheuren Brücken über den East River erschienen aus dieser Höhe fast wie das Werk von Spinnfäden.
Als kleine dunkle Punkte krochen über diese Brücken die Straßenbahnen, während die Menschen fast so lächerlich winzig wirkten, dass man sie mit bloßem Auge kaum wahrnehmen konnte.
Während John Workmann das irdische Wunder aus der Höhe mit innerer Freude genoss, wurde er plötzlich durch zwei laut und scharf klingende Männerstimmen aufgeschreckt.
Die mit dickem roten Fries3 beschlagene Tür, welche zu dem Allerheiligsten des Zeitungsriesen führte, war wohl durch irgendeinen Zufall nicht fest verschlossen, so dass durch einen schmalen Spalt jedes Wort deutlich in das Vorzimmer drang.
Klar vernahm John Workmann die prononciert, wie Metall klingende Stimme eines Mannes:
»Ich vermag Ihnen, General, nicht zu versprechen, dass ich nicht die Initiative einer Aggression ergreife, falls Japan sich noch einmal einen Übergriff durch die Kritik unserer Einwanderungsgesetze erlaubt.«
Darauf ließ sich nach einer Pause die abgehackte englische Redeweise, wie sie die Japaner gebrauchen, vernehmen und erwiderte:
»Bedenken Sie, Mister Bennett, dass Sie uns dann mit Amerika zum Kriege bringen.«
Und wieder klang es wie hartes, dröhnendes Metall:
»Herr General Joka Sumo: Amerika fürchtet keinen Krieg mit Japan. Sie werden es mir zugestehen müssen, dass ich genau beurteilen kann, was meinem Vaterlande nottut.«
Und wieder eine Pause, nach welcher der Japaner sagte:
»Wollen Sie uns nicht ein wenig entgegenkommen, damit meinen japanischen Landsleuten die Einwanderung etwas erleichtert wird?«
»Nein!«, klang es kurz zurück. »Ich sehe für mein Vaterland, für Amerika, keinen Nutzen darin, dass uns Ihre Landsleute unser Wissen und unsere Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Lande tragen.«
»Das ist Ihr letztes Wort?«
»Mein letztes Wort!«
Wenige Minuten später öffnete sich die Tür, und ein General der japanischen Armee trat aus dem Zimmer. Das gelbliche Gesicht hoch gerötet, die sonst müde blickenden Augen blitzend vor verhaltenem Zorn.
Fast atemlos vor Spannung hatte John Workmann allem zugehört. Zum ersten Mal stand er an der Schwelle zu einem Raum, in dem über die Geschichte von Völkern, von Krieg und Frieden entschieden wurde.
Und zu dem, der beides in der Hand hatte, der Tausende von Menschen in den Krieg jagen, der Hunderte von Kanonen zum Brüllen bringen, der Verzweiflung und Entsetzen aussäen konnte, zu diesem Gewaltigen der Welt schritt jetzt John Workmann mit klopfendem Herzen hinein.
Vom Gesicht Mister Bennetts war noch nicht der Ausdruck verschwunden, welchen es bei dem Gespräch mit dem japanischen General angenommen hatte.
Hart, wie aus Stein gemeißelt, sah das gelbliche, hagere, glattrasierte Gesicht aus, und in den Augen lag ein stählerner Glanz, welcher John Workmann befangen machte.
»Nehmen Sie Platz, Sir«, sagte Bennett und machte eine Handbewegung zu einem neben dem Schreibtisch stehenden Klubsessel.
Während sich John Workmann setzte, betrachtete Mister Bennett mit scharfen Blicken den Knaben, und der Eindruck, welchen John Workmann auf ihn machte, musste ein sehr befriedigender sein, denn der harte Gesichtsausdruck milderte sich und in die grauen Augen des Zeitungsriesen trat ein warmes Leuchten.
»Sie leben bei Ihrer Mutter?«, begann Mister Bennett und blätterte in einem kleinen Aktenstück, in dem, ohne dass es John Workmann wusste, alle seine Personalien, ja, man konnte fast sagen, der gesamte Lebenslauf bis zum heutigen Tage auf Erkundigungen von Mister Bennett eingetragen waren.
»Jawohl«, antwortete John Workmann.
»Ich habe erfahren«, sprach Mister Bennett weiter, »dass Sie Ihre Mutter, die kränklich ist und nicht erwerbsfähig, bereits seit Jahren ernähren.«
»Jawohl, das tue ich.«
»Ihr Vater starb vor vier Jahren. Er war ein Deutscher von Geburt. Und, wie ich gehört habe, ein nicht besonders praktischer Mensch. Er malte Porträts, nicht wahr?«
Wiederum bejahte John Workmann und wunderte sich im Stillen, woher der Zeitungsriese das alles wusste.
Mister Bennett las noch eine Weile in dem Aktenstück, dann klappte er es zu, blickte John Workmann fest an und sagte:
»Ich glaube, Sie sind aus dem Holz geschnitzt, aus dem einmal ganze und tüchtige Männer werden. Ich liebe es, solche Männer in meinem Betrieb zu beschäftigen. Haben Sie Lust, bei mir als Arbeiter einzutreten, so bin ich gern bereit, Ihnen den Platz, an dem Sie zu stehen wünschen, anzuweisen. Wofür interessieren Sie sich?«
»Für Maschinen.«
»Recht so«, erwiderte Mister Bennett, »die Maschinen sind die Beherrscher der gesamten Welt. In den Maschinen liegt das Höchste, was wir besitzen können; das heißt, in praktischer Beziehung. Sie haben also demnach Lust, bei den Maschinen in meinem Betriebe als Arbeiter tätig zu sein. Haben Sie sich schon entschieden, welche von den Maschinen Ihr besonderes Interesse erregt?«
»Oh, ja«, entgegnete John Workmann, und seine Augen leuchteten, »ich bewundere immer die großen Maschinen, welche die schönen bunten Bilder hervorbringen.«
»Die Dreifarbendruck-Pressen, nicht wahr?«
»Ich glaube, ja«, nickte John Workmann, »ich kenne sie nicht bei Namen. Ich könnte sie Ihnen nur zeigen.«
»Schön«, sagte Bennett, während er gleichzeitig das Telefon, das ihn mit dem Maschinenraum verband, zur Hand nahm:
»Ich wünsche den Maschinenmeister der Farbenpresse«, sagte Mister Bennett und legte den Hörer auf seinen Platz zurück.
»Sie waren wohl gut mit dem kleinen Charly Beckers befreundet, dass Sie so um ihn besorgt waren?«
»Wir waren Kameraden«, entgegnete John Workmann, »und da steht einer für den anderen ein. Falls ich krank geworden wäre, würden meine Kameraden wohl dasselbe für mich getan haben.«
»Das wundert mich eigentlich von euch Zeitungsboys!«
»Inwiefern?«, fragte John Workmann erstaunt, »wir sind einer auf den anderen angewiesen. Und außerdem müssen Sie sich doch dessen erinnern, wie es unter uns zugeht.«
»Wie meinen Sie das?«
»Nun, waren Sie nicht auch einmal Zeitungsboy?«
»Nein«, lachte Mister Bennett. »Ich habe einen anderen Weg gemacht.«
In diesem Augenblick wurde die Tür leise geöffnet und die Sekretärin meldete den Maschinenmeister.
Scheu und mit fast zitternden Knien trat der Maschinenmeister, ein schwerer, breitschultriger Mann, in das Zimmer und blieb bescheiden an der Tür stehen.
»Treten Sie näher, Mister Johnson«, sagte Mister Bennett, »ich möchte Ihnen eine persönliche Anweisung geben. – Ich wünsche diesen Boy bei Ihnen an der Farbenpresse beschäftigt.«
»Sehr wohl, Mister Bennett.«
»Das ist alles. Sie können wieder gehen.«
Als der Maschinenmeister den Raum verlassen hatte, erhob sich Mister Bennett von seinem Sessel als Zeichen, dass er nun die Unterredung mit John Workmann zu beenden wünsche.
»Treten Sie also morgen früh bei dem Maschinenmeister an und halten Sie sich weiter so brav wie bisher. Ich werde Sie sehr im Auge behalten.«
John Workmann war gleichfalls aufgestanden, drehte seine Mütze verlegen in den Händen, und eine jähe Röte schoss plötzlich über sein Antlitz.
»Ich muss mir noch eine Frage erlauben, bevor ich gehe«, sagte er in bescheidenem, aber festem Ton. »Sie vergaßen mir zu sagen, welchen wöchentlichen Verdienst ich an der Maschine haben werde!«
Über das Gesicht von Mister Bennett huschte ein leichtes Lächeln.
»Selbstverständlich, da hast du ganz recht!«, erwiderte er, plötzlich seine Anrede wechselnd. »Warte einige Sekunden dort.«
Er nahm wieder das Telefon zur Hand und sprach mit irgendeiner Betriebsstelle betreffs des Lohnes.
Als er den Hörer hinlegte, sagte er:
»Du erhältst vorläufig zwei Dollar die Woche und kannst, falls du fleißig bist und deinen Platz gut ausfüllst, in mehreren Monaten schon sechzehn Dollar verdienen.«
Da schüttelte John Workmann seinen Kopf.
»Nein, Herr«, erwiderte er, »ich muss Ihnen für Ihre Freundlichkeit, mich bei den Maschinen zu beschäftigen, danken. –«
»Was musst du?«, fragte der Zeitungsriese erstaunt. »Du willst den Platz, den ich dir anbiete, nicht annehmen? Du sagtest doch noch eben, dass es direkt dein Wunsch sei?«
»Es ist auch mein Wunsch«, entgegnete John Workmann. »Aber ich habe nicht das Recht, meinen Wünschen gemäß leben zu können. – Ich habe meine Mutter zu ernähren.«
Einige Sekunden lang war es ganz still in dem Raum. Man hörte nur das schwere gleichmäßige Ticktack der Normaluhr,4 das leise Grollen der im Kellergeschoss des riesigen Gebäudes befindlichen Maschinen.
Der Kopf des Zeitungsriesen neigte sich auf die Brust, seine Augen blickten in tiefem Sinnen auf den Teppich. Es war, als ob etwas Heiliges plötzlich den Raum erfüllte, etwas anderes als kalte Zahlen, Maschinen und nüchterner Verstand.
Endlich richtete sich der Zeitungsriese wieder hoch und blickte auf John Workmann, der ihn mit offenen geraden Augen anschaute. Dann sagte er:
»Darf ich den Verdienst wissen, den du als Zeitungsboy hast?«
»Zwölf bis fünfzehn Dollar die Woche.«
»Zwölf bis fünfzehn Dollar?«, wiederholte Mister Bennett, »das ist ja ein Verdienst, wie ihn nur ein guter Arbeiter erzielt. Wie ist das möglich?«
Jetzt machte John Workmann ein verwundertes Gesicht. Er konnte sich nicht denken, dass der Zeitungsriese nicht wissen sollte, wie das zusammenhinge.
Da Mister Bennett aber auf eine Antwort zu warten schien, sagte er:
»Ich habe eine gute Ware zu verkaufen, wie sie die Leute wünschen. Hätte ich eine schlechte Zeitung, würde ich nicht so viel Geld verdienen. – Aber Ihre Zeitungen sind gut, Mister Bennett.«
Ein leichtes Lächeln umspielte den Mund Mister Bennetts, und indem er sich setzte, zündete er sich eine Zigarre an, wie um seine Gedanken zu sammeln.
Nachdem er einige Züge geraucht hatte, sagte er:
»Ich bin bereit, eine Ausnahme mit dir zu machen. Ich glaube, du kannst für mich in meinem Betrieb noch einmal eine äußerst tüchtige Stütze werden. Und deshalb bin ich bereit, dir denselben Verdienst jede Woche zu zahlen, wie du ihn bisher als Zeitungsboy hattest.«
Und von neuem schüttelte John Workmann seinen blondlockigen Kopf.
»Es geht nicht, Herr.«
Jetzt zog Mister Bennett seine Augenbrauen unmutig zusammen. Er war es nicht gewohnt, Widerstand zu finden. Ja, es war vielleicht das erste Mal, dass ein Mensch sich nicht seinem Willen fügen wollte.
Sein Gesicht wurde hart, es schien wie aus Bronze.
John Workmann aber, der jede Furcht vor dem mächtigen Mann verloren hatte, sah ihm freimütig in die Augen und sagte:
»Es geht eben nicht, Mister Bennett. Denn ich habe bei Ihnen von morgens neun Uhr bis abends fünf Uhr zu arbeiten. Da würde ich keine Zeit übrig behalten, um die Schule zu besuchen und hätte fernerhin keine freie Zeit, um mich zu erholen und mich um meine Mutter zu kümmern.«
»Du bist ein guter Rechner«, sagte jetzt Mister Bennett. »Ich glaube, wenn ich so wie du in meinen jungen Jahren bereits gerechnet hätte, ich würde noch mehr in der Welt zustande gebracht haben. – Was möchtest du denn einmal werden?«
»Dasselbe wie Sie, Mister Bennett.«
Jetzt verschwand der harte Gesichtsausdruck aus Mister Bennetts Gesicht, als er sagte: