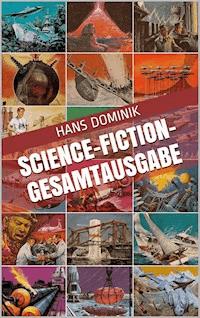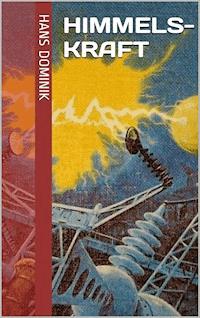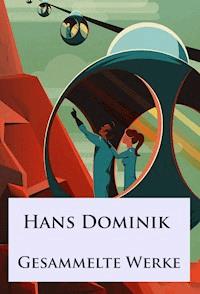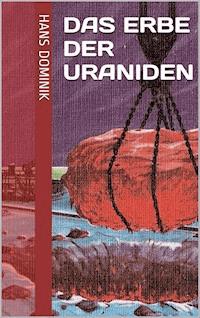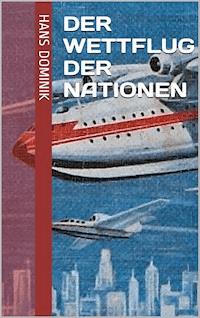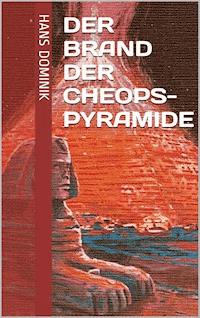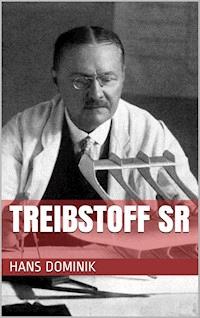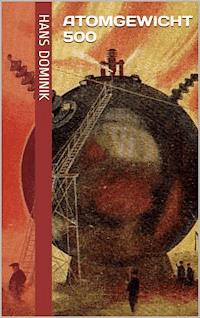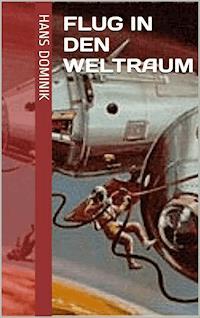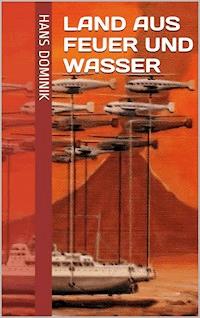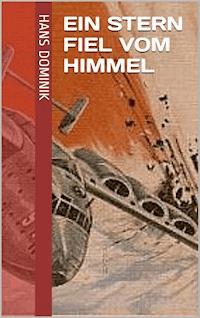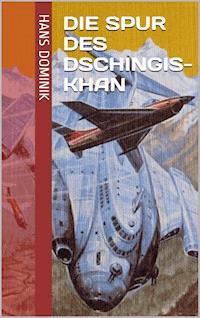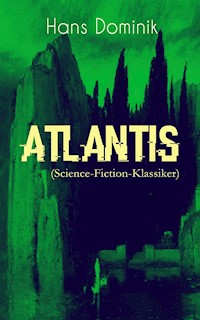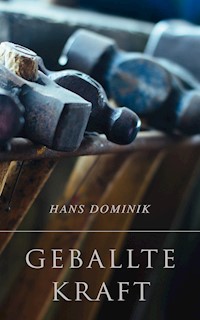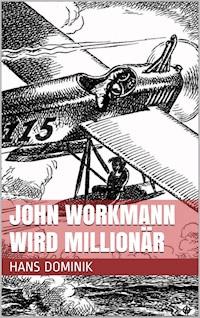
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"John Workmann der Millionär" ist ein 1925 veröffentlichtes Jugendbuch des Autors Hans Dominik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Impressum
1. Kapitel
Die Veröffentlichungen John Workmanns im »Herald« erregten gewaltiges Aufsehen. Da schilderte jemand den Riesenbetrieb ganz schlicht, so, wie er ihn selbst kennengelernt hatte. Ohne jede Übertreibung und Kunst war die Darstellung gegeben, und doch wirkte sie gerade durch ihre Schlichtheit so überzeugend. Daß der Verfasser kein erfahrener Journalist oder Schriftsteller, sondern ein sechzehnjähriger Knabe war, gab der Sache einen besonderen Reiz, und daß dieser Knabe als New Yorker Zeitungsjunge bereits eine gewisse Berühmtheit besaß, machte es noch ganz besonders interessant. Mr. Bennett kannte sein Publikum und dekretierte dementsprechend. Durch den Sekretär Mr. Taylor erfuhr es die Redaktion, und von dieser kam es durch den Mund des Redakteurs Berns an John Workmann. Man legte ihm nahe, öfter einmal einen Beitrag zu liefern.
John Workmann hörte es und zuckte mit den Achseln.
»Ich glaube, Mr. Berns, das wird nichts für mich sein. Es war etwas anderes, als ich hier die Angriffe gegen die Armour-Werke las. Da konnte ich etwas schreiben, denn ich kam direkt aus den Werken und kannte sie genauer als irgendein anderer Mensch in New York. Aber ich bin jung und will noch viel sehen und lernen. Ich denke nur etwa zwei Wochen in New York zu bleiben. Dann will ich wieder auf die Wanderschaft gehen. Wie käme ich dazu, hier als junger Mensch den Leuten, die im allgemeinen viel älter und klüger sind als ich, etwas Lesenswertes mitzuteilen?«
Mr. Berns pfiff den Yankee-Doodle vor sich hin, lächelte verschmitzt und erwiderte dann: »Es ist natürlich Ihre Sache, einen geeigneten Stoff, ein passendes Thema zu finden. Das ist die große Kunst eines erfolgreichen Mitarbeiters. Erst wenn Sie mir eine Arbeit bringen, kann ich entscheiden, ob sie für unser Blatt taugt oder nicht. Im übrigen, mein lieber Junge, ist Bescheidenheit gewiß eine Tugend, aber man soll sie auch nicht zu weit treiben. Mr. Bennett hat Sie im Auge behalten und gibt Ihnen diese Chance. Denken Sie an das alte Wort: ›Wer sich grün macht, den fressen die Ziegen‹. Es wäre nach meiner Meinung doch richtig, wenn Sie während der Zeit, die Sie noch in New York sind, einen Versuch machten. Man kann nicht wissen, wozu es gut ist.«
John Workmann bedankte sich für den Rat und ging.
Langsam schlenderte er den Broadway hinunter zur City Hall, blickte mit seinen Augen in das Menschengewühl, das diese Zeit gegen Mittag am stärksten flutete, und hoffte im stillen, daß etwas sich ereignen würde, das ihm den Stoff zu einem Artikel geben könnte.
Aber nichts geschah. Die Menschen hasteten, ohne aufeinander zu achten, in endlosem Strom an ihm vorüber. Gleichgültig und geschäftsmäßig blickten sie ihn an, jeder mit seinen eigenen Interessen beschäftigt.
Wie eine tadellos funktionierende Riesenmaschine wickelte sich der Verkehr ab, und der Menschenstrom nahm John Workmann mit sich und führte ihn zur Westseite, die Dreiundzwanzigste Straße hinunter, an den Warenhäusern vorüber, bis er, aus den Menschenmassen heraus, in stillere Straßen kam und endlich an dem breiten Kai des Hudson River stehenblieb.
Hier waren keine hastenden Menschenmengen, hier war es still und ruhig auf der Straße. Aber statt des ratternden Geräusches der elektrischen Straßenbahnen, statt des tosenden Lärmes der Hochbahn, der Autos und der Menschen wurde hier die Luft von dem Fauchen einer großen Dampfmaschine in seiner nächsten Nähe erfüllt. Hunderte von Arbeitern waren dort am Ufer beschäftigt, Eisenschienen waren gelegt, und auf ihnen fuhren in endloser Reihe Loren, welche mit Felsblöcken, Schutt und Sand beladen waren.
Und jetzt – John Workmann hielt unwillkürlich den Atem an – donnerte der gewaltige Klang einer Dynamitsprengung von der Arbeitsstelle zu ihm, und voller Neugierde ging er langsam hin, um zu sehen, was dort gemacht würde.
Ein Bretterzaun, in dessen Mitte nur eine Einfahrt für die Loren, die Menschen und Lastwagen frei war, versperrte den Weg. Ein Mann trat aus einem kleinen Häuschen bei der Einfahrt und hielt ihn an, als er hindurchschreiten wollte.
»Ich darf Sie hier nicht hineinlassen, der Zutritt zu dem Tunnelbauplatz ist für Fremde verboten.«
Jetzt wußte John Workmann, daß er sich auf dem Arbeitsplatz der Tunnelbau-Gesellschaft befand, welche New York mit dem gegenüberliegenden Hoboken durch einen Tunnel unter dem Hudson verbinden wollte.
»Ganz recht, Sir«, sagte John Workmann, »ich weiß das sehr wohl, und ich möchte mir gerade die Erlaubnis dazu holen. – An wen wende ich mich?«
»An Bauleiter Wagner.«
»Wo finde ich ihn?«
»Den werden Sie allein nicht finden können. Ich werde Ihnen einen Jungen mitgeben.«
Er pfiff durch die Zähne, und von den Aufladestellen kam ein italienischer Junge, der dort mit anderen Arbeitsdienste verrichtete. Dem gab der Türhüter den Auftrag, John Workmann zu der Arbeitsbude des Bauleiters Wagner zu führen.
Durch ein Gewirr von Eisenschienen, allerlei Stapel von Holz, Eisen und sonstigen Dingen, Maschinen und Röhren und an mehreren Dutzend Arbeitsbuden, Unterkunftsstätten für Arbeiter vorbei, durch tosenden Lärm und ein anscheinend regelloses Durcheinander von Hunderten von arbeitenden Menschen hindurch kam John Workmann zu dem kleinen Wellblechhause, in dem der Leiter des Tunnelbaues, Wagner mit den Ingenieuren sich aufhielt.
Während seines Ganges hatte sich John Workmann schleunigst einen Plan zurechtgelegt.
Das war unbedingt ein Artikel für den »New York Herald«, das Leben und Treiben auf diesem Tunnelplatz für die Öffentlichkeit zu beschreiben. Der Gedanke, endlich einen wertvollen Stoff gefunden zu haben, erfüllte John Workmann mit stolzer Freude.
Als er dem Bauleiter, der mit einigen Ingenieuren in Beratung stand, gegenübertrat, sagte er:
»Mein Name ist John Workmann, Mitarbeiter des ›New York Herald‹. Ich möchte Sie um die Erlaubnis bitten, den Arbeitsplatz zu betreten, weil ich darüber für den ›New York Herald‹ einen Artikel schreiben will.«
Da in Amerika alles, was mit den Zeitungen und der öffentlichen Meinung zusammenhängt, respektiert wird, so verbeugte sich der Bauleiter und sagte:
»Ich gebe Ihnen gern die Erlaubnis, Mister Workmann. Folgen Sie mir, bitte, in mein Büro. Ich werde Ihnen einen Passierschein ausstellen und Ihnen außerdem zur Begleitung in den Tunnel einen meiner Ingenieure mitgeben.«
In dem Büro rief er den Ingenieur Henry Smith und gab ihm den Auftrag, John Workmann in den Tunnel zu begleiten.
John Workmann zog Notizbuch und Bleistift hervor. Während er mit seinem Führer zum Tunnel schritt, begann er, sich nach dessen Erklärungen bereits eifrigst Notizen zu machen. Er hatte schon von der Caissonkrankheit reden gehört, der alljährlich zahlreiche Arbeiter in New York zum Opfer fielen.
»Was bedeutet Caissonkrankheit?« fragte er seinen Führer. Der blieb einen Moment überlegend stehen.
»Dazu muß ich etwas weiter ausholen. Sie wissen wohl, daß wir mit unserem Tunnel vierzig Meter unter den Spiegel des Hudsonflusses gehen. Natürlich würden uns Wasser und Schlamm in unseren unterirdischen Bau hereinbrechen, wenn wir nicht dem Druck dieser Massen von innen her einen gleichstarken Gegendruck entgegensetzten. Nun wirken aber Wasser und Schlamm von zehn Meter Höhe bereits mit dem Drucke, mit welchem hier die Luft auf uns lastet. Wir nennen diesen Druck in der Technik eine Atmosphäre und sagen also, daß in zehn Meter Wassertiefe ein Überdruck von einer Atmosphäre herrscht. In vierzig Meter Tiefe wirkt natürlich der vierfache Druck. Wir müssen Luft mit einem Überdruck von vier Atmosphären in den Tunnel hineinpressen, um dem Druck der Wasser- und Schlammassen an dem Tunnelende, wo gearbeitet wird, das Gleichgewicht zu halten. Zu dem Zwecke ist der Tunnel hier oben am Einfahrtsschacht durch eine Luftschleuse abgeschlossen. Wer in den Tunnel will, muß erst eine Tür öffnen und befindet sich dann in der Schleusenkammer. Er muß die Tür hinter sich schließen. Nun wird der Luftdruck in der Schleusenkammer allmählich im Zeitraum von etwa zehn Minuten auf vier Atmosphären gesteigert. Erst danach kann der Mann in der Schleusenkammer die zweite Tür öffnen und gelangt nun in den Tunnelschacht und weiter in den Tunnel.«
»Gibt das nun die Caissonkrankheit, Mr. Smith ...?«
»Noch nicht unmittelbar. An diesen Überdruck gewöhnt sich der menschliche Körper. Die Leute arbeiten in diesem Druck sechs Stunden, ohne sich besonders unbehaglich zu fühlen. Die Schwierigkeit und die Gefahr beginnt eigentlich erst beim Verlassen des Tunnels. Sie wissen ja, daß unsere Atmungsluft aus Sauerstoff und Stickstoff besteht. Unter dem hohen Druck im Tunnel nimmt nun das Blut diese Gase in großen Mengen auf, ähnlich so, wie man Selterwasser unter Druck mit Kohlensäure sättigt. Dem Wasser in der verschlossenen Flasche sehen Sie diese Belastung gar nicht an. Sobald Sie aber den Pfropfen herausziehen und damit den Druck vermindern, sprudelt das Gas an allen Stellen der Flüssigkeit frei empor.
Genau so ist es mit dem Blut im lebendigen menschlichen Körper. Wenn beim Wiederausschleusen aus dem Tunnel der Luftdruck in der Schleusenkammer allmählich schwächer wird, so perlen im Blut überall feine Gasbläschen auf. Der Sauerstoff wird natürlich durch die Lebensvorgänge im Körper verbraucht. Diese Perlen bestehen daher aus reinem Stickstoff. Obwohl wir nun die Ausschleusung ganz allmählich vornehmen und volle ¾ Stunden vergehen lassen, um den Luftdruck von der Tunnelspannung bis auf die Spannung im Freien zu verringern, kommt es doch immer noch gelegentlich vor, daß sich größere Stickstoffblasen im Adernsystem bilden. Diese aber geben dann die schweren Erscheinungen der Tunnelkrankheit. Eine große Stickstoffblase in den Herzkammern kann den sofortigen Tod zur Folge haben.
Erst gestern hatten wir den Fall bei einem äußerst kräftigen deutschen Arbeiter. Als er den Arbeitsplatz vor der Luftkammer verließ, stürzte ihm das Blut aus Mund, Nase und Ohren, und trotz aller Kunst der Ärzte ist er heute gestorben.«
»Das ist ja furchtbar«, sagte John Workmann. »Bekommen denn diese Leute wenigstens einen höheren Lohn?«
»Yes, Sir. Sie bekommen das Dreifache des Lohnes, den sonst in New York der gut bezahlte Arbeiter erhält. Aber trotzdem – ich muß Ihnen offen gestehen – obwohl ich Ingenieur bin, möchte ich nicht länger als zwei Stunden in dem Tunnel arbeiten. Es ist eine Arbeit auf Leben und Tod.«
»Wozu steht diese große Dampfmaschine hier?« fragte John Workmann und zeigte auf die unter einem Bretterdach arbeitende Maschine.
»Sie dient verschiedenen Zwecken, Sir. Einesteils sorgt sie für den Luftdruck im Tunnel, dann bedient sie die Schleusenkammer, das Heraus- und Hereinbringen aller Lasten, befördert die Schuttmassen aus dem Tunnel und ist uns die wertvollste Gehilfin, die wir hier auf dem Arbeitsplatz besitzen.«
Sie gingen zu einem kleinen Haus, welches im Gegensatz zu den übrigen Gebäuden, die nur aus Wellblech oder Holz aufgeführt waren, aus festen Steinen bestand. Vor demselben stand ein Wächter, der den Ingenieur respektvoll grüßte.
»Hier ist die Schleusenkammer zum Tunnel, Mister Workmann«, sagte der Ingenieur, »und Sie müssen sich nun mit mir einschleusen lassen.«
Der Wächter öffnete ihnen die Tür, und sie traten in einen großen Vorraum, in welchem an Kleiderriegeln Jacken, Westen und sonstige Sachen der zur Zeit im Tunnel arbeitenden Leute hingen. Ein anderer Wächter öffnete ihnen eine andere Tür aus schwerem Eisen, und jetzt befanden sie sich in dem Schleusenraum.
Fest und dicht wurde die Tür hinter ihnen geschlossen. Eine elektrische Glühbirne hing an der Wand, Bänke waren an den Wänden aufgestellt, und auf diesen nahmen John Workmann und der Ingenieur Platz.
Jetzt ertönte ein leises Surren und Brausen.
»Was ist das?« fragte John Workmann.
»Man beginnt uns einzuschleusen«, antwortete der Ingenieur, »der Luftdruck in diesem Räume wird jetzt von Minute zu Minute verstärkt.«
Bereits nach wenigen Minuten fühlte John Workmann eine eigentümliche Schwere im Kopf, ein Benommensein und einen leichten zuckenden Schmerz in den Schläfen. Auch die Augen begannen ihm zu flimmern, und er teilte das dem Ingenieur mit.
»Das ist bei mir auch der Fall«, antwortete der Ingenieur lachend, »das hat nichts zu sagen, wir werden uns in ein paar Minuten an den Luftdruck gewöhnt haben, und damit hören auch die Beschwerden auf.«
Bald hörte das Brausen und Surren des in die Kammer hineingepreßten Luftdruckes auf, die Schwere, welche John Workmann im Kopf verspürt hatte, ließ nach. Ein Klingelzeichen ertönte. Der Ingenieur erhob sich von der Bank und sagte:
»Wir können jetzt in den Tunnel gehen.«
Er ging zu einer zweiten Tür, öffnete sie, und John Workmann stand unmittelbar vor einem brunnenähnlichen, ausgemauerten Schacht, an dessen Seitenwänden eiserne Leitern in die Tiefe führten. Glühlampen waren in diesem tiefen Schacht angebracht und erleuchteten ihn.
Langsam kletterten sie beide hinunter und befanden sich nun am Ausgang des Schachtes in dem Tunnelvorbau, einem hallenartigen Raum, dessen Wände bereits mit Zement bedeckt waren und nichts mehr von der ursprünglichen Eisenwandung sehen ließen. Von der Decke herab hingen elektrische Lampen, Kabel von Armesdicke, Drähte von Telefonleitungen und Klingeln. Am Boden lagen Eisenschienen für die in dem Tunnel befindlichen Loren, und John Workmann mußte achtgeben, daß er nicht über die freiliegenden Holzbohlen zu Fall kam.
Dicht vor ihm tat sich wie ein riesiges Maul die große Tunnel-Öffnung auf.
Wie eine kolossale Röhre mutete John Workmann der Tunnel an.
Langsam ging er mit seinem Begleiter vorwärts. Nichts erinnerte daran, daß hoch über ihren Köpfen der breite, tiefe Hudson zum Ozean floß.
Jetzt interessierte sich John Workmann für die Art, wie der Tunnel gebaut wurde.
Das wollte ihm aber der Ingenieur erst am Endpunkt des Tunnels, wo sich der Druckschild befand, erklären.
Je weiter sie zu dem Tunnelende vordrangen, desto mehr verstärkte sich der Lärm. Das kreischte und dröhnte, hämmerte und pochte in rasendem Tempo. Nietmaschinen waren hier am Werk. Arbeiter mit Brechstangen und großen Hämmern montierten die schweren Eisensegmente, aus denen die einzelnen Ringe der Tunnelröhre zusammengesetzt wurden.
Unter den Gerüsten, auf welchen die Arbeiter standen, mußten sie sich hindurchwinden und kamen jetzt zu der vordersten, gefährlichsten Stelle des Tunnels, wo sich der Druckschild befand.
Der Druckschild steckte auf dem fertigen Tunnelrohr wie etwa ein Fingerhut auf der Fingerspitze. Sein zylindrischer Teil war nur etwa zwei Meter lang und umschloß das eiserne Tunnelrohr so, daß etwa eine gute Handbreit Zwischenraum zwischen dem äußeren Druckschildzylinder und dem inneren Tunnelzylinder blieb. Der Boden dieses Riesenfingerhutes aber bildete nun hier den senkrechten Abschluß des Tunnels nach vorn. Es war freilich ein Fingerhutboden von sechs Meter im Durchmesser und dementsprechend bestand er aus schwerster und widerstandsfähigster Stahlkonstruktion. Auf der Innenseite, also nach dem Tunnel zu, waren an diese Schildscheibe etagenförmig mehrere Plattformen angenietet. Davor hatte der Tunnelboden zahlreiche Türen. Waren diese geöffnet, so lag das Erdreich, triefend nasser Ton und Mergelgrund und bisweilen auch Sand, unmittelbar davor. Auf den Plattformen hinter diesen Türen aber standen zahlreiche Arbeiter und schaufelten den Sand und Schlamm in den Druckschild hinein in kleine Waggons. Sobald das etwa einen Meter weit, soweit eben der Spaten reichte, geschehen war, wurde der Druckschild durch hydraulische Pressen, die ihr Widerlager an dem fertigen Tunnelrohr hatten, mit riesenhafter Gewalt um etwa einen Meter nach vorn getrieben.
Zwölf Arbeiter an zwölf Türen der Schildwand schaufelten ununterbrochen den Boden hinein. Derweil wurde hinter ihnen im Schutze des Druckschildzylinders ein neuer, etwa einen Meter breiter Ring aus einzelnen Segmenten an die Tunnelröhre angefügt. So ging es Tag und Nacht beim Scheine der elektrischen Lampen unaufhörlich und unaufhaltsam voran.
Mit Interesse beobachtete John Workmann die Arbeiter, welche nur mit Hosen bekleidet waren und in der künstlichen Beleuchtung mit dem nackten Oberkörper wie gespenstische Erscheinungen der Unterwelt anmuteten. Er fragte den Ingenieur:
»Sie sagten, daß hier ein gefährlicher Platz wäre.«
»Yes, Sir«, nickte der Ingenieur. »Sie haben wohl beobachtet, daß dort, wo der Druckschild beginnt, eine stählerne Wand den Arbeitsplatz vom Tunnelrohr abschließt. Wir sind durch eine kleine Tür, durch welche der Schutt hinausgeschaufelt wird, eingetreten. Diese Tür, welche Sie dort in Zolldicke aus bestem Stahl gearbeitet sehen können, öffnet sich nur zum Druckschild.«
»Hat das einen besonderen Zweck, Mister Smith?«
»Sogar einen ganz besonderen, denn sie schützt den Tunnel gegen einen eventuellen Wassereinbruch.«
»Einen Wassereinbruch?«
»Yes, Sir, gegen einen Einbruch von Wasser, von Schlamm, Morast und sonstigen schönen Dingen.«
Jetzt verstand John Workmann, warum dieser Platz von dem Ingenieur als gefährlich bezeichnet wurde. Er hatte einen Augenblick vergessen, daß da, wo diese Arbeiter mit ihren Schaufeln den Flußsand hereinholten, nur eine Decke von geringer Dicke sie vom Wasser des Hudson trennte.
»Man nennt die Arbeiter, welche hier in dem Druckschild ihre Tätigkeit ausüben, die verlorene Mannschaft, Mister Workmann«, sagte der Ingenieur, »und es ist bereits zweimal vorgekommen, daß wir eine volle Mannschaft bei dem Tunnelbau hier auf diesem Arbeitsplatz verloren haben.«
»Ist denn eine Rettung ausgeschlossen, Mister Smith?«
»Falls die Arbeiter nicht sehr vom Glück begünstigt sind, ja, Mister Workmann.« Deutlich sah John Workmann, wie das Gesicht des jungen Ingenieurs ernst geworden war. Dann zeigte er mit der Hand zu der Tür, auf welche er John Workmann vorher aufmerksam gemacht hatte, und fuhr fort:
»Sobald hier ein Wassereinbruch erfolgt oder Schlamm und Morast durch die Tür des Druckschildes eindringen, werden die Arbeiter von der Gewalt des hereinbrechenden Elementes aus den kleinen Kammern, in denen sie hinter dem Druckschild arbeiten, wie mit einer Riesenfaust herausgestoßen. Nur wenn sie viel Glück haben, gelingt es ihnen, aus dem Wasser und Morast noch so schnell herauszukommen, daß sie sich durch die Tür in den Tunnel retten können. Da handelt es sich um Sekunden, Mister Workmann. Ja, in dem einen Falle blieben nicht einmal die Sekunden zur Rettung übrig. Denn sobald das Element durch den Druckschild eingedrungen ist, schließt es die Tür in der stählernen Wand zum Tunnel automatisch, und niemand vermag den Unglücklichen hier in diesem Raum Rettung zu bringen. Sie sind in kurzer Zeit von dem feindlichen Element überwältigt, erstickt oder ertrunken. Wir bergen sie nur noch als Leichen.«
Ein Frösteln überlief John Workmann, und voll Bewunderung blickte er auf die muskulösen Gestalten der tapferen Arbeiter, welche dort unentwegt, anscheinend keine Gefahr befürchtend, mit ihren Spaten in das ungewisse Erdreich stießen, Schaufel auf Schaufel herausholten und in die Wagen, die dicht hinter dem Druckschild standen, hineinwarfen.
Ja, John Workmann hätte es nicht ableugnen können, daß er froh war, als er den unheimlichen Arbeitsplatz hinter sich hatte und sich wieder in dem sicheren Tunnelrohr befand.
Ernst und schweigsam legte er mit dem Ingenieur den Weg zum Ausgang des Tunnels zurück. Wieder kletterten sie den Einsteigeschacht empor und mußten jetzt in der Luftschleuse sich ganz langsam von dem auf ihnen lastenden Überdruck befreien lassen.
»Atmen Sie tief und kräftig! Auch wenn wir die Kammer verlassen«, mahnte der junge Ingenieur. »Halten Sie die Brust weit gespannt, damit Sie nicht irgendwelche nachteiligen Folgen verspüren.«
John Workmann tat das. Aber trotzdem empfand er einen heftigen Schmerz in den Lungen, und das Herz klopfte in schnellem Tempo, als er wieder unter freiem Himmel stand.
Ein Glas Eiswasser wurde ihm gereicht, das zu dem Zwecke für die Arbeiter stets bereitgehalten wurde, und das half ihm besser, als es irgendein Whisky getan hätte.
Mit herzlichem Dank verabschiedete er sich von dem jungen Ingenieur und ging dann ernst nachdenkend nach Hause.
Zwei Stunden hindurch arbeitete John Workmann mit heißem Kopf und schilderte den Arbeitsplatz, der jeden Augenblick das Tor zur Ewigkeit bedeuten konnte. Als er den Artikel beendet, setzte er als Titel darüber: »Die verlorene Mannschaft«, und ging dann mit klopfendem Herzen zu Mr. Berns, um dessen Urteil zu hören.
»Hallo, Mister Workmann«, rief der Redakteur, als er in dessen Redaktionszimmer trat. »Freut mich, Sie zu sehen. Was bringen Sie Gutes?«
»Meinen ersten Artikel, Mister Berns.«
»Alle Wetter – da bin ich neugierig! Geben Sie her – ich werde ihn sofort lesen.«
Dann verging eine Viertelstunde, während welcher tiefes Schweigen in dem Zimmer herrschte, das nur durch das Rascheln der umgeschlagenen Papierseiten in Mr. Berns' Hand unterbrochen wurde. Und dann legte Mr. Berns das Manuskript auf den Schreibtisch, blickte sinnend zu John Workmann und sagte:
»Ich gratuliere Ihnen. Das ist eine der besten Arbeiten, die ich seit langer Zeit gelesen habe.«
Am nächsten Sonntag brachte der »New York Herald« in der illustrierten Beilage als Hauptartikel:
»Die verlorene Mannschaft« von John Workmann.
Zeichner und Fotografen waren von der Redaktion zu dem Tunnelplatz geschickt und hatten den Artikel von John Workmann illustrieren müssen.
Als John Workmann das Exemplar der Sonntagszeitung in Händen hielt, als er den auf zwei Seiten stehenden großen Artikel gedruckt vor Augen sah, zitterten seine Hände. Ja, es erfüllte ihn mit ehrlicher Freude, daß er fähig war, den Artikel nochmals zu lesen, so, als wenn ihn ein ganz fremder Mensch geschrieben hätte.
2. Kapitel
John Workmann hatte sich ein festes Ziel gesetzt. Diese letzte Januarwoche wollte er noch in New York bleiben und sich seiner Mutter widmen, die nun doch recht schwach und hinfällig geworden war. Mit dem neuen Monat wollte er dann wieder loswandern, wollte einmal, wie es ihm erfahrene Leute geraten hatten, nach dem Nordwesten, an die Seen gehen.
Heute war einer jener milden Wintertage, an denen man es deutlich spürt, daß New York unter demselben Breitengrade liegt wie Neapel. Das Thermometer zeigte beinahe 15 Grad Wärme, und in tiefer Bläue wölbte sich der Himmel über der Riesenstadt.
John Workmann war auf der Redaktion des »Herald« gewesen und hatte Mr. Berns besucht. Hatte ihm erzählt, daß es doch gar nicht so leicht sei, immer neuen Stoff für neue Schilderungen zu finden. Da hatte Berns nur gelacht.
»Sie sind jetzt bereits in Verlegenheit um Stoff. Lieber Freund, stecken Sie sich Notizbuch und Bleistift ein und wandern Sie durch die Stadt. Durchstreifen Sie unser New York von Bronx und Harlem bis zur Battery, beobachten Sie unser kräftig pulsierendes amerikanisches Leben zu Wasser und zu Lande, und ich wette, Sie werden Stoff in Hülle und Fülle finden.«
Diesen Rat hatte John Workmann befolgt und seit dem Morgen dieses Tages streifte er durch die Stadt.
Den Broadway hinunter kam er zur Battery – dem Platz, wo früher die Einwanderer vom Schiff aus zuerst amerikanischen Boden betraten, dem alten Landungsplatz der Holländer und später der Engländer.
Es ist die Spitze der Landzunge, auf welcher New York gebaut und die auf beiden Seiten von Wasser umgeben ist, rechts von dem majestätischen Hudson, links von dem Meeresarm, dem East River.
Vor dem kleinen Holzhaus mit zwei Etagen, das in der Mitte einen kleinen Turm trug und auf dem Pier »A« lag, blieb John stehen und las an der Eingangstür des Hauses die Goldbuchstaben: F. D. N. Y.
Die Tür war offen, und ein scharfer Geruch von Pfeifentabaksrauch zog zu John Workmann. Einen neugierigen Blick warf er in die Halle, welche hinter der Tür lag. Sie interessierte ihn, weil sie aussah wie der Raum einer Seemannsmission. Eine Gruppe von blau uniformierten Männern saß nach amerikanischer Sitte in hölzernen Schaukelstühlen um den Feuerplatz des Kamins. Einer las eine Zeitung, einige andere hatten den Kopf auf die Brust gelehnt und schliefen, und zwei andere spielten mit aufgestemmten Armen, einen kleinen Tisch zwischen sich, Karten. Ihre Arme ließen auf dem behaarten Fleisch Tätowierungen von allerlei Seemannszeichen, wie Anker und Schiff, erkennen.
Neugierig trat John Workmann näher.
Was waren das für Leute?
Sie blickten kaum auf, als er eintrat, wunderten sich auch nicht, daß er sich in dem Raum umsah, als ob er hier zu Hause wäre. Erst als er den Mann, welcher die Zeitung las, anstieß, fragte der: »Was wünschen Sie, Sir?«
»Entschuldigen Sie, ich bin ein Mitarbeiter des ›New York Herald‹ und komme hier soeben vorbei. Ich blieb stehen und trat bei Ihnen ein.«
Der Mann legte die Zeitung beiseite und blickte ihn mit blauen Seemannsaugen an; Seemannsaugen, klar und scharf wie das salzige Wasser des Ozeans. Ein verwittertes Gesicht, in dem all die Stürme, welche es durchgemacht, sich mit unverwischbaren Zeichen eingegraben, während ein weißer, ausgefranster Seemannsbart, an Kinn und Lippen ausrasiert, das frische Gesicht umrahmte.
Bevor der Mann antwortete, griff er in die Tasche, zog ein Stück Kautabak hervor und reichte es John, ohne ein Wort zu sagen. Als dieser dankend ablehnte, lachte er kurz auf, biß ein Stück mit den kräftigen Zähnen ab und steckte das übrige wieder in die Westentasche.
»Also, mein junger Mann«, sagte der Alte, »Sie wollen wissen, was wir hier sind. Da will ich Ihnen das ganz kurz sagen. Wir sind Feuerwehrleute zur See.«
Das war John Workmann neu.
Er hatte noch nie etwas davon gehört, daß es auch auf dem Wasser, genau so wie in der Stadt, Männer gebe, deren Beruf es war, das Feuer zu bekämpfen.
»Darf ich mir das Haus ansehen?« fragte John Workmann.
»Habe nichts dagegen! Gehen Sie überall hindurch. Wenn es Ihnen Spaß macht, schreiben Sie darüber in Ihrer Zeitung.«
Nach den Worten nahm der alte Seebär wieder seine Zeitung auf, las weiter und kümmerte sich nicht mehr um John Workmann.
Der ging jetzt über eine Treppe nach oben. Dort kam er in einen großen Raum, in welchem in zwei Reihen eiserne Betten standen, mit sauberen überdecken und Kissen. Peinliche Sauberkeit herrschte hier. Der Fußboden, auf dem keine Matte lag, war so blank und so staubfrei, daß man sich fast drin spiegeln konnte.
Das war echte Seemannsart. Durch die Fenster konnte man den wundervollen, sich weit vor den Blicken ausdehnenden Hafen sehen.
Da lagen die Schiffe aller Nationen der Welt, von den größten Ozeanfahrern bis zu den kleinen norwegischen Holzbriggs, die in monatelanger Fahrt sich durch Stürme und Wogen, durch alle Gefahren des Ozeans nach New York gearbeitet hatten.
Ein alter Mann war in dem Raum, und als John durch die Bettreihen hindurchging, um die Tür zu einem zweiten Raum zu öffnen, sagte er:
»Gehen Sie leise hinein, Sir. Die Leute schlafen.«
Vorsichtig öffnete John die Tür und sah in einen zweiten Schlafraum, dessen Fenster dicht verhängt waren, so daß nur ein dämmerndes Licht herrschte. Zwanzig Männer lagen in den Betten und schliefen.
Das war die Nachtschicht der Feuerwehr des Hafens.
Leise ging John Workmann aus dem Raum zurück und sah jetzt vor sich eine schmale, eiserne Wendeltreppe, welche er emporstieg.
Die führte in den Turm. Dort oben saß wieder ein alter Seemann. Er hatte einen Telegrafen- und Telefonapparat vor sich und am Eingang der Tür stand ein großes chinesisches Gong.
Drei Schläge mit dem lederumwundenen Klöppel, welche gellend durch das Haus zitterten, und die Schläfer würden im nächsten Moment aus den Betten springen, die Kleider anziehen und hinunterstürzen.
Dann war ein Schiff in Gefahr, vom Feuer vernichtet zu werden, und es galt Kampf.
Dann gellte der Ruf des Kapitäns der Mannschaft, und im Laufschritt eilten sie zu einem am Pier stets unter Dampf liegenden Feuerwehrboot, jeder an seinen Posten, und jeder vollführte von nun an mit mechanischer Präzision das, was er zu tun hatte.
Hur–urr-rrihihihi gellte dann wohl der schauerliche Ruf der Sirene an Bord des Dampfers durch die Nacht, daß das Echo von den Häusern der schlafenden Stadt zurückprallte. Und mit voller Fahrt jagte dann das Boot mit der tapferen Mannschaft wohl hinüber nach Hoboken, wo grellroter Lichtschein aufzüngelte.
Dem Dampfer in Feuersgefahr rast das Feuerboot New Yorks zu Hilfe, bereit, in jeder Minute tausend Gallonen von Wasser in die Flammen des Dampfers zu schütten.
Das Oberdeck des Feuerbootes machte für Uneingeweihte den Eindruck, als sei es mit Geschützen gespickt. Aber es sind Geschütze, welche aus ihrem Rachen Wasser speien. 42 solcher offenen Mäuler sind auf dem Boot und vermögen einen Strom von 5000 Gallonen Wasser in der Minute herauszuschleudern.
John Workmann erfuhr von dem Mann im Turm, daß sie vor zehn Jahren im unteren Hafen von New York die stärksten Feuerboote hatten, daß aber jetzt seit der letzten Zeit die Fluß-Feuerboote, große, neue Turbinendampfer mit Zentrifugalpumpen und Maschinen von 850 Pferdestärken, die New Yorker Hafenfeuerwehr überflügelt hätten.
Aber sie arbeiteten Hand in Hand. Wenn die gesamte Flotte ihre Kräfte gegen einen Brandherd vereinigte, war sie imstande, 75 000 Gallonen Wasser in der Minute in das Flammenmeer des brennenden Schiffes zu senden.
Mit dem Mann im Turm freundete sich John Workmann an. Joe Hally war sein Name, und er erzählte John Workmann von verschiedenen großen Schiffsbränden, welche sie bekämpft hatten.
»Das Schlimmste, was ich durchgemacht habe«, begann er, »das war das Feuer an der Williamsburg-Brücke. Da mußten wir uns nicht nur gegen die entsetzliche Glut der brennenden Gerüste schützen, sondern auch gegen die herabfallenden rotglühenden Träger. Das war so schlimm wie das Granatfeuer einer Schlacht. Acht Mann von uns starben bei dem Kampf, und über die Hälfte wurden schwer verwundet. Yes, Sir – das war ein furchtbares Bild – die dunkle Nacht, ein schwerer Nordost – das Wasser ging hoch und warf unser Feuerboot hin und her, so daß wir Mühe hatten zu stehen, und vor uns eine brennende Hölle – das riesige Holzgerüst der Brücke, brennend wie Zunder, und ein Regen von niederfallenden heißen Eisen- und Stahlstücken. Wir aber mitten dazwischen, wir mußten das Feuer in unsere Gewalt bekommen, zu beiden Seiten der Brücke lagen große Docks, Petroleumtanks, Kohlenlager, und, Sir – wenn einmal solch Höllenfeuer die Docks ergreift bei solchem Nordoststurm, da könnte es leicht geschehen, daß weder unsere Kameraden von der Stadt noch wir von der See New York vor einer riesigen Feuersbrunst schützen könnten.
Da hieß es nicht nur gegen die Brücke Wasser zu schleudern, da mußten wir versuchen zu sprengen und niederzureißen, da balancierten wir mitten in dem brennenden Chaos, wurden von unseren Genossen mit Wasser überrieselt, damit wir nicht selbst zu brennen anfingen, und arbeiteten wie die Teufel, um die Stadt vor dem Verderben zu schützen. Great Scott – das ist ja die höllische Gefahr, welche von uns Seeleuten bekämpft werden mußte – die Gefahr, daß die ganze Stadt New York ein Schutthaufen wurde.
Sie wissen nicht, welche ungeheuren Werte in den Docks eng beieinander aufgestapelt liegen, welche Millionen an Wert wir zu schützen haben. Und das Schlimme für uns Feuerwehrleute von der See ist, daß alle diese Stoffe einen Feuerfraß bilden, wie man sich ihn besser gar nicht denken kann. Da sind große Lager von Kohlen, Öltanks, große Holzmengen, Felle, Häute, Tausende von Tonnen mit allerlei brennbaren Stoffen gefüllt! Yes, Sir! Mehl in großen Mengen, Getreide und derlei Dinge, so daß sich Feuerherde bilden, die wir nur aus bedeutender Entfernung bekämpfen können, weil ihre Glut zu stark ist.
Etwas anderes ist es, wenn wir es mit einem brennenden Schiff zu tun haben. Wenn irgend möglich, schleppen wir es mitten auf den Strom, damit die Gefahr vom Lande abgewandt ist. Dann haben wir schon ein gutes Stück Arbeit getan. Dann haben wir nur noch den Kampf gegen das Feuer im Schiff zu führen und nicht mehr die Docks gegen einen Feind zu verteidigen, der schlimmer ist, als die Menschen sein können.«
»Ich erinnere mich«, sagte John Workmann, »daß seinerzeit die Docks des Norddeutschen Lloyd brannten, große Ozeandampfer in Flammen gerieten und viele Menschen dabei umkamen.«
Das frische Gesicht des alten Mannes wurde bleich und ernst.
»Yes, Sir, – Sie tun mir keinen Gefallen, mich daran zu erinnern. Wenn an der Williamsburg-Brücke das gefährlichste Feuer war, das wir zu bekämpfen hatten, so war der Brand der Nordwestdeutschen Lloyd-Docks das Entsetzlichste, das ich erlebt habe. Wie wir endlich die großen Ozeansteamer in den Strom hinaustrieben, eine rote, farbige Hölle, mit: Flammen, so hoch wie die Wolkenkratzer, mit Rauchwolken, so dicht, als wäre die ganze Luft ein einziger Ruß und Qualm, und wir mit unseren Feuerbooten dicht zu seiten dieser brennenden Dampfer lagen, da kam erst das Gräßliche: Auf eisernen Leitern, die so heiß waren, daß uns die Haut an ihnen klebenblieb, standen wir und versuchten, die engen Löcher in den dicken Schiffswandungen, die dort Fenster heißen, mit unseren Äxten zu zerschlagen, um den Menschen, den armen, unseligen Menschen, welche dahinter standen und halb verrückt uns um Hilfe und Rettung anwimmerten, welche rasend, verzweifelt, gellend und irrsinnig schrien, Hilfe zu bringen. Und wir mußten von draußen zusehen, wie hinter ihnen die Teufelslohe, das fressende Feuer, gierig in die Kabinen eindrang. Und dann! – vorbei Sir! – Noch oft schrecke ich des Nachts aus wüsten Träumen empor. Dann höre ich die Rufe der Unglücklichen. Dann schlage ich wild mit den Fäusten in die Luft, als habe ich noch eine Axt und es würde mir gelingen, die dicke Schiffswand aus Stahl und Holz zu durchschlagen – Yes, Sir – es wäre besser gewesen, Sie hätten mich nicht danach gefragt. Das Schreckliche ist nicht zu erzählen. Und doch! – ein einziges Leben habe ich gerettet –.« Die Stimme des alten Seebären wurde leise und rauh, fast heiser. John Workmann sah, daß seine klaren Augen einen feuchten Glanz erhielten und ein paar Tränen langsam über die Wangen hinabliefen.
»Ich habe ein kleines Kind, einen Säugling gerettet, den gab mir die Mutter durch das Fenster, durch diese kleinen Fenster, die nur so groß sind, daß ein Kind von wenigen Monaten hindurch kann. Und bis zum letzten Moment hielt ich das Kind der Mutter an das Fenster. Sie herzte und küßte es, bis sie die Flammen töteten.«
Er gab sich einen Ruck, wischte sich hart mit der Faust die Tränen ab und sagte:
»Sehen Sie, auf diesem Posten hier stehe ich nun schon seit fünfzehn Jahren, und immer, wenn es um die Mittagsstunde ist, und ich sehe auf den Hafen nach Hoboken rüber, dann habe ich Furcht, daß sich dort drüben wieder eine Rauchwolke erhebt und ein Feuer ausbrechen könnte, ähnlich dem auf den Schiffen des Norddeutschen Lloyd. Gott behüte uns davor!«
Jetzt erst besah sich John Workmann genauer den Platz, wo der Wächter des Turmes saß.
Es war ein Raum, wie man ihn in der obersten Spitze von Leuchttürmen findet, nur daß die Lampen in der Mitte fehlten. Aber nach allen Seiten waren Glasscheiben, welche dem Beobachter einen weiten Blick über den Hafen gestatteten.
Ein kleines Tischchen mit einem Stuhl war das einzige Mobiliar. Auf dem Tischchen standen ein Telegrafenapparat und ein Tischtelefon.
Mit beiden Apparaten vermochte der Wächter sofort, im Bruchteil einer Sekunde, den nächsten Feuerwehrstationen mitzuteilen, um was es sich handelte.
»Wenn ich Sie fragen darf«, sagte John Workmann, »welchen Beruf hatten Sie oder Ihre Kameraden, bevor Sie bei der Hafenfeuerwehr eintraten?«
»Die Hälfte von uns sind ehemalige Seeleute, Kameraden, denen ihr Seehandwerk zu rauh geworden ist, die aber auch noch nicht an Land vor Anker liegen und nichts mehr tun wollen. Haben zum Teil keine Familie und sind glücklich, daß sie hier in unserem Hause alles haben, was zum Leben gehört. Aber manchmal ist auch Not bei uns. Erst vorige Woche schickte mich unser Chef zu einem Agenten nach dem Broadway, neue Leute zu werben. Der fragte mich, was für Leute wir in unserm Distrikt wünschten. ›Vor allen Dingen starke, kräftige Männer.‹
›Wieviel wir davon in unserem Distrikt anstellen wollten.‹
›Je mehr, desto besser! So an zwei Dutzend könnten wir schon gebrauchen.‹
›All right‹, meinte der Agent, ›die sollen Sie in drei Tagen bei mir haben.‹«
Der ehemalige alte Seebär unterbrach seine Worte, nahm ein Fernrohr und spähte eifrig über den Horizont.
Erst nach mehreren Sekunden steckte er das Fernrohr wieder zusammen, legte es auf den Tisch und sagte:
»Habe mich getäuscht. Es war nur die Rauchfahne eines einfahrenden Dampfers hinter Staten Island. Also ... wie ich nach drei Tagen zu dem Agenten komme, da sagt er: ›Well, mein lieber Freund, die Sache ist nicht so einfach.‹
›Warum denn nicht einfach?‹
Er schüttelte den Kopf.
›Ihr Geschäft ist zu gefährlich, Sir.‹
›Gefährlich? – wer erzählt Ihnen denn das?‹
›Jetzt wollen Sie wohl einen Spaß mit mir machen‹, sagte der Agent, ›das wissen Sie doch ebenso gut wie ich.‹ Ich schüttelte wieder den Kopf und versuchte vergeblich, dem Manne klarzumachen, daß es in ganz New York keinen Feuerwehrmann gäbe, der etwas davon gehört hätte.
›Aber die Leute wußten es doch, die ich für Sie engagieren wollte.‹
›Ach, die Leute erzählten es Ihnen! Well, da lassen Sie nur die Leute Schuster oder Schneider werden. Wir brauchen Kämpfer, keine Feiglinge – Männer, welche bis zum letzten Blutstropfen auf ihrem Posten kämpfend stehen, und so lange alles andere vergessen, auch das eigene Leben.
Die werden unsere Arbeit ausführen können. Da gehören nicht nur starke Arme und Füße dazu, sondern auch ein kräftiges Herz, stählerne Nerven und Lungen, die einen tüchtigen, stickigen, schwarzen Qualm vertragen. Leute müssen wir haben, die, wenn sie jetzt bewußtlos hinfallen, auch ohne ärztliche Hilfe wieder aufstehen und ihre Arbeit weitertun. Sehen Sie, so sind meine Kameraden beschaffen.‹« ...
John Workmann unterbrach die Erzählung und fragte:
»Ist es gestattet, ein Feuerwehrboot anzusehen und sich von jemand erklären zu lassen. Mich würde das sehr interessieren.«
Der alte Mann nickte.
»Das können Sie haben, junger Mann. Wenden Sie sich an unseren Chef Crooker, der wird Ihnen ein Feuerboot zeigen und auch erklären. Gehen Sie wieder in den unteren Raum, der Chef ist der Jüngste. Er zählt erst vierzig Jahre. Sie werden ihn leicht erkennen; meistens sitzt er vor dem Kamin.«
John Workmann verabschiedete sich von dem freundlichen alten Seebären, stieg wieder die eiserne Wendeltreppe hinab und ging zu dem vor dem Kamin sitzenden Chef der Hafenfeuerwehr.
»Entschuldigen Sie, Sir, sind Sie Mister Crooker, der Chef?«
Ein offenes Gesicht mit klaren Augen blickte ihn forschend an, dann legte er das Zeitungsblatt in den Schoß und sagte:
»Was wünschen Sie von mir?«
»Ich habe die Absicht, über Sie und die Tätigkeit Ihrer Leute einen Artikel für den ›New York Herald‹ zu schreiben. Würden Sie die Liebenswürdigkeit haben und mir gestatten, daß ich Ihr Feuerboot besuche?«
»Aber selbstverständlich«, sagte er, »dazu bin ich gern bereit. Wir haben gleich eine Übung an Bord und dann können Sie alles sehen.«
Der Alarmgong ertönte und im Hause wurde es lebendig.
John Workmann hätte es diesen alten Seeleuten niemals zugetraut, daß sie so flink wie die Katzen aus dem oberen Schlafsaal in die Halle stürzten und sich dort vor ihrem Chef, zwei Minuten nach Ertönen des Alarmgongs, in Reih und Glied aufstellten.
Ein kurzer Namensaufruf – ein kurzes »Yes« – eine Handbewegung des Chefs, und im Laufschritt eilten sie aus dem Hause zu dem dicht am Pier liegenden Feuerwehrboot.
John Workmann war als letzter mit an Deck gekommen – kaum war er auf den Planken, so arbeitete auch schon die Schraube, wurden die Verbindungsketten am Pier gelöst, und schon befand sich der Dampfer mitten im Strom, allerdings nur zu einer Übungsfahrt.
Er war einige hundert Meter vom Pier entfernt, als plötzlich ein ungeheurer Donner die Luft erschütterte, gleich darauf ein gewaltiger Luftdruck über den Dampfer brauste und ihn halb auf die Seite legte, und dann – eine zweite Detonation – deutlich hörte man von der Stadt das Klirren von Tausenden von Fensterscheiben und dann – ein Gebrüll, ein orkanartiges Schreien, wie es nur Tausende von entsetzten Menschen hervorbringen können.
Mit ernsten, starren Gesichtern standen die Feuerkämpfer auf ihren Plätzen und blickten zu ihrem Chef Crooker.
Da wurde aus dem Turm, in welchem John Workmann mit dem alten Wächter gesprochen hatte, eine rote Signalflagge dreimal geschwenkt.
Sofort tönte Chef Crookers Befehl zum Steuermann: »Hoboken«.
Während der Dampfer nach der Hobokener Seite eilte, wurden zwei blaue und eine weiße Winkflagge aus dem Turm geschwenkt. Sie meldeten, daß es Pier 1 der Central Railroad war. Dort war etwas geschehen.
Die blauen Flaggen bedeuteten Eisenbahn und die weiße Flagge Nummer 1.
Da auf der Hobokener Seite nur die Central Railroad fuhr, so konnte Chef Crooker daraus sofort folgern, daß auf deren Platz etwas geschehen war.
Eine schwarze Flagge stieg jetzt am Fahnenmast des Turmes empor.
Das war die gefürchtetste der Flaggen – die bedeutete Pulver oder Dynamit.
Und jetzt sahen sie auch, wie über den Wolkenkratzern eine riesige schwarze Wolke mit gelbgezackten Rändern blitzschnell emporstieg, sich dort oben ausbreitete, den Himmel verdunkelnd, immer weiter, immer breiter ausladend, so, als ob sie die ganze Stadt einhüllen wollte.
Während am Lande die gellenden Pfiffe und Sirenen und Glocken der wie rasend durch die Straßen eilenden Feuerwehren erschollen, während sie dort noch alle nicht wußten, um was es sich handelte, steuerte das Feuerwehrboot mit seinen tapferen Kämpfern bereits dem Schauplatz der Gefahr zu.
Alle Dampfer im Hafen ließen die schauerlichen Warnungsrufe ihrer Sirenen ertönen, und jetzt kamen unter der Kraft ihrer Maschinen fluchtartig mehrere Dutzend von Dampfern den Hudson hinunter, achteten gar nicht auf die Rufe, welche ihnen das Feuerboot durch ein Megafon zusandte, sondern versuchten, sich so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen.
Noch wußten weder Chef Crooker noch seine Leute, was ihnen bevorstand.
Die Wolken senkten sich auf den Hafen hernieder, ein süßlich schmeckender, nach Parfüm und Konfekt riechender Dampf, weißgelblich, umhüllte das Schiff, und sofort wußten die Feuerwehrleute, um was es sich handelte.
John Workmann, der dicht unter der Kommandobrücke gestanden, wagte jetzt einen der in seiner Nähe stehenden Feuerwehrleute zu fragen, um was es sich handele.
»Dynamit.«
Und wieder rief Chef Crooker einen Befehl zum Maschinenraum: »Volldampf.«
Es ging ihm nicht schnell genug, an den Platz der ungeheuren Gefahr zu kommen.
Er wußte, daß drüben seit heute früh große Mengen Dynamit, welche mit der Eisenbahn gekommen waren, in offene Transportschiffe verladen wurden. Dort lag genügend Dynamit, um die stolzen Wolkenkratzer des Broadway und die ganze untere Stadt bis zur Battery in einen Schutthaufen zu verwandeln.
Und während er den Dampfer mit voller Maschinenkraft dem Ziel zusteuerte, überlegte er nur, was er mit seinen Leuten tun könne, um die schreckliche Gefahr von der Riesenstadt abzuwenden.
Jetzt kamen sie zu dem Pier, wo das Unglück geschehen war. Ein Schuppen stand dort unversehrt, Eisenbahnfrachtwagen standen darunter auf den Schienen, die bis dicht zum Verladeplatz geführt waren. Unweit am Lande flohen bleiche Menschen von den Schiffen und aus den Häusern.
Immer noch erfüllte die Luft der ungeheure Lärm der Dampfpfeifen, der Sirenen und Glocken. Chef Crooker ließ die Maschine stoppen und fuhr mit dem Dampfer auf den Kampfplatz der Gefahr.
Da lag in nächster Nähe des Piers, noch fest durch Trossen mit dem Lande verbunden, ein brennender Dampfer.
Unweit von ihm aber trieben in dem durch mächtige Strudel aufgerührten Wasser zertrümmerte Holzteile und zerrissene Menschenleiber.
Jetzt lag das Feuerboot neben dem brennenden Dampfer. Aus allen seinen Strahlrohren ergoß sich die Flut auf das Feuer. Von neuem verfinsterte sich die Luft durch dicke Wolken weißen Wasserdampfes. Wohl zehn Minuten dauerte der Kampf der Elemente, dann war die Macht des Feuers gebrochen. Jetzt wurde es möglich, den abgelöschten Dampfer an eine Trosse zu nehmen und in den Strom hinabzuschleppen. Mitten im Hudson zerhieben sie kurzerhand die Trosse und ließen das halbverbrannte Schiff seiner Wege treiben. Mochten andere sich darum bemühen und es bergen. Schon eilte das Feuerboot mit vollem Dampf zur Unglücksstelle zurück und machte am Pier fest. Als erster von allen ging Chef Crooker an Land. John Workmann folgte ihm dicht auf dem Fuße, und nun waren sie an der Unfallstelle. Die Faust eines Riesen schien hier den ganzen Pierbau bis zum Grunde des Hudson in den Boden geschlagen zu haben. Nur noch aus den Trümmerstücken ließ sich ein Bild des Unglücks gewinnen. Ein flacher Güterwagen war bis an die Spitze des Piers gefahren worden. Aus ihm hatten die Verlader das Dynamit, welches in kleine Holzkisten von je 25 Pfund Gewicht verpackt war, über eine schräge Holzbahn in das Frachtboot getragen. Bis dahin konnte man sich die Situation aus den Trümmern und