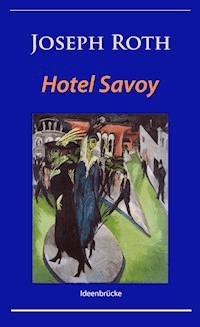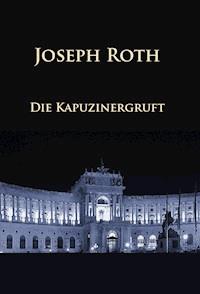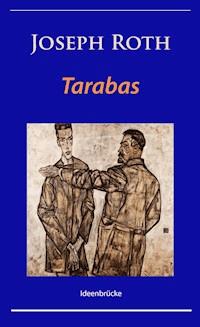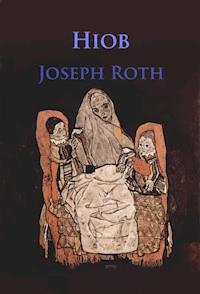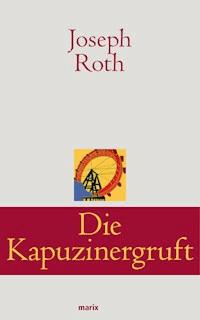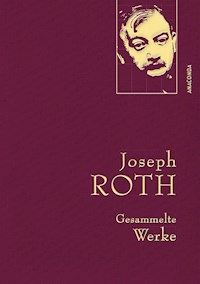Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gesammelte Werke bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Mit Aufsatz zu Leben und Werk »Ich kann mich nicht im Literarischen kasteien, ohne im Körperlichen auszuschweifen.« - (Joseph Roth in einem Brief an Stefan Zweig, 22. September 1930) Joseph Roth - Literat, Denker, Provokateur, Trinker. Zeichnete er sich im Leben durch eine mentale Grobknochigkeit gegenüber fast alles und jedem aus, hinterließ er uns als Vertreter der »Neuen Sachlichkeit« auf Papier eine lupenreine und geschliffene Literatur. Wegen seines maßlosen und rastlosen Lebens immer am Limit arbeitend, die Vorschüsse seiner Verleger längst schon aufgebraucht, erging er sich Hasstiraden gegen seine »Kollegen« und eilte von Weltanschauung zu Weltanschauung, nur um doch heimatlos - im Geographischen wie im Seelischen - zu bleiben. Letztlich hatte er nur die Literatur als Heimat. Wie auch sein Meiste-Zeit-Freund Stefan Zweig: wieder ein Gescheiterter, wieder ein Getriebener der Weltpolitiken. Hinterlassen hat er uns mächtige und bedeutsame Werke des frühen 20. Jahrhunderts: »Der Radetzkymarsch«, »Hiob«, »Die Flucht ohne Ende« - jedes einzelne Buch hätte schon zu einem erfüllten Dichterleben gereicht. Es gehören gesunde Nerven zu diesem Leben und eine große Portion revolutionärer Überzeugung. Denn man muß voraussetzen, daß die Revolution, von lauter Feinden umgeben, keine anderen Möglichkeiten hat, ihre Macht zu sichern, als die, jedes Individuum zu opfern, wenn es nötig ist. Stelle Dir also vor: Man liegt jahrelang auf einem Altar und wird nicht geschlachtet. [Ausschnitt aus »Die Flucht ohne Ende«] Die wichtigsten Werke (Essays, Romane, Reportagen, Erzählungen und Lyrik) sind vertreten, u.a.: - Die Geschichte von der 1002. Nacht - Hotel Savoy - Hiob - Roman eines einfachen Mannes - Radetzkymarsch - Das Spinnennetz - Die Flucht ohne Ende - Reportagen aus Russland, Wien und Berlin - Die Legende vom heiligen Trinker Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 4107
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joseph Roth
Joseph Roth
Gesammelte Werke
Joseph Roth
Joseph Roth
Gesammelte Werke
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]: Jürgen Schulze 2. Auflage, ISBN 978-3-954184-66-8
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Leben und Werk
Essays
Panoptikum am Sonntag
Gedicht von Wandkalendern
Man munkelt bei Schwannecke
Trübsal einer Straßenbahn im Ruhrgebiet
Der Rauch verbindet Städte
Der Polizeireporter Heinrich G
Fräulein Larissa, der Modereporter
Der Nachtredakteur Gustav K
Der Kongreß
Sentimentale Reportage
Ankunft im Hotel
Der Portier
Der alte Kellner
Der Koch in der Küche
Der Patron
»Madame Annette«
Abschied vom Hotel
Einzug in Albanien
Artikel über Albanien
Die russische Grenze
Briefe aus Deutschland
Brief aus Polen
Weihnachten in Cochinchina
Bemerkungen zum Tonfilm
Seine k. und k. apostolische Majestät
Bei der Betrachtung von Schlachtenbildern
Auf das Antlitz eines alten Dichters
Romane
Rechts und Links
Die Geschichte von der 1002. Nacht
Zipper und sein Vater
Der stumme Prophet
Hotel Savoy
Die Kapuzinergruft
Beichte eines Mörders, erzählt in einer Nacht
Die Rebellion
Hiob -- Roman eines einfachen Mannes
Radetzkymarsch
Das Spinnennetz
Das falsche Gewicht -- Die Geschichte eines Eichmeisters
Die Flucht ohne Ende -- Ein Bericht
Tarabas
Reportagen
Über Rußland
Aus Wien
Aus Berlin
Lyrik
Der Schalter
Ritter Meuchelmord
Deutsche Elendsreime
Kommentar zu Kant
Praktische Anwendung
Legende vom Kasernenhof
Gasgranate
Der Hakenkreuzler
Die Invaliden grüßen den General
Ungeziefer
Die Internationale
Das neue Lesebuch
Bürgerliche Kultur
Erzählungen
April
Ein Kapitel Revolution
Die Legende vom heiligen Trinker
Stationschef Fallmerayer
Der stumme Prophet
Der Leviathan
Index
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Gesammelte Werke bei Null Papier
Edgar Allan Poe - Gesammelte Werke
Franz Kafka - Gesammelte Werke
Stefan Zweig - Gesammelte Werke
E. T. A. Hoffmann - Gesammelte Werke
Georg Büchner - Gesammelte Werke
Joseph Roth - Gesammelte Werke
Mark Twain - Gesammelte Werke
Kurt Tucholsky - Gesammelte Werke
Rudyard Kipling - Gesammelte Werke
Rilke - Gesammelte Werke
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Leben und Werk
»Ein Ostjude auf der Suche nach einer Heimat -- das mag, wenn man die Vokabel Heimat nur weit genug versteht, jene Formel sein, mit der sich Joseph Roths Lebensweg noch am ehesten andeuten lässt.« -- (Marcel Reich-Ranicki in der Frankfurter allgemeinen Zeitung, 6. April 2010)
Der kleine Jossele gerät am 2. September 1894 in einen überschaubaren Teil der brodelnden Welt: Das nahe der russischen Grenze gelegene Schtetl Brody gehört zu Österreich-Ungarn, dessen Monarch im fernen Wien residiert. Mutter Maria entstammt einer Kaufmannsfamilie. Vater Nachum betätigt sich als Getreide- und Holzhändler. Die Roths genießen bürgerlichen Wohlstand, eingebettet in die Gemeinschaft chassidischer Juden.
Als wolle aber eine höhere Macht dafür sorgen, dass der Knabe auch ja sein Potenzial entfalte, brechen zwei bedeutende Autoritäten früh in seinem Leben weg: Nachum beschließt sein Leben bei einem Wunderrabbi, nachdem er einige Zeit in einer Nervenheilanstalt zugebracht hatte. Der inzwischen schulpflichtige Sohn erinnert sich nicht an seinen Vater.
Bewusst nimmt er dagegen den Verlust des Landesvaters wahr. Seinerzeit studiert Roth Philosophie und Germanistik in Lemberg und Wien, er gefällt sich in der Rolle des Links-Pazifisten. Allmählich gelangt er zu der Erkenntnis, dass der Untergang der Habsburger gleichbedeutend ist mit dem Verlust der Heimat.
Die tollwütige Kriegsbegeisterung ergreift den Studenten keineswegs. Seinen Widerwillen gegen den Eintritt in die Armee überwindet er erst 1916: Die patriotisch gewordenen Frauen interessierten sich vornehmlich für Verwundete, wie er gegenüber Gustav Kiepenheuer resümieren wird.
Wohlbehalten wieder in Wien eingetroffen, muss Roth sein Studium nach dem Krieg wegen Geldmangels aufgeben. »Der neue Tag« beschäftigt ihn ab 1919 als Redakteur. Dort trifft er auf Egon Erwin Kisch, der ihm nachweisen wird, dass seine angebliche russische Kriegsgefangenschaft geflunkert ist. Er selbst sieht das freilich anders: Schon in jungen Jahren neigt er dazu, sich quasi neu zu erfinden. Die Realität ist für ihn unerheblich. Was zählt, ist die innere Wahrheit.
Nach Einstellung der Zeitung arbeitet er in Deutschland für höchst unterschiedliche Blätter: Im sozialistischen »Vorwärts« zeichnet er als »Der rote Joseph«, nachdem er den bürgerlichen »Berliner Börsen-Courier« verlassen hat. Zwar bewegen ihn soziale und politische Erscheinungen, doch wenn ein konservatives Blatt gut zahlt, ist ihm der Magen näher als das weltanschauliche Gewissen. Noch 1929 wird er kollegialen Unmut erregen, als er von einem national-konservativen Verlag ein stattliches Honorar für wenige Zeilen kassiert.
Bereits in den frühen 1920er Jahren ist Roth ein gefragter Feuilletonist: Er schreibt hauptsächlich für die Frankfurter Zeitung (FZ) sowie für mehrere Wiener und zwei osteuropäische Tageszeitungen. Als die von ihm erwartete höhere Wertschätzung bei der FZ ausbleibt, besänftigt ihn nur das Angebot, als Korrespondent aus Paris zu berichten. Anschließend verfasst er bis in die frühen 1930er umfangreiche Reisereportagen.
Friederike Reichler, die er 1922 geheiratet hatte, erträgt diesen unsteten Lebenswandel nicht. Erste Symptome einer Geisteskrankheit zeigt sie 1926. Roth lässt nichts unversucht, um die unheilbar Erkrankte zu retten. Dass ihn das Unglück seiner Frau sowohl emotional als auch finanziell erheblich belastet, geht aus zahlreichen Briefen hervor. Er trinkt unmäßig und zerquält sich die Seele; erst 1935 löst er die Ehe. Friederikes Odyssee durch österreichische Kliniken wird 1940 in der Hartheimer Gaskammer enden.
»Ich kann mich nicht im Literarischen kasteien, ohne im Körperlichen auszuschweifen.« -- (Joseph Roth in einem Brief an Stefan Zweig, 22. September 1930)
Seit 1923 in Berlin sein erster Roman erschien, begreift sich Roth zunehmend als Romancier. Die Not, wie er sagt, treibt ihn zurück zu den Zeitungen. Dieselbe Not lässt ihn auch dann nicht los, als ihm 1930 mit »Hiob« endgültig der Durchbruch gelingt: Die Freunde mahnen, mit den Vorschüssen des Verlags auszukommen, in Vorgesprächen nicht sofort erhebliche Summen zu fordern und das Trinken zu mäßigen ... Stefan Zweig, selbst Autor von Weltrang, hilft mit Geld und einträglichen Freundesdiensten.
Roths Leben bestimmen seit Friederikes Krankheit Alkohol, manisches Schreiben und Existenzkampf. Die sechsjährige Beziehung mit Andrea Manga Bell stabilisiert ihn vorübergehend; erst im französischen Exil wird das familiäre Miteinander brechen. Dennoch klagt er in zahllosen Briefen über seine Armut, die weder nach dem »Hiob« noch nach dem zwei Jahre später erschienenen »Radetzkymarsch« endet. Beide Werke sind kommerzielle Erfolge, doch ihr Verfasser braucht die Vorschüsse schneller auf, als die Leser seine Bücher kaufen können. Die ständige Geldnot zwingt ihn dazu, von einem Projekt zum nächsten zu hetzen -- er ist rastlos bis zur völligen Erschöpfung.
Die ohnehin labile Situation spitzt sich mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten zu. Roth hatte früh vorhergesehen, dass in diesem Fall sowohl das geistige Europa als auch die Existenz humanistischer Schriftsteller in Deutschland verloren wären. Er sieht die Demokratie als gescheitert an, überhäuft in Briefen die Linke -- insbesondere die jüdische Linke -- mit verbalem Unflat und verachtet den »Völkischen Beobachter« ebenso leidenschaftlich wie Tucholskys »Weltbühne«. Meister des Worts, der Roth eigentlich ist, ergeht er sich hemmungslos in Fäkalsprache, wenn er gegen seine Kollegen wettert.
Während der vorangegangenen Jahre hatte er sich vom Sozialisten zum Konservativen gewandelt. Nun, da er die demokratische Nation als untauglich auffasst, betrachtet Roth die Monarchie als einzige funktionierende Staatsform. Die einst gewichtigen Äußerungen des bekannten Feuilletonisten büßen deswegen Ansehen ein, dennoch wird er bis zum Ende das Wort als Waffe nutzen. In der Emigration lässt seine Wut zwar nicht nach, doch sie keilt nicht mehr nach allen Seiten: Aus der Schweiz schreibt er 1933 an Stefan Zweig, dass gegen die deutsche Öffentlichkeit »selbst mein alter Feind Tucholsky mein Waffenkamerad« ist.
Nach der Trennung von Andrea Manga Bell lernt Roth 1936 Irmgard Keun kennen, mit der er bis 1938 Hass und Alkoholexzesse teilen wird. Weiterhin schreibt er geradezu manisch, publiziert Artikel in der Emigrationspresse sowie Romane und Novellen in eigens für die deutschen Exilanten gegründeten Verlagen. Seine Bücher gelangen nach England und in die USA, der »Hiob« wird verfilmt.
Doch Roth hält sein Leben für verpfuscht, es geht ihm zu oft über die Kraft und der Alkohol fordert hohen Tribut. Freunde charakterisieren ihn in den Jahren vor seinem Tod als ebenso traurig wie hasserfüllt. Seinem Selbstbild entspricht die Trauer durchaus, den Hass leugnet er: Zurückgekehrt zum jüdischen Glauben, möglicherweise auf der Suche nach dem Heimischen darin, deutet er Hass als Sünde. Unerbittlichkeit freilich ist erlaubt ...
Joseph Roth versteht sich »auf die österreichische Kunst, [...] noch aus dem Lebensüberdruss wahre Meisterwerke der Liebenswürdigkeit zu schaffen.« -- (Marcel Reich-Ranicki in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 6. April 2010)
Nachdem er 1939 berühmt und völlig verarmt in Paris gestorben ist, bleibt von Roth eine Fülle widersprüchlich beschriebenen Papiers: Seine erzählende Werke haben nichts von der mentalen Grobknochigkeit, die er in Korrespondenz und Presse gerne demonstriert. Dort widerspricht er sich selbst, will gerecht sein und häuft im nächsten Satz Tiraden über Kollegen, will in den 1920ern seinen Sozialismus nicht verleugnen und macht linke Autoren verächtlich, nicht ohne deren jüdische Abstammung ins Feld zu führen ...
Letztlich kann Roth den Kampf um seine Seele ausschließlich in der Literatur gewinnen. In seine fiktionale Prosa arbeitet er ebenso feinfühlig wie gewitzt ein, was ihn bedrückt und wovon er träumt. Das ins Überpersönliche gerückte Private erscheint darin gleichsam literarisch veredelt.
Als Roths wichtigstes Buch gilt heute der 1932 erschienene »Radetzkymarsch«, worin die bedeutsamsten Protagonisten den Namen ihres Schöpfers tragen. Natürlich ist es möglich, den Stoff ausschließlich historisch aufzufassen. Aber im Grunde ist er das nicht -- nicht gemäß der Wirklichkeit des Verfassers, der sich nirgends so genau kennt wie in seinen Romanen.
Essays
Panoptikum am Sonntag
Für Benno Reifenberg
Eines Tages -- es war ein Sonntag -- wich die Scheu, mit der ich oft an dem Musée Grevin vorbeigegangen war. Es regnete in Abständen. Die Wolken, die aus Schwefel zu sein schienen, strömten ein gelbes Licht aus. Am Nachmittag bekamen die sonntäglich gekleideten Menschen den Ausdruck abgekämpfter, feierlicher und vergeblich auferstandener Schatten. Es war, als ob der Sonntag, zu dem sie ausgezogen waren, ausgefallen sei. An seiner Stelle befand sich eine Art verregneter und trüber Lücke, die den verflossenen Samstag vom künftigen Montag trennte und in der die verlorenen Spaziergänger umherschwankten, geisterhaft und körperlich zugleich und alle wie aus Wachs. Mit ihnen verglichen waren die wächsernen Puppen im Musée Grevin aufrichtigere Imitationen. Das gelbe Licht der Lampen in den fensterlosen Räumen, die niemals den Tag gekannt hatten, vermischte sich so innig mit dem Dämmer, der aus den Winkeln kam, daß beide aus dem gleichen Stoff zu sein schienen und Hell und Dunkel Geschwister. Die Gestalten der Geschichte und die bescheinigte Authentizität ihrer Gesichter, Bratenröcke, Kostüme, Zylinder; die Schatten, die sie wie zum Beweis ihrer Lebendigkeit auf den Fußboden warfen; die wächserne Starrheit ihrer Stellungen; und schließlich die unheimliche Stummheit, die lebende Zeitgenossen und längst Verstorbene gleichmäßig ausströmten: das alles kam mir wie eine angenehmere Fortsetzung und Bestätigung jenes gelben Sonntags vor, den ich eben verlassen hatte. Manche Persönlichkeiten hielten den einen Fuß vorgestreckt, die Hose warf unter dem Knie ebenso lebenswahr unbeabsichtigte Falten wie über dem Hals das Kinn ein Doppelkinn, und hundert kleine Nachlässigkeiten des Schneiders und der Natur waren bemüht, selbst dem verstockten Zweifler die wahre Existenz der Figuren zu beweisen. Ja, der Zuschauer kam oft dazu, mit dem eigenen Wunsch die Absicht des Panoptikums zu unterstützen.
Auf den Gesichtern der lebendigen Besucher wieder lagerte ebenfalls eine Stummheit, die aus Ehrfurcht, Schrecken und Staunen bestand, wie ein matter Widerschein jener Figuren. Niemand wagte laut zu sprechen. Alle flüsterten oder murmelten, als befänden sie sich wirklich in der Nähe der bedeutenden oder furchtbaren Persönlichkeiten und als könnten sie durch einen stärkeren Laut die Puppen zu einem unwilligen Fluch veranlassen. Ein Geruch von lange ungelüfteten Kleidern schwebte um alle Denkmäler und machte sie noch realer. Gleichzeitig aber mit der Furcht, die sie einflößten, fühlte man eine Art Mitleid mit ihnen, den ewig eingeschlossenen, und empfand es fast als ein Unrecht, daß ihre Vorbilder, die noch lebten, in der schönen freien Luft und an den grünen Tischen der Weltgeschichte atmen und handeln durften. Es war, als stünde hier im Panoptikum der wahre Poincaré zum Beispiel und draußen führe irgendwo in einem Auto zu einem offiziellen Ereignis der nachgemachte. Denn alles Wesentliche und Kennzeichnende schien die wächserne Puppe dem lebendigen Vorbild abgelauscht und weggenommen zu haben, so daß dieses ohne seine stabilen Züge in der Welt herumlief. Und ebenso wie die Zeitgenossen der Erde, so schienen die toten Heroen dem Jenseits entwendet worden zu sein; und für die Dauer meines Aufenthalts im Panoptikum war es mir klar, daß sich in der Unterwelt nur die billigen Durchschnittsschatten aufhalten konnten, die für die Geschichte wie für das Musée Grevin überhaupt nicht von Bedeutung waren.
Im Sterbezimmer Napoleons auf St. Helena roch man das schwelende Licht, obwohl es von einer elektrischen Birne kam, und man erstarrte in Ehrfurcht vor dem doppelten Schweigen des Todes: dem metaphysischen und dem imitierten. Für die Ewigkeit festgehalten war die Ewigkeit selbst, und das Flügelrauschen des Todesengels hatte seine Flüchtigkeit verloren und war beständig geworden, eingefangen im Sterbezimmer. Die authentischen Gegenstände aus Napoleons Besitz, seine Taschenuhr zum Beispiel, die auf dem Nachttisch lag, strömten eine überzeugende Echtheit aus, wie Gewürze Düfte verbreiten. Jede kleinste Lücke zwischen den nachgemachten Tatsachen, in die etwa die Phantasie des Betrachters hätte schlüpfen können, war ausgefüllt mit einer nachgemachten Wahrscheinlichkeit zumindest. Also war die Wirklichkeit nicht nur imitiert, sondern sogar übertroffen. Es war eine Welt, in der jede körperliche Erscheinung der menschlichen Phantasie vorgriff, um sie überflüssig zu machen, und in der alles plastisch vorhanden zu sein schien, was man sich sonst mit geschlossenen Augen kaum in verschwimmenden Umrissen ausmalen darf. Die Schatten waren eben Körper geworden und warfen eigene Schatten.
Über allem lag eine makabre Stimmung. Aber sie entströmte nicht so sehr den dargestellten Katastrophen (wie etwa der Christenverfolgung in Rom und der unterirdischen Welt der Katakomben), sondern viel eher der unerbittlichen Körperlichkeit, in die alle Ausgeburten der Phantasie hineingesprungen waren, dieser wächsernen Härte, umgeben von historisch unanfechtbaren Requisiten und diesem legitimen Geschichtsunterricht, an dem nicht mehr gezweifelt werden konnte, einfach, weil er aus Wachs war und gar nicht vom Fleck zu rühren. Es war wie eine Begegnung mit okkulten Erscheinungen, obwohl alles Okkulte und der Vernunft schwer Zugängliche rationalistisch präpariert allen irdischen Sinnen aufgedrängt wurde. Man konnte Wunder mit körperlichen Augen sehen und war infolgedessen ein bißchen niedergedrückt und in Sorge, die liebe Erde zu verlieren, auf der man so gerne glaubend und zweifelnd herumwandert.
Nur in einer einzigen Abteilung -- Palais de Mirages, im Märchenpalast also -- war die Begegnung mit dem Wunderbaren nicht schrecklich, sondern heiter. In diesem Palast sind alle Wände und die Decke aus Spiegeln. In der Mitte stehen ein paar Säulen, deren Aufgabe es ist, nicht die Decke zu stützen, sondern sich selbst zu vervielfältigen. Es ist ein besonderes System drehbarer Spiegel, die ein unwahrscheinliches Getöse verursachen, sobald man sie in Bewegung bringt. Um das Getöse zu übertönen, veranstaltet ein Orgelmechanismus eine Opernmusik, die aus Porzellanhimmeln, Messingsphären und Stanniolplaneten zu kommen scheint. Eine Zeitlang ist es stockfinster. Eine Pause, die dazu dient, die erregten Sinne auf ein neues Märchen vorzubereiten, und allen Besuchern Gelegenheit gibt, die Körper ihrer vertrauten Begleiterinnen wie fremde Wunder im Finstern zu fühlen. Dann leuchtet es langsam auf, von hunderttausend Lampen und Ampeln, violett, gelb, grün, blau, rot, und man befindet sich im orientalischen Palast, der von durchsichtigen Säulen getragen wird. Vor einigen Minuten waren es noch dichtbelaubte Eichen und Ahornbäume, und man befand sich in einem deutsch-französischen Märchenwald mit Orgelgezwitscher. Bald dröhnt es wieder, und flugs stehen wir unter einem blauen Sternen- und Kometenzelt.
Erst in diesem Palast gelangten die Besucher aus der flüsternden Furcht in ihre natürliche Spektakelfreude. Denn sosehr auch hier das Unwahrscheinlichste wirklich geworden war, so blieb doch diese von vornherein zugestandene Märchenhaftigkeit ein Kinderspiel, verglichen mit den Wahrscheinlichkeiten und Wirklichkeiten der menschlichen Geschichte. Es war keineswegs merkwürdig, aus dem Wald in die Alhambra mit einem Schlag versetzt zu werden. Aber unmöglich schien die Kreuzigung Christi, der Tod Napoleons, die Ermordung Marats, das Zirkusspiel der Römer. Ja, selbst die zeitgenössischen Politiker, deren Leistungen erst in hundert Jahren die panoptikale Reife erlangt haben werden, wirkten schon so, wie sie dastanden, im Bratenrock und Zylinder, unmöglich und gespenstisch. Wie wenige von all den Besuchern wußten, daß sie vor sich selbst erschrocken waren und eigentlich noch in den Straßen hätten erschrecken müssen -- -- vor ihrem eigenen Spiegelbild in einem Schaufenster! Da gingen sie wieder herum, aus Wachs und aus Gips, mit allen Schrecknissen des Panoptikums in der eigenen Brust, und eines jeden Seele war eine Folterkammer. Es regnete immer noch, schief und strichweise, die gelben Wolken galoppierten über den Dächern, und tausend Regenschirme schwankten unheimlich über den Köpfen der Unheimlichen ...
Gedicht von Wandkalendern
In meiner Kindheit (und vielleicht nur in dem Land, in dem ich sie verlebt habe) gab es eine besondere Art von Wandkalendern, an die ich mich jedes Jahr in den Wintermonaten erinnere, wie man sich an Weihnachtsbäume und Großmütter erinnert, an Bilderbücher und Bonbons, an alle Personen und Dinge, die einen Glanz, eine Süße und eine Wärme hatten und die in ein gläsernes Grab gesunken scheinen, immer noch sichtbar, aber tot, Reliquien der heiligen Kindheit. Die Wandkalender bestanden, wie die heutigen auch, aus einem dicken Bündel neuer, glänzender, schwarzer und roter Tage, über die wie ein Bühnenvorhang ein buntes Blättchen gelegt war, darstellend einen Ast voll roter Kirschen oder ein Büschel Veilchen, jedenfalls immer ein blühendes Versprechen des neuen noch zugeklappten Jahres. Das Bündel der 365 Tage steckte an einem ziemlich großen und breiten Pappendeckel, der die Wand, das senkrechte Fundament war, auf dem sich das neue Jahr zu erheben gedachte. Dieses harte Papier war von einem noch härteren Glanz überzogen, von einer lackierten Schicht, einer spiegelnden, gewölbten Oberfläche, in der sich die Sonne konzentrierte, wenn der Wandkalender gegenüber dem Fenster hing, und in der, wie eine ferne Erzählung vom Wetter, die Färbungen des Himmels und der Luft zu lesen waren. Doch war diese Eigenschaft des Glanzes nur eine angenehme sekundäre. Während das Wichtigste die gepreßte, erhabene Illustration auf dem Pappendeckel war, die, obwohl sie das ganze Jahr naturgemäß nicht wechselte, dennoch nicht die gleiche zu bleiben schien und ihre Aktualität bis zum 1. Dezember bewahrte, zu welcher Zeit schon die Erwartung des neuen Kalenders das Bild auf dem alten gewohnt und gewöhnlich machte.
Was waren das für Illustrationen! Wie leuchteten die starken und einfachen Farben, Rot, Blau, Gold, Grün hochsommerlich mitten im Winter, von jener Kraft, hinter der die Kraft der Phantasie zurückbleibt und von der die Träume dennoch befruchtet werden! Eine Frau, schwarz von Haar, das ein tiefrotes Kopftuch zur Hälfte bedeckte, mit roten Wangen und knallblauen Augen, mit einem Hals und einer Büste wie weißer, noch vom Wasser glänzender und in Sonne segelnder Schwan, mit schweren Zöpfen, die sich an der Brust zusammenfanden wie von einem koketten Wind hingelegt -- -- solch eine Frau hielt mit beiden Armen ein papierenes Körbchen, das schräg im Pappendeckel steckte, wie mit der Laubsäge gearbeitet schien und nichts weniger als einen Korb voll Weintrauben darstellte, saftiger grüner und dunkelblauer, deren Farbe zwar an Karbonpapier erinnern mochte, aber an ein Karbonpapier, das man nur in der Kindheit kennt, das eine Art Wunder bedeutet, weil es ferne Striche und Buchstaben fernen Blättern vermittelt und das noch umständlicheren Schmutz erzeugt als ein Tintenstift. Welch eine Frau! Sie war offenbar vom Lande, eine Winzerin, ihre roten Lippen waren so weit geöffnet, daß man den siegreichen und gefährlichen Glanz ihrer Zähne sehen konnte. Obwohl sie aus Papier war und offensichtlich ohne Unterleib, schien sie dennoch im ganzen Zimmer einen merkwürdigen und erregenden Duft von Fleisch, Milch und Sommerregen zu verbreiten, sie war lebendig und mehr noch: eine Persönlichkeit, Vertreterin alles Weiblichen und Irdischen. Mit ihr verband ich den Begriff des »Heidnischen« und der Liebe zuerst, und lange Jahre später, als ich in nachbarlichen Dörfern die Bauernmädchen suchte, trug ich ein kindisches Verlangen nach jener Kalenderfrau, und jedem roten Kopftuch, das zwischen Grün aufbrannte, entsprach ein kleines rotes Feuer in meinem Herzen. Ja, heute noch lebt in dem von Skepsis verschont gebliebenen Teil meiner Seele die Sehnsucht nach dem schwarzen Mädchen -- und obwohl ich das kurze Haar der Frauen liebe, kann ich an die Zöpfe nicht ohne Wehmut denken.
Und jedes Jahr kam eine andere Frau. Es kamen Wandkalender mit sentimentalen, zarten, blonden Feen, mit halbwüchsigen Backfischen, die an Schokolade erinnerten, mit Feen, die Kränze im Haar trugen. Und jede Frau versank bis zur Brust im Körbchen, das, wie ich später einmal erfuhr, dazu dienen sollte, Briefe aufzubewahren, in dem ich aber gefundene Haarnadeln gerne verbarg. Aber so weit ich mich heute erinnere, wurden die Wandkalender immer sachlicher, nach den blassen Frauen kamen nur noch Firmeninschriften, es scheint, daß sich die Phantasie der Kalenderfabrikanten allmählich erschöpfte oder daß sie die Erfahrung gemacht hatten, das die Reklame wirksamer sei, wenn kein Bild von ihr ablenke.
Vielleicht aber gab es diese Kalender auch später noch, nur ich sah sie nicht, weil ich inzwischen so groß geworden war, daß ich die Nägel überragte, an denen die Kalender hingen. Denn wir wachsen über unsere alten Freuden hinaus, andern entgegen, die so hoch hängen, daß wir sie nie erreichen.
Man munkelt bei Schwannecke
Obgleich der Lärm, den die redenden Gäste verursachen, weit bedeutender ist als die Gegenstände, die sie behandeln, ergibt er doch jene Art der geselligen und undeutlichen Äußerung, die man Munkeln nennt. Die sehr bestimmte Lautheit nämlich, mit der einer dem andern eine Neuigkeit mitteilt, erzeugt schon selbst das akustische Halbdunkel, die tönende Dämmerung, in der jede Mitteilung ihre Konturen verliert, die Wahrheit den Schatten einer Lüge wirft und die Nachricht die Züge ihres eigenen Dementis trägt. Und wie im Licht einer zwar grellen, aber flackernden Flamme ein Gegenstand nicht deutlich agnosziert werden kann, ebenso fällt es dem angestrengten Lauscher schwer, eine Äußerung zu werten, die man ihm zugetragen hat; insbesondere wenn sie ein Geheimnis ist, wie in den meisten Fällen.
Das Lokal der Berliner Künstler und Literaten, in dem man um Mitternacht alle finden kann, die noch am Abend versichert hatten, sie gingen prinzipiell nicht mehr hin, ja, sie wären seit Jahr und Tag nicht dort gewesen, beherbergt eine Art arrivierter Boheme, deren Kreditfähigkeit bereits außer Zweifel ist. Keiner von diesen Gästen hätte es nötig, seine Schlafstätte später aufzusuchen, als es ihm sein bürgerlicher Instinkt befiehlt. Auch beschließt jeder jede Nacht, diesen Ort in der nächsten zu meiden. Aber die Angst, seine Freunde, die ihn erwarten, um mit ihm Gutes zu reden, könnten von ihm Schlechtes reden, wenn er nicht käme, veranlaßt ihn, sich tapfer dort zu zeigen, wo es vielleicht mutig wäre, abwesend zu sein. Er kommt, um die Eintracht nicht zu stören, die, aus Angst und Mißtrauen gebildet, in den Nischen nistet, und um sich und seinen Tisch vor jener üblen Nachrede zu bewahren, die schon am nachbarlichen gemunkelt wird. Hätte einer die Fähigkeit, an allen Tischen gleichzeitig zu sitzen, man würde an allen nur Gutes von ihm reden; und das Wunder, das er selbst vollbrächte, wäre noch gering im Vergleich zu jenem, das die anderen sich abzuringen hätten. Immerhin erreichen die meisten wenigstens die Grenze des Wunderbaren, indem sie sehr schnell einen Tisch nach dem andern kontrollieren. Aber immer noch bleiben sie hinter der Schnelligkeit zurück, mit der die Sitzenden das Thema zu wechseln verstehen -- -- und gelegentlich auch die Anschauung.
Es gibt freilich auch Sitzende, denen ihr Rang gerade noch erlaubt aufzustehen, nicht aber mehr, Besuche abzustatten. Auch sie sind nicht gefeit vor der Angst, irgend jemand könnte irgend etwas von ihnen erzählen. Aber sie tragen die Last, nicht wohlgelitten zu sein, wie einen Beweis für ihre Bedeutung -- und das Mißtrauen, das die noch nicht so weit Arrivierten in Zuvorkommenheit packen, verwandeln die Bedeutenden in Verachtung und in Geringschätzung. Alle, die man im Augenblick nicht brauchen kann, sind für den, der sie erst nach einem Jahr brauchen wird, heute nur Luft, die er zwar atmet, aber nicht sieht. Gemach, gemach! Sie werden sich bald aus ihrer durchsichtigen Anonymität zu jener pseudonymen Körperlichkeit entwickelt haben, ohne die man unmöglich einen Lehnstuhl vor einem Bürotisch einnehmen kann. Sie, deren Sehnsucht es heute noch ist, Schatten von Körpern zu sein, werden einmal sogar eigene Schatten werfen, Protektionsschatten auf Anonyme, Durchsichtige und Luftige. Sie werden selbst die Filmreferate zu verteilen haben, die heute nur einige Male im Jahr wie göttliche Gnaden auf sie fallen, sie werden selbst in Konferenzen begriffen sein, wegen deren sie heute noch fortgeschickt werden, und sie werden bei Premieren neben den Kritikern sitzen, selber Kritiker, aber von einer »neuen Richtung«, mit einer neuen Terminologie, dank der sie vor Urteilen bewahrt und zu Vorurteilen angeregt werden. Deshalb empfiehlt es sich für Vorsichtige, auch nicht die Geringsten unter den Anwesenden zu übersehen, ja selbst die Unsichtbaren mit einer gewissen Achtung ins Auge zu fassen und die Schatten so zu begrüßen, als wären sie beredt und könnten erwidern. In den langen Jahren, in denen ich den deutschen Literaturbetrieb beobachten darf, habe ich schon gesehen, wie Nullen sich an Ziffern hängten und zusammen Zahlen ergaben, mit denen man natürlich rechnen mußte. Ja einige, die in der Gesellschaft bei Schwannecke die unbedeutende Funktion von ornamentalen vertikalen Linien auszuüben schienen, verwandelten sich in Striche, durch ahnungslose Rechnungen gemacht. Und manche Analphabeten, die, während sie in den Vorzimmern der Redaktionen warteten, die Zeitungen buchstabierten, begannen auf einmal, Bücher zu besprechen.
Auch Feindschaften unter den Gästen von Schwannecke können überraschende Folgen zeitigen, und nur ein Ahnungsloser ist imstande, an eine Feindschaft zu glauben und aus ihr etwa Nutzen für sich selbst ziehen zu wollen. Selbst nach einer unmißverständlichen Erklärung der sogenannten Tintenfehde -- die zusammen mit der Tintenrache die gefährlichste Sitte der Schwannecke-Stämme bildet -- kann niemand voraussehen, wie schnell ein Feuilletonist imstande ist, eine uralte, seit Wochen und Tagen stammende Feindschaft gegen einen Autor in einer langen, lobenden Kritik zu begraben, ohne daß jemand zu sagen wüßte warum, wieso und wozu. Ganz besonders unterrichtete Zwischenträger wissen dann manchmal zu berichten, daß gemeinsame Interessen für einen neuen Typ eleganter Sportautomobile die Gegner einander nahegebracht hätten. Denn seit einiger Zeit hat die Verpflichtung zum »Tempo«, in dem sich Um-, Neu- und Wiederaufbauten auf dem Kurfürstendamm und auch sonst im Lande vollziehen, sogar die Diener am Geist sowie dessen Bediente erfaßt, und alle sind imstande, hinter eine Fahrt mit 80-Kilometer-Geschwindigkeit eine Weltanschauung zurückzustellen. Vor dem Erlebnis der meßbaren Geschwindigkeit, mit der sie eine Straße dahinrasen, bleibt auch die Sensation jener unmeßbaren zurück, mit der sie ein Bekenntnis vergessen. Und seitdem in unserer zeitgenössischen Literatur ein Monokel ein Auge ersetzen kann, ist selbst in den Blicken einzelner Gegner Zu- oder Abneigung nicht mehr zu erkennen. Gedruckte Angriffe und Beleidigungen in unseren literarischen Blättern lese ich deshalb schon lange so, als wären es bereits Widerrufe und Entschuldigungen.
Nicht ohne Grund ärgere ich mich über die Innenarchitektur Schwanneckes, den langen Raum, den Korridor, an dessen beiden Seiten viereckige Nischen angenäht sind, so daß die Gästegruppen voneinander getrennt sind, als gehörten sie nicht zusammen. Mich kränkt die Enge dieses Raumes und der Umstand, daß er nicht alle faßt, die hineingehören. Ich ergebe mich gerne der Vision, die mich manchmal aufsucht, wenn ich in einer der Nischen am frühen Morgen sitze, der hier ein Anhang an die Nacht ist. Ich sehe einen kolossalen, übersichtlichen Schwanneckebau mit einer Kuppel, er faßt die ganze Literatur, die Öffentlichkeit und ihre Kritik, die Filmproduktion und ihre Rezensenten, die Bühne und ihre Referenten und sogar die Arbeitszimmer der einzelnen, die dem Snobismus der Einsamkeit huldigen, die ihnen nicht zusteht -- auseinandergefallene und aufgelöste Arbeitszimmer, in denen nur die Schreibmaschinen die tönende Leere der Gedanken unterbrechen. Ich sehe ein unermeßliches, gewissermaßen übersinnliches Schwannecke, ein Pantheon der lebenden, wenn auch nicht lebendigen künstlerischen Öffentlichkeit, in der auch die Autogaragen der kühnen Schnelligkeitsdichter Raum fänden und eine Autorennbahn für die Besinger der Gegenwart und ein Flugplatz für die Feuilleton-Homere der Ozeanflieger.
Trübsal einer Straßenbahn im Ruhrgebiet
Es regnet dünn und dauerhaft. Um zwölf Uhr fünfzehn geht die Straßenbahn ab. Um ein Uhr fünfundvierzig wird sie in der nächsten Stadt sein. Die Haltestelle ist vor einer Schenke. Ich trinke ein Kirschwasser und sehe durch die Netzornamente der Vorhänge auf die Straße. In so einem Regen werden die Geräusche unhörbar, genau wie im Schnee. Ja, hätten diese Vorhänge keine Ornamente, hätte diese gute Schenke überhaupt keine Vorhänge -- wozu Vorhänge? --, dann könnte ich wohl die Straßenbahn kommen sehen. Ich zittere, sie könnte mir davonfahren, und gleichzeitig wünsche ich, sie täte es. Ich würde dann vielleicht mit der schnelleren, solideren, bequemeren Eisenbahn fahren. Nun aber stehe ich im Bann einer freigewählten Qual. Je mehr Zeit, Geduld, Kältegefühl, Kirschwasser und Abscheu ich in dieses Unternehmen investiere, desto schwerer fällt es mir, darauf zu verzichten. Die Zeit und der Regen rinnen.
Pünktlich, sie war gar nicht dazu verpflichtet, kommt die Straßenbahn. Ihr Trittbrett ist hoch und naß, auch der Fußboden im Innern des Wagens ist feucht, ein alter Mann raucht Pfeife, eine Frau sitzt, einen verhüllten Korb auf dem Schoß. Schulmädchen steigen ein, mit häßlichen, harten Schultornistern, auf die der Regen getrommelt hat; Ertüchtigungsinstrumente mit baumelndem Schwamm. Zwei Arbeiter lehnen auf dem Hinterperron neben dem Schaffner. Eine ländliche Magd ist da, sie trägt eine goldgefaßte Brille und ist barfuß. Sie mahnt mich an einen Pflug, der von einer Lokomotive gezogen wird. Niemand spricht. Alle machen sich auf die Qual einer langen Fahrt gefaßt. Eine solche Sammlung bedarf der vollkommenen Schweigsamkeit. Die harten Sitze aus glänzend poliertem Holz sind nicht nur kurz, sondern auch abschüssig. Hier sitzen heißt: fortwährend und fruchtlos hinaufrücken.
Wir fahren durch eine lange Straße, an schwarzen Häusern und Häuserlücken vorbei, an Brettern, an Zäunen, an einem Gelände, das keinen Sinn hat, nicht die Erwartung, jemals einen Garten, einen Acker oder ein Haus zu tragen. Es ist die Leiche eines Geländes. Die Stadt hört nicht auf. Wenn sie aber einmal aufhört, beginnt sofort die andere. Die Städte reichen einander die Straßen. Jedesmal halten wir vor braunen Wartehäuschen aus geteertem Holz, sie sehen aus wie die Urformen von Bahnhöfen in den wilden Teilen Amerikas. Jetzt kommen Schrebergärten, kleine Häuschen aus Dachpappe, die Sommerschlösser des kleinen Mannes und des Kaninchens. Auf spitzen Zaunlatten sind Krüge, Töpfe, Schüsseln aufgespießt wie abgeschnittene Häupter. Eine Fabrik, rote Ziegel, Backsteine, ein eisernes Gitter, ein kleines Portierhäuschen aus weißem Stein, mit sichtbarer Kontrolluhr, dahinter große Schlote, vier, fünf, sechs, bereit, sich noch zu vermehren, ihnen soll’s nicht darauf ankommen.
Das Land will immer wieder anfangen, Land zu sein -- und kann’s nicht. Da sind keine Häuser. Jetzt könnte es eine Landstraße werden. Sogar Bäume stehen zu beiden Seiten und sind bereit, sie zu bestätigen. Aber unsere Straßenbahn bedarf der Drähte, und die Drähte bedürfen der langen, hölzernen Pfosten, der kahlen, an deren höchstem Ende ein paar weiße Porzellangefäße zu elektrischen Zwecken blühen. Karikaturen von Schneeglöckchen.
Hinten, weit, am Horizont, sind Bestrebungen der Natur im Gange, einen Wald hervorzubringen. Aber es ist kein Wald. Es entsteht eine Art beginnender Vegetationsglatze, mit vereinsamten Tannensträhnen.
Jetzt fangen die Gasthäuser an, eines folgt dem andern, und jedes kündigt ein »ausgezeichnetes Gartenlokal« an. Was mag das sein, ein Gartenlokal? Ich stelle mir ein Lokal mit gemalten Orangenbäumen vor und Lorbeeren in Blumentöpfen; oder ein Stückchen Kohlrübenfeld mit einer Veranda; vier Zäune mit wildem Weinlaub. Der Phantasie sind keine Schranken gesetzt.
Jetzt folgt ein Aufenthalt ohne logischen Grund. Der Führer steigt vom Trittbrett, der Schaffner folgt ihm, in der Mitte begegnen sie einander. Man hört den Regen rinnen. Man sieht kein Wartehäuschen. Schornsteine, große, schlanke, dampfen in unerlöster Qual. Der Regen zerfranst den dicken Rauch, zerstäubt ihn, gleichmäßig, ohne Wut. Der Regen spannt Vorhänge über die Landschaft, ohne Ornamente. Es ist keine Landschaft, es ist eine Art langgedehnter Stadtschaft, Industrieschaft, von blühenden Gartenlokalen unterbrochen.
Da kündigt sich, durch den Regenvorhang noch sichtbar, ein Beerdigungsinstitut an und auf der anderen Seite Persil, das Sinnbild des Lebens. Niemand spricht. Sooft die Tür aufgeht, schlägt sie einer mit Überzeugung zu. Es ist kalt. Wenn wir halten, ist es noch kälter. Alle möchten ihre Füße auf die Sitze hinaufziehen, aber es wäre sicherlich verboten. Gestattet ist die Lektüre der Aufschriften: »20 Sitzplätze«, »Nicht in den Wagen spucken«. Ich täte es gern.
Wir fahren jetzt wieder. Da beginnt auch schon die nächste große Stadt. Wir sind am Ziel. Es sieht aus wie der Anfang. Es ist, als gäbe es keine räumlichen Ziele hier: nur zeitliche, wie den sicheren, unausbleiblichen, endgültigen Tod des letzten Stückchens Erde.
Der Rauch verbindet Städte
Hier ist der Rauch ein Himmel. Alle Städte verbindet er. Er wölbt sich in einer grauen Kuppel über dem Land, das ihn selbst geboren hat und fortwährend neu gebärt. Wind, der ihn zerstreuen könnte, wird vom Rauch erstickt und begraben. Sonne, die ihn durchbohren möchte, wehrt er ab und hüllt sie in dichte Schwaden. Als wäre er nicht erdgezeugt und sein Wesen nicht vergänglich, erhebt er sich, erobert himmlische Regionen, wird konstant, bildet aus Nichts eine Substanz, ballt sich aus Schatten zum Körper und vergrößert unaufhörlich sein spezifisches Gewicht. Aus ungeheuren Schornsteinen zieht er neue Nahrung heran. Sie dampft zu ihm empor. Er ist Opfer, Gott und Priester. Milliarden kleiner Stäubchen atmet er wieder aus, er, ein Atem. Indem man ihn erzeugt, betet man ihn an. Man erzeugt ihn mit einem Fleiß, der mehr ist als Andacht. Man ist von ihm erfüllt.
Erfüllt ist von ihm die ganze große Stadt, die alle Städte des Ruhrgebiets zusammen bilden. Eine unheimliche Stadt aus kleinen und größeren Gruppen, durch Schienen, Drähte, Interessen verbunden und vom Rauch umwölbt, abgeschlossen von dem übrigen Land. Wäre es eine einzige, große, grausame Stadt, sie wäre immer noch phantastisch, aber nicht drohend gespenstisch. Eine große Stadt hat Zentren, Straßenzüge, verbunden durch den Sinn einer Anlage, sie hat Geschichte, und ihre nachkontrollierbare Entwicklung ist beruhigend. Sie hat eine Peripherie, eine ganz entschiedene Grenze, sie hört irgendwo auf und läuft in Land über. Hier aber ist ein Dutzend Anfänge, hier ist ein Dutzendmal Ende. Land will beginnen, armseliges, rauchgeschwängertes Land, aber schon läuft ein Draht herbei und dementiert es. Große Fabrikwürfel aus Ziegelstein rücken unversehens heran, stehen da, fester gegründet als Berge, Hügel, naturnotwendiger als Wälder. Jede kleine Stadt hat ihren Mittelpunkt, ihre Peripherie, ihre Entwicklung. Da sie aber alle vom Rauch zu einer einzigen Stadt vereinigt werden sollen, verliert ihre natürliche Anlage und ihre Geschichte an Glaubwürdigkeit, jedenfalls an Zweckmäßigkeit. Wozu? Wozu? Wozu hier Essen, da Duisburg, Hamborn, Oberhausen, Mülheim, Bottrop, Elberfeld, Barmen? Wozu so viele Namen, so viele Bürgermeister, so viele Magistratsbeamte für eine einzige Stadt? Zum Überfluß läuft noch in der Mitte eine Landesgrenze. Die Bewohner bilden sich ein, rechts Westfalen, links Rheinländer zu sein. Was aber sind sie? Bewohner des Rauchlands, der großen Rauchstadt, Gläubige des Rauchs, Arbeiter des Rauchs, Kinder des Rauchs.
Es ist, als wären die Bewohner der Städte weit zurück hinter der Vernunft und dem Streben der Städte selbst. Die Dinge haben einen besseren Zukunftsinstinkt als die Menschen. Die Menschen fühlen historisch, das heißt rückwärts. Mauern, Straßen, Drähte, Schornsteine fühlen vorwärts. Die Menschen hemmen die Entwicklung. Sie hängen sentimentale Gewichte an die beflügelten Füße der Zeit. Jeder will seinen eigenen Kirchturm. Indessen wachsen die Schornsteine den Kirchtürmen über die Spitze. Verschiedenartige Glockenklänge verschlingt der Rauch. Er hüllt sie in seine düstere Wattesubstanz, daß sie nicht vernehmbar, geschweige denn zu unterscheiden sind. Jede Stadt hat ihr Theater, ihre Andenken, ihr Museum, ihre Geschichte. Aber nichts von diesen Dingen hat erhaltende Resonanz. Denn die Dinge, die historischen (sogenannten »kulturellen«), leben vom Echo, das sie nährt. Hier aber ist kein Raum für Echo und Resonanz. Glockenklänge leben vom Widerhall, und alle kämpfen gegeneinander, bis der Rauch kommt und sie erstickt.
Da haben einige kleine Städte ihre alten, winkligen, wenn man will: romantischen Teile. Man nennt so was lauschig. Rings um sie schmettert die Zeit. Dröhnende Drähte umspannen sie. Alle zitternden Luftwellen sind erfüllt von radio-gesprochenen Worten der Gegenwart. Was wollen diese schlummernden Portale, diese verträumten Schönheiten? Sie waren daheim, als der blaue Himmel noch über ihnen sich wölbte. Nun aber wölbt sich grauer Rauch über ihnen. Nun sind sie verschüttet von Millionen Kohlenstäubchen. Niemals, niemals wird ihre Wiederauferstehung erfolgen. Niemals mehr wird ein reiner, nackter Sonnenstreifen sie vergolden. Niemals wird ein sauberer Regen sie waschen. Niemals wird eine echte Wolke sie beschatten. Verloren sind sie in all ihrer Festigkeit. Sie waren für Jahrhunderte gebaut aus ewigem Stein, und nur weil ihre materielle Substanz so dauerhaft ist, sind sie noch da. Nicht, weil ihre Lebenskraft noch vorhanden ist. Sie sind wie alte Münzen aus solidem Silber, die keinen Währungswert mehr haben. Die lächerlichste Banknote aus dünnstem Papier ist gegenwärtiger.
Aus lächerlich dünnem Material sind die neuen Stadtteile. Da sind Wände, die man mit Daumen und Mittelfinger umspannen könnte. Da sind Baracken aus Holz und hohlem Ziegel. Da sind Schindeldächer, wie von Kindern aufgestülpt. Es steht, es fällt, es wird wiederaufgebaut. Soeben noch waren sie weiß, strahlend von neuer, kurzlebiger Tünche. Jetzt sind sie schwarz wie faule Zähne. Jede Straße wie ein offener Mund.
Menschen wohnen hier. Menschen, die alle ein Ziel haben. Auch die Arbeitslosen haben ein Ziel. Sie schreiten aus. Wozu schlendern? Was ist hier zu sehn? Kinder spielen in der Straßenmitte. Alle Fenster sind gleich. Alle Häusertüren sind gleich. Hier sind nur Nummern verschieden. Alle Menschen haben den verbissenen Willen, ein Ziel zu erreichen. Vielleicht ist es die Arbeitslosenunterstützung. Vielleicht ist es der Konsumverein. Vielleicht ist es das Versammlungslokal. Vielleicht ist es ein Einbruch. Vielleicht ist es die Revolution. Vielleicht ist es das Kino.
Ach, es ist so gleichgültig! Ein Ziel wie das andere. Eine Stadt wie die andere. Eine Straße wie die andere. Steig in die Straßenbahn. Du bist in einer halben Stunde in der nächsten Stadt. Hat sich was geändert? Rauch über der Welt! Man fährt nach Oberhausen, von da nach Mülheim, von da nach Recklinghausen, nach Bochum, nach Gladbeck, nach Buer, nach Hamborn, nach Bottrop. Rauch über der Welt! Kein Himmel, keine Wolke! Regen, der aus Rauch kommt. Schwarzer Regen. Hundert Schornsteine, aufgestreckte Zeigefinger, Säulen des Rauchhimmels, Altäre des Gottes Rauch. Schienen auf der Erde, korrespondierende Drähte in der Luft. Eine einzige, grausame Stadt aus Stadthäufchen, aus Städtchengruppen. Dazwischen läuft eine eingebildete Landesgrenze. Aber darüber wölbt sich ein einheitlicher Himmel aus Rauch, Rauch, Rauch.
Der Polizeireporter Heinrich G
Heinrich G., ein Polizeireporter, übte seinen Beruf schon seit mehr als zwanzig Jahren aus. Er war ein Mann von einem freundlichen, runden, heiteren Angesicht und einem behäbigen Körper. Er schien weder die Schnelligkeit zu besitzen, die sein Beruf erfordert, noch einen kritischen Sinn für die Erträglichkeit der Schrecken, über die er berichtete. Man hätte ihn etwa für den Direktor eines Puppentheaters halten können, auch für einen Schnellphotographen für verliebte Spaziergänger im Grünen, der flotten Nachlässigkeit wegen, mit der seine Hose in Querfalten auf die soliden Stiefel fiel, der sorglosen Willkür wegen, mit der ein breiter, windiger Schmetterling aus brauner Seide über dem kargen Ausschnitt der Weste flatterte, keine Krawatte mehr, sondern ein munteres Spielzeug der Lüfte. Die lächelnde Ruhe dieses Mannes lag über seinem Interesse für die blutigen Schauder der Kriminalistik wie ein heiterer Sommertag vor dem Eingang zu einer panoptikalen Schreckenskammer. Den harmlosen Freuden des Alltags schien sein Wesen zugewandt. Er schlenderte durch die Straßen, den Spazierstock in beiden Händen und beide Hände auf dem Rücken; dermaßen, daß es aussah, als erhielte er von rückwärts her die rundliche Wölbung seines Bauches. Oft blieb er vor den Schaufenstern stehn. Sein Blick suchte nicht die ausgestellten Gegenstände, sondern den Luftraum hinter der Scheibe, vielleicht aber auch sein eigenes Spiegelbild. Das Auge war verloren wie das eines Träumers, der zwecklos in den Himmel sieht. So ließ er sich von seinen vorübergehenden Freunden überraschen, deren er viele zählte. Es waren große, vierschrötige Männer mit viel zu kleinen, grünen Lodenhütchen auf glattrasierten Schädeln: Kriminalbeamte. Sie blieben stehen. Ihr Beruf hatte sie daran gewöhnt, die Menschen, mit denen sie in Verbindung treten wollten, zuerst zu beobachten und dann zu überraschen. Auch um einen Freund anzusprechen, legten sie ihre schwere Hand auf seine ahnungslose Schulter, als wollte ihr Mund schon »Im Namen des Gesetzes ...« sagen. Aber sie ließen nur ein mächtiges »Hallo!« erschallen. Heinrich G. wandte sich nicht um. Er wurde im Lauf des Tages so oft überrascht, seine rechte Schulter erhielt so viele freundschaftliche Schläge, sein Ohr vernahm so häufig das freundliche »Hallo«, daß er eher verwundert gewesen wäre, einmal eine Viertelstunde vor einem Schaufenster zu stehn, ohne angesprochen zu werden. Ohne seinen Blick von der Scheibe zu heben, sagte er, zu ihr gewandt: »Grüß Gott!« Der andere wartete. Erst eine geraume Weile später wurde er von Heinrich G. besehen und agnosziert: »Ah, das ist der Anton! Ich dachte, das wär’ der Franz! Du hast aber genau dieselbe Hand. Eine Laune der Natur!« Hierauf setzten sich beide in Bewegung. Nach dem ersten Schritt zog Heinrich G. eine nackte Zigarre aus der linken oberen Westentasche. Er hielt die Zigarre ein wenig vor den Augen, drehte sie und sagte: »Delikate Havanna!« Dann schenkte er sie seinem Freund.
Fast alle Kollegen trugen Aktentaschen und gingen mit eiligen Schritten über die Straße. Er allein schlenderte langsam dahin -- und trug er gelegentlich eine Tasche, so waren keine Papiere und Zeitungen darin, sondern Lebensmittel, schöne blutige Fleischklumpen und herzerfrischende Möhrchen und flatternder Blättersalat. Denn er besuchte gerne die morgendlichen Märkte, von allen Händlern gegrüßt und freundlich mit einem Finger salutierend. Man brachte ihm alles entgegen. Er brauchte nicht zu wählen. Blieb er wortlos, einen Finger am Hutrand, die Zigarre zwischen den Lippen, vor einem Händler stehen, so wandte sich dieser um, ging zu seinen Körben, holte eine Ware hervor, packte sie ein und legte sie selbst in Heinrich G.’s Aktentasche. Heinrich G. zahlte. Alles spielte sich lautlos ab. Andere Kunden mußten warten.
Seine Kollegen hatten bestimmte Bürostunden. Heinrich G. arbeitete unterwegs. Manchmal betrat er ein Kaffeehaus, salutierte, ging in die Telephonzelle, kramte aus der geräumigen Rocktasche ein paar zerknüllte Zettel hervor und telephonierte seiner Zeitung eine neue Schreckensnachricht. Sie bestand nur aus Rohmaterial, aus Namen, Daten, Fakten. Es waren Stichworte, keine Sätze. Ungefähr so lautete eine Meldung: »Heute, 26. April, Henriette Kralik ermordet aufgefunden, Polizei, Spur, Tagelöhner Richard Josef Haber, 32 Jahre, einmal Einbruch vorbestraft, abgeschafft, Aufenthalt ungesetzlich.« Er diktierte ein Dutzend Morde, Raubüberfälle, Einbrüche in Banken und Privathäuser, zündete die Zigarre wieder an und verließ das Kaffeehaus, einen Finger am Hutrand. Woher erfuhr er alle Grausamkeiten? Er entzog sie der Luft, in der sie gelegen waren, den Schaufenstern vielleicht, er entnahm sie dem »Hallo«, mit dem ihn seine Freunde begrüßten. Am Vormittag ging er zur Polizei. Der Posten vor dem Eingang salutierte und bekam von Heinrich G. eine Zigarre. In dem langen, halbdunklen Korridor, in dem die weißen Reihen der Türknöpfe aus Porzellan leuchteten, öffnete Heinrich G. eine Tür nach der andern, steckte den Kopf durch den Spalt, während gleichzeitig sein Stock, von der Linken am Rücken gehalten, ein paar lebhaftere Wedelbewegungen machte, als hätte er eine unmittelbare physiologische Beziehung zu der Zunge und den Lippen, die »Guten Morgen!« in die Büros hineinriefen. »Guten Morgen!« kam es zurück. Die Tür schloß sich wieder, eine andere ging auf. Manchmal -- es war nicht zu erkennen, aus welchen Gründen -- trat Heinrich G. in eines der Zimmer und blieb ein paar Minuten. Pfeifend, mit gespitzten Lippen, die einen komischen kleinen, roten Fleck im Gesicht bildeten, trat er wieder in den Korridor. Das Liedchen, das er pfiff, ließ erkennen, daß er etwas Besonderes erfahren hatte. Er ging zur nächsten Tür, »Guten Morgen!« sagen. Dann stieg er in den zweiten Stock, unaufhörlich gegrüßt, unaufhörlich salutierend auf der Treppe, die von Auf- und Absteigenden bevölkert war. Im zweiten Stock, wo die Korridore etwas heller waren, wiederholte er seinen Morgengruß an den Türen. Durch einen anderen, rückwärtige Ausgang verließ er das Gebäude. Auch hier salutierte ein Posten. Und auch dieser bekam von Heinrich G. eine Zigarre.
Zu einer späten Abendstunde, wenn die andern sich anschickten, nach Hause zu gehen, besuchte er die Redaktion. Er trat in sein Zimmer, das weit und kahl war, entzündete die Lampe, setzte sich an den Schreibtisch und zerknüllte den dicken Haufen von Papieren, die seit dem Morgen auf ihn gewartet hatten. Es waren Nachrichten von der Polizeikorrespondenz, die er alle schon kannte. Er kam von den Quellen, nichts Neues konnte er noch erfahren. Die Papiere beleidigten ihn fast. Längst hatte er alle Nachrichten »dem Blatt gegeben«, die sie enthalten mochten. Und wahrscheinlich enthielten sie nicht einmal alles, was er wußte. Der Tisch war leer. Das Tintenfaß trocken, die Federn rostig und zerbrochen. Heinrich G. schrieb nicht. Er brauchte nichts zu schreiben. Er saß vor seinem leeren Tisch, zog seine Schublade auf, entnahm ihr eine Handvoll »delikater Havannas«, schlug die Lade wieder zu und verließ das Zimmer. Wie er am Vormittag durch alle Türen der Polizei »Guten Morgen« gerufen hatte, so rief er jetzt durch alle Türen der Redaktion: »Guten Abend!« Die Redaktionsboten im Vorzimmer bekamen Havannas. Dann telephonierte Heinrich G. in ein Restaurant. Fünf Minuten später brachte ihm ein Kellner das Abendessen auf einer riesigen Platte. Es dampfte. Ein dichter, weißer Schaum rann über die Ränder des gläsernen Bierkrugs. Der Kellner bekam eine Havanna. Und nichts weiter geschah. Und nichts mehr habe ich zu erzählen. So, wie oben beschrieben, war Heinrich G., der Polizeireporter.
Fräulein Larissa, der Modereporter
Fräulein Larissa verfügte zwar über ein Pseudonym, aber anscheinend nicht über einen Familiennamen. Als hätten die Seltenheit und der fremde und schöne Klang ihres Vornamens Larissa von der bürgerlichen Pflicht befreit, noch einen anderen zu führen, oder als hätte sich dieser andere, weil er vielleicht zu simpel, geschämt, sich an die Seite eines Worts wie »Larissa« zu stellen.
Sie war seit undenklichen Zeiten eine treue Mitarbeiterin des Blattes, die man aus Galanterie nicht eine »alte Mitarbeiterin« nennen konnte. Man sagte lieber: eine »langjährige«. In der Tat hatte die Galanterie ausnahmsweise nicht unrecht. Larissa war nicht mehr jung, aber sie blieb jugendlich. Ja, ihre Jugendlichkeit war keineswegs künstlich, sondern eher eine Art zweiter natürlicher Jugend, die mit der ersten die charakteristische anmutige Torheit gemein hatte. Ihr verdankte Larissa gelegentlich Bewegungen, Mißverständnisse, Aussprüche, rührende Manifestationen einer rührenden Ahnungslosigkeit, die den erwachsenen, ältlichen Menschen mit einem Schlag und nur für die Dauer einiger Sekunden in einen charmanten Backfisch verwandelten. Dann war Larissa wie ein junges Mädchen aus einer ganz fernen, verschollenen Zeit. Es war, als wäre sie vor langen Jahren in der Blüte ihrer Jugend gestorben und eben durch ein Wunder aus einem ewigen Schlaf erwacht, um ihre Jugend fortzusetzen. Sie war gleichsam nicht gealtert; sondern im Verlauf der Jahre zu einer Ruhestätte, einer Behausung ihrer eigenen verborgenen eingeschlafenen und nur gelegentlich erwachenden Jugend geworden.
Sie war Berichterstatterin über Modeangelegenheiten. Da aber die Mode allein nicht genug Erträgnisse einbrachte, kümmerte sich Larissa auch um alle jene öffentlichen Dinge, die nach einer weitverbreiteten Meinung der weiblichen Natur »näherliegen« als der männlichen. Zum Beispiel um Mutterschutz, Waisenkinder, Wohltätigkeitsfeste, Lotterien und Scheidungsprozesse, Blumenausstellungen und Obdachlosenasyle. So sehr sich alle diese Angelegenheiten auch voneinander unterschieden, so blieb doch Fräulein Larissas Haltung gegenüber den Demonstrationen des Luxus wie jenen des Elends immer gleich, die Melodie ihrer Berichte -- denn sie hatte statt eines Stils eine Melodie -- immer dieselbe. Nur das Adjektivische wechselte. Hieß es einmal: »In den prachtvollen Räumen des ...Kasinos fand am 21. dieses Monats« usw., so stand das andere Mal: »In den düsteren Räumen des ... Obdachlosenasyls herrschte am 23. dieses Monats helle Freude ...« usw. Fräulein Larissas schriftliche Berichte waren von einer hellen, optimistischen Sachlichkeit, während ihre mündlichen Berichte sie selbst und den Hörer bis zu Tränen rühren konnten. Sie besaß einen Blick, das Rührende ausfindig zu machen, und eine Stimme, es zu erzählen. Den Worten aber, in denen sie es niederschrieb, fehlten die Wärme und die Anmut, kurz: »die Beseeltheit« ihrer Stimme. Zwischen den Zeilen schwebte verloren der Rest einer persönlichen Melodie, auch nur für sehr feine Ohren vernehmbar. Da der Lokalredakteur aber für »Substantielles im Blatt« war und von zwanzig Zeilen, die Fräulein Larissa geschrieben hatte, vierzehn zu streichen pflegte, entschwebte meist auch der Rest der Melodie für ewige Zeiten. Aus diesen und ähnlichen Gründen blieb Fräulein Larissa ein Objekt, ein Werkzeug, ein Organ des Luxus, auch wenn sie sich mit dem Elend befaßte. Und selbst ihre Berichte über aktuelle Angelegenheiten der öffentlichen Armut blieben liegen, weil man glaubte, es wären Berichte über Blumenfeste.
Von der besonderen Eleganz, die Fräulein Larissa äußerlich kennzeichnete, muß noch einiges gesagt werden: sie ging, weil sie die besten beruflichen Verbindungen mit den großen Schneidern hatte, nicht etwa nach der »letzten Mode« gekleidet, sondern bereits nach der nächsten. Sie trug schon im Frühling die Sommerpelze und im Herbst die Winterhüte. Und so war sie selbst der zuverlässigste, der bestgelungene »Vorbericht über die nächste Modeseason«. Es gibt keine größere journalistische Vollkommenheit. Sie verwandelte sich selbst in ihre Artikel -- und die Zeilen, die sie schrieb und die man ihr strich, waren vielleicht nur deshalb so unbeholfen, weil ihre äußere Erscheinung ihre journalistischen Fähigkeiten vorweggenommen hatte.
Ja, sogar ihre Gestalt schien sich den kommenden wechselnden Moden anzupassen. Sie bekam und verlor verschiedene »Linien«, Hüften, Büsten, Schultern. Und dennoch behielt das, was man ihr »eigentliches Wesen« nennen könnte, gleichsam die innerste körperliche Hülle ihrer Seele, etwas Unzeitgemäßes, Verschollenes, und immer war ein Abstand zwischen »ihr selbst« und der Persönlichkeit, der sie sich abwechselnd anpaßte. Vielleicht machte diesen Abstand ein vollkommener Mangel an Eitelkeit sichtbar. Fräulein Larissa demonstrierte die Kleider, die sie trug, wie etwa ein Physiker Experimente. »Sehen Sie«, konnte sie sagen, »so einen rechteckigen Fehbelag am Ärmel wird man nächstens tragen. Die Schöße werden wieder glockenförmig. So wie bei mir!« Und sie stand auf, machte eine Wendung, und man sah die Glockenform ihres Rocks.
Jeder Witz machte sie verlegen. Denn sie, die niemals eine Doppelsinnigkeit begriff, fürchtete immer eine »Anzüglichkeit«. Und sie wurde auf jeden Fall rot, auch wenn sie etwas Belangloses, Einfaches mißverstanden hatte. Das waren übrigens die Augenblicke, in denen sie schön wurde und in denen man sie hätte lieben können. Die Scham verzauberte sie. Sie war ein junges Mädchen. Ihr verkümmertes Gesicht weckte die Verlegenheit, die gleiche Verlegenheit, die man in der Anwesenheit eines jungen Mädchens empfindet: eine Verlegenheit, gemischt aus Väterlichkeit, Mitleid und Lust.
Fräulein Larissa starb am Typhus während des Krieges. Sie war Pflegerin gewesen. Sie starb in Bukarest. Dort wurde sie begraben. Zum ersten und zum letzten Mal stand ihr voller Name in der Zeitung. Sie hieß Larissa Schorr.
Der Nachtredakteur Gustav K
Gustav K. war ein Nachtredakteur.
Das Blatt erschien jeden Morgen um drei Uhr. Jede Nacht um elf Uhr dreißig erschien der Nachtredakteur.
Er war frisch rasiert, frisch gewaschen, ausgeruht, nach Seife duftend und Menthol. Ein vorausgeeilter Teil des nächsten Morgens.
Er schien die Müdigkeit der anderen nicht zu begreifen. Erfrischt von seiner Morgenwanderung durch die nächtlichen Straßen betrat er ahnungslos die Gesellschaft der Erschlafften, klopfte den Stehenden auf die Schultern, den Sitzenden auf die Knie und wunderte sich, daß sie zusammenfielen, morsche Gerüste.
Er schien sich für den Gesundesten zu halten. Ja, es war, als ob er sich jede Nacht aufs neue seine eigene Stärke absichtlich demonstrierte, um sein schwächliches Aussehen, seine mageren Glieder, sein blaßgelbes Gesicht zu dementieren.
Zwei Stunden später war auch er verwandelt. In zweimal sechzig Minuten hatte er einen zwölfstündigen Arbeitstag zurückgelegt.
In seinem dünnen Angesicht flossen die Schatten der Sorgen mit den zufälligen fetten Spuren der Druckerschwärze zusammen, die ein achtloser Finger hinterlassen hatte. Die gescheitelten dünnen, schwarzen Haare standen wie Drähtchen und winzige Spirälchen. Die Ränder der Fingernägel waren auf einmal schief geschnitten, wenigstens schienen die lila Flecken unaufhörlich nachgespitzter Tintenstifte die Unregelmäßigkeit der Nagelformen sichtbar zu machen. Als wäre die Arbeit am Schreibtisch ein unfehlbares Haarwuchsmittel, begann der Bart des Nachtredakteurs, kaum eine Stunde, nachdem er rasiert worden war, üppig und grauschwarz aus den Poren der Wangen zu dringen. Die weißen Manschetten klebten am Handgelenk, dahin war ihr halbgesteifter Glanz. Der Knoten der Krawatte wurde locker, schob sich zwischen die Wände des »Stehumlegkragens« und ließ ein glänzendes goldenes Knöpfchen sehen, an dem nicht nur der Kragen und das Hemd, sondern auch die ganze Kleidung des Mannes, ja er selbst zu hängen schienen. Erhob sich Gustav K. aus seinem Lehnstuhl, so sah man plötzlich die Holzwolle aus einem Loch im dünnen Lederbezug dringen -- und zwar mit einem solchen Ungestüm, daß man glauben konnte, das Loch wäre früher nicht dagewesen, sondern erst von der Wirbelsäule des Redakteurs ausgebohrt worden. Er selbst ging mit vorgeneigtem Oberkörper und lockeren, seitwärts schlendernden Beinen die Stiege zur Setzerei hinauf. Er erinnerte an einen Lahmen, der die Krücken abgelegt hat. Oben, in der Setzerei, lehnte er sich mit aufgestützten Ellenbogen an einen der langen, metallbeschlagenen Tische, einen Kopierstift zwischen den Lippen, den er hin- und hergleiten ließ wie eine natürliche Fortsetzung der Zunge. Der Bleistift begleitete so die Bewegungen der Augen, die einen Bürstenabzug lasen. An der und jener Stelle blieben sie haften, und auch der Bleistift stand still. Manchmal löste sich die Hand von der Wange, der Ellenbogen vom Tisch. Gustav K. ergriff ein Stück Papier, zerknüllte es langsam, formte es zu einem Ball und schleuderte es einem der ahnungslosen Setzer zu, der eine erschrockene Bewegung machte. Das war ein Witz gewesen. Es war, als hätte sich der Nachtredakteur nur überzeugen wollen, ob er noch zielen könne. Einen Augenblick nur hatte sein Angesicht den Ausdruck einer knabenhaften Verspieltheit gezeigt. Man konnte ihn sehen, wie er in kurzen Höschen vor dreißig Jahren am Ufer eines Wassers Steinchen in die Wellen schleudert.
Er wurde sofort wieder ernst. Er vergaß nicht einen Augenblick, daß er die »ganze Verantwortung« für »das Blatt« trug und daß er unaufhörlich Gefahr lief, eine falsche Nachricht für eine richtige zu halten, eine richtige für falsch, eine wichtige für belanglos, eine Kleinigkeit für wichtig.
Er kannte die ganze Welt, obwohl er nur einen kleinen Teil von ihr gesehen hatte. Wenn ein Telegramm aus Peru meldete, eine Brücke wäre eingestürzt, so schien es Gustav K., weil er mit Peru so vertraut war, daß der Einsturz der Brücke wichtig genug sei, in Borgis gesetzt zu werden. Kam ein Bericht über Heuschrecken im Kaukasus, so hätte Gustav K., weil er die Heuschrecken so genau kannte und den Kaukasus, am liebsten einen Aufsatz von einem Naturforscher gebracht. Für ihn gab es keine geographische Ferne. Er beschwerte »das Blatt« mit fünfzig überflüssigen Nachrichten. Hielt ihm der Chefredakteur am nächsten Abend vor, daß die Nachricht über den General Correira in Mexiko niemanden etwas angehe, so erwiderte Gustav K.: »Sie täuschen sich! Der General Correira hat eine außergewöhnliche Laufbahn! Im Jahre 1874 geboren, ist er 1894 schon Oberst der Truppen von Vera Cruz, und der nächste Aufstand macht ihn zum Kommandanten der Hauptstadt. Sogar seine Feinde achten ihn. Und jetzt hat er eine schwere Rippenfellentzündung ...!« Ging es schon nicht an, die Rippenfellentzündung in Petit zu bringen, so erschien sie wenigstens in Nonpareille unter den »Vermischten Nachrichten«. Eine Tollwut unter den Hunden von Konstantinopel hatte Anspruch auf zehn Zeilen auf der dritten Seite, links oben, weil die Hunde in Konstantinopel eine Gefahr für die ganze Menschheit werden konnten. »Unter Umständen«. -- »Unter Umständen«, pflegte Gustav K. zu sagen, »kann so eine Tollwut die Matrosen großer Dampfer erreichen«. Es gab also nichts »Unwichtiges«. Wenn der Nachtredakteur eine Nachricht über ein kleines Ereignis in einem weit entfernten Lande schon in den Papierkorb getan hatte, so bückte er sich nach fünf Minuten, holte das zerknüllte Papier hervor, glättete es und wandelte es künstlich wieder in den Zustand einer eben eintreffenden, noch unbekannten Nachricht. Er zwang sich, sie zu vergessen, um sie hierauf noch einmal zu erfahren. Noch einmal tauchten die alten Argumente gegen ihre Veröffentlichung auf; und noch einmal warf er sie weg.
Aber wahrscheinlich tat sie ihm noch lange leid. Und fand er sie am nächsten Tag in einem anderen Blatt, so empfand er Gewissensbisse über seine Gleichgültigkeit der Zeit und ihren Ereignissen gegenüber, und er beneidete seinen Kollegen, der die Nachricht »ins Blatt« gebracht hatte. Ja, es ist anzunehmen, daß er in solchen Augenblicken beschloß, bei dem »Umbruch« der folgenden Nummer vorsichtiger mit den kleinen und vermischten Nachrichten umzugehen. Aber saß er dann wieder vor dem aufgehäuften »Material«, las er die Berichte aus der näheren Umgebung, so erinnerte er sich mit einem wehen Schrecken an die unbarmherzige Wirklichkeit einer in Nationen, Staaten, Länder, Städte aufgeteilten Welt und an die Tatsache, daß er selbst der Redakteur eines bestimmten national bestimmten Blattes war, das in einer bestimmten Stadt erschien. Daß es also Grenzen gab zwischen nahen und den fernen Ereignissen und daß »der Leser« kein Kosmopolit war, dem die ganze Erde ein gleichmäßig interessantes Angesicht bot, sondern ein festgesessener Mensch, den der Nachbar mehr interessierte als der Ausbruch des Vesuvs. Und er sortierte die Ereignisse, wie es seine Pflicht war, nach nahen und fernen, nach Garmond, Borgis, Petit und Nonpareille, und die nächsten Dinge bekamen die größten Schriften.
Gegen drei Uhr morgens wusch er sich die Hände an der Wasserleitung in der Setzerei, langsam, gründlich, mit Streusand und scharfer Seife. Dann warf er noch einen Blick in den halberblindeten Spiegel, fuhr mit den Fingern über das Haar und wischte mit einem Taschentuch die schwarzen Flecken aus seinem Angesicht. Er erinnerte an einen Schauspieler, der sich abschminkt. Im Sommer war, wenn er die Straße betrat, der Himmel schon klar. Die ersten Amseln begannen zu flöten. Die Milchwagen ratterten. Die Bäckerjungen flatterten weiß von Haus zu Haus. Gustav K. begab sich in ein Kaffeehaus in der Nähe des großen Marktes. Es öffnete sich sehr früh, der Händler wegen. Über dem Büfett brannte trüb und gelb die Lampe, ein schon gestorbenes Licht von gestern. Der Redakteur, dem gestern nacht bereits der heutige Morgen gewesen war, erinnerte heute morgen an die gestrige Nacht. Er saß zwischen den rüstigen ländlichen Frauen und Männern, die nach Rüben und Karotten rochen, doppelt bleich, zehnfach einsam, der intellektuelle Repräsentant der Stadt, der echteste aller Städter: ein Redakteur. Er entfaltete das erste der Morgenblätter, und sofort vertrieb die Druckerschwärze den Geruch der Rüben und Karotten. Es war der Geruch der Stadt. Er erinnerte an den des schmelzenden Asphalts und des Terpentins und des Pechs, mit dem die Straßen ausgebessert wurden. Gustav K. wartete auf die anderen Morgenblätter, fand in ihnen kleine Nachrichten, die er selbst nicht »gegeben« hatte, und ging verärgert zur Haltestelle der Straßenbahn. Mit dem ersten Wagen, der frisch und munter aus der Garage kam, fuhr er nach Hause.
Nur einmal im Monat, am Dreißigsten, kam er am hellen Mittag in die Redaktion, um auf den weißen Umschlag zu warten, in dem der kümmerliche Rest eines Gehalts lag. Auf dem Umschlag stand der Name Gustav K. unversehrt neben der schwerverletzten, durch Subtraktionen mißhandelten Summe. Gustav K. war sauber, rasiert, feucht gekämmt, wie um Mitternacht. Aber ernst und nicht zu kräftigen Späßen aufgelegt. Ein rebellischer Geist erfüllte ihn. War es die ungewöhnliche Stunde, zu der er das Bett verlassen hatte? War es das geringe Gehalt, dessentwegen er aufgestanden war? -- Um die Mittagsstunde eines jeden 30. verkündete Gustav K. kommunistische Grundsätze. Er verfluchte die demokratische Gesinnung des Blattes. Er nannte den Chefredakteur einen »Lakaien der Finanz«. Er schwor, nächstens sozialistische »Kuckuckseier« ins Blatt zu legen. Und nach einem Monat zu kündigen. Ja, er trat mit dem weißen Umschlag in der Hand in das Konferenzzimmer, wo einige Redakteure saßen, und sagte: »Ich kündige, meine Herren!« Niemand sah auf. Alle hatten es schon zwanzigmal gehört. »Ich arbeite nicht mehr in diesem Schweinestall!« fuhr Gustav K. fort.
Da ereignete es sich manchmal, daß einer sagte: »Haben Sie gelesen, wie uns die Sozialdemokraten heute angreifen?«
»Wo steht das?« sagte der Nachtredakteur. »Diese Bande! Sehen Sie, wie schlecht sie das Blatt aufmachen! Daß überhaupt jemand dieses Blatt liest! Das sind keine Journalisten! Das sind ...« und Gustav K. suchte lange nach einem beleidigenden Ausdruck, bis er endlich die schimpflichste aller Bezeichnungen fand: »Parteipolitiker sind sie! ...«
Und er steckte den Umschlag in die Tasche.