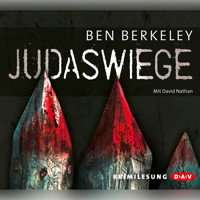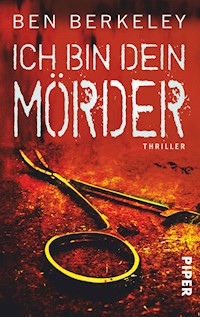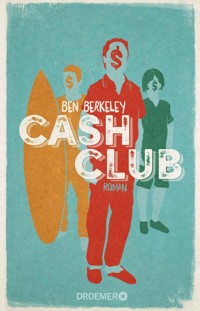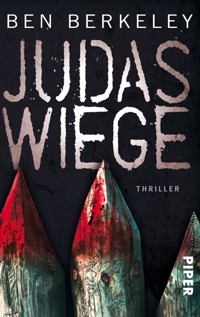
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
»Schau unter den Fahrersitz, Jessica.« Mit Autobomben zwingt ein Psychopath junge Frauen in abgelegene Waldgebiete und ermordet sie mit einem mittelalterlichen Folterwerkzeug, der Judaswiege. Doch schon bald ist ihm das nicht mehr genug: Er stellt Videos von seinen grausamen Taten ins Netz, getarnt als harte Pornografie. Ein schwieriger Fall für Sam Burke, Psychologe und leitender Ermittler beim FBI. Hilfe von unerwarteter Seite erhält er durch seine Ex-Partnerin Klara »Sissi« Swell, die sich bei ihren Untersuchungen jedoch am Rande der Legalität bewegt. Können sie den brutalen Killer stoppen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage Dezember 2011
ISBN 978-3-492-95626-0
Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH 2011 Umschlagkonzept: semper smile, München Umschlaggestaltung und -motiv: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
KAPITEL 1
Juni 2004
Big Beach, Maui, Hawaii
Jessicas Schritte patschten im flachen Wasser der Brandung, sie lachte ausgelassen. Ein schwarz-weißer Hund, den sie nicht kannte, tollte um ihre Beine, forderte sie zum Spielen auf. Sie freute sich über die Zufallsbekanntschaft mit dem freundlichen dicken Wollknäuel. Lachend spritzte sie ihm ein paar Tropfen auf die Schnauze, er bellte kurz wie zum Dank und trollte sich dann über den weichen Strand, der in der Abendsonne glitzerte, zu seinem Herrchen.
Jessica ließ die Wellen den Sand von ihrem Körper waschen und lief zurück zu ihrem Handtuch, sie musste sich jetzt beeilen. Schon Viertel vor sieben, um halb acht wollte sie mit Adrian zu Abend essen. Sicher hatte er wieder etwas Wunderbares gezaubert, Kochen war nicht nur sein Beruf, sondern seine Passion. Und so stand er auch in ihren Flitterwochen an manchen Nachmittagen am Herd. Jessica nutzte die freie Zeit an solchen Tagen, um schwimmen zu gehen, oder für Ausflüge in die Berge, aber zum Abendessen war sie immer pünktlich zurück in ihrer Ferienwohnung.
Wie schön, dass ich mich auch nach über sechs Jahren immer noch so auf ein Wiedersehen mit ihm freue, dachte sie und lächelte. Der Wind strich über die feinen Härchen ihrer Haut und ließ sie frösteln. Sie schlang das Handtuch um die Hüften und schnappte sich ihre Flip-Flops.
Noch einmal blickte sie zurück über das Meer, auf die geheimnisvolle Insel, die vor der Küste lag wie ein überdimensionaler dunkler Stein. Ob dort Menschen wohnten?, fragte sie sich zum hundertsten Mal, als sie sich auf den Weg zu ihrem Mietwagen machte. Der nasse Sand klebte zwischen ihren Zehen, er kitzelte angenehm.
Keine zwei Minuten später erreichte sie das Auto und zog sich ein leichtes Sommerkleid über den Bikini. Das Innere des Jeeps war aufgeheizt, ein dicker Schwall schwül-heißer Luft schlug ihr entgegen. Jessica öffnete alle Fenster, bevor sie den Wagen startete und langsam von dem Strandparkplatz rollte. Ihr Magen knurrte. Es wurde Zeit, dass sie etwas zu essen bekam. Vielleicht eines dieser phantastischen Mondfisch-Steaks?
Das Wasser lief ihr im Mund zusammen, als sie das Klingeln ihres Handys aus ihren Gedanken riss. Sicher wunderte sich Adrian, wo sie blieb. »Hallo, Adrian«, begrüßte sie lächelnd ihren frischgebackenen Ehemann. Die Leitung knackte. Wieder einmal eine schlechte Verbindung, dachte Jessica. Typisch für Maui, auf Inseln scheinen sie die Mobilfunknetze einfach nicht in den Griff zu kriegen.
»Adrian?«, fragte sie erneut.
»Nicht ganz«, antwortete eine leise Stimme.
»Wer ist da?«, wollte Jessica wissen, jetzt leicht verärgert wegen des offensichtlich falsch verbundenen Anrufers.
»Jessica, ich möchte, dass du ruhig bleibst«, verlangte der Unbekannte.
Was konnte das bedeuten? War Adrian etwas zugestoßen? Ihr Magen krampfte sich in dunkler Vorahnung zusammen.
»Was ist passiert?«, wollte sie wissen.
»Noch ist nichts passiert, Jessica«, beruhigte sie die Stimme. »Jessica, ich möchte, dass du unter deinen Sitz schaust.« Die Stimme klang kalt und teilnahmslos.
Ihre Hand begann zu zittern. Was wollte dieser Mann von ihr? Wieso sollte sie unter ihren Sitz schauen? Wie benommen steuerte sie den schweren Wagen auf den Seitenstreifen und blickte in den Rückspiegel. Außer ihr war keine Menschenseele auf der abgelegenen Landstraße unterwegs. Sie stellte die Automatik auf Parken und beugte sich nach unten. Ihre Augen gewöhnten sich nur langsam an die Dunkelheit des Wagenbodens. Sie hielt den Atem an, und ihr Herz stockte. Was sollte das alles? Ein schlechter Scherz von einem von Adrians Bekannten? Sie starrte auf die rote Leuchtdiode, die in regelmäßigen Abständen blinkte. Die kleine Lampe klebte an einem großen grauen Paket aus Plastik, um das Gopher-Tape gewickelt war.
Sie saß auf einer Bombe.
»Jessica, hast du unter den Sitz geschaut?« Wieder die Stimme, jetzt klang sie überlegen, und Jessica meinte, den Mann am anderen Ende der Leitung lächeln zu sehen.
»Ja«, stammelte sie.
»Gut. Steig nicht aus dem Wagen, Jessica.«
Sie überlegte fieberhaft. Es war kein Auto in Sicht, sie war allein auf der staubigen Straße. Wie sollte er wissen, ob sie aus dem Auto stieg oder nicht?
Als hätte er ihre Gedanken erraten, wiederholte er sich: »Steig nicht aus, Jessica. Tu uns das nicht an. Ich kann dich sehen.«
Obwohl sie nicht zum Schwitzen neigte, klebte das Sommerkleid an ihrer Haut wie ein nasser Sack, das Adrenalin hatte ganze Arbeit geleistet. Angst, Stress und Schweiß. Panik erfasste sie. Was sollte sie tun, was hatte der Mann mit ihr vor? Wurde sie entführt? Wegen Adrian? Wegen Geld? Verdammt, Adrian …
»Jessica, frag dich nicht, warum. Es geht nicht um Adrian, es geht nur um uns beide.«
Als könne er ihre Gedanken lesen wie ein offenes Buch. Jessica schluckte. Sie stammelte: »Was meinen Sie damit, es geht um uns?«, fragte sie.
Die Stimme lachte: »Das wirst du noch früh genug begreifen, Jessica. Fahr jetzt weiter. Und halte dich an das Tempolimit, wir wollen doch nicht, dass ein Unfall geschieht, nicht wahr, Jessica?«
Wieso wiederholt er ständig meinen Namen?, wunderte sie sich. Ein verdammter Freak. Aber welche Wahl hatte sie schon? Wenn die Bombe echt war, dann musste sie auf Zeit spielen. Und wenn nicht, wenn es nur ein Spinner war, der ihr einen Schrecken einjagen wollte? Sie glaubte nicht daran. Vielleicht ein verflossener Liebhaber. Welcher wäre verrückt genug, ihr so etwas anzutun? Ihr fiel keiner ein. Aber wer konnte schon in fremde Köpfe schauen? In die dunkelsten Ecken, dorthin, wo die abseitigen Phantasien ihr verborgenes Dasein fristeten? Niemand.
Nur dieser eine One-Night-Stand schlich sich in ihr Bewusstsein. Damals, vor Jahren, die schummrige Bar, mehrere Drinks, eine einzige Nacht. Er hatte sie gewürgt beim Sex. Sie hatte es als nicht schlimm empfunden, betrunken, wie sie war, hatte es sie sogar angemacht. Konnte er die Stimme sein? Sie wusste gar nichts mehr, sie wusste nur noch, dass sie auf einer Bombe saß und ihr diese Stimme drohte, sie in die Luft zu jagen, wenn sie nicht tat, was der Mann verlangte.
Sie beschloss, kein Risiko einzugehen und zunächst nachzugeben. Ihr Verstand versuchte, die Kontrolle zu übernehmen. Konnte sie nicht einfach vor einer Polizeistation halten und aus dem Wagen springen? In Filmen hechteten sie ständig aus explodierenden Autos und kamen mit heiler Haut davon. Sie kalkulierte ihre Chancen, bis sie sich eingestehen musste, dass sie zu wenige Variablen kannte. Sie fühlte sich ausgeliefert. Trotzdem startete sie den Wagen.
»Gut, Jessica. Bleib auf der Landstraße bis zur nächsten Kreuzung, und nimm dann die Abzweigung nach Hana im Norden. Ich rufe dich wieder an. Und denk dran, dass ich dich sehen kann, ja? Willst du das für mich tun, Jessica?«
Als könnte sie dadurch alles rückgängig machen, presste Jessica sich den Hörer ans Ohr, vernahm ihren eigenen Atem, der gegen die Panik ankämpfte. Als sie nicht antwortete, wurde die Stimme schärfer: »Jessica, hast du mich verstanden?«
»Ja«, erwiderte sie. Was blieb ihr für eine Alternative?
»Gut. Ich melde mich wieder«, versprach er.
Wie der Verrückte verlangt hatte, nahm Jessica zunächst den Highway und bog im Norden Richtung Hana ab. Der Asphalt wand sich in engen Kurven an der Küste entlang, es war eine beliebte Route für Touristen, angeblich die schönste Straße von ganz Hawaii. Es war jetzt Viertel nach sieben. Um diese Uhrzeit waren die Touristen längst verschwunden, und die Kurven schlängelten sich einsam durch die dichte Vegetation von Maui. Sie musste langsam fahren, immer wieder wurde die Fahrbahn einspurig. Nacheinander passierte sie Attraktionen wie die Zwillings-Wasserfälle oder einen verlassenen Stand, der tagsüber Bananenbrot verkaufte, aber abends waren die Läden verrammelt.
Manchmal glaubte sie, hinter sich ein Scheinwerferpaar zu sehen. Sie fuhr langsamer, aber der Wagen holte nicht auf. Da bist du also. Konnte sie es hier riskieren, aus dem Auto zu springen? Die Strecke war derart unübersichtlich, dass er sie zwangsläufig aus den Augen verlieren musste. Ja, so könnte es gehen. Jessica wartete auf zwei besonders enge, aufeinanderfolgende Passagen und versuchte, möglichst weit vorauszuspähen. Als ein gelbes Schild mit großen schwarzen Pfeilen eine Hundertachtzig-Grad-Kehre ankündigte, beschloss sie, ihr Glück dort herauszufordern. Noch vierzig Meter, dreißig, zwanzig. Dann klingelte ihr Handy. Mit zitternden Fingern drückte sie auf die Taste.
»Jessica, schau nach rechts oben an den Türrahmen. Und bitte: Halte mich nicht für dumm. Das senkt deine Überlebenschancen drastisch. Wir sind fast da, du hast den ersten Teil gleich geschafft. Hinter der nächsten Kurve biegst du nach rechts ab in den Bambuswald. Der Weg ist klein und matschig, aber ich bin sicher, du wirst ihn finden.«
Er kappte die Verbindung. Sie blickte zum Türrahmen, fluchte. Eine kleine schwarze Linse klebte kaum sichtbar an der Scheibe. Er hatte sie die ganze Zeit beobachten können. Shit. Ihr Plan war gescheitert. Sie hatte keine Chance, er saß am längeren Hebel. Diese niederschmetternde Erkenntnis lenkte sie ab, sodass sie die Kehre viel zu schnell genommen hatte. Plötzlich spürte sie, dass sie von der Straße abkam. Der große Wagen schlitterte, und Jessica trat hektisch auf die Bremse. Gerade noch rechtzeitig kam sie vor einer steilen Felswand zum Stehen. Puls und Atem lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Jessica hatte das Gefühl, ihr Herz könnte jeden Moment stehen bleiben. Aber dann hätte der Geisteskranke sogar ohne ihr Zutun sein Ziel erreicht. Sie klammerte sich ans Lenkrad und fuhr wieder an.
Nach der nächsten Rechtskurve hielt sie Ausschau nach der Abzweigung, die ihr die Stimme beschrieben hatte. Dicht an dicht ragten riesige Bambusstauden wie Tausende übergroße Schaschlikspieße gen Himmel. Was wollte der Mann hier von ihr? Grauenhafte Bilder tauchten vor ihrem inneren Auge auf: gespreizte Schenkel, Schreie, eine Hand auf ihrem Mund. Dann Schmerz. Jessicas Magen krampfte. Aber was hatte sie schon für eine Wahl?
Sie versuchte verzweifelt, mit ihren zitternden Händen das Lenkrad festzuhalten, als sie auf der rechten Seite eine schlammige Abzweigung bemerkte, die in das undurchdringliche Dickicht führte. Es war schon fast zu spät. Im letzten Moment riss sie das Steuer herum, sodass der Wagen ins Schleudern geriet.
Als sie ihn wieder unter Kontrolle hatte, holperte er auf dem unebenen Weg derart, dass Jessica fürchtete, die Bombe würde von selbst in die Luft fliegen, aber nichts dergleichen geschah. Nach fünfzig Metern endete der Weg abrupt. Sie musste falsch abgebogen sein. Sie drehte den Kopf zurück und legte den Rückwärtsgang ein, als erneut ihr Handy klingelte. Ein Wunder, dass sie hier draußen überhaupt Empfang hatte. Mit bebender Stimme antwortete sie: »Ja?«
»Das hast du gut gemacht, Jessica. Den ersten Teil hättest du geschafft.«
»Was meinen Sie mit erstem Teil?«, schrie sie panisch, ihre Stimme überschlug sich. »Was wollen Sie von mir?«
»Bleib ruhig, Jessica. Es erhöht deine Überlebenschance drastisch. Unterschätze mich nicht, und behalte die Nerven, das ist das Wichtigste.«
Jessica schluckte ihre Tränen herunter. So viel war sicher: Wenn sie diesen Albtraum unversehrt überstehen wollte, musste sie sich am Riemen reißen. Nicht weil er das sagte, sondern weil sie sonst an ihrer Furcht sterben würde. Dazu bräuchte sie keinen kranken Vergewaltiger, der ihr eine Bombe unter den Autositz legte. Also gut. Als Erstes musst du rausfinden, was er von dir will, und dann musst du Adrian eine Nachricht zukommen lassen. Er wird wissen, was zu tun ist, er weiß immer, was zu tun ist.
»Was wollen Sie von mir?«, fragte sie erneut. Ihre Stimme klang jetzt fester, sie hatte nun zumindest eine vage Idee, wie sie dem Wahnsinnigen entkommen konnte.
»Jessica, ich kann deine Neugier verstehen. Ich werde es dir sagen.« Ein Blitzen im Rückspiegel erregte ihre Aufmerksamkeit. Von der Landstraße bog ein zweiter Wagen in den matschigen Waldweg ab. Das musste er sein. Das Scheinwerferpaar zuckte auf und ab, als der Wagen auf dem unebenen Boden durchgeschüttelt wurde. Sie fühlte wieder die Panik in sich aufsteigen, kämpfte sie aber nieder. Behalt die Nerven, Jessica.
»Jessica?«, fragte die Stimme. Ihr Verfolger hatte jetzt angehalten, die Scheinwerfer strahlten durch die Dämmerung, die Sonne war beinahe untergegangen, in wenigen Minuten würde es in dem Bambuswald komplett dunkel sein.
»Ja«, antwortete sie.
»Du machst den Motor und das Licht aus, und dann legst du den Schlüssel auf das Wagendach.«
Jessica schluckte. Ihr war bewusst, dass mit jeder seiner Anweisungen, der sie Folge leistete, ihre Chancen sanken, diesem Albtraum zu entkommen. Andererseits würde es ihr auch nichts nützen, ihn zu provozieren. Er wollte, dass sie den Schlüssel aufs Dach legte. Nun gut, in dieser tickenden Zeitbombe hielt sie es ohnehin keine Sekunde länger aus. Wenn er wollte, dass sie aus dem Auto stieg, sollte es ihr nur recht sein. Sie löschte das Licht. Der Wald lag jetzt vor ihr wie ein dunkler Vorhang. Wie in Zeitlupe zog sie den Schlüssel ab, nahm ihn in die linke Hand und legte ihn auf das Wagendach. Sie schloss die Augen, fasste einen Plan.
»Was wollen Sie von mir, Mister?«
»Du bekommst eine realistische Chance, Jessica. Wirklich.«
Er sagte es, als sei es das Normalste von der Welt, eine Chance zu erhalten.
»Aber Sie haben sie mir doch erst genommen, Mister. Ohne Sie bräuchte ich gar keine Chance. Ich wollte keine, schon vergessen?«
Die Stimme lachte. Ein emotionsloses Lachen, seltsam entrückt. Das Lachen eines Psychopathen.
Jessica dachte an Adrian und ihre Mutter, die sie immer vor Männern gewarnt hatte. Du pauschalisierst, Mom, hatte sie ihr immer geantwortet.
»Jetzt noch das Handy, und dann läufst du los. Ich gebe dir eine halbe Stunde Vorsprung, ich hatte dir schließlich eine realistische Chance versprochen.«
Das war es also? Was sollte das bedeuten? Ein krankes Spiel? Vorsprung klang nach Fangen spielen in den Vorgärten der Nachbarn. Unschuldig und ohne Konsequenzen. Was hatte dieser Mann im Sinn, der sich die Mühe gemacht hatte, eine Bombe in ihrem Auto zu platzieren? Oder war es doch möglich, dass es sich um eine Attrappe handelte? Sie sah ihre Optionen schwinden. Er konnte sie beobachten, jeden ihrer Schritte mit der Zündung der Bombe beantworten. Bis auf einen vielleicht. Vorsichtig, damit er keinen Verdacht schöpfte, tastete sie durch den dünnen Stoff ihres Sommerkleids. Ja, ihr Zweithandy war noch da. Das war ihre Chance, die Oberhand zu gewinnen. Sie konnte ihm ruhig das Handy auf dem Wagendach überlassen. Und wenn das Ganze doch nur ein Scherz war, hatte sie auch nichts verloren.
Dennoch wollte das Zittern in ihrer Hand nicht nachlassen, als sie das Funktelefon auf das Wagendach legte. Sie hatte gerade die Hand zurückgezogen und fragte sich, was der Mann jetzt vorhatte, da er nicht mehr mit ihr kommunizieren konnte, als sie ein stetes Piepsen vernahm. Panik erfasste sie. Sie schnallte den Sitzgurt los und starrte zu der Bombe. 00:27 stand jetzt auf einem rot leuchtenden LED-Display. 00:26. Jede Sekunde zählte die Uhr nach unten. Ihr blieb nicht einmal eine halbe Minute, um weit genug von dem Auto wegzukommen. Fuck. Auf der Rückbank hatte doch eine Taschenlampe gelegen, oder nicht? Damit hatte sie gestern einen verlorenen Ohrring gesucht. Eine schwarze Maglite, schwer und mit neuen Batterien. Sie brauchte die Lampe. Fieberhaft kramte sie in der Unordnung und verfluchte ihre Nachlässigkeit. Sie starrte noch einmal auf die Uhr. Fünfzehn Sekunden. Vierzehn. Da endlich ertastete sie mit ihren Fingerspitzen das kühle Metall. Sie streckte sich und riss die Lampe an sich, öffnete die Wagentür, stürzte hinaus, stolperte über den matschigen Grund. Wieso hatte sie nicht ihre Turnschuhe angezogen, anstatt einfach barfuß ins Auto zu steigen? Weil es heute Nachmittag gar keinen Grund gab, festes Schuhwerk anzuziehen. Heute Nachmittag kam ihr vor wie vor ewig langer Zeit.
Noch zwölf Sekunden. Sie schlitterte über den Waldboden, versuchte verzweifelt, Halt zu finden. Sie rutschte einen Hügel hinunter, verlor immer wieder den Halt auf dem glitschigen Untergrund. Aber die Böschung würde die Wucht der Bombe mindern, oder nicht? Noch fünf Sekunden. Sie duckte sich hinter eine besonders dichte Ansammlung von Stauden, als eine ohrenbetäubende Explosion ihr Trommelfell fast zum Platzen brachte. Ein riesiger Feuerball erhellte die Nacht, sie blickte ungläubig in Richtung der Stelle, an der vorher ihr Geländewagen gestanden hatte. Da dürfte nicht viel übrig geblieben sein.
Also keine Attrappe, dachte Jessica. Ihr Gefühl hatte sie nicht getäuscht. Es war tatsächlich das Werk eines Psychopathen und kein schlechter Scherz. Ihr wurde klar, dass es hier für sie um Leben und Tod ging. Eine halbe Stunde Vorsprung hatte ihr der Mann versprochen, aber sie wollte auf Nummer sicher gehen, sich wenigstens ein Stück weit von ihm entfernen, bevor sie mit ihrem Handy Hilfe rief. Wer weiß, ob sich der Verrückte an seine Ansage halten würde. So schnell sie konnte, kletterte sie weiter den Hügel hinunter. Überall lauerten tückische Steine, sie verlor den Halt und stürzte in den Schlamm. Verdammte Scheiße. Hektisch warf sie einen Blick zurück. Sie hatte es kaum zwanzig Meter weit geschafft. Noch ein Stück, Jessica.
Sie rappelte sich auf und stolperte weiter. Vor sich konnte sie einen kleinen Fluss ausmachen. Es hilft nichts, rein da. Das Wasser war eiskalt, was ihr auf Hawaii seltsam vorkam, aber zum Glück nicht sehr tief. Sie hielt das Handy in der Hand, damit es trocken blieb, und watete zum anderen Ufer. Der Bambuswald sah hier noch dichter aus, und sie konnte nur Umrisse erkennen, tiefer im Gebüsch wurde es sicher stockfinster.
Als sie das Ufer erreicht hatte, ließ sie sich auf den Boden fallen und wählte Adrians Mobilfunknummer. Nichts. Panik stieg in ihr auf. Das Display zeigte ihr an, wo das Problem lag: kein Empfang. Sie kämpfte die Panik nieder, aber die Angst blieb. Dreh jetzt bloß nicht durch, Jessica. Hektisch blickte sie sich um. Der Flusslauf wäre bei Tag sicher schön anzuschauen, kurz nach der Stelle, an der sie ihn überquert hatte, bahnte er sich über einen kleinen Wasserfall den Weg ins Tal. Weiter oben erstreckten sich die weitläufigen Berge des Koolau Forest Reservats, dem Regenwald im Osten Mauis.
Nach oben oder nach unten? Bergab lag die Kleinstadt Paia, ein verschlafenes Surfer-Nest. Wie weit war sie seitdem gefahren? Mindestens neun Meilen. Durch den Dschungel würde sie bis weit in den nächsten Morgen brauchen, um die Zivilisation zu erreichen. Andererseits war es nicht gesagt, dass der Empfang oben in den Bergen besser wäre. Denk nach, denk endlich nach. Sie schaute auf das Display ihres Handys: 19:45. Von ihrem Vorsprung blieben ihr noch knappe zwanzig Minuten.
Die erfolgversprechendste Alternative lag auf der Hand: Sie musste zurück zu der Stelle, an der der Verrückte sie das letzte Mal erreicht hatte. Dort konnte sie sicher telefonieren. Aber das hieß: zurück in Richtung der Stimme. Zurück in Richtung des Psychopathen, der dort in seinem Wagen auf sie lauerte. Jessica schauderte bei dem bloßen Gedanken daran. Aber war es nicht doch die beste aller Optionen? Sie überlegte fieberhaft. Oder sollte sie sich durch den Dschungel zur Stadt durchschlagen? Nein, entschied Jessica. Sie musste Adrian so schnell wie möglich erreichen, es musste ihr einfach gelingen, das Blatt zu wenden, ihr Schicksal wieder selbst in die Hand zu nehmen. Sie warf noch einmal einen Blick auf das Handy: zehn vor acht. Ihr blieben noch fünfzehn Minuten. Und Warten machte die Situation mit Sicherheit nicht besser.
Aus ihrem Versteck hinter den Bambushalmen spähte sie über den Fluss. Es war gerade noch hell genug, um ohne Verletzungen auf die andere Seite zu gelangen. Also los, Jessica, spornte sie sich an. Sie nahm ihren kostbarsten Schatz, das Handy, in die linke und die schwere Taschenlampe in die rechte Hand. Es war ihre einzige Waffe, und sie war fest entschlossen, sie auch einzusetzen, wenn sie musste.
Nachdem sie den Fluss ohne Probleme überquert hatte, hielt sie am anderen Ufer kurz inne und lauschte. Sie vernahm das Knacken von berstendem Holz. Wo kam das Geräusch her? Sie konnte es nicht lokalisieren. War er das? Verzweifelt starrte sie gegen die schwarze Wand. Jetzt war es auf einmal wieder still, nur das Plätschern des Bachs war zu hören. Und seine eiskalte, unbeteiligte Stimme in ihrem Kopf: »Ich gebe dir eine halbe Stunde, Jessica.«
Sie packte die Stablampe fester und begann, sich zwischen den dichten Sträuchern hindurchzuzwängen. Die Blätter und Zweige kratzten bei jeder Bewegung an ihrer Schulter und raschelten beim Zurückschnellen. Das Geräusch kam ihr unwirklich laut vor. Und sie hatte noch ein gutes Stück Weg vor sich, denn sie musste das Auto des Verrückten umgehen, um etwas weiter im Westen zur Straße zu gelangen. Dort würde sie dann endlich telefonieren können. Zur Sicherheit überprüfte Jessica noch einmal den Handyempfang: nichts. Der Boden war mit kräftigen Halmen bewachsen, und bei fast jedem Schritt schnitten die Fasern tief in die Haut ihrer nackten Fußsohlen. Denk nicht dran.
Sie schlich etwa fünfzig Meter Richtung Straße, immer wieder starrte sie auf die Balken ihres Telefons, aber sie bewegten sich nicht. Zum Glück war der Akku voll aufgeladen. Sie schlug einen großen Bogen und erreichte eine kleine Anhöhe. Von dort aus konnte sie den Asphalt der Straße nur wenige Meter unter sich in der Dämmerung erkennen. Endlich! Und das Display zeigte ihr, dass sich ihr Telefon ins Netz eingewählt hatte. Mit zitternden Fingern drückte sie die Wahlwiederholung. Es dauerte eine kleine Ewigkeit, bis das Freizeichen ertönte. Sie presste den Lautsprecher ans Ohr und lauschte. Endlich klingelte es. Aber da war noch etwas anderes. Sie spürte einen Luftstoß an ihrem Rücken, ganz leicht. Es klingelte immer noch. Geh ran, Adrian, geh doch bitte ran.
»Ich wusste, dass du zurückkommen würdest«, sagte die kalte Stimme direkt neben ihrem freien Ohr. Sie warf den Kopf herum. Und blickte in eine hässliche schwarze Fratze. Der Teufel selbst ist hinter dir her! Der Schrecken fuhr ihr in die Knochen, ihre Beine gaben nach. Sie schlug wie wild mit der Maglite um sich, versuchte, ihren Peiniger zu treffen. Ihre Hand mit dem Telefon wurde brutal nach links weggeschlagen.
»Adrian!«, schrie Jessica auf und streckte ihre Hand nach dem Gerät aus, aber sie griff ins Leere: Ihr wichtigster Schatz war auf der Straße zerschellt. Die Fratze griff nach ihren Haaren, zog sie ruckartig nach hinten, sodass ihre Wirbelsäule krachte.
»Und jetzt lauf, Jessica«, forderte die Stimme und keuchte, bevor sie Jessica brutal vor sich her stieß.
KAPITEL 2
Februar 2011
National Center for the Analysis of Violent Crimes (NCAVC), Quantico, Virginia
Special Agent Sam Burke kratzte das Schwarze unter seinen Fingernägeln hervor und schnippte es in den Papierkorb, der rechts neben ihm stand. Ich sollte mehr Sport machen, nahm er sich vor und strich sich über sein blütenweißes Hemd, dessen leichte Wölbung verriet, dass er zugenommen hatte, seit er in Quantico arbeitete. Kein Wunder: morgens mit dem Auto zur Arbeit, den ganzen Tag am Computer und abends wieder mit dem Wagen nach Hause, ein Bewegungsmuster wie ein Gorilla im Zoo, nur ohne Klettergarten. Dazwischen Kantinenfutter und Donuts. Das konnte ja nichts werden, urteilte Sam und biss in die süße Teigschnecke, die auf seinem staub- und aktenfreien Schreibtisch lag.
Burke hielt nichts von Akten und ebenso wenig von liegen gelassener Arbeit. Sie vermehrt sich, wenn man sie alleine lässt, referierte er grundsätzlich, wenn er auf die blitzblanke Arbeitsfläche angesprochen wurde. Sam wusste jedoch, dass er gar keinen Ordnungsfimmel hatte, auch wenn einiges dafür sprach: Er besaß siebzehn Paar gleiche Schuhe in zwei Farben, neun schwarze Anzüge, fünfundzwanzig Paar identische Socken, dreizehn weiße Hemden und eine Jeans. Letztere trug er nur sonntags, was natürlich nur weiteres Wasser auf die Mühlen der Bürogerüchte war. Er hatte eben Prinzipien. Aber nicht um der Ordnung willen, sondern nur, weil es praktischer war.
Mochten sie ihn doch ruhig für einen Knorrkopf halten, Hauptsache, die Arbeit vermehrt sich nicht wie die Karnickel – bloß, weil man einen Moment nicht hingeschaut hat, sinnierte er, als das Telefon klingelte. Gelangweilt blickte er auf das Display: Irgendein Wesley Brown mit der Durchwahl 2256. »Wesley, dich habe ich schon bei Raumschiff Enterprise gehasst, du neunmalkluger, besserwisserischer Teenyarsch«, sagte Sam. Er nahm trotzdem ab. Eine Stunde später sollte er feststellen, dass er nicht komplett danebengelegen hatte.
Als er den schmucklosen Flur der Experimental Cyber Crime Unit hinunterging, fragte er sich immer noch, was die Eltern geritten haben musste, ihrem Jungen ausgerechnet den Namen Wesley zu geben. Konnte es angehen, dass sie gar keine Ahnung hatten, dass sie ihrem Jungen damit die Höchststrafe verpassten? Nein, unmöglich. Als Kinder der Achtziger- und Neunzigerjahre mussten sie Raumschiff Enterprise einfach kennen. Jeder kennt Raumschiff Enterprise und das Besserwisser-Arschloch. Und Tasha Yar, Traumfrau seiner Jugend. Nur getoppt von seiner Expartnerin Klara, deren lebenslange Wut er ausgerechnet dadurch auf sich gezogen hatte, dass er ihre Karriere vernichtet hatte.
Wie oft hatte er sich schon gefragt, ob es hätte anders laufen können, ob ihn doch Schuld traf, wie es Klara unterstellte. Bis heute verfasste er wöchentlich einen Brief und schrieb ihn in seiner krakeligen Handschrift auf feinstes Büttenpapier. Ob sie immer noch als Kellnerin arbeitete? Wahrscheinlich, was hatte sie schon für eine Wahl als Ex-Cop auf Bewährung? Ob sie irgendwann einsehen würde, dass alles längst verloren gewesen war, dass er gar nichts mehr für sie hätte tun können?
Ihre Beziehung hatte er unwiederbringlich zerrüttet, so viel war ihm klar. Aber konnten sie nicht wenigstens auf einer freundschaftlichen Ebene wieder zueinander finden? Wenn Sam ehrlich war, glaubte er nicht daran. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Er vermisste die Abende mit ihr vor dem Kamin, wenn er sie »Sissi« genannt hatte, und wie sie gelacht hatten über den größten Unsinn.
Als er die Tür zu Wesley Browns Büro öffnete, schnupperte er. Das war doch eindeutig ein Burger, oder nicht? Ein wunderbar gebratener Burger mit Zwiebeln und einer knackigen roten Tomatenscheibe.
»Was ist das hier? Ein verdammter Drive-In?«, fragte er mit gespielt verärgerter Stimme.
Ein schmächtiger rothaariger Junge, der tatsächlich ein wenig aussah wie der Fähnrich aus dem Fernsehen, nahm hektisch die Füße vom Schreibtisch und stapelte Papier auf den armen Burger. Banause, dachte Sam.
»Entschuldigen Sie, Sir. Das ist mein Mittagess…«
»Entspannen Sie sich, Fähnrich Crusher«, unterbrach ihn Sam. Hatte der Jungspund wirklich die Augen gerollt bei Fähnrich Crusher? Er konnte kaum älter sein als das Fernsehvorbild, vielleicht Anfang zwanzig. Die neu gegründete Cyber Crime Unit, die sich um Hacker und andere subversive Elemente des angebrochenen Jahrtausends kümmerte, brachte eine ganze Schar anders aussehender und vor allem jüngerer Kollegen zum FBI. Sam, der trotz seiner konservativen Ticks durchaus als aufgeschlossener Vertreter seiner Generation galt, freute sich darüber, obwohl er das kaum öffentlich zugeben würde. Für die Cyberjungs gehörte er mit seinen zweiundvierzig Jahren doch schon fast zum alten Eisen.
»Okay, Sir, kein Problem, Sir«, stammelte Wesley, der sich offensichtlich wieder gefangen hatte.
»Sag mal, kommst du vom Marineball, oder was ist los? Lass das Sir-Gesabbel und sag mir lieber, was es mit diesem Bildscanner auf sich hat, von dem du mir am Telefon vorgeschwärmt hast«, verlangte Sam und stellte zufrieden fest, dass es ihm gelungen war, Wesley zu verunsichern. Seine Taktik, wenn er auf einen der Frischlinge stieß, war stets die gleiche, und normalerweise funktionierte sie blendend. Bis auf Klara, da hatte es nicht geklappt. Schon wieder Klara. Verzieh dich aus meinem Kopf, wenigstens bis nach Feierabend, okay?
»Ähm«, stotterte der rothaarige Junge, »also. Wir testen gerade eine neue Technologie, die wir mit den Jungs von Google entwickelt haben. Einfach gesagt, ist es eine erweiterte Bildsuche im Netz, die dann mit unserer Vermisstendatenbank abgeglichen wird.«
Sam starrte ihn verständnislos an.
»Okay, also noch mal zum Mitschreiben«, setzte der Rothaarige neu an. Eine Frechheit, die ihm Sam normalerweise nie hätte durchgehen lassen, aber er hatte heute seinen gütigen Tag. Der Teenager zeigte auf einen Bildschirm auf seinem Schreibtisch: »Nehmen wir dieses Foto einer vermissten Person.« Es handelte sich um eine bildhübsche Frau mit spanischen Gesichtszügen. Wunderschön, korrigierte sich Sam selbst. »Und nehmen wir auf der anderen Seite«, er deutete auf einen zweiten Bildschirm, »eine umfassende Bildersuche im Internet: Firmenserver, private Homepages, soziale Netzwerke, das ganze Paket. Die Ergebnisse sehen Sie hier.«
Sam zog die rechte Augenbraue nach oben. Dieses Greenhorn wollte ihm also sagen, dass sie eine Person, die als vermisst gemeldet wurde und die am anderen Ende der Welt ein Facebook-Profil anlegte, finden könnten, oder etwa nicht? Darauf lief es hinaus. Sam musste feststellen, dass er an den Ausführungen des Computerfreaks zumindest mildes Interesse zeigte. Aber was hatte das mit ihm zu tun? Die Opfer seiner Klienten eröffneten keine Facebook-Seiten mehr. Nie mehr. »Behavioral Science Unit 2«, das hieß übersetzt: Serienmörder.
»Bei einem Testlauf mit Datensätzen des Violent Criminal Apprehension Program (ViCAP) haben wir Folgendes gefunden.« Er rief eine Datei auf, die den ganzen Bildschirm füllte.
»Heilige Scheiße«, murmelte Sam und setzte sich auf den freien Platz neben Fähnrich Crusher.
KAPITEL 3
März 2011
Strafgerichtshof der Stadt New York, New York City
Pia Lindt goss nach. § 7 der Steinschen Prozessordnung lautete: »Ein leeres Glas hemmt den Strafverteidiger.« Und so viel hatte sie in den drei Monaten gelernt, die sie jetzt für Thibault Godfrey Stein und seine überaus prestigeträchtige Kanzlei arbeitete: Seine ureigene Prozessordnung war ihm wichtig, wenn nicht heilig. Und so achtete sie peinlich genau darauf, den Wasserstand nicht unter zwei Drittel sinken zu lassen und stets die korrekte Akte bereitzulegen.
Leider waren seine Kapriolen schwer vorauszusagen. Vor Gericht konnte der kleine, zerbrechlich wirkende Mann Haken schlagen wie ein aufgescheuchter Rehbock. Aber sie hatte den Job ergattert, den jeder ehrgeizige Strafrechtsstudent am meisten begehrte: Steins Assistent. Zum einen umwehte die Kanzlei ein legendärer Ruf, zum anderen wurde hinter vorgehaltener Hand kolportiert, dass Stein weder Nachfolger noch Erben ausgewählt hatte. Für die zielstrebigen angehenden Juristen, die über die Flure von Harvard, Yale oder Stanford hetzten, bedeuteten Prestige und Geld eine unwiderstehliche Mischung. »Der Winkeladvokat« nannte man ihn an den Eliteuniversitäten – nicht despektierlich sondern bewundernd. Denn kein Strafverteidiger hatte eine ähnlich beeindruckende Bilanz wie Thibault Godfrey Stein aufzuweisen, der kaum 1 Meter 65 große, weißhaarige Mann mit dem aschgrauen Gesicht, dessen Nase – wie Pia Lindt zum wiederholten Male feststellte – aussah wie eine verdorrte Ingwerwurzel.
Stein hatte einen Footballstar rausgepaukt, der seine Ehefrau erschlagen hatte – oder doch nicht? Er hatte einen Kolumbianer verteidigt, in dessen Auto fünfzig Kilogramm Kokain gefunden worden waren – aber war es tatsächlich sein Wagen? Für Stein begann Schuld erst beim Urteilsspruch, und § 10 seiner Prozessordnung besagte: »Wenn du nicht gewinnen kannst, verlier wenigstens nicht.« Pia war gespannt, wie er das heute anstellen wollte, denn der Fall lag glasklar auf der Hand, und die Beweise gegen ihren Mandanten schienen geradezu erdrückend.
Soeben beendigte die Anklage die Vernehmung ihres wichtigsten Zeugen, des Detectivs der Mordkommission, der ihren Fall bearbeitet hatte. Es war gut gelaufen für den Staatsanwalt, kein Geschworener, der seine fünf Sinne beisammen hatte, konnte an seinen präzisen Ausführungen zweifeln. Jetzt lag es an Stein. Der Staatsanwalt schritt zu seinem Platz, die Absätze seiner teuren italienischen Schuhe knallten auf den hundert Jahre alten Steinfliesen des Gerichtssaals. Schwungvoll ließ er sich in den Stuhl fallen und reckte siegessicher den Hals.
»Ihr Zeuge, Herr Verteidiger«, skandierte der Richter.
Pia blickte auf die Knollennase zu ihrer Linken. Stein hatte die Fingerspitzen ineinandergefaltet und lächelte. Er trank einen Schluck aus dem vollen Wasserglas. Nicht zu schnell, nicht zu langsam, gerade so, dass es unbeabsichtigt wirkte. Er räusperte sich: »Danke.«
»Meine Damen und Herren Geschworenen«, begann er die Vernehmung des Zeugen, was ungewöhnlich war. »Vor Ihnen sitzt ein treuer Diener dieser Stadt, ein ehrbarer Polizist. Mr. Foudy ist ohne Frage das, was wir alle«, er ließ seinen Blick über ihre Gesichter wandern, »einen aufrichtigen Mann nennen.«
Foudy rutschte unruhig auf dem Zeugenstuhl hin und her.
»Ich würde ihm jederzeit das Leben meiner Kinder anvertrauen«, fuhr der kleine Mann fort. »Denn ich weiß, er wird sie mit seinem eigenen Leben beschützen. Wie jeden einzelnen Bürger der Stadt New York. Wie Sie alle«, wieder ließ er den Blick über die Geschworenenbank schweifen. »Habe ich nicht recht, Lieutenant Foudy?«
Der Polizist nickte erstaunt, sicher fragte er sich, wann endlich die Befragung begann.
»Aber …«, Stein blieb vor der Geschworenenbank stehen und hielt inne, »… darum geht es heute gar nicht, nicht wahr? Heute geht es nicht darum, festzustellen, dass Lieutenant Foudy ein ehrbarer Polizist ist, dem wir blind unsere Kinder anvertrauen würden. Im Grunde geht es sogar um das Gegenteil.«
Die Geschworenen blickten sich jetzt gegenseitig Rat suchend an, offensichtlich hatte Stein sie mit seinem Vortrag verwirrt, sie waren genauso wenig wie Foudy darauf vorbereitet, mitten im Prozess eine Art Abschlussplädoyer zu hören.
Stein ließ sich nicht beirren: »Ich will gerne zugeben, was die Staatsanwaltschaft heute Vormittag so trefflich dargelegt hat: Giorgio Canelli kam am 23. Februar um 23:05 Uhr nach Hause. Mit dem Wagen. Von einem Geschäftsessen in der Innenstadt. Er hatte einen Teller Spaghetti gegessen und ein Glas Rotwein getrunken.«
Pia Lindt lächelte innerlich. Ein Teller Spaghetti? Laut Aussage ihres Mandanten hatte es sich um Bandnudeln mit Trüffeln aus dem Périgord gehandelt und beim Rotwein um einen sündhaft teuren Barolo, für den das Restaurant dreihundertfünfzig Dollar in Rechnung gestellt hatte. Stein versuchte, die Lebenswelt seines Mandanten in Griffnähe der Geschworenen zu rücken. Es war Pias dritter Gerichtstermin mit Stein, und er hatte sich jedes Mal für eine gänzlich andere Strategie entschieden. § 3 der Prozessordnung: Wechsele deine Taktik öfter als deine Krawatten. Pia begann zu begreifen, warum man Steins Methode nicht studieren konnte und weshalb er jede Lehrtätigkeit kategorisch ablehnte. Seine Art zu denken wäre kaum in einem Seminar vermittelbar.
Pia wunderte sich abermals, dass er gerade sie als Assistentin ausgewählt hatte. Lag es an ihrem Aussehen? Sie hielt sich für nicht unattraktiv, aber als Model wäre sie schon vor dem ersten Casting rausgeflogen. Mit 1 Meter 80 besaß sie zwar Laufstegmaße, aber leider nur, was die erforderliche Größe anging. Sie hatte eine zu weibliche Figur und eine zu große Nase. Dachten Männer dabei auch an eine Ingwerwurzel?, erschreckte sie sich und betastete unauffällig ihre Gesichtsmitte. Quatsch, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Konzentrier dich lieber wieder auf den Prozess, Pia.
»Als Mr. Canelli die Haustür aufschloss, rief er nach seiner Frau.« Stein bestätigte immer noch die Sicht der Staatsanwaltschaft, was im Grunde vollkommen überflüssig war. Pia wunderte sich, wann ihr Chef endlich auf den Punkt kommen würde.
»Aber sie antwortet nicht«, fuhr er fort. »Canelli ging in die Küche, goss sich ein Glas Rotwein ein und nahm die Treppe hinunter zum Schlafzimmer, wo er seine Frau vermutete. Er rief ihren Namen: ›Maria, Schatz, bist du da?‹ Immer wieder rief er ihren Namen. Als er immer noch keine Antwort bekam, betrat er durch die geöffnete Terrassentür den Poolbereich. Dann der Schock. Er sieht seine Frau auf dem Boden liegen in einer Lache aus Blut. Er stürzt zu ihr, beugt sich über sie, nimmt ihren Kopf in die Arme. Ungläubig, wie betäubt. Er ruft weiter ihren Namen, obwohl er weiß, dass es sinnlos ist. Das Loch in ihrem Kopf lässt kaum einen Zweifel zu. Er sieht sich um, da liegt eine Pistole. Er nimmt sie in die Hand, immer noch ungläubig vor Trauer und Entsetzen. Seine geliebte Frau ist tot. Die Nachbarn hatten einen Schuss gehört und die Polizei gerufen. Lieutenant Foudy war in der Nähe, und so ist er es, der ebendiese Szene mit gezogener Waffe betritt. Natürlich ist er auf der Hut, wer wäre das nicht? Schließlich hatte jemand geschossen. Lieutenant Foudy nähert sich also mit gezogener Waffe dem Pool.«
Stein veränderte seine Position, er adressierte jetzt nicht mehr die Geschworenen, sondern den Zeugen der Anklage: »Hat es sich so abgespielt, Lieutenant?«
Der dickliche Polizist räusperte sich, es war eindeutig, dass er es gewohnt war, im Zeugenstand zu sitzen. Er wusste, was die Staatsanwaltschaft von ihm erwartete, er redete klar und deutlich: »Das glaube ich nicht, Herr Verteidiger.«
»Das ist interessant, Herr Foudy. Sie glauben das also nicht …« Stein runzelte die Stirn und drehte sich wieder zu den Geschworenen. Er gestikulierte mit seinem Gehstock, das Licht der Deckenlampen spiegelte sich auf dem silbernen Knauf. »Das ist wichtig, bitte prägen Sie sich das genau ein: Lieutenant Foudy glaubt nicht, dass es sich so abgespielt hat.«
Der Beamte wollte protestieren, aber Stein schnitt ihm das Wort ab: »Denn genau darum geht es heute in Wirklichkeit. Wir müssen uns heute nicht entscheiden, ob wir Lieutenant Foudy blind unsere Kinder anvertrauen. Er ist ein ehrbarer Polizist, über jeden Zweifel erhaben, da sind wir uns alle einig. Aber heute, meine Damen und Herren, geht es um die Frage, ob ein ehrbarer Mann das glauben kann, was wirklich geschehen ist. Und ich muss zugeben, ich kann Lieutenant Foudy verstehen. Stellen Sie sich vor, Sie kommen an einen Tatort, Nachbarn haben Schüsse gehört. Sie bewegen sich also mit gezogener Waffe durch ein unbekanntes Haus, befürchten, jeden Moment niedergeschossen zu werden. Und als Sie den Pool erreichen, sitzt da ein Mann mit einer Waffe in der Hand, seinen Kopf über eine Leiche gebeugt. Was denken Sie?«
Er blickte die Geschworenen an. Dann stakste er langsam zu Pia zurück, nahm einen Schluck Wasser. Mit dem Trinken gibt er ihnen Zeit zum Nachdenken, und zwar auf eine Art, die den Geschworenen vermittelt, nicht etwa sie, sondern er selbst bräuchte eine Denkpause, bemerkte sie. Deshalb auch der Wasserglasparagraph. Der Alte war wirklich ein Fuchs.
Er trank halb aus, erst dann wandte er sich wieder an die Geschworenen und lächelte: »Natürlich denken Sie das. Jeder hätte das gedacht. Da sitzt der Täter mit der Waffe in der Hand. Natürlich. Jeder Mensch, der seine fünf Sinne beisammen hat, wäre sofort davon überzeugt. Deshalb glaubt Lieutenant Foudy ja auch nicht, dass es sich anders abgespielt haben könnte. Aber heute, meine Damen und Herren, ist es Ihre Pflicht herauszufinden, ob es tatsächlich und zwangsläufig der Ablauf der Ereignisse war. Oder könnte Mr. Canellis Version doch zutreffen? Denn wenn Sie auch nur einen kleinen Zweifel haben, ob es nicht doch anders gewesen sein könnte, darf Herr Canelli auch morgen und übermorgen seine Spaghetti in Freiheit genießen. Nur, wenn Sie sich ganz sicher sind, dass kein anderer Täter infrage kommt, dürfen Sie ihn wegen Mordes verurteilen.«
Stein machte eine weitere Kunstpause, bevor er fortfuhr: »Sagen Sie, Mr. Foudy, wie viele Jahre sind Sie schon bei der Polizei?«
»Ich feiere im nächsten Jahr mein fünfundzwanzigjähriges Dienstjubiläum«, antwortete er mit sichtlichem Stolz.
»Man könnte also mit Fug und Recht behaupten, Sie sind ein Experte für Tatorte, oder nicht?«
Der Mann nickte.
Stein kramte in den Unterlagen, die Pia so gedreht hatte, dass er sie bequem lesen konnte. »Bei Tatorten ganz im Allgemeinen … Wo finden Sie meistens Ihr bestes Beweismaterial? Die brauchbarsten Spuren? Nicht auf diesen Fall bezogen, nur ganz im Allgemeinen. Sagen wir von allen Mordfällen, die Sie bisher bearbeitet haben.«
»Nun ja, in aller Regel dort, wo sich die meiste DNA findet. Im Bett, in der Dusche, auf einem Kamm …«
»Zum Beispiel im Abfluss eines Pools?«, fragte Stein mit veränderter Stimme. Sie klang jetzt scharf wie eine Rasierklinge, die durch Papier gleitet. Pia spürte, dass Stein in die entscheidende Phase kam.
»Im Allgemeinen schon …«, setzte der Polizist an, aber Stein unterbrach ihn.
»Und sagen Sie, Mr. Foudy, haben Sie den Abfluss von Mr. Canellis Pool auf DNA-Spuren untersuchen lassen?«
»Das war in diesem Fall nicht notwendig, da ja die Waffe …«
»Beantworten Sie bitte einfach meine Frage, Mr. Foudy: Haben Sie Mr. Canellis Pool auf DNA-Spuren untersuchen lassen?«
»Nein, aber …«
»Sehen Sie, Mr. Foudy, ich schon«, lächelte Stein nachsichtig. »Wie ich schon eingangs erwähnte: Ich kann Sie gut verstehen. Jeder normale Mensch hätte reagiert wie Sie. Er sitzt mit der Waffe am Pool, über die Leiche gebeugt. Sonnenklarer Fall. Sie nehmen ihm die Waffe aus der Hand und versuchen, ihn zu beruhigen.«
»Aber er war ganz ruhig …«, versuchte Foudy für den Staatsanwalt zu retten, was zu retten war. Dieser rutschte jetzt auf seinem Stuhl hin und her und wartete auf die Möglichkeit, gegen ein neues Beweismittel Einspruch zu erheben. Er kramte in seinen Unterlagen, ob er etwas übersehen haben könnte, sein Gesicht war kreidebleich.
»Wissen Sie, was erstaunlich ist, Mr. Foudy? Es gab im Pool Spuren von genau vier Personen: Zum einen von Mr. Canelli und seiner Frau, was nicht verwundern darf angesichts der Tatsache, dass es sich um ihren Pool handelt. Dann vom Poolboy, auch dies wäre kein Grund zur Beunruhigung. Aber es gab noch eine vierte DNA-Spur, Mr. Foudy. Laut dem Reinigungsplan des Pools war der Filter am Morgen getauscht worden. Dieser Jemand muss also am selben Tag in Mr. Canellis Haus gewesen sein – und zwar in der Nähe des Pools oder gar im Pool. Könnte es nicht sein, dass dieser Jemand Mrs. Canelli erschossen hat und sich doch alles so zugetragen hat, wie es der Angeklagte geschildert hat?«
Der Lieutenant gewann Selbstsicherheit zurück: »Nun, theoretisch ja. Aber die Spuren könnten von jedermann stammen. Oder können Sie mir vielleicht sagen, von wem die DNA stammt?«
»Nun, Mr. Foudy, das kann ich tatsächlich«, sprach Stein nun wieder zu den Geschworenen, mit einer kraftvollen Stimme, die wie die eines Fernsehpredigers klang. »Denn er ist wegen Körperverletzung vorbestraft. Es handelt sich um Matteo d’Alba.« Stein deutete mit seinem Gehstock ins Publikum. »Dürfte ich Sie bitten aufzustehen, Mr. d’Alba?«
Im Publikum erhob sich ein dunkel aussehender, grobschlächtiger Kerl mit Lederjacke und grinste schief Richtung Geschworenenbank. Im Saal wurde es schlagartig unruhig, es wurde heftig getuschelt, und einige Zuschauer hielt es kaum auf ihren Bänken. Auch dem Staatsanwalt stand der Mund offen, und Pia war in diesem Moment klar, dass Stein gewonnen hatte. Zumindest diese Jury würde Canelli niemals mehr verurteilen, und die Staatsanwaltschaft würde sich sehr bemühen müssen, wenn sie ein zweites Verfahren erwirken wollte.
Der Staatsanwalt packte seine Sachen zusammen, während er aufstand und nuschelte: »Die Staatsanwaltschaft beantragt, das Verfahren einzustellen.«
Während sich der Richter bemühte, mit dem Hammer für Ruhe zu sorgen, zischelte der Staatsanwalt dem Polizisten zu: »Verdammte Schlamperei, Foudy. Sehen Sie zu, dass Sie Land gewinnen. Und schaffen Sie mir alles über diesen d’Alba ran.«
Pia stand jetzt neben Stein, der die Anweisung des Staatsanwalts mit angehört hatte. Er lächelte spöttisch: »Lieber Herr Kollege, aber d’Alba sagt, er war es gar nicht. Er sagt, der da war’s«, und zeigte auf einen Mann in der hintersten Reihe, der dem frisch gebackenen vermeintlichen Täter wie aus dem Gesicht geschnitten schien.
»Sie sind eineiige Zwillinge«, zwinkerte Stein dem Staatsanwalt zu. »Und ich denke, wir sind uns einig, dass Sie damit Ihren Prozess gegen die d’Albas vergessen können. Eineiige Zwillinge haben eine nahezu identische DNA. Lesen Sie es nach, Sie werden ihnen höchstens nachweisen, dass einer von den beiden am Tatort war, aber niemals, welcher«, verabschiedete er sich und zwängte sich durch den Mittelgang, wobei er die überschwängliche Dankesrede von Canelli überhörte, der die Hand nach ihm ausstreckte.
Pia folgte ihm mit den Unterlagen, die sie in einem Stapel vor der Brust balancierte. Auch sie lächelte. Es war ein gutes Gefühl, zu gewinnen, obwohl sie nicht sicher war, ob heute die Gerechtigkeit einen Sieg davongetragen hatte.
Draußen vor der Tür wartete bereits Steins Limousine, ein alter Rolls Royce Phantom VI. Dieselbe Staatskarosse, die auch die Queen immer noch fuhr, und laut Stein das letzte ordentliche Auto, das jemals gebaut worden war.
Als die Reportermeute abgeschüttelt und die schwere Wagentür ins Schloss gefallen war, atmete Pia durch. Sie legte die Unterlagen zwischen sich und den kleinen alten Mann und strich den Rock ihres Kostüms glatt. Sie versuchte ihren Blick starr geradeaus zu richten, aber Stein forderte sie ganz direkt auf: »Na kommen Sie schon, Miss Lindt. Fragen Sie.«
Sie betrachtete ihren Chef von der Seite. Er schien zufrieden zu sein, ja beinahe glücklich. Seine kleinen Augen neben der Ingwerknolle lachten, die Falten seines über siebzig Jahre alten Gesichts sahen nicht müde aus. Auf einmal wirkte er gar nicht mehr so zerbrechlich wie zuvor im Gerichtssaal.
»Wie kommt man damit zurecht?«, fragte Pia. »Mit der Schuld unserer Mandanten?«
Ihr Chef lächelte nachsichtig: »So dürfen Sie das nicht sehen, Miss Lindt. Es ist nicht unsere Aufgabe, über die Schuld oder Unschuld unserer Mandanten zu urteilen. Wir tun unsere Pflicht, der Staatsanwalt tut die seine. Und wenn die Gegenseite nur über eingeschränkte Kreativität verfügt, was den Tathergang anbelangt … sei’s drum. Sie hätten ebenso gut wie wir den Poolabfluss untersuchen können. Haben sie aber nicht.«
»Sie wollen also sagen, dass Sie die DNA-Spuren nicht manipuliert haben?«, fragte Pia hoffnungsvoll.
»Genauso wenig, wie Canelli seine Frau umgebracht hat, Miss Lindt«, bestätigte Stein, und seine Mundwinkel verzogen sich leicht nach unten, als hätte er Mühe, bei dem Gedanken daran nicht zu grinsen.
Pia schaute aus dem Fenster, um in Ruhe über Steins Aussage nachzudenken. Wie so oft redete der alte Mann in kurzen Sätzen, mit denen er es trotzdem schaffte, mehrmals die Richtung zu wechseln. Hatte nun Canelli seine Frau erschossen oder nicht? Sie wusste es nicht mehr. Noch lange vor dem Lunch konnte einen dieser alte Mann mit dem Gehstock und dem unfassbar hellen Verstand um selbigen bringen.
Sie blickte durch die Fensterscheibe nach draußen: Schier endlose Reihen aus hauptsächlich schwarzen, weißen oder silbernen Autos schoben sich im Schneckentempo durch die Häuserschluchten. Vier Spuren ärgerlich hupender Fahrer, die sich gegenseitig die nächsten Zentimeter streitig machten. In der buntesten Stadt der Welt gab es die wenigsten farbigen Autos. Einzig die leuchtend gelben Taxis brachten ein wenig Abwechslung in das Einerlei aus Blech. Im Stop-and-go der Rushhour, die in Manhattan erst weit nach Sonnenuntergang endete, bewunderte Pia wieder einmal die Fahrkünste von Edward, Steins Chauffeur, dem es dennoch gelang, sie wie in einer Sänfte durch die Straßen zu gondeln. Der Mann war noch älter als Thibault, mit einem gütigen Gesicht, wie man es sich von seinem Großvater wünscht. Und er war ebenso charmant.
Pia ließ sich in das weiche Leder fallen und warf einen Blick zu Stein. Er las seine E-Mails, die er sich heute Morgen von ihr hatte ausdrucken lassen. Sein amüsierter Gesichtsausdruck war verschwunden, er grübelte über etwas, seine Stirn in Falten gelegt.
»Ist etwas passiert, Mr. Stein?«, fragte Pia vorsichtig.
»Das könnte man so sagen, Miss Lindt«, gab Stein zu. Er seufzte: »Wir müssen einem alten Freund eine unangenehme Nachricht überbringen. Bitte reichen Sie mir das Telefon.«
Pia fischte in ihrer Aktentasche nach ihrem Mobiltelefon. Die Kanzlei besaß keins. Stattdessen hatten sie mit Stahlstich handgeprägte Visitenkarten und eine Telefonanlage, die seit drei Jahren »Santa Claus is coming to Town« spielte, auch im Hochsommer. So gut der Ruf der Kanzlei auch war, einen gewissen Anachronismus konnte man Stein nicht absprechen. Ihr Chef wählte die Nummer aus dem Gedächtnis, es musste sich also um einen wirklich guten Freund handeln, schlussfolgerte Pia.
»Adrian, hier ist Stein. Leider erreiche ich Sie nicht persönlich, aber wir müssen uns sehen, so schnell wie möglich. Sind Sie in New York? Rufen Sie mich bitte zurück, die Nummer ist …«, Stein gestikulierte mit seinem Stock in ihre Richtung. Pia notierte ihre eigene Nummer auf einen Zettel und reichte ihn herüber. Stein nannte die Nummer und legte dann einfach auf, wahrscheinlich mochte er keine Anrufbeantworter oder war sie nicht gewohnt, mutmaßte Pia. Sie nahm das Telefon zurück und legte es in ihren Schoß. Danach schaute sie fragend zu Stein hinüber, aber er hatte sich schon wieder in seine Akten vertieft.
Etwa zwanzig Minuten später betraten sie die Kanzlei an der altehrwürdigen Upper East Side. Das viktorianische Stadthaus beherbergte in der Beletage die Kanzlei, in den oberen beiden Stockwerken wohnte Stein selbst. Er war auch insofern ein ungewöhnlicher Anwalt, als er sich trotz der dicken Honorare, die er zweifelsohne einstrich, keine Sekretärin leistete. Pia war seine einzige Mitarbeiterin. Deshalb schloss sie die Haustür auf, die in das Treppenhaus führte, das sich wie eine eng gewundene Schlange durch das keineswegs riesige Haus zog.
Dennoch war Pia klar, dass es auf dem Markt mindestens fünfzehn Millionen Dollar bringen würde, aber den New Yorker Häusermarkt verstand seit der Immobilienkrise ohnehin niemand mehr. Stein wippte schon ungeduldig mit den Knien, und Pia beeilte sich, die Tür zur Kanzlei zu öffnen. Stein schritt voran über den dunklen Holzboden. Ihr Büro bestand nur aus drei Zimmern. Besucher betraten zunächst den großen Empfangsraum, an dessen Wänden alte Gemälde hingen. Wuchtige Sessel, bezogen mit schwerem grünem Leder, thronten darunter, auf kleinen Tischen standen Aschenbecher neben Zeitschriften über Polo und Segeln.
Stein zog sich ohne Umschweife in sein Büro zurück, einen riesigen Raum, der an eine Bibliothek erinnerte. Pia hängte ihren Mantel an die Garderobe und betrat ihr eigenes Arbeitszimmer. Obwohl deutlich kleiner als das von Stein, fühlte Pia sich dort recht wohl. Die altbackene, aber ehrwürdige Einrichtung half ihr, die Arbeit vom Privatleben zu trennen. Einzig die nackten Wände störten sie ein wenig. Zum wiederholten Male nahm Pia sich vor, endlich Bilder aufzuhängen, um dem Raum wenigstens den Hauch einer persönlichen Note zu geben, als ihr Handy klingelte. Sie meldete sich mit ihrem vollen Namen.
»Miss Lindt, ich habe diese Nummer von Thibault Stein. Oder habe ich mich verwählt?«, fragte eine äußerst angenehme Männerstimme. Pia schluckte, das musste der wichtige Klient sein, mit dem sich Stein treffen wollte. Oder hatte er ihn nicht sogar als alten Freund bezeichnet?
Sie räusperte sich: »Nein, nein. Sie sind bei mir durchaus richtig. Ich bin Pia Lindt, Steins neue Assistentin. Er hat Sie von meinem Handy aus angerufen.«
»Hat er sich etwa immer noch kein eigenes besorgt?«, tadelte die attraktive Männerstimme. Er klang amüsiert. »Wissen Sie, warum er mich treffen will?«
»Leider nein, Herr …«
»Von Bingen. Verzeihen Sie, ich habe mich nicht vorgestellt. Mein Name ist Adrian von Bingen.«
»Also, Herr von Bingen. Mit dieser Information kann ich leider nicht dienen, aber ich kann Sie gerne mit Herrn Stein …«
»Das wird nicht nötig sein, Miss Lindt. Sagen Sie Thibault, dass ich in der Stadt bin und heute Abend bei ihm vorbeikomme. Sagen wir um 20 Uhr? Wäre Ihnen das recht?«
Im Hintergrund hörte sie, wie Metall auf Metall schlug, woraufhin ein Mann einige sehr unanständige Flüche auf Spanisch von sich gab.
»Ehrlich gesagt, Herr von Bingen, das weiß ich nicht … Der private Kalender ist …«
»Sagen Sie ihm doch bitte, er möge mich anrufen, wenn es ihm nicht passt … Ich muss los, die Gäste warten. Es hat mich sehr gefreut, Sie am Telefon kennengelernt zu haben, Miss Lindt.«
Pia blickte mit hochgezogenen Brauen auf das Telefon und drückte die Taste, um die Verbindung zu unterbrechen. Sie hatte noch nie von diesem Klienten gehört, er klang überaus freundlich. Nein, das war eigentlich nicht das richtige Wort. Wie er wohl aussah? Sie machte sich auf den Weg in Steins Büro, ihre Stöckelschuhe klackerten auf dem alten Parkettboden, der vor einigen Jahren liebevoll restauriert worden war.
Die Tür war offen, aber sie blieb aus Höflichkeit davor stehen und klopfte an das lackierte Holz der Wandvertäfelung. Der Anwalt saß an seinem riesigen Schreibtisch und machte sich Notizen, eine alte Messinglampe warf schummriges Licht auf das weiße Papier. Er winkte sie herein und blickte nach ein paar Sekunden auf.
»Adrian von Bingen hat zurückgerufen. Er ist in New York und würde Sie gerne heute Abend treffen. Wenn es Ihnen passt, kommt er um 20 Uhr hierher.«
Stein lehnte sich in seinem Stuhl zurück: »Das ist gut, Miss Lindt. Sagen Sie ihm, er ist wie immer herzlich willkommen.«
»Er meinte, wenn wir uns nicht melden, kommt er einfach vorbei.«
»Auch gut. Typisch Adrian. Dann soll er ruhig kommen. Mal sehen, ob der Keller noch eine ordentliche Flasche Rotwein vorzuweisen hat.«
Pia wandte sich um und wollte gerade den Raum verlassen, als Stein sie noch einmal zurückrief: »Ach, Miss Lindt, ich hätte Sie übrigens gerne dabei heute Abend. Könnten Sie sich um kurz vor acht bei mir einfinden? Es tut mir leid, wenn ich Ihnen die Abendplanung verhagele, aber es könnte sein, dass Arbeit auf uns zukommt.«
Welche Abendplanung?, ärgerte sich Pia. Seit John ausgezogen war, herrschte abends nichts als Ebbe in ihrem privaten Terminkalender. Ein Rotwein mit Thibault Stein versprach zumindest interessanter zu werden, als getrocknete Apfelringe vor der neuesten Folge von Lost zu knabbern.
»Kein Problem. Wer ist eigentlich dieser Adrian von Bingen? Er ist mir bisher in den Akten noch nicht begegnet.«
»Das wundert mich nicht, Miss Lindt. Ich kenne Adrian schon eine halbe Ewigkeit und seinen Vater sogar fast doppelt so lange. Sein Vater ist ein wichtiger Klient für uns, Adrian selbst ist … nun ja, die Franzosen würden wohl sagen, das ›Enfant terrible‹ der Familie. Aber ich mag ihn. Sehr sogar. Er ist mir über die Jahre beinah zu so etwas wie einem Freund geworden.«
Pia konnte sich bei Steins Arbeitspensum kaum vorstellen, dass er Zeit für Freunde fand. Sie war gespannt darauf, wen Stein in seiner Wohnung empfangen wollte: »Wieso empfangen Sie ihn eigentlich nicht hier in der Kanzlei wie alle anderen?«, fragte Pia.
»Wie ich schon sagte, er ist ein Freund, Miss Lindt. Und die offiziellen Dienste der Kanzlei könnte er sich ohnehin nicht leisten. Ihm ist es lieber so, und mir ehrlich gesagt auch.«
»Sie sprachen im Taxi davon, wir hätten ihm eine schlechte Nachricht zu überbringen?«
»Ja, leider …«, begann ihr Chef und erzählte ihr, warum ihm der Besuch so am Herzen lag.
Vier Stunden später stand Pia vor Steins Wohnungstür. Sie hatte sich wenigstens noch kurz frischmachen wollen, bevor sie die attraktive Stimme kennenlernen sollte. Und Adrians Geschichte, die ihr Stein am Nachmittag erzählt hatte, hatte ihre Erwartungen noch befördert.
Von Bingen entstammte einem alten deutschen Adelsgeschlecht mit beachtlichem Vermögen, von dem er allerdings vor fünfzehn Jahren komplett enterbt worden war, nachdem er sich mit seinem Vater wegen seines Werdegangs überworfen hatte: Nach einer Kochlehre, der sein Vater noch zähneknirschend zugestimmt hatte, hatte sich Adrian in den Kopf gesetzt, in Mexico City eine Armenküche zu eröffnen. Seinem Vater gegenüber hatte er die Meinung vertreten, es sei endlich an der Zeit, dass ihre Familie der Welt etwas zurückgebe, von der sie über die Jahrhunderte so viel genommen habe. Sein Vater hatte ihn daraufhin ohne Umschweife aus dem Haus geworfen. In seinen Augen war Adrian ein Nichtsnutz, ein Tagelöhner und ein Schmarotzer, er werde schon sehen, was ihm die Einstellung zum Vermögen seiner Vorfahren einbrächte. Adrian war ohne ein weiteres Wort ausgezogen und nach Mexiko gegangen.
Dort führte er ein armes, aber erfülltes Leben – und er fand die Liebe seines Lebens: Jessica. Er verlor sie jedoch sechs Jahre später, nur zwei Wochen nach ihrer Hochzeit, im zarten Alter von achtundzwanzig Jahren: Während ihrer Flitterwochen auf Hawaii war sie spurlos verschwunden, ihr Auto entdeckte die Polizei, von einem Sprengsatz zerstört, in einem verlassenen Waldstück. Die groß angelegte Suchaktion endete vier Wochen später ergebnislos.
Adrian fiel in ein Loch, »tiefer als die Hölle«, so hatte Stein es beschrieben. Er begann zu trinken, verließ Mexiko, wo ihn alles an Jessica erinnerte, und kam nach New York. Seitdem arbeitete er als Koch in einem drittklassigen Restaurant an der 42. Straße, das verkochte Pasta an nichtsahnende Touristen verkaufte.
Laut Stein war er einer der besten Köche, die er kannte, aber Adrian schien die Lust am Essen verloren zu haben. Wenigstens trank er nicht mehr übermäßig und konnte seine Stromrechnung bezahlen.
Pia hatte die Geschichte tief berührt. Natürlich wussten alle, allen voran die Polizei, dass Jessica von Bingen nicht mehr lebte, nie mehr zu ihrem liebenden Ehemann zurückkehren würde. Ermordet worden war. Aber Adrian hatte keinen Leichnam, den er zu Grabe tragen konnte, und so hatte er sich nie ganz frei machen können von Zweifel und Ungewissheit.
Wie fühlte es sich an, wenn ein geliebter Mensch einfach verschwand? Wie ging man mit Leere und Trauer um, wenn die Gewissheit fehlte? Pia stellte es sich unendlich grausam vor.
—
Bevor sie die Klingel zu Steins Wohnung drückte, zupfte sie noch einmal ihre Bluse zurecht. Sie hatte sich für einen etwas modischeren Hosenanzug entschieden als den spießigen Rock von heute Mittag, aber schließlich handelte es sich immer noch um einen Klienten, auch wenn Stein ihn privat empfing, um ihm die horrenden Rechnungen der Kanzlei zu ersparen.
Im Inneren ertönte ein angenehm dunkler Dreiklang. Pia war noch nie zuvor in Steins Wohnung eingeladen worden, normalerweise fanden alle Besprechungen in der Kanzlei im Erdgeschoss statt. Sie war neugierig, wie ihr Chef wohl leben mochte. Er öffnete die Tür in demselben schwarzen Anzug und mit perfekt gebundener Krawatte wie immer. Wahrscheinlich zog er den edlen Zwirn nicht mal zum Schlafen aus, vermutete Pia. Er begrüßte sie herzlich: »Guten Abend, Miss Lindt. Freut mich, dass Sie es einrichten konnten.«
Er führte sie in sein Wohnzimmer und bot ihr ein Glas Rotwein an, das Pia dankend akzeptierte. Das Appartement unterschied sich nur in der Einrichtung von der Kanzlei. Auch hier waren die Wände mit dunklem Holz vertäfelt, aber es lag ein dicker Teppich unter dem flachen Tisch, der vor einer riesigen Eckcouch stand. Im Kamin knisterte ein Feuer, und auch in seinem Wohnzimmer wurde Steins Faible für Bücher deutlich: Die gesamte hintere Wand nahm ein Regal ein, das mit alten Bänden geradezu vollgestopft war. Pia wusste nicht, was Stein tun wollte, wenn er auch nur ein einziges weiteres Exemplar darin unterbringen musste.
Als sie sich auf dem Sofa gegenübersaßen, fragte Stein das erste Mal nach ihrem Privatleben, allerdings zurückhaltend, als wolle er sie nicht drängen. Pia genoss den schweren Rotwein, der nach Brombeeren und Ebenholz duftete, und beantwortete geduldig seine Fragen. Sie hätte gar nicht gewusst, was sie ihm hätte verschweigen sollen.
Um kurz nach acht klingelte es an der Haustür. Stein wollte sich schon auf seinen Gehstock gestützt aus der bequemen Couch stemmen, als Pia ihn zurückhielt: »Warten Sie, ich mache das schon. Ich kenne ja jetzt den Weg.« Stein lächelte dankbar.
Als Pia die Haustür öffnete, war sie ehrlich überrascht. In ihrer behutsam geschürten Erwartungshaltung hatte sie entweder einen Koch mit Schmuddelhemd oder einen langweiligen Blaublüter mit Karojackett erwartet, aber nicht einen smarten Mittdreißiger, der noch viel besser aussah, als es die Stimme am Telefon versprochen hatte: Er trug ein offenes weißes Hemd, Jeans und eine Lederjacke, die irgendwie … reichlich mitgenommen aussah. Unter einem wuscheligen Lockenkopf blitzten sie zwei grüne Augen an.
»Guten Abend, Miss Lindt, nehme ich an. Mein Name ist Adrian von Bingen«, begrüßte er sie und schüttelte ihr die Hand.
»Pia Lindt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Kommen Sie rein, Mr. Stein wartet schon.«
Er betrat die Wohnung und lief schnurstracks Richtung Wohnzimmer, ohne sie weiter zu beachten. Er kannte sich aus, vermerkte Pia, und konnte nicht umhin, ihn nochmals zu mustern: Sie schätzte ihn auf 1 Meter 85, und er hatte eine Figur, die man als Koch in Pias Augen gar nicht hätte haben geschweige denn behalten können. Seine Unterarme waren kräftig, aber nicht übermäßig muskulös, seine Hände hatten schlanke Finger, nur zwei kleine Pflaster wiesen auf die Arbeit am heißen Herd hin, und er roch nach Gras statt nach Fett. Ein überaus attraktiver Blaublüter, der gar nicht aussieht wie ein Hilfskoch, stellte Pia fest.
Stein begrüßte ihn herzlich. Sie umarmten sich, obwohl sie sich siezten, was Pia ausgesprochen seltsam vorkam. Nachdem Stein auch dem Neuankömmling ein Glas Wein angeboten und alle auf dem großen Sofa Platz genommen hatten, blickte von Bingen sie erwartungsvoll an. Er hielt das Glas in beiden Händen zwischen seinen Knien wie einen Kelch. Als ahnte er, dass ihn unangenehme Nachrichten erwarteten. Pia blickte zu Boden.
Schließlich fragte er: »Warum haben Sie mich hergebeten, Thibault?«
Stein zögerte eine Sekunde, bevor er antwortete: »Adrian, ich habe unerfreuliche Neuigkeiten.«
Sein Gegenüber machte keine Anstalten zu antworten, sondern starrte mit leerem Blick in das Tiefrot zwischen seinen Beinen. Schließlich blickte er auf. Das Funkeln in seinen Augen war verschwunden, sein Blick war leer und traurig: »Es geht um Jessica, nicht wahr?«
Stein nickte.
Pia bemerkte, dass Adrian schluckte. Er schaute zu Thibault auf: »Haben sie Jessica endlich gefunden?«
Der Anwalt trank einen Schluck Wein, bevor er antwortete: »Nicht ganz«, und reichte ihm ein Blatt Papier, auf dem in den schlierigen Lettern eines Faxes das Siegel des FBI zu erkennen war. Pia, die das Schreiben am Nachmittag gelesen hatte, lief ein Schauer den Rücken hinunter.
Adrian nahm die Seite mit zittrigen Fingern entgegen und blickte lange Zeit darauf, ohne etwas zu sagen. Als er die Augen schloss, löste sich eine einzelne Träne und zerplatzte auf der Glasplatte des Couchtischs.
»Thibault, werden Sie mir helfen, die Beerdigung für Jessica zu organisieren?«
Der alte Mann drückte seine Hand und sagte: »Natürlich, Adrian. Das ist doch selbstverständlich.«
—
Anderthalb Wochen später standen Pia, Thibault und Adrian vor dem Aushub auf dem Green Wood Friedhof in Brooklyn. Der Ehemann hatte sich eine Trauerfeier im kleinsten Kreis gewünscht, er habe ja auch sonst niemanden, hatte er ihnen erklärt.
Der Regen pladderte in Strömen auf die schwarzen Regenschirme, und ihre Schuhe versanken im aufgeweichten Gras, als statt eines Sargs eine kleine Urne in die Grube gelassen wurde. Adrian von Bingen warf ein Schäufelchen Erde in das Grab, danach eine rote Rose.
Pia stand neben ihm, er schien beinahe erleichtert. Sie griff nach der Schaufel: »Schade, dass wir uns nie kennengelernt haben, Jessica«, murmelte sie und hoffte, dass es in Adrians Augen nicht anmaßend klang. Die Krumen fielen auf die Urne, die in der Mitte des Erdlochs ruhte.
Als Pia ihm ihr Beileid aussprach und seine Hand schüttelte, schien Adrian kurz irritiert. Er schaute über ihre Schulter und nickte kaum merklich jemandem zu. Pia traute sich nicht, sich umzudrehen. Erst als sie auf dem Kiesweg Richtung Ausgang schritten, warf sie einen Blick zurück. Ein älterer Herr und eine Frau waren an das Grab getreten. Sie sahen traurig und verloren aus. Adrian von Bingen drehte sich nicht mehr zu ihnen um.
KAPITEL 4
Mai 2011
Brooklyn, New York City
Klara ›Sissi‹ Swell schwitzte. 56, 57 … Die Muskeln ihrer Oberarme brannten wie Feuer. Sie presste die Lippen zusammen. Komm, Klara, noch drei. Bäuchlings auf einer schmalen Bank liegend, griff sie fest um die beiden Fünfundzwanzig-Kilogramm-Hanteln und zog sie nach oben: 58, 59, 60. Erleichtert atmete sie auf und ließ die Gewichte auf die Gummimatte fallen. Mit der Eleganz, wie sie nur ehemalige Spitzenturnerinnen aufbringen, stemmte sie sich hoch und schwang sich seitlich auf die Bank. Obwohl es in dem billigsten Fitnessstudio der Lower East Side kalt war wie in einem Kühlschrank, dampfte ihr Körper von der Anstrengung ihres täglichen Trainings.
Sie musste in Form bleiben. Denn wenn schon nichts in ihrem Leben mehr die gewohnte Form aufwies, sollte wenigstens ihr Körper den alten Glanz behalten. Und als ehemalige Turnerin mit der typischen zierlichen Figur war sie stolz auf jedes Kilo Muskeln, das sie in den letzten drei Jahren dazuaddiert hatte.
Sie trank einen Schluck aus der mitgebrachten Wasserflasche und sah auf die Uhr: Mist, schon Viertel nach drei. In weniger als einer halben Stunde begann ihre Schicht im Schiller’s. Auf dem Weg nach draußen warf sie die leere Plastikflasche in den Mülleimer gegenüber der Rezeption. Für Charlie. Es gibt immer welche, denen es noch schlechter geht, denk daran, Sissi. Danke für die Erinnerung, Daddy, ich hätte nicht für möglich gehalten, dass ich jemals darüber nachdenken könnte, das Pfand doch lieber selbst einzustecken.
Zwanzig Minuten später saß Klara auf einem abgeranzten Barhocker, nippte an einem Glas Cola und blätterte durch ihre Post, die sie auf dem Weg zur Arbeit aus dem Briefkasten gefischt hatte.
Was trieb ihn nur dazu, ihr immer wieder Briefe zu schicken, die sie doch nicht las?, sinnierte sie und zerriss den Umschlag in vier Teile. Ansonsten fand sie in dem Stapel nur Werbung für einen Sushilieferservice, der auch Pizza im Angebot hatte, eine Reinigungsfirma, die versprach, bei Abgabe von drei Mänteln zwei Hosen kostenlos mitzusäubern, und einen Brief der Bradford Hills Correctional Facility. Letzteren öffnete sie mit zitternden Fingern, sie hatte von dort noch nie gute Nachrichten erhalten.
Sie entfaltete das matschig-graue Umweltpapier mit dem offiziellen Emblem des Gefängnisses: Ihr Gesuch um Wiederaufnahme des Verfahrens »The People vs. Klara Swell« war abgelehnt worden.
»Damn it«, fluchte Klara und schmiss das gesamte Papierzeug in einen großen Mülleimer, der hinter der Bar stand.
»Sissi«, bellte eine Stimme aus der Küche. »Arbeit!«
Seufzend schwang sie sich mit einer eleganten Bewegung von dem für sie viel zu hohen Stuhl. Ihren Spitznamen, der sie schon seit über fünfzehn Jahren verfolgte, hatte sie ihren braunen Locken zu verdanken. Sie trug sie seit ihrer Jugend kinnlang, und sie umrahmten ihr Gesicht wie ein Jugendstilrahmen. Dazu noch Turnerin – es hatte keiner großen Phantasie bedurft, sie mit dem Spitznamen der österreichischen Zuckerbäckerkaiserin zu titulieren. Und irgendwie war er hängen geblieben, bis heute.
Die Küche lag im hinteren Teil der Bar, und es herrschte wie üblich hektische Betriebsamkeit. Zwar war um vier Uhr nachmittags noch kein Hochbetrieb, aber ein paar frühe Gäste saßen bereits in dem dunklen Lokal in der Lower East Side. In zwei Stunden würde es rund dreißig Minuten dauern, bis Gäste einen Platz bekamen und Klara sich auf ein ordentliches Trinkgeld freuen konnte.