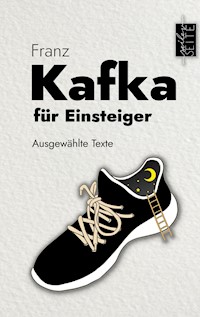
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der außergewöhnlichste Schriftsteller der deutschen Literaturgeschichte zu sein - diesen Ruf hat sich Franz Kafka gegen seinen eigenen Willen erschrieben. Auch einhundert Jahre nach seinem Tod faszinieren die oft düsteren, bisweilen rätselhaften Motive seiner Texte Leser und Literaten gleichermaßen, obwohl Kafka den Großteil seiner Werke nach seinem Ableben vernichten lassen wollte. Dieses Lesebuch zeigt einen abwechslungsreichen Querschnitt durch das vielfältige Schaffen des von Zweifeln geprägten und doch mit einer ausgezeichneten Beobachtungsgabe gesegneten Autors: Prosatexte, Lyrik, Tagebucheinträge, ein Drama und Romanauszüge gehören ebenso dazu wie ausgewählte Zitate und eine Kurzbiografie Kafkas. Die Lektüre ermöglicht so einen Einstieg in eine einzigartige Gedankenwelt, deren Wirkung auf Leser und Literaturgeschichte noch lange nachhallt. Aus dem Inhalt: Der Nachhauseweg Brief an den Vater Der Gruftwächter Die Verwandlung Ein Hungerkünstler Der Prozess Gestern kam eine Ohnmacht zu mir u.v.m.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Ein Traum
Der Nachhauseweg
Ein Brudermord
Meine Erziehung
Der Fahrgast
Gespräch mit dem Betrunkenen
Das nächste Dorf
Gespräch mit dem Beter
Das Gassenfenster
Der Gruftwächter
Gestern kam eine Ohnmacht zu mir
Ein Hungerkünstler
Kühl und hart
Der Advokat Dr. Bucephalus
Die Verwandlung (I.)
27. Januar 1922
Brief an den Vater
Der Prozess (Auszug)
Der Prozess: Rezension von Kurt Tucholsky
Quellenverzeichnis
Kurzbiografie von Franz Kafka
»Ich habe die Beobachtung gemacht, dass ich nicht deshalb den Menschen ausweiche, um ruhig zu leben, sondern um ruhig sterben zu können.«
Tagebucheintrag
Ein Traum
Josef K. träumte:
Es war ein schöner Tag und K. wollte spazieren gehn. Kaum aber hatte er zwei Schritte gemacht, war er schon auf dem Friedhof. Es waren dort sehr künstliche, unpraktisch gewundene Wege, aber er glitt über einen solchen Weg wie auf einem reißenden Wasser in unerschütterlich schwebender Haltung. Schon von der Ferne fasste er einen frisch aufgeworfenen Grabhügel ins Auge, bei dem er haltmachen wollte. Dieser Grabhügel übte fast eine Verlockung auf ihn aus und er glaubte gar nicht eilig genug hinkommen zu können. Manchmal aber sah er den Grabhügel kaum, er wurde ihm verdeckt durch Fahnen, deren Tücher sich wanden und mit großer Kraft aneinanderschlugen; man sah die Fahnenträger nicht, aber es war, als herrsche dort viel Jubel.
Während er den Blick noch in die Ferne gerichtet hatte, sah er plötzlich den gleichen Grabhügel neben sich am Weg, ja fast schon hinter sich. Er sprang eilig ins Gras. Da der Weg unter seinem abspringenden Fuß weiter raste, schwankte er und fiel gerade vor dem Grabhügel ins Knie. Zwei Männer standen hinter dem Grab und hielten zwischen sich einen Grabstein in der Luft; kaum war K. erschienen, stießen sie den Stein in die Erde und er stand wie festgemauert. Sofort trat aus einem Gebüsch ein dritter Mann hervor, den K. gleich als einen Künstler erkannte. Er war nur mit Hosen und einem schlecht zugeknöpften Hemd bekleidet; auf dem Kopf hatte er eine Samtkappe; in der Hand hielt er einen gewöhnlichen Bleistift, mit dem er schon beim Näherkommen Figuren in der Luft beschrieb.
Mit diesem Bleistift setzte er nun oben auf dem Stein an; der Stein war sehr hoch, er musste sich gar nicht bücken, wohl aber musste er sich vorbeugen, denn der Grabhügel, auf den er nicht treten wollte, trennte ihn von dem Stein. Er stand also auf den Fußspitzen und stützte sich mit der linken Hand auf die Fläche des Steines. Durch eine besonders geschickte Hantierung gelang es ihm, mit dem gewöhnlichen Bleistift Goldbuchstaben zu erzielen; er schrieb: »Hier ruht.« Jeder Buchstabe erschien rein und schön, tief geritzt und in vollkommenem Gold. Als er die zwei Worte geschrieben hatte, sah er nach K. zurück; K., der sehr begierig auf das Fortschreiten der Inschrift war, kümmerte sich kaum um den Mann, sondern blickte nur auf den Stein. Tatsächlich setzte der Mann wieder zum Weiterschreiben an, aber er konnte nicht, es bestand irgendein Hindernis, er ließ den Bleistift sinken und drehte sich wieder nach K. um. Nun sah auch K. den Künstler an und merkte, dass dieser in großer Verlegenheit war, aber die Ursache dessen nicht sagen konnte. Alle seine frühere Lebhaftigkeit war verschwunden. Auch K. geriet dadurch in Verlegenheit; sie wechselten hilflose Blicke; es lag ein hässliches Missverständnis vor, das keiner auflösen konnte. Zur Unzeit begann nun auch eine kleine Glocke von der Grabkapelle zu läuten, aber der Künstler fuchtelte mit der erhobenen Hand und sie hörte auf. Nach einem Weilchen begann sie wieder; diesmal ganz leise und, ohne besondere Aufforderung, gleich abbrechend; es war, als wolle sie nur ihren Klang prüfen. K. war untröstlich über die Lage des Künstlers, er begann zu weinen und schluchzte lange in die vorgehaltenen Hände. Der Künstler wartete, bis sich K. beruhigt hatte, und entschloss sich dann, da er keinen andern Ausweg fand, dennoch zum Weiterschreiben. Der erste kleine Strich, den er machte, war für K. eine Erlösung, der Künstler brachte ihn aber offenbar nur mit dem äußersten Widerstreben zustande; die Schrift war auch nicht mehr so schön, vor allem schien es an Gold zu fehlen, blass und unsicher zog sich der Strich hin, nur sehr groß wurde der Buchstabe. Es war ein J, fast war es schon beendet, da stampfte der Künstler wütend mit einem Fuß in den Grabhügel hinein, dass die Erde ringsum in die Höhe flog. Endlich verstand ihn K.; ihn abzubitten, war keine Zeit mehr; mit allen Fingern grub er in Erde, die fast keinen Widerstand leistete; alles schien vorbereitet; nur zum Schein war eine dünne Erdkruste aufgerichtet; gleich hinter ihr öffnete sich mit abschüssigen Wänden ein großes Loch, in das K., von einer sanften Strömung auf den Rücken gedreht, versank. Während er aber unten, den Kopf im Genick noch aufgerichtet, schon von der undurchdringlichen Tiefe aufgenommen wurde, jagte oben sein Name mit mächtigen Zierraten über den Stein.
Entzückt von diesem Anblick erwachte er.
Der Nachhauseweg
Man sehe die Überzeugungskraft der Luft nach dem Gewitter! Meine Verdienste erscheinen mir und überwältigen mich, wenn ich mich auch nicht sträube.
Ich marschiere und mein Tempo ist das Tempo dieser Gassenseite, dieser Gasse, dieses Viertels. Ich bin mit Recht verantwortlich für alle Schläge gegen Türen, auf die Platten der Tische, für alle Trinksprüche, für die Liebespaare in ihren Betten, in den Gerüsten der Neubauten, in dunklen Gassen an die Häusermauer gepresst, auf den Ottomanen der Bordelle.
Ich schätze meine Vergangenheit gegen meine Zukunft, finde aber beide vortrefflich, kann keiner von beiden den Vorzug geben und nur die Ungerechtigkeit der Vorsehung, die mich so begünstigt, muss ich tadeln.
Nur als ich in mein Zimmer trete, bin ich ein wenig nachdenklich, aber ohne dass ich während des Treppensteigens etwas Nachdenkenswertes gefunden hätte. Es hilft mir nicht viel, dass ich das Fenster gänzlich öffne und dass in einem Garten die Musik noch spielt.
»Das entscheidend Charakteristische dieser Welt ist ihre Vergänglichkeit.«
Aus den »Oktavheften«
Ein Brudermord
Es ist erwiesen, dass der Mord auf folgende Weise erfolgte:
Schmar, der Mörder, stellte sich gegen neun Uhr abends in der mondklaren Nacht an jener Straßenecke auf, wo Wese, das Opfer, aus der Gasse, in welcher sein Büro lag, in jene Gasse einbiegen musste, in der er wohnte.
Kalte, jeden durchschauernde Nachtluft. Aber Schmar hatte nur ein blaues Kleid angezogen; das Röckchen war überdies aufgeknöpft. Er fühlte keine Kälte; auch war er immerfort in Bewegung. Seine Mordwaffe, halb Bajonett, halb Küchenmesser, hielt er ganz bloßgelegt, immer fest im Griff. Betrachtete das Messer gegen das Mondlicht; die Schneide blitzte auf; nicht genug für Schmar; er hieb mit ihr gegen die Backsteine des Pflasters, dass es Funken gab; bereute es vielleicht; und um den Schaden gutzumachen, strich er mit ihr violinbogenartig über seine Stiefelsohle, während er, auf einem Bein stehend, vorgebeugt, gleichzeitig dem Klang des Messers an seinem Stiefel, gleichzeitig in die schicksalsvolle Seitengasse lauschte.
Warum duldete das alles der Private Pallas, der in der Nähe aus seinem Fenster im zweiten Stockwerk alles beobachtete? Ergründe die Menschennatur! Mit hochgeschlagenem Kragen, den Schlafrock um den weiten Leib gegürtet, kopfschüttelnd, blickte er hinab.
Und fünf Häuser weiter, ihm schräg gegenüber, sah Frau Wese, den Fuchspelz über ihrem Nachthemd, nach ihrem Mann aus, der heute ungewöhnlich lange zögerte.
Endlich ertönt die Türglocke vor Weses Büro, zu laut für eine Türglocke, über die Stadt hin, zum Himmel auf, und Wese, der fleißige Nachtarbeiter, tritt dort, in dieser Gasse noch unsichtbar, nur durch das Glockenzeichen angekündigt, aus dem Haus; gleich zählt das Pflaster seine ruhigen Schritte.
Pallas beugt sich weit hervor; er darf nichts versäumen. Frau Wese schließt, beruhigt durch die Glocke, klirrend das Fenster. Schmar aber kniet nieder; da er augenblicklich keine anderen Blößen hat, drückt er nur Gesicht und Hände gegen die Steine; wo alles friert, glüht Schmar.
Gerade an der Grenze, welche die Gassen scheidet, bleibt Wese stehn, nur mit dem Stock stützt er sich in die jenseitige Gasse. Eine Laune. Der Nachthimmel hat ihn angelockt, das Dunkelblaue und das Goldene. Unwissend blickt er es an, unwissend streicht er das Haar unter dem gelüfteten Hut; nichts rückt dort oben zusammen, um ihn die allernächste Zukunft anzuzeigen; alles bleibt an seinem unsinnigen, unerforschlichen Platz. An und für sich sehr vernünftig, dass Wese weitergeht, aber er geht ins Messer des Schmar.
»Wese!«, schreit Schmar, auf den Fußspitzen stehend, den Arm aufgereckt, das Messer scharf gesenkt. »Wese! Vergebens wartet Julia!« Und rechts in den Hals und links in den Hals und drittens tief in den Bauch sticht Schmar. Wasserratten aufgeschlitzt, geben einen ähnlichen Laut von sich wie Wese.
»Getan«, sagt Schmar und wirft das Messer, den überflüssigen blutigen Ballast, gegen die nächste Hausfront. »Seligkeit des Mordes! Erleichterung, Beflügelung durch das Fließen des fremden Blutes! Wese, alter Nachtschatten, Freund, Bierbankgenosse, versickerst im dunklen Straßengrund. Warum bist du nicht einfach eine mit Blut gefüllte Blase, dass ich mich auf dich setzte und du verschwändest ganz und gar. Nicht alles wird erfüllt; nicht alle Blütenträume reiften; dein schwerer Rest liegt hier, schon unzugänglich jedem Tritt. Was soll die stumme Frage, die du damit stellst?«
Pallas, alles Gift durcheinanderwürgend in seinem Leib, steht in seiner zweiflügelig aufspringenden Haustür. »Schmar! Schmar! Alles bemerkt, nichts übersehn.« Pallas und Schmar prüfen einander. Pallas befriedigt’s, Schmar kommt zu keinem Ende.
Frau Wese mit einer Volksmenge zu ihren beiden Seiten, eilt mit vor Schrecken ganz gealtertem Gesicht herbei. Der Pelz öffnet sich; sie stürzt über Wese; der nachthemdbekleidete Körper gehört ihm; der über dem Ehepaar sich wie der Rasen eines Grabes schließende Pelz gehört der Menge.
Schmar, mit Mühe die letzte Übelkeit verbeißend, den Mund an die Schulter des Schutzmannes gedrückt, der leichtfüßig ihn davonführt.
Meine Erziehung
Oft überlege ich es und lasse den Gedanken ihren Lauf, ohne mich einzumischen, und immer, wie ich es auch wende, komme ich zum Schluss, dass mir in manchem meine Erziehung schrecklich geschadet hat. In dieser Erkenntnis steckt ein Vorwurf, der gegen eine Menge Leute geht. Da sind die Eltern mit den Verwandten, eine ganz bestimmte Köchin, die Lehrer, einige Schriftsteller – die Liebe, mit der sie mir geschadet haben, macht ihre Schuld noch größer, denn wie sehr hätten sie mir mit Liebe ..., einige der Familie befreundete Familien, ein Schwimmmeister, Eingeborene der Sommerfrischen, einige Damen im Stadtpark, denen man es gar nicht ansehn würde, ein Friseur, eine Bettlerin, ein Steuermann, der Hausarzt und noch viele andere, und es wären noch mehr, wenn ich sie alle mit Namen bezeichnen wollte und könnte, kurz, es sind so viele, dass man achtgeben muss, damit man nicht im Haufen einen zweimal nennt. Nun könnte man meinen, schon durch diese große Anzahl verliere ein Vorwurf an Festigkeit und müsse einfach an Festigkeit verlieren, denn ein Vorwurf sei kein Feldherr, er gehe nur geradeaus und wisse sich nicht zu verteilen. Gar in diesem Falle, wenn er sich gegen vergangene Personen richtet. Die Personen mögen mit einer vergessenen Energie in der Erinnerung festgehalten werden, einen Fußboden werden sie kaum mehr unter sich haben, und selbst ihre Beine werden schon Rauch sein. Und Leuten in solchem Zustand soll man nun mit irgendeinem Nutzen Fehler vorwerfen, die sie in früheren Zeiten einmal bei der Erziehung eines Jungen gemacht haben, der ihnen jetzt so unbegreiflich ist wie sie uns. Aber man bringt sie ja nicht einmal dazu, sich an jene Zeiten zu erinnern, kein Mensch kann sie dazu zwingen, aber offenbar kann man gar nicht von Zwingen reden, sie können sich an nichts erinnern, und dringt man auf sie ein, schieben sie einen stumm beiseite, denn höchstwahrscheinlich hören sie gar nicht die Worte. Wie müde Hunde stehn sie da, weil sie alle ihre Kraft dazu verbrauchen, um in der Erinnerung aufrecht zu bleiben. Wenn man sie aber wirklich dazu brächte, zu hören und zu reden, dann würde es einem von Gegenvorwürfen nur so in den Ohren sausen, denn die Menschen nehmen die Überzeugung von der Ehrwürdigkeit der Toten ins Jenseits mit und vertreten sie von dort aus zehnfach. Und wenn diese Meinung vielleicht nicht richtig wäre und die Toten eine besonders große Ehrfurcht vor den Lebenden hätten, dann werden sie sich erst recht ihrer lebendigen Vergangenheit annehmen, die ihnen doch am nächsten steht, und wieder würden uns die Ohren sausen. Und wenn auch diese Meinung nicht richtig wäre und die Toten gerade sehr unparteiisch wären, so könnten sie es auch dann niemals billigen, dass man mit unbeweisbaren Vorwürfen sie stört. Denn solche Vorwürfe sind schon von Mensch zu Mensch unbeweisbar. Das Dasein von vergangenen Fehlern in der Erziehung ist [nicht] zu beweisen, wie erst die Urheberschaft. Und nun zeige man den Vorwurf, der sich in solcher Lage nicht in einen Seufzer verwandelte.
Das ist der Vorwurf, den ich zu erheben habe. Er hat ein gesundes Innere, die Theorie erhält ihn. Das, was an mir wirklich verdorben worden ist, aber vergesse ich vorerst oder verzeihe es und mache noch keinen Lärm damit. Dagegen kann ich jeden Augenblick beweisen, dass meine Erziehung einen anderen Menschen aus mir machen wollte als den, der ich geworden bin. Den Schaden also, den mir meine Erzieher nach ihrer Absicht hätten zufügen können, den mache ich ihnen zum Vorwurf, verlange aus ihren Händen den Menschen, der ich jetzt bin, und da sie ihn mir nicht geben können, mache ich ihnen aus Vorwurf und Lachen ein Trommelschlagen bis in die jenseitige Welt hinein. Doch dient das alles nur einem andern Zweck. Der Vorwurf darüber, dass sie mir doch ein Stück von mir verdorben haben – ein gutes schönes Stück verdorben haben – im Traum erscheint es mir manchmal wie andern die tote Braut –, dieser Vorwurf, der immer auf dem Sprung ist, ein Seufzer zu werden, er soll vor allem unbeschädigt hinüberkommen, als ein ehrlicher Vorwurf, der er auch ist. So geschieht es, der große Vorwurf, dem nichts geschehen kann, nimmt den kleinen bei der Hand, geht der große, hüpft der kleine, ist aber der kleine einmal drüben, zeichnet er sich noch aus, wir haben es immer erwartet, und bläst zur Trommel die Trompete.
Oft überlege ich es und lasse den Gedanken ihren Lauf, ohne mich einzumischen, aber immer komme ich zu dem Schluss, dass mich meine Erziehung mehr verdorben hat, als ich es verstehen kann. In meinem Äußern bin ich ein Mensch wie andere, denn meine körperliche Erziehung hielt sich ebenso an das Gewöhnliche, wie auch mein Körper gewöhnlich war, und wenn ich auch ziemlich klein und etwas dick bin, gefalle ich doch vielen, auch Mädchen. Darüber ist nichts zu sagen. Noch letzthin sagte eine etwas sehr Vernünftiges: »Ach, könnte ich Sie doch einmal nackt sehn, da müssen Sie erst hübsch und zum küssen sein.« Wenn mir aber hier die Oberlippe, dort die Ohrmuschel, hier eine Rippe, dort ein Finger fehlte, wenn ich auf dem Kopf haarlose Flecke und Pockennarben im Gesicht hätte, es wäre noch kein genügendes Gegenstück meiner innern Unvollkommenheit. Diese Unvollkommenheit ist nicht angeboren und darum um so schmerzlicher zu tragen. Denn wie jeder habe auch ich von Geburt aus meinen Schwerpunkt in mir, den auch die närrischste Erziehung nicht verrücken konnte. Diesen guten Schwerpunkt habe ich noch, aber gewissermaßen nicht mehr den zugehörigen Körper. Und ein Schwerpunkt, der nichts zu arbeiten hat, wird zu Blei und steckt im Leib wie eine Flintenkugel. Jene Unvollkommenheit ist aber auch nicht verdient, ich habe ihr Entstehn ohne mein Verschulden erlitten. Darum kann ich in mir auch nirgends Reue finden, soviel ich sie auch suche. Denn Reue wäre für mich gut, sie weint sich ja in sich selbst aus, sie nimmt den Schmerz beiseite und erledigt jede Sache allein wie einen Ehrenhandel; wir bleiben aufrecht, indem sie uns erleichtert.
Meine Unvollkommenheit ist, wie ich sagte, nicht angeboren, nicht verdient, trotzdem ertrage ich sie besser, als andere unter großer Arbeit der Einbildung mit ausgesuchten Hilfsmitteln viel kleineres Unglück ertragen, eine abscheuliche Ehefrau zum Beispiel, ärmliche Verhältnisse, elende Berufe, und bin dabei keineswegs schwarz vor Verzweiflung im Gesicht, sondern weiß und rot.
Ich wäre es nicht, wenn meine Erziehung so weit in mich gedrungen wäre, wie sie wollte. Vielleicht war meine Jugend zu kurz dazu, dann lobe ich ihre Kürze noch jetzt in meinen Vierzigerjahren aus voller Brust. Nur dadurch war es möglich, dass mir noch Kräfte bleiben, um mir der Verluste meiner Jugend bewusst zu werden, weiter, um diese Verluste zu verschmerzen, weiter, um Vorwürfe gegen die Vergangenheit nach allen Seiten zu erheben und endlich ein Rest von Kraft für mich selbst. Aber alle diese Kräfte sind wieder nur ein Rest jener, die ich als Kind besaß und die mich mehr als andere den Verderben der Jugend ausgesetzt haben, ja ein guter Rennwagen wird vor allen von Staub und Wind verfolgt und überholt, und seine Räder fliegen über die Hindernisse, dass man fast an Liebe glauben sollte.
Was ich jetzt noch bin, wird mir am deutlichsten in der Kraft, mit der die Vorwürfe aus mir herauswollen. Es gab Zeiten, wo ich in mir nichts anderes als vor Wut getriebene Vorwürfe hatte, dass ich bei körperlichem Wohlbefinden mich auf der Gasse an fremden Leuten festhielt, weil sich die Vorwürfe in mir von einer Seite auf die andere warfen, wie Wasser in einem Becken, das man rasch trägt.
Jene Zeiten sind vorüber. Die Vorwürfe liegen in mir herum wie fremde Werkzeuge, die zu fassen zu heben ich kaum den Mut mehr habe. Dabei scheint die Verderbnis meiner alten Erziehung mehr und mehr in mir von neuem zu wirken, die Sucht, sich zu erinnern, vielleicht eine allgemeine Eigenschaft der Junggesellen meines Alters, öffnet wieder mein Herz jenen Menschen, welche meine Vorwürfe schlagen sollten, und ein Ereignis wie das gestrige, früher so häufig wie das Essen, ist jetzt so selten, dass ich es notiere.
Aber darüber hinaus noch bin ich selbst, ich, der jetzt die Feder weggelegt hat, um das Fenster zu öffnen, vielleicht die beste Hilfskraft meiner Angreifer. Ich unterschätze mich nämlich, und das bedeutet schon ein Überschätzen der andern, aber ich überschätze sie noch außerdem. Und abgesehen davon, schade ich mir noch geradeaus. Überkommt mich Lust zu Vorwürfen, schaue ich aus dem Fenster. Wer leugnet es, dass dort in ihren Booten die Angler sitzen, wie Schüler, die man aus der Schule auf den Fluss getragen hat; gut, ihr Stillehalten ist oft unverständlich, wie jenes der Fliegen auf den Fensterscheiben. Und über die Brücke fahren die Elektrischen, natürlich wie immer mit vergröbertem Windesrauschen und läuten wie verdorbene Uhren, kein Zweifel, dass der Polizeimann, schwarz von unten bis hinauf, mit dem gelben Licht der Medaille auf der Brust, an nichts anderes als an die Hölle erinnert und nun mit Gedanken, ähnlich den meinen, einen Angler betrachtet, der sich plötzlich – weint er, hat er eine Erscheinung oder zuckt der Kork? – zum Bootsrand bückt. Das alles ist richtig, aber zu seiner Zeit, jetzt sind nur die Vorwürfe richtig.
Sie gehn gegen eine Menge Leute, das kann ja erschrecken, und nicht nur ich aus dem offenen Fenster, auch jeder andere würde lieber den Fluss ansehn. Da sind die Eltern und die Verwandten. Dass sie mir aus Liebe geschadet haben, macht ihre Schuld noch größer, denn wie sehr hätten sie mir aus Liebe nützen können; dann befreundete Familien mit bösem Blick, aus Schuldbewusstsein machen sie sich schwer und wollen nicht in die Erinnerung hinauf; dann die Haufen der Kindermädchen, der Lehrer und der Schriftsteller und eine ganz bestimmte Köchin mitten unter ihnen, dann, zur Strafe ineinander übergehend, ein Hausarzt, ein Friseur, ein Steuermann, eine Bettlerin, ein Papierverkäufer, ein Parkwächter, ein Schwimmeister, dann fremde Damen aus dem Stadtpark, denen man es gar nicht ansehn würde, Eingeborene der Sommerfrischen als Verhöhnung der unschuldigen Natur und viele andere; aber es wären noch mehr, wenn ich sie alle mit Namen nennen wollte und könnte, kurz, es sind so viele, dass man achtgeben muss, dass man sie nicht zweimal nennt.
Ich überlege es oft und lasse den Gedanken ihren Lauf, ohne mich einzumischen, aber immer komme ich zu dem gleichen Schluss, dass die Erziehung mich mehr verdorben hat als alle Leute, die ich kenne, und mehr als ich begreife. Doch kann ich das nur einmal von Zeit zu Zeit aussprechen, dann fragt man mich danach: »Wirklich? Ist das möglich? Soll man das glauben?« Schon suche ich es aus nervösem Schrecken einzuschränken.
Außen schaue ich wie jeder andere aus; habe Beine, Rumpf und Kopf, Hosen, Rock und Hut; man hat mich ordentlich turnen lassen, und wenn ich dennoch ziemlich klein und schwach geblieben bin, so war das eben nicht zu vermeiden. Im übrigen gefalle ich vielen, selbst jungen Mädchen, und denen ich nicht gefalle, die finden mich doch erträglich.
Wenn ich es bedenke, so muss ich sagen, dass mir meine Erziehung in mancher Richtung sehr geschadet hat. Ich bin ja nicht irgendwo abseits, vielleicht in einer Ruine in den Bergen, erzogen worden, dagegen könnte ich ja kein Wort des Vorwurfes herausbringen. Auf die Gefahr hin, dass die ganze Reihe meiner vergangenen Lehrer dies nicht begreifen kann, gerne und am liebsten wäre ich jener kleine Ruinenbewohner gewesen, abgebrannt, von der Sonne, die da zwischen den Trümmern von allen Seiten auf den lauen Efeu mir geschienen hätte, wenn ich auch im Anfang schwach gewesen wäre unter dem Druck meiner guten Eigenschaften, die mit der Macht des Unkrauts in mir emporgewachsen wären.
Wenn ich es bedenke, so muss ich sagen, dass mir meine Erziehung in mancher Richtung sehr geschadet hat. Dieser Vorwurf trifft eine Menge Leute, nämlich meine Eltern, einige Verwandte, einzelne Besucher unseres Hauses, verschiedene Schriftsteller, eine ganz bestimmte Köchin, die mich ein Jahr lang zur Schule führte, einen Haufen Lehrer (die ich in meiner Erinnerung eng zusammendrücken muss, sonst entfällt mir hie und da einer, da ich sie aber so zusammengedrängt habe, bröckelt wieder das Ganze stellenweise ab), einen Schulinspektor, langsam gehende Passanten, kurz, dieser Vorwurf windet sich wie ein Dolch durch die Gesellschaft und keiner, ich wiederhole, leider keiner ist dessen sicher, dass die Dolchspitze nicht einmal plötzlich vorn, hinten oder seitwärts erscheint. Auf diesen Vorwurf will ich keine Widerrede hören, da ich schon zu viele gehört habe und da ich in den meisten Widerreden auch widerlegt worden bin, beziehe ich diese Widerreden mit in meinen Vorwurf und erkläre nun, meine Erziehung und diese Widerlegung haben mir in mancherlei Richtung sehr geschadet.
Oft überlege ich es, und immer muss ich dann sagen, dass mir meine Erziehung in manchem sehr geschadet hat. Dieser Vorwurf geht gegen eine Menge Leute, allerdings sie stehn hier beisammen, wissen wie auf alten Gruppenbildern nichts miteinander anzufangen, die Augen niederzuschlagen fällt ihnen gerade nicht ein und zu lächeln wagen sie vor Erwartung nicht. Es sind da meine Eltern, einige Verwandte, einige Lehrer, eine ganz bestimmte Köchin, einige Mädchen aus Tanzstunden, einige Besucher unseres Hauses aus früherer Zeit, einige Schriftsteller, ein Schwimmmeister, ein Billeteur, ein Schulinspektor, dann einige, denen ich nur einmal auf der Gasse begegnet bin, und andere, an die ich mich gerade nicht erinnern kann, und solche, an die ich mich niemals mehr erinnern werde, und solche endlich, deren Unterricht ich, irgendwie damals abgelenkt, überhaupt nicht bemerkt habe, kurz, es sind so viele, dass man achtgeben muss, einen nicht zweimal zu nennen. Und ihnen allen gegenüber spreche ich meinen Vorwurf aus, mache sie auf diese Weise miteinander bekannt, dulde aber keine Widerrede. Denn ich habe wahrhaftig schon genug Widerreden ertragen, und da ich in den meisten widerlegt worden bin, kann ich nicht anders, als auch diese Widerlegungen in meinen Vorwurf mit einzubeziehen und zu sagen, dass mir außer meiner Erziehung auch diese Widerlegungen in manchem sehr geschadet haben.
Erwartet man vielleicht, dass ich irgendwo abseits erzogen worden bin? Nein, mitten in der Stadt bin ich erzogen worden, mitten in der Stadt. Nicht zum Beispiel in einer Ruine in den Bergen oder am See. Meine Eltern und ihr Gefolge waren bis jetzt von meinem Vorwurf bedeckt und grau, nun schieben sie ihn leicht beiseite und lächeln, weil ich meine Hände von ihnen weg an meine Stirn gezogen habe und denke: Ich hätte der kleine Ruinenbewohner sein sollen, horchend ins Geschrei der Dohlen, von ihren Schatten überflogen, auskühlend unter dem Mond, wenn ich auch am Anfang ein wenig schwach gewesen wäre unter dem Druck meiner guten Eigenschaften, die mit der Macht des Unkrauts in mir hätten wachsen müssen, abgebrannt von der Sonne, die zwischen den Trümmern hindurch auf mein Efeulager von allen Seiten mir geschienen hätte.
»Je länger man vor der Tür zögert, desto fremder wird man.«
Aus der Erzählung »Heimkehr«
Der Fahrgast
Ich stehe auf der Plattform des elektrischen Wagens und bin vollständig unsicher in Rücksicht meiner Stellung in dieser Welt, in dieser Stadt, in meiner Familie. Auch nicht beiläufig könnte ich aussprechen, welche Ansprüche ich in irgendeiner Richtung mit Recht vorbringen könnte. Ich kann es gar nicht verteidigen, dass ich auf dieser Plattform stehe, mich an dieser Schlinge halte, von diesem Wagen mich tragen lasse, dass Leute dem Wagen ausweichen oder still gehn oder vor den Schaufenstern ruhn. – Niemand verlangt es ja von mir, aber das ist gleichgültig.
Der Wagen nähert sich einer Haltestelle, ein Mädchen stellt sich nahe den Stufen, zum Aussteigen bereit. Sie erscheint mir so deutlich, als ob ich sie betastet hätte.
Sie ist schwarz gekleidet, die Rockfalten bewegen sich fast nicht, die Bluse ist knapp und hat einen Kragen aus weißer kleinmaschiger Spitze. Die linke Hand hält sie flach an die Wand, der Schirm in ihrer Rechten steht auf der zweitobersten Stufe. Ihr Gesicht ist braun, die Nase, an den Seiten schwach gepresst, schließt rund und breit ab. Sie hat viel braunes Haar und verwehte Härchen an der rechten Schläfe. Ihr kleines Ohr liegt eng an, doch sehe ich, da ich nahe stehe, den ganzen Rücken der rechten Ohrmuschel und den gebogenen Schatten an der Wurzel.
Ich fragte mich damals: Wieso kommt es, dass sie nicht über sich verwundert ist, dass sie den Mund geschlossen hält und nichts dergleichen sagt.
Gespräch mit dem Betrunkenen
Als ich aus dem Haustor mit kleinem Schritte trat, wurde ich von dem Himmel mit Mond und Sternen und großer Wölbung und von dem Ringplatz mit Rathaus, Mariensäule und Kirche überfallen.
Ich ging ruhig aus dem Schatten ins Mondlicht, knöpfte den Überzieher auf und wärmte mich; dann ließ ich durch Erheben der Hände das Sausen der Nacht schweigen und fing zu überlegen an:
»Was ist es doch, dass Ihr tut, als wenn Ihr wirklich wäret. Wollt Ihr mich glauben machen, dass ich unwirklich bin, komisch auf dem grünen Pflaster stehend? Aber doch ist es schon lange her, dass du wirklich warst, du Himmel, und du Ringplatz bist niemals wirklich gewesen.«
»Es ist ja wahr, noch immer seid Ihr mir überlegen, aber doch nur dann, wenn ich Euch in Ruhe lasse.«
»Gott sei Dank, Mond, du bist nicht mehr Mond, aber vielleicht ist es nachlässig von mir, dass ich dich Mondbenannten noch immer Mond nenne. Warum bist du nicht mehr so übermütig, wenn ich dich nenne ›Vergessene Papierlaterne in merkwürdiger Farbe‹. Und warum ziehst du dich fast zurück, wenn ich dich ›Mariensäule‹ nenne und ich erkenne deine drohende Haltung nicht mehr Mariensäule, wenn ich dich nenne ›Mond, der gelbes Licht wirft‹.«
»Es scheint nun wirklich, dass es Euch nicht gut tut, wenn man über Euch nachdenkt; Ihr nehmt ab an Mut und Gesundheit.«
»Gott, wie zuträglich muss es erst sein, wenn Nachdenkender vom Betrunkenen lernt!«
»Warum ist alles still geworden. Ich glaube es ist kein Wind mehr. Und die Häuschen, die oft wie auf kleinen Rädern über den Platz rollen, sind ganz festgestampft — still — still — man sieht gar nicht den dünnen, schwarzen Strich, der sie sonst vom Boden trennt.«
Und ich setzte mich in Lauf. Ich lief ohne Hindernis dreimal um den großen Platz herum und da ich keinen Betrunkenen traf, lief ich ohne die Schnelligkeit zu unterbrechen und ohne Anstrengung zu verspüren gegen die Karlsgasse. Mein Schatten lief oft kleiner als ich neben mir an der Wand, wie in einem Hohlweg zwischen Mauer und Straßengrund.
Als ich bei dem Hause der Feuerwehr vorüberkam, hörte ich vom kleinen Ring her Lärm und als ich dort einbog, sah ich einen Betrunkenen am Gitterwerk des Brunnens stehn, die Arme waagerecht haltend und mit den Füßen, die in Holzpantoffeln staken, auf die Erde stampfend.
Ich blieb zuerst stehn, um meine Atmung ruhig werden zu lassen, dann ging ich zu ihm, nahm meinen Zylinder vom Kopfe und stellte mich vor:
»Guten Abend, zarter Edelmann, ich bin dreiundzwanzig Jahre alt, aber ich habe noch keinen Namen. Sie aber kommen sicher mit erstaunlichen, ja mit singbaren Namen aus dieser großen Stadt Paris. Der ganz unnatürliche Geruch des ausgleitenden Hofes vom Frankreich umgibt Sie.«
»Sicher haben Sie mit Ihren gefärbten Augen jene großen Damen gesehn, die schon auf der hohen und lichten Terrasse stehn, sich in schmaler Taille ironisch umwendend, während das Ende ihrer auch auf der Treppe ausgebreiteten bemalten Schleppe noch über dem Sand des Gartens liegt. — Nicht wahr, auf langen Stangen, überall verteilt, steigen Diener in grauen frechgeschnittenen Fräcken und weißen Hosen, die Beine um die Stange gelegt, den Oberkörper aber oft nach hinten und zur Seite gebogen, denn sie müssen an Stricken riesige graue Leinwandtücher von der Erde heben und in der Höhe spannen, weil die große Dame einen nebligen Morgen wünscht.« Da er sich rülpste, sagte ich fast erschrocken: »Wirklich, ist es wahr, Sie kommen Herr aus unserem Paris, aus dem stürmischen Paris, ach, aus diesem schwärmerischen Hagelwetter?« Als er sich wieder rülpste, sagte ich verlegen: »Ich weiß, es widerfährt mir eine große Ehre«.
Und ich knöpfte mit raschen Fingern meinen Überzieher zu, dann redete ich inbrünstig und schüchtern:
»Ich weiß, Sie halten mich einer Antwort nicht für würdig, aber ich müsste ein verweintes Leben führen, wenn ich Sie heute nicht fragte.«
»Ich bitte Sie, so geschmückter Herr, ist das wahr, was man mir erzählt hat. Gibt es in Paris Menschen, die nur aus verzierten Kleidern bestehn und gibt es dort Häuser, die bloß Portale haben und ist es wahr, dass an Sommertagen der Himmel über der Stadt fliehend blau ist, nur verschönt durch angepresste weiße Wölkchen, die alle die Form von Herzen haben? Und gibt es dort ein Panoptikum mit großem Zulauf, in dem bloß Bäume stehn mit den Namen der berühmtesten Helden, Verbrecher und Verliebten auf kleinen angehängten Tafeln.«
»Und dann noch diese Nachricht! Diese offenbar lügnerische Nachricht!«
»Nicht wahr, diese Straßen von Paris sind plötzlich verzweigt; sie sind unruhig, nicht wahr? Es ist nicht immer alles in Ordnung, wie könnte es auch sein! Es geschieht einmal ein Unfall, Leute sammeln sich, aus den Nebenstraßen kommend mit dem großstädtischen Schritt, der das Pflaster nur wenig berührt; alle sind zwar in Neugierde, aber auch in Furcht vor Enttäuschung; sie atmen schnell und strecken ihre kleinen Köpfe vor. Wenn sie aber einander berühren, so verbeugen sie sich tief und bitten um Verzeihung: ›Es tut mir sehr leid,





























