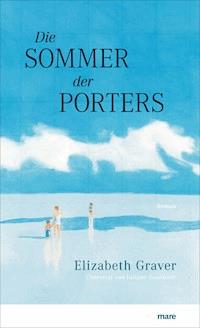Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rebecca Cohen genießt als Tochter eines sephardischen Unternehmers die Privilegien der Istanbuler Oberschicht. Doch als sich in den 1920er-Jahren die Stimmung in Europa verdüstert, beginnt für sie eine jahrelange Odyssee, die sie über Barcelona und Havanna bis nach New York führt. Auf ihrer Flucht wird Rebecca, kaum Ehefrau und Mutter, zur Witwe, muss ihre Eltern zurücklassen, um ihren Kindern eine Zukunft zu bieten, und ihr Schicksal einem Mann anvertrauen, den sie nur aus Briefen kennt. Doch an jeden neuen Ort trägt sie ihre Erinnerung und ihre Lieder und baut sich daraus gegen alle Widerstände eine neue Heimat. »Kantika« (»Lied«) ist eine eindringliche, lyrische Erzählung über Identität und Exil und eine inspirierende Geschichte weiblicher Resilienz, mit der Elizabeth Graver ihrer Großmutter Rebecca Cohen ein Denkmal setzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elizabeth Graver
Kantika
Roman
Aus dem amerikanischen Englischvon Juliane Zaubitzer
mare
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel Kantika bei Metropolitan Books, Henry Holt & Company, New York.
Copyright © 2023 by Elizabeth Graver
Alle Fotos stammen mit freundlicher Genehmigung der Autorin aus ihrem Familienarchiv, mit Ausnahme der beiden Fotos auf Seite 163, die mit Genehmigung des National Center for Jewish Film abgedruckt wurden.
Seite 367: Fotografie von Jack Levy.
© 2024 by mareverlag, Hamburg
Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag
Coverabbildung © Nataliia Tosun / Shutterstock
Datenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-832-8
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-710-9
www.mare.de
Für meine Mutter
Suzanne Levy Graver
und in Erinnerung an meine Großmutter
Rebecca Cohen Baruch Levy
Deshame entrar, y me azere lugar.
Lass mich ein, und ich werde mir
einen Platz schaffen.
Ladino-Sprichwort
Inhalt
Konstantinopel, 1907
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Istanbul, 1924
Barcelona, 1925
Kapitel I
Kapitel II
Barcelona, 1926
Kapitel I
Kapitel II
Adrianopel, 1929
Barcelona, 1929
Barcelona, 1934
Havanna, 1934
Astoria, 1934
Kapitel I
Kapitel II
Astoria, 1937
Kapitel I
Kapitel II
Cambria Heights, 1942
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Cambria Heights, 1944
USS Franklin, 1945
Cambria Heights, 1950
Dank
Konstantinopel, 1907
I
Es ist die schöne Zeit, die Zeit der ausgebreiteten Flügel, der Freudensprünge und offenen Türen, das Leben ein haltloser Fluss von hier nach dort. Es ist die vorgedankliche Zeit, die Welt noch nicht als Listen wahrgenommen, nicht als Rückblick oder Futur, sondern als inbrünstige Musik – kantar, singen. Rebecca singt im Rhythmus der Ruder, wenn das Boot sie in die Schule bringt, und in der Schule mit den Nonnen – tournez vos yeux vers Jésus. Wenn sie im Turnverein an Seilen hochklettert – immer eine Hand über die andere, haltet euch mit den Füßen fest, Mädchen –, zieht weniger die brüllende Trainerin oder die Muskelkraft sie empor als der sich abspulende Faden ihrer eigenen Stimme. Sie singt wortlose Melodien, sinnentleerte Worte oder Balladen, auf Ladino, Französisch, ein bisschen Türkisch, Hebräisch, Griechisch, so wie der Zitronenverkäufer Zitronen singt, der Bulgare Pudding, der Gemüsehändler Auberginen, Kürbis und Artischocken – »Frisch und günstig, meine Damen, die Auberginen und ich erwarten Sie!« In der Schule singt sie im Chor und die täglichen Loblieder, und abends singt ihre Mutter die Kinder in den Schlaf: »Durme durme, kerido ijiko …« – schlaf, schlaf, mein Sohn, dabei sind zwei von ihnen Mädchen. Obwohl die Nachtigall mit den glanzlosen Augen nur selten zwitschert, bleibt ihr Vater fast jeden Morgen vor ihrem Käfig stehen und versucht sie zum Singen zu animieren, und er singt in der Synagoge – »Du hast mir eine Stimme gegeben, die nicht müde wird, Dich zu preisen« –, und eines Morgens nach dem Gottesdienst führt er Rebecca zum Toraschrein, und sie singt für die Männer unten und die Frauen oben, ihre Stimme ebenso unerschütterlich wie die gepufferten Freiheiten und das unbeschreibliche Glück ihrer Kindheit (trotzdem näht ihre Großmutter vorsichtshalber eine bonjuk-Perle an die Unterseite jedes Kragens, um Unheil abzuwenden).
Ihr Haus hat drei Stockwerke und ist aus Stein, der nicht brennt. Den Hang hinunter liegt Balat, wo die armen Juden wohnen, ihre Familie jedoch wohnt ganz oben auf dem Berg in Fener, die Nachbarn griechische Diplomaten, armenische Ärzte, jüdische Bankiers oder Kaufleute, wie ihr Vater, und Rebecca und ihre Schwester Corinne gehen mit den Töchtern dieser Familien und einigen ebenso wohlhabenden muslimischen Mädchen auf die katholische Schule. Von ihrem Schlafzimmer aus sehen sie den Backsteinturm der griechischen Jungenschule. Und darunter die Minarette der Moscheen; in der Ferne das Goldene Horn mit dem blinkenden Leuchtturm und auf der anderen Seite Hasköy und Galata. Sie hören, wie unten die Leute kommen und gehen, die Tür mehr Einladung als Hindernis. Abends treffen Männer ein, um ihrem Vater beim Gebet Gesellschaft zu leisten, und erst nachdem die Gäste die Mesusa geküsst haben und in der Dunkelheit verschwunden sind, verriegelt er die Tür und schließt das Eisengitter. Sonntagnachmittags kommen Freundinnen und Familie ihrer Mutter, um Karten zu spielen, zu tratschen und Körbe für die Armen zu bestücken, und Soundso könnte eine Cousine zweiten Grades sein oder die Cousine einer Cousine, oder Rebeccas beste Freundin Rahelika kommt die Treppe hochgerannt oder die Schneiderin zur Anprobe, oder Oktay, der Musiklehrer, um ihrem Vater beizubringen, die Ney zu spielen. Unter der Woche ist ihr Vater in der Textilfabrik oder ist in der Stadt unterwegs, aber freitags kommt er zu ihnen zurück, das Haus makellos, die Kinder auch. Ihre Mutter hält die Hände vors Gesicht, spricht das Gebet und zündet die Kerzen an, und während die Dochte herunterbrennen, geht die Sonne unter, und im Haus kehrt Ruhe ein.
Der Samstag erwacht mit Ton und Licht. Später im Leben wird Rebecca Juden kennenlernen, für die der Sabbat eine ernste, fromme Angelegenheit ist – keine Aprikosen in Sirup oder Granatäpfel mit ihren blutigen Perlen, nur Gefilte Fisch in Glibber. Auch hier werden die Mahlzeiten vorher zubereitet, und Gateel, das armenische Hausmädchen, kommt, um Feuer anzumachen, Essen zu servieren und Geschirr abzuwaschen, doch die Kinder werden ermuntert, am Sabbat zu tanzen und fröhlich zu sein, und nachmittags besucht die Familie Verwandte oder fährt mit dem Schiff in den Park, wo die Babys in Hängematten schlafen – manchmal gleich mehrere Babys an einem Baum, wie herabhängende, reife Früchte. Zum Abendessen gibt es kalten Fisch mit Zitrone und Ei und zum Nachtisch Lokum und geröstete Melonenkerne, und dann spielen sie Ball und holen das Tambourin raus, um zu singen. Später zünden sie zu Hause die geflochtene Kerze an, löschen sie dann mit Wein und lachen laut, um böse Geister zu vertreiben. Hahaha, hahaha!
Kyen no rizika, no rozika. Wer nicht lacht, gedeiht nicht.
Auch wenn Rebeccas Vater schon damals kein lauter oder besonders heiterer Mensch ist, lacht er viel, ein dünnes, hohes, fast keuchendes Geräusch, und obwohl er nicht groß ist, wirkt er groß – weil die anderen Männer ihn respektvoll grüßen oder ihm auf die Schulter klopfen, ob in der kal – der Synagoge – oder auf dem Markt oder im Café, und er verkehrt mit wichtigen Leuten: dem Apotheker und dem Zahnarzt im Sultanspalast, dem Besitzer der Tabakfabrik, der Rebecca Schokoladenzigaretten schenkt. Zu seinen Freunden zählen Philosophen, Gelehrte, Bankiers, sogar der Oberrabbiner, der zu ihnen nach Hause kommt, um Ideen zu diskutieren oder Ratschläge zu erteilen. Sie nennen ihren Vater Alberto, doch sein richtiger Name, Abraham, bedeutet »Vater von vielen«, und der Name ihrer Mutter, Sultana, bedeutet »Königin«, und ihr Nachname, Cohen, bedeutet »Hohepriester«, was nichts ist, womit man angibt, aber trotzdem gut zu wissen, so wie Rebecca weiß, dass ihr eigener Name von der Mutter ihrer Mutter stammt und »verbinden« oder »zusammenfügen« bedeutet, und dass der Name ihrer Straße, Çorbaci Çeşmesi, Brunnen des Suppenkochs bedeutet, und eines Tages, als sie und Corinne von der Schule kommen, entdecken sie zwei Schalen mit dampfender Suppe auf dem Brunnenrand, und ihre Mutter sagt, sie sollen dem Brunnen danken, und verscheucht die Katzen.
Alle paar Jahre gehen sie ins Studio Parnasse in der Grande Rue de Péra, wo ein Armenier mit riesengroßen Händen sich ein schwarzes Tuch überwirft und ein Foto von ihnen macht. Einmal ist ihr Kindermädchen Victoria dabei, gleichzeitig ihre Cousine zweiten Grades, die sich für das Porträt hinter die Kinder stellt. Sie posieren in einem unechten Garten mit einer gemalten dorischen Säule im Hintergrund, Seidenblumen zu ihren Füßen. Angeblich hat man die Wahl – Garten, Palast, Salon oder Kaik –, doch ihr Vater wählt immer den Garten, so wie er sich auch immer hinter dem Fotografen positioniert, die Hände gebieterisch erhoben, wie ein Dirigent, der innehält.
Will er etwas beweisen? Es de buena famiya. Oder etwas bewahren? Er hat erst spät im Leben zum zweiten Mal geheiratet und hat Freude an der jugendlichen Schönheit seiner Kinder, obwohl ihm selbst die Zeit im Nacken sitzt. Oder etwas verstecken? Nur selten ist er selbst auf den Fotos. Den Kindern tun die Füße weh vom langen Stehen, doch schon mit vier oder fünf fällt Rebecca auf, dass sie sich wahrhaftiger fühlt, gesehen, wenn sie fotografiert wird. Alberto wird das Bild von den Kindern mit ihrer Cousine Victoria zum Geburtstag seiner Frau Sultana rahmen lassen, obwohl sie selbst nicht drauf ist, sondern zu Hause im Bett, was bedeutet, wieder schwanger, mit dem Risiko einer weiteren Fehl- oder Totgeburt. Also schluck die Tabletten aus Frankreich. Also häng ein Zweiglein ruda – Weinraute, die Königin der Kräuter – über deine Schlafzimmertür und fang den Tau auf deiner Fensterbank in einer Teetasse auf (er hält nichts von diesem Unsinn, aber seine Frau schon). Bete.
Hinter dem Haus ist ein kleiner, abschüssiger Garten mit Albertos Rosen und Sultanas Kräutern, im Frühling Krokusse, Tulpen und Traubenhyazinthen, zur Straßenseite im Winter der kalte Steinbrunnen und den Berg hinunter immer die erste Frau von Rebeccas Vater, Djentil Nahon. Wenn es brennt – für gewöhnlich in Balat oder auf der andere Flussseite –, schreit der Wächter: Yangin var! Yangin var!, und alle steigen die Steinstufen zum höchsten Punkt des Berges hinauf, um sich den Rauch anzusehen und die Flammen, die hinaufkriechen, wenn auch nie bis zu ihrem Haus, nie ganz bis zu ihrem Viertel, aber schätze dich nicht zu glücklich, sag ja nicht, dass du Glück hast – sonst ist es vorbei. Warte einfach, bis der Rauch sich verzieht, und biete Hilfe an, indem du Geld, Lebensmittel und Kleidung spendest. Die Feuerwehrleute löschen ein bisschen, aber meistens reißen sie die Häuser ab, schlagen Türen, Wände und Fenster ein, damit das Feuer nicht auf das nächste Gebäude übergreift, und bald ist dort, wo die Flammen gewütet haben, nur noch Asche übrig, die in den Augen brennt, und Matratzen, die sich schwerfällig durch die Straßen schleppen, kopflose Monster auf den gekrümmten Rücken von Männern.
Verspürt Rebecca hier einen ersten Anflug von Unbehagen, als sie geborgen zwischen ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder Isidoro steht, die Hand eines Erwachsenen auf ihrem Haar? Registriert die Haut ihrer Augenlider hier zum ersten Mal die Möglichkeit von unerwartetem Verlust – dass für die Leute da unten ein Haus eine Streichholzschachtel ist, die Bewohner schlanke Streichhölzer mit roten Köpfen, und wenn man sie anzündet, brennen sie? Der Rauch riecht süß nach Moschus, das Ganze ein von innen erleuchtetes Schattenspiel, und dann reckt sich das Gebilde auf die Zehenspitzen, rote Rippen flammen auf, das Feuer züngelt an Handgelenken, Brust, Leisten.
Am Purimfest verschenken sie biscochos an die Nachbarn, und an Tu Bischwat verteilen sie gebrannte Mandeln, um den Bäumen zum Geburtstag zu gratulieren. An Schawuot mieten sie ein Boot, um im Tal der süßen Wasser zu picknicken, und am orthodoxen Osterfest schenken ihnen die Papadopouloses von nebenan gefärbte Eier. Rebecca ist es zwar verboten, in der Osterwoche an der Kirche vorbeizugehen oder sich der Parade mit der Rabbinerpuppe zu nähern, aber verboten ist viel. Halt dich von den Zigeunern fern. Pflück nicht die Blumen deines Vaters. Beglückwünsche niemandem zu seinem hübschen Baby, und wenn du es vergisst, mach die Worte mit anderen Worten rückgängig, nimm sie zurück, eine verbreitete Gepflogenheit im Judenspanischen, wo böse Geister buena djente heißen – gute Leute – und ein Blinder ein vistozo ist, ein Sehender.
In der Schule muss man immer Französisch sprechen, und wenn man dabei erwischt wird, wie man in einer anderen Sprache redet, selbst in der Pause, muss man eine Münze in die Büchse für die Armen stecken. Christus ist überall im Lycée Notre Dame de Sion – im Alkoven auf dem Gang, in den Klassenzimmern, im Kunstraum, wo sie sich Bilder vom Jesuskind ansehen, nackt oder gewickelt, pummelig oder dünn, fast leuchtend weiß. Manchmal liegt ein Porzellanbaby in einem weißen Kleid auf dem Tisch, das sie malen sollen. Die meisten Mädchen bringen nicht mehr als ein paar unbeholfene Umrisse zustande, doch Rebecca erledigt die Aufgabe mit Leichtigkeit, folgt der Linie des Armes, der breiten Stirn, sogar die Finger gelingen ihr, indem sie sich auf die Zwischenräume konzentriert.
Zweimal die Woche, wenn die christlichen Schülerinnen den Katechismus lernen, bekommen die jüdischen Mädchen getrennt Religionsunterricht (weil es so wenig Muslime an der Schule gibt, dürfen sie früher gehen). Ihr Lehrer ist Monsieur Eskenazi, der ihnen von der Jagd auf Juden erzählt und der Vertreibung der Juden und dem Mut der Juden, während eine alte Nonne in der Ecke döst, damit sie nicht mit einem Mann allein sind. Wer ist Haschem?, fragt Monsieur. Eine Hand schießt nach oben – Roza Valpreda, die Streberin. Der, dessen Name man nicht sagen darf. Rebecca hat nie ein Bild von El Dyo gesehen, und wenn ihr Vater von Ihm spricht, dann nur wahnsinnig abstrakt – Der, Den Man Durch Das Begreift, Was Er Nicht Ist, oder Der, Der Keine Menschliche Form Hat, oder Der, Der Durch Das Unausgesprochene Ausgesprochen Wird. So lehrt er es seine Kinder, mit wachsender Verbissenheit, bis Rebeccas Mutter ihm Einhalt gebietet, und dann kabbeln sie sich. Aber ich muss es ihnen doch beibringen, Sultana! – Aber du redest zu viel, Schatz – Nun, du redest zu wenig. – Stimmt nicht, ich rede viel, nur nicht von Dingen, die ein Kind unmöglich verstehen kann.
Seid brav im Klassenzimmer, die Hände gefaltet, das Gesicht nach vorn, und knickst, wenn ihr Notre Mère Marie-Godeleine seht, der die jüdischen Mädchen besonders am Herzen liegen, weil die Schule von einem bekehrten deutschen Juden gegründet wurde, dessen dunkles Ölporträt in der Eingangshalle hängt. Lernt nähen und sticken – erst mit dicker roter Wolle, dann mit Baumwolle und schließlich mit Seide für eure Aussteuer – und kleidet euch à la Franca nach der neuesten Mode aus Pariiiee. Seid großzügig zu den Armen. Rebecca und Corinne begleiten ihre Mutter mit Paketen in ein jüdisches Waisenhaus in einem Viertel, dessen holprige Straßen keine Namen haben und wo Frauen in Hauseingängen hocken und kochen. Den Mädchen ist es nicht erlaubt, aus der Kutsche zu steigen, aber sie dürfen den Waisenjungen zuwinken. Ihre Eltern nennen es benadamlik – ein guter Mensch sein –, und die Nonnen in der Schule schreiben le devoir avant tout in Schönschrift an die Tafel.
Egal, wie man es nennt, Rebeccas Kindheit ist davon durchtränkt, und es entspricht und widerstrebt ihrem Naturell gleichermaßen: Hände öffnen, berühren, geben, schaffen, aber auch zugreifen, verstauen, horten. Und obwohl sie zu jung ist, um zu begreifen, dass ihr Vater ein zerstreuter, halbherziger Geschäftsmann ist, der das Vermögen der Familie durchbringt, und dass sich das Blatt gegen die Griechen wendet und vor allem gegen die Armenier, aber auch gegen die Juden, und dass ihr Volk hier in einer Ökonomie der Toleranz nur etwas länger zu Gast sein darf, ist sie von all ihren Freundinnen am empfänglichsten für das Glitzern einer Münze zwischen den Pflastersteinen, hungrig auf den silbernen Geschmack herausgefischten Glücks.
II
Auf halbem Weg nach unten zum Fluss wohnen zwei wichtige Menschen – Rahelika und Djentil Nahon. Rebecca hat schon immer eine beste Freundin gehabt, und es ist schon immer Rahelika gewesen, die mit ihr zur Schule geht und zum Turnen und ins Sommerhaus in Büyükdere, weil ihre Mütter eng befreundet sind und Likas Vater ein schlecht bezahlter Lehrer an einer Schule der Alliance Israélite ist und die Familie kein eigenes Sommerhaus besitzt. Die beiden Mädchen ähneln sich, beide dunkelhaarig und zierlich. Fremde halten sie manchmal für Zwillinge, obwohl Rebeccas Augen heller sind. Die Mädchen schleppen blond gelockte Zwillingspuppen mit sich herum – Geburtstagsgeschenke von Rebeccas Vater –, Chérie und Bella. In der Schule glänzt Rebecca im Zeichnen, Malen und Singen, während Lika, die Stipendiatin an der Sion ist, eine Begabung für Mathematik und Naturwissenschaften hat und Krankenschwester werden möchte, was durchaus möglich ist, sagen die Nonnen, wenn man genug betet und lernt. »Beccalika« nennt Mère Maline (so jung, so hübsch, so fröhlich, dass sie eher wie eine große Schwester wirkt) die Mädchen, oder »Likabecca«, und als Rebecca neun ist, darf sie allein zu Likas Haus gehen, Chérie fest umklammert, immer bergab, vorbei am Glasbläser mit dem verbrannten Gesicht, vorbei am Kürschner, Fischhändler, Sesamölfabrikanten, bis an Likas Tür.
Dort wird sie von Likas Mutter verhätschelt, bekocht, verwöhnt und darf sich mit Lika stundenlang Fantasiespielen hingeben, oder sie blättern französische Zeitschriften durch, die Likas Vater für den Unterricht benutzt – Journal des Voyages und Je Sais Tout –, wo sie eines Tages zwischen oberkörperfreien Walfängern und Indianerhäuptlingen mit Federschmuck auf ein illustriertes Porträt des orientalischen Juden stoßen, unter anderem auf eine Frau mit einem breiten schwarzen Band um Kinn und Kopf und einem anderen Band um den Oberkörper, das ihren riesigen Busen hochschiebt. Ihr Blick ist benommen, die Augen glänzen; sie erinnert an ein zusammengebundenes Hähnchen. Typische türkische Jüdin steht darunter. Gackernd stopfen sich die Mädchen Geschirrtücher unter die Kleider, binden sich Schärpen um und tun, als würden sie für Fotos posieren. Manchmal übernachtet Rebecca sonntagabends bei Lika. Dann bringt sie ihre Schuluniform mit, das schwarze Kleid mit weißem Spitzenkragen, dazu im Winter die schwarze Cabanjacke und den breitkrempigen Hut und im Frühling den Strohhut aus Frankreich.
Djentil Nahon, die erste Frau von Rebeccas Vater, wohnt über Lika, und Lika nennt sie tiya, Tante, obwohl sie nicht verwandt sind, deshalb tut Rebecca es auch. Mehrmals pro Woche ruft Tiya Djentil aus dem Fenster oder klopft auf den Fußboden, der Likas Zimmerdecke ist, und dann wissen die Mädchen, dass sie etwas erledigen sollen. Wenn sie auf die Straße gehen, lässt sie in einem Korb an einem Seil Geld herunter und schickt sie zu Krämern oder Läden, Aufträge, die sie, so Likas Mutter, ohne Murren erledigen sollen, weil es ein Unglück ist, keine Kinder zu haben, und Tiya ihre alte Mutter nicht allein lassen kann. Manchmal bringen die Mädchen die Sache schnell hinter sich und legen die Besorgungen in den Korb. Aber ab und an sagt Tiya Djentil auch, kommt rauf, mi suvrinas, ich habe einen Kuchen für euch gebacken. Dann steigen sie die steilen Stufen zur düsteren Wohnung hoch, pflichtbewusst zunächst, dann immer neugieriger, und während Tiyas alte Mutter auf dem Sofa schnarcht, bietet sie ihnen Mandelkuchen an und Lindenblütentee oder schwarzen Kaffee mit Zucker, den sie schnell hinunterkippen, damit Tiya Djentil ihnen im trüben Kaffeesatz die Zukunft voraussagen kann. Nachdem der Kuchen aufgetischt ist und Tiya Djentil gesagt hat, kome kon gana – esst mit Genuss –, setzt sie sich mit ihrem winzigen, seltsam mädchenhaften Körper auf einen riesigen Holzstuhl und erzählt ihnen Geschichten, wie Rebeccas Vater sie verabscheut, die ihre Mutter duldet und nach denen Rebecca süchtig ist.
»Also, an einem Tag in der letzten Woche habe ich geklopft und gerufen – ich hatte euch einen Kuchen gebacken –, aber ihr seid nicht gekommen. Erst dachte ich, na gut, wenn sie nicht kommen, sind sie in der Schule oder helfen ihren Müttern, aber bald war es spät am Nachmittag, und ich hatte aufgehört zu klopfen, aber begann mir Sorgen zu machen. Es ist etwas Schlimmes passiert! Eine Entführung, ein Unfall, ein Feuer, Vergewaltigung gar – ihr solltet nicht wissen, was das ist –, doch dann begriff ich, dass es böse Geister sind, shedim, direkt hier in meiner Wohnung, in meinem Holzlöffel, denn nachdem ich meiner guten Mutter die Nägel geschnitten hatte, vergaß ich, die Späne zu verbrennen. Deshalb sagte ich: Mama, wach auf, schnell! Es gibt Ärger in unserem Löffel! Bedenkt, ich habe nicht shedim gesagt – denn wenn man in deren Gegenwart ihren Namen ausspricht, zeigen sie sich. Meine arme Mutter ist aufgewacht und hat angefangen zu wimmern – aaaah, aaaah, aaaah! –, als würde sie jemand mit einem heißen Messer foltern. Sie waren da an jenem Tag, die shedim! Der Löffel hat mich verfolgt, und meine Mutter auch! Aber euch nicht, Mädchen. Ich muss euch unbewusst ferngehalten haben. Ich habe es gespürt, bevor der Löffel es mir gesagt hat. Ich bin mit dieser Gabe gesegnet. Vielleicht besitzt ihr diese Gabe ja auch.«
Rebecca sieht zu Lika, deren Lippen vom Puderzucker weiß sind, und Lika, die versucht, nicht zu lachen, schnaubt stattdessen, sodass es staubt. In Rebecca steigt auch etwas auf, doch es ist kein Lachen. Ist es möglich, dass auch sie diese besondere Gabe besitzt? Will sie das? Die Gegenstände auf dem Tisch – der Keksteller, eine trübe bombonyera mit muffigen Bonbons, Gläser mit Perlen und Gewürznelken – bekommen plötzlich Gewicht, als hätte alles nicht unbedingt ein Gesicht, aber eine Seele, eine Persönlichkeit, einen Willen. In ihren Träumen kommen regelmäßig Dinge vor, die mehr als Dinge sind – ein Kleiderschrank, der geht, aber keine Füße hat, ein Schiff, das lacht, aber keinen Mund hat, Menschen, die nicht wirklich Menschen sind, aber so scheinen. Solange sie denken kann, sieht sie überall Gesichter, nicht nur in den Wolken, was ja verbreitet ist, sondern auch in Astlöchern und Fenstergittern und in den Blumen im Garten ihres Vaters mit ihren klaffenden Mündern und seidigen Köpfen. Vor ein paar Jahren hat sie an Pessach den Propheten Elias gesehen, nur den Zipfel seines Ärmels und den Stiel von seinem Weinglas, doch nur Hunde und Menschen mit einer besonderen Gabe können ihn überhaupt sehen.
»Was ist dann passiert?«, fragt sie Tiya Djentil.
»Der Löffel wurde in meiner Hand so heiß, dass meine Haut sich abgelöst hat, abgepellt, genau hier …« Sie hält einen Finger mit glänzender, wunder Kuppe hoch.
»Oh, Tiya! Du hast dich verbrannt«, sagt Lika. »Du musst es verbinden. Hast du Pflaster da? Ich kann von meiner Mutter welches holen.«
Djentil winkt ab. »Nicht nötig. Ich habe mich schon darum gekümmert.«
»Wie?«, fragt Rebecca.
Tiya zuckt die Schultern. »Nur mit Zucker und Papier.«
»Auf den verbrannten Finger? Er wird sich entzünden!« Lika klingt fast wütend.
»Natürlich nicht! Ich habe Zucker und Papier unter mein Kissen gelegt. Am nächsten Tag trinkt man ihn mit dem Morgentau. Damit sie verschwinden. Vos do dulseria, ke me desh sultura.« Ich gebe euch Süßes, damit ihr von mir weicht. »Das ist ein zuverlässiges Mittel, aber versprecht mir, dass ihr es nicht aufschreibt. Alle wahren Weisheiten gehen von Mund zu Ohr. Bis ihr es weitergebt, bewahrt es« – sie klopft zweimal an ihre Stirn – »hier.«
Und so geht es weiter. Manches von dem, was sie sagt, klingt vertraut, denn die Mädchen haben viele Verwandte, die noch an Geister und den bösen Blick glauben, auch wenn die Nonnen in der Schule ihnen die Amulette abschneiden, wenn sie diese entdecken. (Aber was ist mit dem Wein als Blut und der Oblate als Leib – ist das nicht genauso an den Haaren herbeigezogen?) Die Väter der Mädchen halten nichts von den alten Bräuchen, während ihre Mütter immer noch automatisch jedes Kompliment mit einem sin ojo oder ojo malo ke no tengan! aufheben – ohne Blick oder möge der böse Blick dich verschonen. Eines Tages erzählt Djentil ihnen, dass der Schlaf zu einem Sechzigstel Tod ist und man deshalb im Traum toten Seelen begegnen kann. Am nächsten Tag erzählt Rebeccas Vater ihnen, er habe gerade gelesen, dass ein Wissenschaftler, der auf den Eiffelturm geklettert ist, kosmische Strahlung entdeckt hat. Warum nicht, eins von beiden, beides. Eins scheint so plausibel wie das andere.
Rebecca freut sich immer mehr auf die Besuche bei Tiya Djentil. Alles andere in ihrem Leben ist auf Ordnung ausgerichtet, von ihrem Zuhause – trotz der Kinderschar eine gut geölte Maschine – über die Schule mit Millimeterpapier und gebohnerten Gängen bis zum Turnverein, wo sie wie die Soldaten marschieren, die kleinen Ärmchen angespannt, denn ein Jude sein heißt stark sein. Bei Tiya Djentil findet sie eine andere Welt. Trotz der Enge erinnert die Wohnung sie an die verbotenen Gegenden der Stadt, die sie magisch anziehen: der Gewürzbasar, auf dem sie nur ein einziges Mal war, während eines Schulausflugs, bei dem sie sich alle an einem langen Seil festhalten mussten, damit sie nicht verloren gingen; oder die Darbietungen der Zigeuner, bei denen ein angeketteter Bär die Trommel schlägt und gemütlich mit seinem Roma-Herrchen schwoft. Einmal, als sie den Bären aus der Ferne entdeckte, war sie so aufgeregt, dass sie der würdevollen, traurigen, schlurfenden Kreatur glatt in die Arme gelaufen wäre, hätte ihre Mutter sie nicht zurückgehalten. Schon damals (sie konnte nicht älter als vier gewesen sein) erkannte sie den Erzählwert der Geschichte, die sie mit jedem Mal mehr aufbauschte und von der sie monatelang zehrte, auch wenn es sich immer anfühlte, als wäre es gerade erst passiert: Gestern habe ich mit einem großen Bären getanzt! Sag die Wahrheit, Rebecca, ermahnte ihre Mutter sie von klein auf. Heb dir deine Fantasie für die Handarbeit auf.
Wenn ihre Eltern Geschichten erzählen, enthalten diese immer eine Moral, und es kommt fast nie das Wort Ich darin vor. Nicht so bei Djentil Nahon: Habe ich euch erzählt, wie ich meine presyoza Mutter bei einem Feuer verloren habe? Habe ich euch von dem wilden Hund erzählt, der sich nachts mein Baby geschnappt hat?
Hinterher, wenn die Mädchen ins Tageslicht treten, ziehen sie Bilanz, und zuweilen muss Rebecca Lika trösten, die Djentils Fantastereien mehr mitnehmen als Rebecca, und manchmal nimmt Lika die Geschichten auseinander und findet Ungereimtheiten: Sie hat gesagt, es ist im Juli passiert, aber in der Geschichte hat es geschneit; ihre Mutter ist nicht tot, sie liegt auf dem Sofa! Ab und zu schleichen sie sich in die Gärten ihrer eigenen Mütter, um Kräuter zu pflücken, die sie in Zaubertränke geben oder in die Tür hängen, und wenn in ihren Spielen schlimme Dinge passieren (Feuer, Krankheit, Tiere mit Reißzähnen, verstümmelte Kinder, tote Geschwister), gibt es immer einen Zaubertrank oder -spruch dagegen, und wenn ihnen die Geschichten ausgehen oder sie Appetit auf etwas Süßes haben, können sie jederzeit eine Besorgung für Tiya Djentil erledigen.
Dass Rebeccas Vater einmal mit Djentil Nahon verheiratet war, ist einfach so. Es wird noch lange dauern, bevor Rebecca es merkwürdig findet, dass ihr Vater vor ihrer Mutter überhaupt eine Ehefrau hatte. Auch dass er viel älter ist als ihre Mutter, ist einfach so, und obwohl sie auf abstrakte Weise versteht, dass ihre Eltern ein Leben vor ihr hatten, interessiert es sie nicht, und die beiden reden selten darüber. Als sie nach einem Nachmittag bei Djentil Nahon ihre Mutter einmal fragt, warum die erste Ehe ihres Vaters nicht gehalten hat, erfährt sie, dass Djentil Nahon keine Kinder bekommen konnte.
Ein Hund hat sich ihr Baby geschnappt, sagt Rebecca fast, doch irgendetwas hält sie zurück. »Warum haben sie kein Waisenkind angenommen?«
»So einfach ist das nicht, und es geht dich auch nichts an. Sei einfach nett zu ihr.«
»Bin ich ja. Gestern haben wir ihr Brot besorgt.«
Ihre Mutter legt das Nähzeug weg und blickt sie prüfend an. »Likas Mutter hat mir erzählt, dass ihr zum Tee zu Sinyora Nahon geht. Sie sagt, sie ist harmlos. Es ist lieb von euch, ihr zu helfen.«
»Es macht mir nichts aus.«
»Weiß sie, wer du bist, dass Papa dein Vater ist?«
Kennt im Viertel nicht jeder jeden? »Glaub schon. Ich weiß nicht.«
»Erwähne es lieber nicht.« Sie stickt weiter, etwas Kleines, Filigranes. Die Nadel in ihrer rechten Hand geht auf und ab, auf und ab, während sie mit der linken den Rahmen dreht. »Es könnte sie aufregen.«
»Warum? War Papa gemein zu ihr?«
Ihre Mutter zögert. »Nein, nicht gemein, sie ist nur … sie hat Probleme. Dein Papa unterstützt sie immer noch. Sie hat kein eigenes kleines Mädchen.« Sie seufzt. »Ich hatte – ojo malo – großes Glück, auch wenn die Arbeit nie abreißt.« Sie bindet einen Knoten und beißt das Ende mit den Zähnen ab.
»Wie unterstützt er sie?«
»Es reicht, Rebecca.«
»Gibt er ihr Geld?«
»Stellst du in der Schule auch so viele Fragen? Deine Nonnen tun mir leid!«
Ihre Mutter hat den Mundwinkel jetzt voller Stecknadeln, deren Perlenköpfchen zwischen den Lippen herausragen, während sie den Rahmen löst und die Stickerei, an der sie gearbeitet hat, auf einem größeren Stoffstreifen befestigt, weiß und durchscheinend, duftig frisch. Rebecca sieht, dass es ein Kleid für ihre kleine Schwester Elsa wird, teilweise gesmokt, vorn eine gestickte Ente im Regen, die einen Schirm hält, daneben ein Kaninchen in Galoschen. Der Regen besteht aus schrägen grauen Vorstichen, die Stiefel aus rosa Kreuzstichen. Die Augen – Rosa fürs Kaninchen, Schwarz für die Ente – sind feste französische Knoten. Es ist das Schönste, was sie je gesehen hat, und nicht für sie.
»Halt das bitte mal für mich«, sagt ihre Mutter durch einen immer noch mit Nadeln verstopften Mund, doch während Rebecca gegen den Drang ankämpft, den Stoff wegzuschieben, fängt Elsa im Kinderzimmer an zu weinen, wovon Marko aufwacht, der ebenfalls zu weinen anfängt, und dann steht das Kindermädchen da – ein neues, korpulentes aus Bulgarien –, mit Elsa auf der Hüfte, Marko neben sich, und ihre Mutter steckt die Nadeln wieder in das pralle zartrosa Kissen und erhebt sich mit einem Schulterblick – hast du deine Hausaufgaben gemacht? –, bevor sie sich mit offenen Armen zu den Kleinen herabsinken lässt.
Tiya Djentil fragt nie, ob sie ihre Hausaufgaben gemacht haben. Sie nennt sie nicht mal beim Namen. Nur, nehmt noch Tee, nehmt noch einen Keks, hört zu, sodass die Mädchen in ihrer Gegenwart vier offene Ohren, vier Augen, zwei hungrige Münder werden. Seit einiger Zeit schließt Rebeccas Vater die Türen zur Bibliothek, um mit Geschäftspartnern und Männern von der Synagoge wichtige Angelegenheiten zu besprechen. Ihre Eltern reden neuerdings über die Köpfe der Kinder hinweg auf Englisch. Rebecca hat einen Wachstumsschub und noch mehr Appetit auf Süßes als sonst. Ihre Waden schmerzen. Von den Nonnen wird sie zurechtgewiesen, weil sie im Unterricht mit den Beinen wippt und lauter als die anderen Mädchen singt; von ihrer Mutter, weil sie die Treppen runterpoltert, und von Corinne, weil sie nachts im Bett nicht still liegt, denn sie hat entdeckt, wie gut es sich anfühlt, wenn sie die Handfläche an ihrem Becken reibt, und schläft jetzt immer so ein.
Tiya Djentil erzählt ihnen von einem Wesen mit dem Gesicht eines Jungen und dem Körper eines Delfins, von einem Geist, der unsichtbar ist, aber Fußabdrücke wie Hühnerkrallen hinterlässt, und von einer zingana, einem Roma-Mädchen, das von ihrem Liebsten verlassen wird und ihm einen Zaubertrank verabreicht, von dem er Ausschlag bekommt; aus jeder Wunde sprießt ein Pilz, und das Mädchen macht ihm daraus eine Pilzsuppe, die er isst, worauf er sich wieder in sie verliebt. Das ist wirklich passiert, beginnt Djentil jede ihrer Geschichten. Sobald ihre Mutter stöhnt, steht Djentil auf, um sie anders hinzulegen, ihr Brühe in den Mund zu löffeln oder ihren schütteren Schädel mit Mandelöl einzureiben, wobei sie ihr gut zuredet, wie einem Baby – mi alma Mamasita, mi presyoza korazon.
Das Faszinierendste an Tiya Djentil sind für Rebecca nicht ihre Geschichten, sondern dass sie einerseits in ihrer Fantasiewelt lebt und andererseits so patent und fürsorglich ist. Ihre Wohnung ist zwar stickig und staubig, aber es gibt immer leckeres Essen. Ihre Mutter, knorrig und gekrümmt, mehr tot als lebendig, ist immer sauber, und Djentil kniet sich in regelmäßigen Abständen vor der alten Frau hin, die fast doppelt so groß ist wie sie, und massiert ihr behutsam die Muskeln, angefangen bei den Fingern, dann die Zehen, Füße, Waden, und singt leise dazu, bevor sie zu ihren Geschichten zurückkehrt, sodass es fast egal ist, ob die Mädchen da sind und zuhören, doch wenn die Mädchen gehen wollen, dreht sie den Kopf und bittet sie, zu bleiben.
Im Lauf der Zeit verstören die Besuche Lika immer mehr, obwohl die Süßigkeiten sie nach wie vor locken. Sie sollte mit ihrer Mutter zum Arzt gehen, sagt sie über Tiya Djentil. Sie sollte ihr einen dieser Stühle mit Rollen besorgen und ab und zu lüften. In der Schule haben sie alles über Florence Nightingale gelernt, die vor Kurzem gestorben ist, und Lika hat angefangen Tortendiagramme zu zeichnen und regelmäßiges Lüften und Händewaschen zu propagieren.
»Wir sollten sie nicht beachten, wenn sie auf den Fußboden klopft. Vielleicht öffnet sie dann das Fenster, wenn sie uns draußen sieht«, sagt Lika eines Tages. »Dann wird die Wohnung mal durchgelüftet.«
»Hör auf, Lika. Sie ist einsam«, sagt Rebecca, als wäre sie die Gütigere, Großzügigere von ihnen, dabei will sie nur die Geschichten.
»Eines Tages also – das ist eine wahre Geschichte, keine konseja – gab es da eine reiche Dame oben auf dem Berg. Zusammen mit ihrem Ehemann bereiste sie Städte in aller Welt. In einem Jahr fuhren sie nach Barcelona in Spanien, und im Hotel unterhielten sie sich mit dem Herrn an der Rezeption: ›Sinyor, wir sind hier, um Ihre wunderschöne Stadt kennenzulernen. Können Sie uns sagen, welche Museen, welche Kirchen und Burgen wir uns ansehen sollen?‹ Der Hoteldirektor sagt: ›Natürlich, gehen Sie zu dieser Kirche, jener Ausstellung, und wenn Sie Courage haben, zeige ich Ihnen danach noch etwas anderes.‹ Der Ehemann sagt: ›Was meinen Sie damit, Sinyor?‹ ›Ich meine, wenn Sie die Courage haben, den Schneid, zeige ich Ihnen etwas hier in meinem Hotel!‹ Der Ehemann versteht immer noch nicht. ›Natürlich, wir sind hier, um Ihr Land kennenzulernen, wir wollen alles sehen.‹ Wenn Sie darauf bestehen‹, erwidert der Hoteldirektor. ›Ich zeige es Ihnen, aber es ist nicht meine Schuld.‹
Bueno, das Paar besucht also alle Sehenswürdigkeiten, und an ihrem letzten Tag endlich führt der Hoteldirektor sie in den Keller. Nun, wenn man einen Teppich hat, was macht man damit im Sommer? Man trägt ihn in den Hof, gießt heißes Wasser drüber. Schrubbt ihn. Man macht ihn sauber, rollt ihn zusammen, dann verstaut man ihn bis zum Winter im Keller. Das Paar folgt dem Hotelmanager also in den Keller, und was sie sehen, ist ein großer, aufgerollter Teppich. Und der Hoteldirektor sagt, der ist aus Ihrer Haut, der Haut Ihrer Vorfahren. Menschenhaut. Jüdische Haut. Tut mir leid, dass ich Ihnen das sagen muss‹, erklärt er, ›aber es ist die Wahrheit.‹ An den Wänden sehen sie Bilder, lange Gemälde, in allen Farben – ebenfalls aus unserer Haut.
Ich habe die Geschichte von der Dame persönlich«, sagt Tiya Djentil. »Sinyora Estella Caldora, möge sie in Frieden ruhen. Danach hat sie immer gesagt: ›Also reist, meine Freunde, seht euch die ganze Welt an, genießt es, aber versprecht mir, dass ihr nie nach Spanien zurückkehrt, denn es ist verflucht.‹ Ich hatte nie davon gehört. Ich wusste, dass man den Juden, die nicht geflohen oder konvertiert sind, in Spanien Arme und Beine gebrochen hat. Sie wurden verbrannt und gesteinigt, all so etwas, aber das mit der Haut hatte ich nie gehört. Haut sollte verschwinden, nachdem man gestorben ist. Einfach zu Erde werden, wisst ihr. Keine Spuren hinterlassen. Diese ist noch da. Könnt ihr euch das vorstellen?«
Sie seufzt, ein langes, rasselndes Geräusch, und scheint für einen Moment sehr weit weg, wie jemand anderes. »Es ist mir ein Rätsel, wie sie das gemacht haben. Ein Rätsel.«
III
Drei Jahre hatte Alberto mit Djentil Nahon zusammengelebt, die durch die Heirat für eine Weile zu Djentil Cohen wurde. Er war zweiundzwanzig, als sie heirateten, und sie achtzehn, die Ehe von den Eltern arrangiert, als sie noch Kinder waren. Während Djentil heranwuchs, gelang es der Familie irgendwie, deren Eigenarten weitgehend zu verbergen, die sie von den Bediensteten oder von der älteren Generation übernommen hatte oder die von dem Sturm herrührten, der sich in ihrem Gehirn zusammenbraute. Vielleicht wurde Alberto auch von den Wünschen seiner Eltern geködert oder von der Tatsache, dass Djentil außergewöhnlich hübsch war, zierlich, mit großen Augen und langen schwarzen Locken, flinken Bewegungen wie ein Singvogel; Alberto war kein hochgewachsener Mann und ein kleiner Romantiker (er liebte Blumen, schrieb gelegentlich Gedichte). Wie es Brauch war, zog sie zu ihm und seinen Eltern, und für eine Weile ging es gut. Ihre Väter waren Geschäftspartner, beide in der Textilbranche, beide erfolgreich. Die Ehe stärkte die Geschäftsbeziehung, und Djentil sang und plauderte und leistete seiner Mutter Gesellschaft.
Obwohl es im Ehebett lebhaft zuging, kam kein Kind, nicht im ersten Jahr, nicht im zweiten, und ungefähr zu dieser Zeit begann Djentil, ein Glas auf den Balkon zu stellen, um den Morgentau zu trinken und Beschwörungen zu murmeln, und bald begann sie, zu jeder Tageszeit Raki zu trinken und nachts durch die Straßen zu irren, und eines Tages brach sie bei der Brit Mila des Sohnes von Albertos Cousin mitten in der Zeremonie in Tränen aus und verlangte nach der Vorhaut, um einen Zaubertrank daraus zu machen, damit ihre Pechsträhne abreißen und sie ein Kind bekommen würde, und die anderen Frauen hatten Mitleid und Angst zugleich, und einige der Männer machten einen Witz daraus – Hungrig, Lady? Bedien dich! –, und Alberto fühlte sich zutiefst gedemütigt.
Er fand einen Arzt, der auf Frauenleiden spezialisiert war, und einen weiteren, der Geisteskrankheiten behandelte. Er ließ sogar Djentils Großmutter, die aus dem Landesinnern in der Nähe von Ankara kam, einige Hausmittel ausprobieren, milizina de la kaza, denn Gedanken besaßen Macht, und er war verzweifelt, nicht weil er unbedingt ein Kind wollte – das erwies sich bald als zweitrangig –, sondern weil er mit seiner Frau am Arm zum Gottesdienst gehen wollte und zu den Einladungen seiner Geschäftspartner und zu Wohltätigkeits- und Purimbällen, weil er wollte, dass sie ihn, wenn er nach Hause kam, ruhig, bei Verstand, freundlich und mit seinen Hausschuhen und einem Glas Wein erwartete.
Djentils Großmutter spaltete gekochte Eier mit einem Haar und gab sie Djentil zu essen. Sie ließ Djentil ihren Bauch am Bauch einer Schwangeren reiben. Albertos Mutter sah hilflos zu und betete. Die Ärzte verschrieben Bettruhe, Wickel, Tabletten, frische Luft, Gesellschaft, Zurückgezogenheit. Alberto begann zu spielen, erst nur ein bisschen, Karten im Café. Mit geringem Einsatz. Nur um Dampf abzulassen. Nicht nur, weil Djentil nicht schwanger wurde, sondern weil ihr Zustand immer schlimmer wurde. Sie hörte Stimmen. Sie schnitt sich mit einem Messer die Haare ab und machte Schmuck daraus, flocht Perlen und Flügel von Käfern hinein. Auf Wochen, in denen sie zu viel redete, folgten Wochen, in denen sie überhaupt nicht sprach. Es beängstigte und ekelte ihn, wie sie Religiöses in ihre Geschichten einstreute, wenn sie behauptete, der Prophet Elias sei in sie eingedrungen und habe sie geschwängert. Eines Tages ging Alberto mit seinen Sorgen zu einem Mann, der die Nahons von Kind an kannte, und der Mann sagte: Djentil, loka? Das überrascht mich nicht, sie war schon immer ein bisschen – und er pfiff und ließ einen Finger neben dem Ohr kreisen. Zum ersten Mal verspürte Alberto so etwas wie Wut, die einen dumpfen Schmerz in seinen Zahnwurzeln auslöste. Niemand hat mich gewarnt, sagte er.
Damals blühte in Manchester das Baumwollgeschäft. Albertos Vater, der das Familienunternehmen bereits um mehr als das Doppelte vergrößert hatte, sah für seinen Sohn eine Fluchtmöglichkeit, die gleichzeitig Profit versprach. Warum denkst du nicht darüber nach, Alberto, warum siehst du es dir nicht mal an? Es gab dort einen Freund der Familie, ebenfalls ein Turkino, der expandierte. Alberto konnte das Handwerk lernen, das Exportgeschäft übernehmen, Englisch lernen, Abstand zu den Problemen zu Hause gewinnen. Wessen Idee war es? Er schrieb die Schuld, beziehungsweise das Verdienst, gern seinem Vater zu. Zunächst fuhr er nur für ein oder zwei Monate, dann für längere Zeiträume. Wenn er zurückkehrte, schlief er im Doppelbett neben seiner Frau, fasste sie jedoch nie an, denn wenn man nach einer gewissen Zeit kein Kind hatte – eine lange Zeit, zehn Jahre –, konnte man sich von Rechts wegen scheiden lassen. In England fand er Frauen in Bordellen und nahm sich für eine Weile sogar eine nichtjüdische Geliebte. Es gelang ihm, die Erinnerung an Djentil zu verdrängen, die ihn anflehte, sie mit nach England zu nehmen, und ihn mit Zaubersprüchen belegte, wenn er zurückkehrte, sich mitten in der Nacht rittlings auf ihn setzte, mit bloßen Brüsten und immer noch wunderschön, schmal wie ein Kind, aber mit überraschenden Kurven, zimtfarbenen Brustspitzen und geschickter Zunge, und schließlich sagte, dass etwas mit ihm nicht stimme – er müsse Jungen mögen, er müsse verhext sein –, wenn er sich (was ihm ungemein schwerfiel) verweigerte. Nimm mich mit, ich verspreche, ich bin brav, flehte sie, aber sie wäre an einem Ort wie Manchester untergegangen, und Albertos Wut machte ihm selbst Angst, denn im Herzen war er kein guter Mensch, nicht wirklich, jedenfalls glaubte er das. Er hatte verstörende Visionen, wie er sie windelweich prügelte, bis ihr die loka-Gedanken aus Ohren und Nase bluteten, und er zählte die Monate und Jahre runter.
Djentil zog zurück zu ihren Eltern. Einmal, als er nach Hause kam und Geld vorbeibringen wollte, sagte man ihm, sie sei nicht da, man habe sie in ein Sanatorium gebracht. Jeden Monat schickte er Geld aus England und für eine Zeit lang auch ein Geschenk zu ihrem Geburtstag, einen feinen Wollschal oder Samthut. Er bekam einige Briefe von Djentil, die, wie er glaubte, ihre Mutter verfasste. Dann blieben die Briefe aus. Als er nach zwei Jahren für einen Sommerurlaub zurückkehrte, meldete er sich nicht bei ihr, und schließlich hörte ihr Vater auf, mit seinem Vater Geschäfte zu machen. Albertos Bruder Maurice hatte eine gute Partie gemacht, deshalb waren seine Eltern so gnädig, ein Auge zuzudrücken.
Alberto blieb zehn Jahre und sechs Monate in Manchester (um auf Nummer sicher zu gehen), abgesehen von gelegentlichen kurzen Heimatbesuchen. Es fühlte sich wie eine angemessene Buße an. England lag ihm nicht, wie man dort drüben sagte. Es war grau und kalt, das Essen fade, die Sprache schwierig und ohne jeden Charme. Der Ehemann der nichtjüdischen Geliebten kehrte aus Indien zurück. Alberto entwickelte ein Interesse für edle Stoffe, lernte Vokabeln wie fustian, brocade und velveteen zu verwenden, stand mit einem Fes auf dem Kopf (sollte er noch eine Schlange mit Korb oder eine Wasserpfeife hinzufügen?) im Cotton Yard und machte Geschäfte; doch die Geschäftswelt langweilte ihn, und Zahlen waren noch nie seine Stärke gewesen. Zu dieser Zeit begann er, der in den Talmud-Tora- und Alliance-Schulen seiner Jugend nur ein leidlicher Schüler gewesen war, nachts zu lesen, und zu lernen; zunächst, um sein Englisch zu verbessern, und dann, als ein Freund aus Thessaloniki ihm Bücher auf Ladino, Hebräisch und Französisch lieh, um die großen jüdischen Denker zu studieren. In den Worten von Saadia Gaon, Jehuda Halevi und vor allem Maimonides fand er tiefschürfende, logische Gedankengänge zu den Themen, die ihn beschäftigten, aber auch einen Weg zurück zu El Dyo, der ihn verlassen hatte oder den er verlassen hatte, obwohl er schon vorher die Gottesdienste der sephardischen Synagoge in der Cheetham Hill Road besucht hatte, weil die rosa Marmorsäulen und der maurische Bogen inmitten des ganzen Graus das Einzige waren, was ihn ein bisschen an zu Hause erinnerte.
Nach der Scheidung, die zwar ins Geld ging, ansonsten aber unkompliziert war, kehrte er erleichtert nach Konstantinopel zurück, ein Ort, den er jeden einzelnen Tag während seiner langen Abwesenheit vermisst hatte. Als er Sultana bei einem Spaziergang auf der Insel Büyükada zum ersten Mal begegnete, war sie barfuß und hängte gerade Wäsche auf. Zu diesem Zeitpunkt war er schon seit einigen Jahren Junggeselle. Tagsüber arbeitete er, abends frequentierte er Varietés, Kaffeehäuser und Bars, spielte Backgammon und Poker und Schach, zockte, diskutierte, debattierte, hörte und spielte Musik und sang mit den anderen Männern. Nach den Bars las er, und nach dem Lesen betete er, und manchmal betete er mehr, als dass er trank, und manchmal trank er mehr, als dass er betete. Jedenfalls schienen die beiden Dinge nie im Widerspruch zu stehen. Freitagabends und samstagmorgens ging er in die Ahrida-Synagoge, und an den meisten Tagen betete er morgens in der kleinen kal im Viertel, wo er auch Freunde traf und beim Kaffee Geschäfte besprach, der von einem barfüßigen Jungen mit einem flaumigen Schnauzer serviert wurde. Jeden Monat schickte er über einen Kurier Geld an Djentil Nahon, und wenn die Geschäfte gut liefen, schickte er ein bisschen mehr, wenn nicht, ein bisschen weniger. Niemand schien besonders daran interessiert, ihm nach seiner Scheidung eine Ehefrau zu vermitteln, und er war der Ehe gegenüber sowieso misstrauisch geworden und wohnte bei seinen Eltern, worüber er nicht unglücklich war.
Sultana mit ihrem frischen Gesicht und den nackten Armen, auf denen sich Wäsche türmte, hätte auch ein Dienstmädchen sein können, doch irgendetwas ließ ihn innehalten – ihre Güte vielleicht oder ihr draller Körper (im Gegensatz zu Djentil Nahon hatte sie etwas Fleisch auf den Rippen) oder die Meeresbrise, die ihren Rock aufbauschte und ihr Haar zerzauste. Er sprach sie an, und sie sagte: Ja, es sei in der Tat ein schöner Tag, und er hörte den irischen Akzent in ihrem Spanyol, fast ein Näseln, eine ungewohnte Melodie. Es stellte sich heraus, dass sie kein Dienstmädchen war, sondern Tochter einer wohlhabenden Familie, die den Großteil ihrer Kindheit in Irland verbracht hatte. Ihr Vater, Behor Camayor, war ein erfolgreicher Tabakhändler (nach seinem Tod würde die irische Botschaft sechs weiße, in Gold gekleidete Pferde stellen, um die Kutsche mit seinem Sarg zu ziehen), und die Familie hatte abwechselnd in Irland, der Türkei und Malta gelebt, bis ihr Vater sich endlich zur Ruhe gesetzt hatte. Ob sie Lust hätte, später ein Eis mit ihm essen zu gehen? Sie sah so jung aus, dass er fürchtete, sie würde Nein sagen, doch sie sagte Ja.
Sie sprachen eine fließende Mischung aus Ladino und Französisch, aber Englisch war ihre Geheimsprache. I’m a wee bit tired, sagte sie, wenn sie bei seinen Eltern zum Abendessen waren, und dann wusste er, es war Zeit für einen Spaziergang im Park, wo sie sich im Schatten der Bäume umarmten. Sultana war flink und lebhaft, fleißig, vernünftig und liebevoll, geistig gesund, und sie schien ihn nicht dafür zu verurteilen, dass er sich von einer anderen Frau hatte scheiden lassen, auch wenn Djentil ihr wahnsinnig leidtat. Ihr gefiel, dass er belesen war (obwohl sie es nicht war) und dass er sang und musizierte. Es war eine Liebesheirat, und weil er bei seinen Eltern gewohnt hatte und kein junger Mann mehr war und sie eine gute Mitgift mitbrachte, konnten sie sich ein Haus auf dem Berg in Fener leisten. Bald kam Corinne zur Welt, dann Rebecca, dann Isidoro. Durch den Tod eines unverheirateten Onkels gelangte Alberto zu noch mehr Geld, und sie kauften ein Sommerhaus auf Büyükdere, also nicht auf der Prinzeninsel direkt, wo die meisten aus ihrem Umfeld den Sommer verbrachten, doch es hatte einen weitläufigen Garten und lag in einem vornehmen Viertel in der Nähe der Sommerbotschaften und nicht weit von der Stadt (wenn die Pflicht rief, war er mit dem Boot in einer Stunde bei der Arbeit), und wenn man vor die Tür trat, begegnete man nicht jedes Mal einem Cousin oder dem Cousin eines Cousins.
Nach Isidoro verlor Sultana zwei Babys, eine Fehlgeburt und eine Totgeburt, sodass Alberto, als das nächste Kind, ein gesunder Junge, geboren wurde, sich auf Sultanas Wunsch dem alten Brauch fügte und ihn für ein paar Tage zu Verwandten gab. Als der Junge zurückkehrte, war er wie ein Prinz gekleidet und trug einen neuen Namen, Marko, was so viel hieß wie »verkauft«. Und auf ihn folgte Elsa. Alberto verdiente es nicht, doch El Dyo hielt die Hand über ihn, weshalb er sich bemühte, schwarze Zahlen zu schreiben und gut für seine Familie zu sorgen. Und das gelang ihm, größtenteils, für geraume Zeit, doch als sich die Kinder mehrten und seine Verantwortung wuchs, wuchs auch sein Verlangen nach Ablenkung. Nicht nach Frauen – er würde Sultana nie betrügen, auch wenn er anderen Frauen nachschaute –, aber nach seinen alten Lieblingsorten, Bars, Bädern, Kaffeehäusern, und am meisten vielleicht nach der Gartenarbeit.
»Lass uns wandeln durch der Gärten Luft / Schmecken der Narden und der Rosen Duft«, schrieb der von ihm geliebte Dichter Jehuda Halevi. Es war ein tiefes, herrlich verbotenes Vergnügen, mitten am Tag die Arbeit zu verlassen und sich für eine Stunde oder so im Garten zu verstecken, wenn niemand zu Hause war – Sultana bei ihrer Mutter oder mit irgendeiner guten Sache beschäftigt, die Kinder bei ihr oder beim Kindermädchen oder in der Schule –, und er harkte oder stutzte oder pflanzte eine neue Tulpensorte, die er in Holland bestellt hatte. Dabei trug er Handschuhe, damit seine Hände ihn nicht verrieten, obwohl er sie manchmal auszog, weil er die Erde fühlen wollte, und zuweilen wurde seine Hose dreckig. Falls Sultana es später entdeckte, verdrehte sie die Augen – du bist schlimmer als die Kinder –, aber es war ein vergleichsweise harmloses Laster. Für ihn war das Gärtnern jedoch fast so erfüllend wie Sex, und vor allem brachte es ihn Gott näher. Es vertrieb seine Sorgen, an deren Stelle tiefe Wurzeln traten, sprießende Triebe, die dünne Umhüllung einer Knospe, die in ihrer eigenen Zeit existierte; sie würde aufgehen, wenn sie aufging, ihre Hülle abstreifen.
Vielleicht versäumte er es also, ein oder zwei potenzielle neue Kunden zu werben. Vielleicht hörte das Geschäft auf zu wachsen und begann zu schrumpfen. Die Zeiten wurden immer härter, nicht nur für ihn, sondern für alle. Wenn die Belastungen der Arbeit ihm zu viel wurden, ging er Poker, Schach oder Backgammon spielen, meist um hohe Einsätze, und gewann immer gerade genug, um sich selbst einzureden, dass Spielen eine vernünftige Lösung sei (öfter verlor er, und das Geld verschwand, als hätten seine Taschen Löcher, obwohl Sultana seine Sachen gut in Schuss hielt, seit sie kein Geld mehr hatten, neue Anzüge nähen zu lassen). Es sind harte Zeiten. Nichts ist mehr so, wie es war. War es seine Schuld, dass die Umstände (und irgendwie gefiel ihm die Vorstellung sogar) ihn in einen dekadenten Fin-de-Siècle-Mann verwandelten? Sein Vater war inzwischen tot und konnte ihn nicht mehr kritisieren. Sultana hatte ihn gebeten, nicht zu spielen, doch Frauen hatten keinen Zutritt zu den Clubs, und die Männer deckten einander, woher sollte sie es also wissen?
Zwar war das schlechte Gewissen sein ständiger Begleiter und sprang gelegentlich aus dem Schatten, um ihn in die Waden zu beißen, doch ebenso präsent war sein Stolz. Er teilte seine Sorgen mit niemandem. Er war stets gut gekleidet, egal zu welchem Anlass, und hatte einen aufrechten Gang. Er war immer in Bewegung, schlängelte sich durch seine Stadt, durch Viertel, wo man ihn kannte und grüßte, und solche, wo er angenehm unerkannt blieb. Manchmal kehrte er in ein Kaffeehaus ein oder vergnügte sich an einer Straßenecke bei einem schlichten Glücksspiel, bei dem man in einen Stoffbeutel griff und einen Knopf hervorzog, verschiedene Farben für verschiedene Gewinne – Ball, Pfeife, Stoffpuppe mit dem Gesicht des Sultans. Dann kam er mit Geschenken für die Kinder nach Hause: Welche Hand, welche Hand? Wie sie kreischten, an ihm zogen, ihn belagerten, also blieb er eine Weile, dann befreite er sich von ihren gierigen, klebrigen Händen – loslassen, ihr Strolche, euer Papa hat einen wichtigen Termin – und zog weiter.
IV
A ls Rebecca zehn ist, stirbt die Mutter von Djentil Nahon. Sie erfahren es von Nurie, Likas Mutter, die mit Lika die Fähre von der Stadt zum Sommerhaus in Büyükdere genommen hat, um eine Woche zu bleiben. Die Mädchen sind im Garten, wo sie gemeinsam mit Corinne auf Rebeccas jüngere Geschwister aufpassen sollen, als sie hören, wie die beiden Mütter sich auf der Veranda über den Tod der alten Dame unterhalten. Offenbar sammelt die Gemeinde Spenden für den Grabstein, doch Djentil ist mit der Organisation überfordert; und hat ihre Familie nicht von irgendwoher Geld, hatten sie jedenfalls mal, und gab es da nicht eine Schwester in Frankreich und einen Bruder in Amerika, aber es kommt nie jemand zu Besuch, den Nahons hat früher das ganze Haus gehört, dann haben sie ein Stockwerk verkauft, dann das andere. Traurig. Wie kann ihre Familie sie so im Stich lassen?
Während des Schuljahrs waren die Besuche der Mädchen bei Tiya Djentil immer seltener geworden, und Rebecca ist froh, dass sie nicht dabei waren, als die alte Dame ihren letzten Atemzug tat.
»Tut mir leid, das zu sagen, aber sie hat eigentlich schon wie tot gewirkt – sie war fünf vor zwölf!«, flüstert Lika, und die Mädchen lachen, weil ihre Mütter diesen Ausdruck immer verwenden, doch dann versucht Rebecca Likas »tot« zurückzunehmen, bevor es noch Unglück bringt. »Du meinst ›lebendig‹«, sagt sie und sieht ihre Freundin eindringlich an, die kurz stutzt, bevor sie erwidert: »Oh, klar. Sie hat lebendig gewirkt. Sehr lebendig! Oh ja, sehr sogar.«
Schließlich verlieren sie das Interesse und müssen sowieso Elsa hinterherjagen, die auf die Gartenmauer geklettert ist, während die Jungen unter der Linde mit Schwertern spielen. Corinne ignoriert sie, die Nase in einem Buch, und die Eidechsen sitzen wie erstarrt auf den Steinen und beobachten alles. Dann taucht ihr Vater zwischen den Büschen auf, schweißgebadet, fast glühend in seinem Gartenhut und den Handschuhen. Er schreit die Jungen an, dass sie aufhören sollen, steigt die Stufen zur Veranda hinauf und wedelt mit den Armen, als wollte er Sultana und Nurie auseinandertreiben, obwohl sie sich nur unterhalten, zwei harmlose Mütter in Blümchenkleidern an einem Sommertag.
Alles steht still. Sogar die Kleinen wissen, dass sie sich besser ruhig verhalten. Dann schreit ihr Vater so laut, dass es die Nachbarn hören. Es reicht, bringt nicht noch mehr Schande über mich, hört zu, es wird keine Spende der Gemeinde geben! Wie können sie es wagen – wie könnt ihr es wagen, so etwas zu sagen und Schande über mich zu bringen? Rebeccas Mutter beschwichtigt ihn, natürlich, du hast recht, Schatz, und beruhige dich, und bitte, Alberto, die Kinder, und bei diesen Worten fährt er herum und starrt seine Kinder und Lika an, als sähe er sie zum ersten Mal.
»Lo syento«, entschuldigt er sich, dann sagt er dieselben Worte noch mal zu seiner Frau und ein drittes Mal zu Likas Mutter, fast weinerlich. »Tut mir leid, tut mir leid, ich habe den Kopf verloren, bitte verzeiht.«
Doch er hört danach nicht auf, wechselt nur ins Englische, die Worte, wenn auch etwas ruhiger, scharf und nasal, mit gespuckten Ts. Tiya Nurie sammelt die Kinder ein – »Kommt, wir gehen die Schiffe anschauen, und wenn ihr brav seid, kaufe ich euch ein Eis« –, paart Klein mit Groß und scheucht sie durchs Tor, obwohl keiner an Eis denkt, sondern alle nur zwei Worte im Kopf haben: Djentil Nahon, Djentil Nahon.
Im Herbst, als sie wieder in der Stadt sind, ruft Tiya Djentil nach Rebecca und Lika, nicht nur ein- oder zweimal pro Woche, sondern Tag und Nacht. Sie klopft auf den Boden (Likas Zimmerdecke), ruft aus dem Fenster, zunächst nach ihren suvrinas, ihren Nichten, so wie es ihre Gewohnheit war, doch schon bald fängt sie an, sie Töchter zu nennen: »Kommt, mijikas, ihr müsst etwas für mich erledigen! Kommt schnell, ich habe etwas für euch gebacken!«
Ihre Mütter sind sich einig, dass Djentil Nahon den Verstand verloren hat, und obwohl sie ein Auge auf die arme Frau haben und dafür sorgen, dass sie nicht verhungert, befehlen sie ihren Töchtern, sich von ihr fernzuhalten. Sie kommt allein zurecht, sagt Nurie, jetzt, wo sie nicht mehr für ihre Mutter sorgen muss. Es tut ihr gut, das Haus zu verlassen. Die Frauen von der Armenhilfe, darunter auch Sultana und Nurie, schauen regelmäßig bei ihr vorbei. Rebecca und Lika protestieren nicht. In Wahrheit sind sie erleichtert. Sie werden größer, zu alt, um ihre Zeit damit zu verbringen, eine verrückte alte Jungfer zu besuchen, und die Nonnen haben gesagt, dass man von zu viel Zucker Pickel bekommt, aber vor allem macht Djentil ihnen jetzt Angst, weil sie so dringend nach ihnen verlangt, weil sie zu sehr an die unsichtbare Welt glaubt, weil sie Mama, Mama, Mama in die Nacht ruft. Lika, sonst ganz wissenschaftlichem Denken verhaftet, sagt, dass sie die alte Frau halb verwest in ihrem Bett liegen sieht, dass sie diese Bilder nicht aus dem Kopf bekommt, und hat Djentil Nahon es eigentlich sofort jemandem erzählt, hat sie das Leichentuch selbst genäht, und was, wenn der Geist ihrer Mutter zurückkehrt? Wir sollten uns von so jemandem fernhalten, sagt Lika mit überraschender Kälte. Wir hätten sie nie Tiya nennen dürfen.