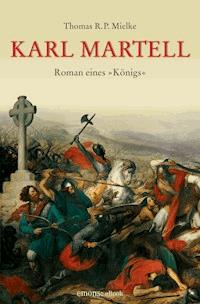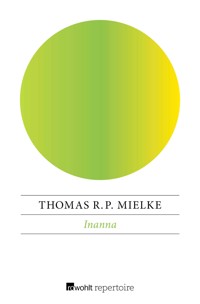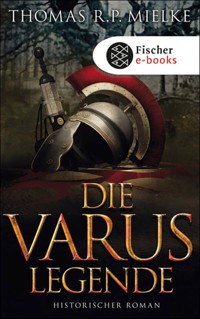Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vater Europas, Herrscher, Krieger und Heiliger. Auf dem Höhepunkt seiner Macht wird er im Petersdom vom Papst zum Kaiser gekrönt: Karl der Große, König der Franken und erster römisch-deutscher Kaiser. Er konnte nicht schreiben, aber versammelte die besten Gelehrten an seinem Hof. Er war unentweg in seinem riesigen Reich unterwegs und schlug als gefürchteter Kriegsherr Sachsen und Sarazenen. Er liebte seine Ehe- und Nebenfrauen ebenso wie seine zahlreichen Söhne und Töchter. Welche Kraft, welcher Wille eines Kerls - denn das bedeutet der Name Karl, - der die politische Landkarte Europas und die abendländische Kultur wesentlich geprägt hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1027
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas R.
Dieses Buch ist ein Roman. Die Handlung ist frei erfunden, wenngleich in das historische Umfeld eingebettet. Einige Personen, Orte, Ereignisse, Zeitangaben und Schreibweisen sind historisch belegt, einige sind es nicht oder in heutiger Lesart verwendet. Letzteres gilt besonders für das noch nicht abschließend geklärte Geburtsjahr Karls des Großen.
© 2013 Hermann-Josef Emons Verlag Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: Monogramm Karls des Großen von 781 Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch eBook-Erstellung: CPI – Clausen & Bosse, LeckISBN 978-3-86358-286-9 Überarbeitete Neuausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons:
Vorwort
IBU DU MI ENAN SAGES, IK ME DE ODRE WET.
»Wenn du nur einen sagst, ich mir die anderen weiß«, heißt es in einem berühmten Vers des Hildebrandsliedes – dem einzigen Fragment, das noch aus Karls germanischem Liederbuch stammt und nicht wie andere Dokumente gleich nach Karls Tod Opfer der ersten groß angelegten Büchervernichtung in der Geschichte Europas wurde.
Neben lateinisch abgefassten Werken hatten die mündliche Überlieferung sowie nicht schriftlich gesicherte Verlautbarungen zu Karls Zeit einen wesentlich glaubhafteren Informationswert als zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Seltsamerweise entdeckt gerade die heute heranwachsende Generation, wie Namen von einzelnen Menschen oder bestimmte Reizworte ganze Wolken von Zusammenhängen wecken.
Karl und seine Gefährten waren keineswegs eine staatstragende Elite mit klarem Ziel und heldischem Auftrag. Aber sie bildeten eine interaktive Gruppe aufeinander eingeschworener »Edelinge«. Sie zelebrierten Klassizismus als Spiel und pflegten ihre Männergemeinschaft unweit von Camelot, der Götterdämmerung und anderen großen Familiensagas der menschlichen Geschichte.
Vieles von Karl und seinen Kampfgefährten, seinen Ehefrauen, Geliebten und Kindern wurde bereits zu ihren Lebzeiten aus unterschiedlichsten Blickwinkeln weitererzählt. Schreibweisen von Namen und Orten, die Jahreszahlen und das Würdigen oder Verschweigen bestimmter Ereignisse verbergen sich auch heute noch in einem fast mystisch-liebenswerten Unschärfenebel.
Auch die Chronisten im audiovisuellen Zeitalter neigen dazu, den Wert der Dinge nach Beweisbarkeiten in der Denkweise der sogenannten Aufklärung zu bestimmen.
Was aber, wenn bereits die Reichsannalen des Klosters Lorsch geschönte Hofberichterstattung sind und Eginhard/Einhard als einziger Zeitzeuge Karls in seiner »Vita Caroli Magni« mehrfach Frauen und Kinder, Jahreszahlen und Zusammenhänge verwechselt?
Wenn zudem im »Roman seines Lebens« von Paderborn, Regensburg oder Venedig gesprochen wird, ist das zwar eine Hilfe für den Leser, aber streng genommen geschichtlich unwahr, da es diese Namen damals noch nicht gab.
Aus Karls Regierungszeit sind heute 261Urkunden bekannt. 41 davon sind mit Schreibfehlern gespickte Originale, 122 noch fehlerhaftere Kopien und 98 nachgewiesene Fälschungen. Karls Leben ist 1.200Jahre lang umgeschrieben und nach den unterschiedlichsten Absichten gedeutet worden. Weltweit gibt es Tausende von Arbeiten über Karl den Großen, Charles the Great oder Charlemagne – aber nicht einmal eine Handvoll Romane (was nichts anderes als »verständliche Sprache« bedeutet) über das Leben dieses Mannes, das im Wortsinne bewegter war als irgendein anderes.
1.200Jahre nach seinem Tod sollte Karl deshalb das Recht erhalten, auch einmal Mensch zu sein – ein ganz normaler Mensch.
Thomas R.P. Mielke
Berlin im Jahr vor 2014
1
Der Papst und das Kind
Die Ohren der Stute spitzten sich. Gleichzeitig schnaubte die Braune in die viel zu frühe Winterkälte. Von allen Pferden der kleinen Reiterschar, die sich am Rand der vereisten oberen Rhone flussaufwärts kämpfte, trug die Stute die leichteste Last.
»He, Karl, pass auf!«, rief der versetzt hinter ihm reitende Anführer der Kriegergruppe. »Sieh nach vorn und nicht auf die Ohren der Mähre!«
»Sie hat etwas gehört!«, antwortete der Junge, und seine hellblauen Augen blitzten stolz. Er ärgerte sich über die ständigen, eigentlich gut gemeinten, aber verletzenden Belehrungen seines Onkels. War er nicht groß genug, um mit seinen fellumwickelten Füßen festen Halt in den Steigbügeln zu finden? Hatte er den Wintereinbruch bereits im November nicht ebenso durchgehalten wie die in Schafspelze gehüllten Männer mit ihren Ohrenwärmern unter Helmen aus Leder und Eisen? Auch ihre Gesichter waren vor Kälte und Anstrengung gerötet. Was machte es da, dass er selbst erst in einigen Tagen seinen zwölften Geburtstag feiern würde?
Natürlich wusste er, welche Auszeichnung es war, dass er zusammen mit den besten Männern des Frankenkönigs einem besonderen Ereignis entgegenreiten durfte.
»Wenn eintrifft«, murmelte er den längsten und schwersten Satz, den er je auswendig gelernt hatte, »wenn eintrifft, worauf das ganze Frankenreich von der Bretagne bis Baiern wartet, das kranke Rom hofft, was der König der Langobarden mit aller Macht zu verhindern versucht hat und was die islamischen Herren Hispaniens, den christlichen Kaiser von Byzanz und den blutrünstigen Kalifen von Damaskus mit Sorge erfüllte, dann … ja dann wird dieser Tag den Beginn einer neuen Epoche einleiten.«
Ein großer Tag, denn 753 Jahre nach Christi Geburt wollte erstmals ein Papst nördlich der Alpen erscheinen. Und das auch nur, weil er beim König der Langobarden in Pavia kein Gehör gefunden hatte.
Der junge Königssohn hatte mitbekommen, was die Erwachsenen sprachen, doch eigentlich interessierte ihn die großartige Landschaft viel mehr. Noch nie zuvor hatte er derartige Berge gesehen. Die Walliser Alpen kamen ihm wie Wirklichkeit gewordene Weltenwunder aus den uralten Sagen und Überlieferungen der Ahnen vor, wie Asgard, die Burg der germanischen Götter, wie Utgard, die Felsenwildnis, und weit entfernt von Midgard, dem Land der Menschen. Hier hätten die Wipfel der Weltesche Yggdrasil in den Himmel hinaufragen können. Das Schnauben der Pferde, das Klirren der Waffengehänge und die gelegentlichen Warnrufe der Reiter vor und hinter ihm klangen genau so, wie er sich immer die ersten Ausritte der Uralten vorgestellt hatte.
Der Anführer der Reiterschar merkte, wie es in Karl arbeitete. »Was ist denn, Blondschopf? Noch immer beleidigt, dass ich dich heute Morgen im Kloster über dem Grab des heiligen Moritz zurücklassen wollte?«
»Nein«, sagte Karl und presste seine vor Kälte schmerzenden Lippen zusammen. Gekränkt und dennoch stolz drehte er den Kopf zur Seite. Seit sie die Königspfalz von Ponthion in der Champagne verlassen hatten, war kaum eine Stunde vergangen, in der Onkel Bernhard ihn nicht gerügt, auf Fehler in seinem Verhalten hingewiesen und immer wieder belehrt hatte.
»Komm, Junge«, beschwichtigte Bernhard. Er ritt dicht neben Karl und legte ihm den Arm um die Schulter. »Ich meine es doch nur gut. Du bist ein großer, schöner Kerl, mutig und königlich in deinem Denken, aber du musst noch lernen, dass Träumereien ebenso tückisch sind wie das Eis hier am Ufer des Flusses.«
Karl hörte die Worte seines Onkels, aber er wollte sie nicht verstehen, denn gleichzeitig bewegten sich erneut die Ohren seiner Stute.
»Siehst du das?«
Er sah seinen Onkel herausfordernd an. Er war ebenso wie sein Vater Pippin ein Sohn des berühmten Karl Martell. »Die Stute hört, was du nicht hörst! Und ich bemerke es, deshalb werde ich eines Tages größer und besser sein als du!«
Bernhard lachte. »Karl, ich fürchte mich vor dir!«, rief er dröhnend. Er war der Anführer der Abordnung, die sein Halbbruder als König der Franken dem Papst entgegenschickte. Er lachte erneut, dann beugte er sich vor und ließ sein Pferd noch riskanter über die mehrschichtigen Eisplatten am Felsenufer staksen.
»Dein Hengst hat auch etwas gehört!«, rief Karl ihm nach. »Ich glaube, sie kommen … dort oben, an der Nordflanke des Mons Jupiter …«
Er deutete zum gewaltigen Bergmassiv, das aus dem engen Flusstal der oberen Rhone wie eine unüberwindliche, bis in den Himmel aufragende Mauer aussah. Bernhard zügelte seinen schwarzen Rappen, legte die Hand über die Augen und blinzelte über die strahlenden Schneeflächen hinweg zum dunklen Teil des Mons Jupiter.
»Vor so hohen Bergen müssen wir Flachländer uns vorsehen«, rief er Karl zu. »Wir stammen vom unteren Rhein und haben kein Gefühl für die Gefahren des Hochgebirges.«
Im gleichen Moment drang das ferne Echo eines Trompetensignals bis zu den Männern.
»Sie kommen, sie kommen!«, riefen die Reiter, die sich seit Tagen im Sattel hielten. Karl spürte die Aufregung, und auch die Pferde schienen die tagelangen Anstrengungen zu vergessen. Selbst Bernhards Rappe fing sich wieder und sprang mit einem weiten Satz neben Karls Stute.
»Unglaublich!«, sagte Bernhard und bewunderte die bunten Flecken hoch oben im Schnee. »Sie haben es geschafft! Ausgerechnet in der kalten Jahreszeit kommt ein Papst aus Rom über die Alpen. Stephan II., in Rom abgeholt, beschützt und begleitet durch unsere beiden besten Kirchenmänner.«
Karl konnte sich kaum an den Abt Fulrad von Sanct Denis erinnern. Er hatte ihn nur einmal gesehen. Von Burchard von Würzburg wusste er nur, dass er ein Schüler des großen Missionars Bonifatius sein sollte.
»Und wie findest du das alles, Junge?«, rief Bernhard vergnügt.
»Ich glaube, dass es sehr wichtig ist.«
»Wichtig? Nur wichtig?« Bernhard lachte noch lauter. »Es wird der größte Triumph deines Vaters sein! Denk doch – der Papst aus Rom, der mächtige Bischof der Christenheit … dieser Mann kommt unter unserem Schutz durch das gefährliche Aostatal und die Bergriesen ins Frankenreich! Und was will er? Ich sage es dir: Er will die Macht deines Vaters … gegen die Langobarden, die Araber, gegen die Oströmer in Konstantinopel und gegen die schlaff gewordenen Adelsfamilien am Tiber, die längst vergessen haben, was Rom einmal war. Sie lassen Schafe rund um den Lateranpalast weiden! In Rom, Karl, verstehst du?«
Karl überlegte, was er über Rom wusste. Bisher hatten ihm seine Lehrer mehr über die Völkerwanderung, die germanischen Stämme und über die Merowinger als schwache Frankenkönige erzählt. Kaum ein Tag war vergangen, an dem er nicht etwas vom Ruhm und der Kraft seines Vaters gehört hatte, der vor Kurzem noch Hausmeier der fränkischen Merowingerkönige und nicht selbst König der Franken gewesen war.
Rom … ja, was war Rom? Eine vage Erinnerung an ein Weltreich, das seit Jahrhunderten keine Bedeutung mehr hatte. Karl wusste, dass es überall an den großen Strömen und selbst in den düsteren Wäldern von Gallien, Austrien und Neustrien alte Kastelle, verfallene Städte und Reste von gepflasterten Römerstraßen gab. Er hatte sogar etwas aus der Schrift von Caesar über den Krieg der Römer in Gallien gelesen, auch wenn er die Sätze noch nicht nachschreiben konnte. All die Geschichten von den versunkenen Königreichen gefielen ihm, weil sie groß, voller Abenteuer und wie ein Ziel für ihn selbst waren.
»Träum nicht schon wieder!«, rief Bernhard. »Was soll denn der Papst vom Sohn das Frankenkönigs denken? Komm, bleib noch zwei Stunden wach, dann treffen wir ihn!«
Karl wusste nicht, was er erwartet hatte, aber mit Sicherheit nicht das, was er jetzt sah … Der Zug des Papstes war keine glanzvolle Prozession, sondern sah viel eher wie ein jämmerlich wirkender Abstieg frierender Saumtiere aus. In der Mitte der mühsam näher kommenden Gruppe wurde ein unsicherer Zelter an ledernen Gurten geführt. Von seinem Brustgeschirr spannten sich weitere Leinen bis zu einer durch den Schnee tiefer rutschenden Kuhhaut, auf der sich eine vermummte Gestalt festklammerte.
»Ist das der Papst?«, fragte Karl ungläubig. Sein Onkel wischte sich über seinen mit Eisperlen bedeckten Schnurrbart.
»Scheint so«, sagte er. Das, was er sah, schien ihm ebenso wenig zu gefallen wie den anderen. »Aber vergiss nicht, dass dieser Mann seit Oktober unterwegs ist. Und unsere beiden edelsten Kirchenfürsten, die ihn jetzt begleiten, waren vor zwei Jahren schon einmal in Rom.«
»Ich weiß«, sagte Karl. »Sie sollten den damaligen Papst Zacharias fragen, ob es gut sei, dass derjenige König heißt, der zusammen mit seinem Sohn ins Kloster Prüm geschickt wurde und nur noch den Titel hat, oder ob nicht viel eher derjenige der wahre König ist, der alle Macht in seinen Händen hat.«
»Wer hat dir das gesagt?«, fragte Bernhard verwundert.
»Viele«, antwortete Karl. »Ich habe zugehört, wenn sich die Edlen und auch die Knechte darüber unterhielten. Und Vaters Frage an den Papst muss gut gewesen sein, sonst wäre doch immer noch der Merowinger Childerich III. König der Franken, oder?«
»Darüber könnte man lange streiten«, seufzte Bernhard.
Karl spürte, dass es Geheimnisse der Macht geben musste, von denen er nichts ahnte. »Auf jeden Fall hat die Reichsversammlung in Soissons vor zwei Jahren uns zum König gewählt«, sagte er. »Ich war dabei, und ich habe selbst gesehen, wie Bonifatius meinen Vater salbte. Und wie der letzte König der Franken aus dem Geschlecht der Merowinger geschoren und ins Kloster geschickt wurde …«
»Dann pass schön auf, dass du nicht ebenfalls die Kutte bekommst!«
Karl schnalzte abfällig.
Aus irgendeinem Grund hatten die Reiter an einer Schleife des Flusses an einer mehrere Fuß hohen Felswand angehalten. Bernhard schickte einen Grafen aus seiner Begleitung vor. Der viel zu schwer bewaffnete Graf Rupert stammte aus dem oberen Rheingau. Er kam bereits nach wenigen Augenblicken wieder. »Sie bauen sich ein Zelt auf. Ich denke, dass sie den Papst vor seiner ersten Begegnung mit uns umkleiden.«
»Auch das noch!«, schimpfte Bernhard. »Und mittlerweile frieren wir uns hier die Ärsche ab!« Er sah sich hektisch um, dann zeigte er auf eine ausgewaschene Stelle am Flussufer.
»Wir sitzen ab und schlagen dort drüben Feuer. Holz haben wir mit. Und für einen Becher heißen Wein sollte die Zeit reichen!«
Steifbeinig rutschte er von seinem Pferd und übergab es einem Pferdeknecht. Karl folgte ihm. Sie sahen zu, wie die Waffenknechte ein kleines Feuer im Schnee auflodern ließen und einen Kessel für den Wein aufhängten. Die Männer, die bisher wie angewachsen auf den Rücken der Pferde gehangen hatten, liefen aufstampfend im Kreis herum, schlugen die Arme zusammen und versuchten, die Kälte aus ihren Körpern zu vertreiben.
»Verrückt, was?«, schnaubte Bernhard.
»Ich weiß nicht, was du meinst«, sagte der junge Königssohn.
»Na ja, da läuft der heiße Schweiß aus allen Körperfalten – gleichzeitig frieren uns Nasen und die Finger ab … hier, sieh mal meinen Bart …« Er beugte sich zu Karl hinüber, zerrte an seinem Bart und brach sich plötzlich einen ganzen Eiszapfen aus seinem blonden Haargestrüpp. Karl wollte nicht, aber er musste lachen.
»Jetzt hast du dir den halben Schnurrbart abgebrochen!«
Bernhard, der Krieger, Heerführer und Halbbruder des neuen Frankenkönigs, starrte ungläubig auf das Eisstück in seinen Fingern. Mit seinem dichten Büschel aus blonden Haaren sah er wie ein wässriger Pinsel aus den Schreibstuben der Mönche aus.
»Hach!«, sagte Bernhard, nachdem er sein Erstaunen und seinen Ärger hinuntergeschluckt und seine edlen, aber vereisten Barthaare weggeworfen hatte. Er drehte sich um und stampfte mit seinen in graugrüne Binden gewickelten Beinen durch den Schnee. Karl hatte Mühe, ihm zu folgen. Sein Fellmantel und das extra für ihn geschmiedete Kurzschwert schleiften, und mit jedem Schritt sank er bis zu den Kniehosen ein.
Der Platz, an dem die Knechte laut lärmend ein Feuer angezündet hatten, war beinahe schneefrei, aber glatt und gefährlich.
»Herrgott, warum ausgerechnet hier?«, fluchte einer der jungen Reiter. Karl sah, wie Bernhard sein Gesicht verzog. Mit seinem halben Schnurrbart sah es ziemlich schief aus.
»Hör auf zu grinsen!«, fauchte er Karl an.
»Aber ich grinse doch gar nicht …«
»Natürlich grinst du! Jeder hier grinst!«
»Die Männer frieren«, sagte Karl. »Nur deshalb verziehen sie den Mund …«
»So?«, fragte Bernhard und hielt sich die Hand vor sein Gesicht. »Meinst du wirklich?«
Karl nickte ernsthaft. Er blickte auf das lodernde Feuer, über dem der Kessel mit rotem gewürztem Wein zu singen begann.
»Ein halber Schnurrbart sieht nicht gut aus«, sagte er nachdenklich.
»Ja, und? Was soll ich tun?«, fauchte Bernhard.
Karl hob die Schultern. Er überlegte eine Weile, und eine kleine Falte bildete sich auf seiner kindlich glatten Stirn. »Du könntest deinen Helm abnehmen und den Kopf schnell durch die Flammen des Feuers dort bewegen.«
»Bist du wahnsinnig? Soll ich mit Kindereien Gott den Allmächtigen erzürnen! Das würde mir die Haare und auch noch den Kinnbart ansengen.«
»Ja«, sagte der Junge mit seiner hellen Stimme. »Genau das soll es ja!«
Bernhard zuckte zusammen. Erst jetzt begriff er, was der nicht einmal Zwölfjährige ihm vorschlug. Karl wollte ihn nicht quälen, ihn nicht verletzen oder zum Narren halten. Im Gegenteil! Klar und vorausschauend empfahl er seinem Onkel den kurzen Schmerz der Flammen für den zerstörten Bartschmuck anstelle des Gelächters, das Bernhard nicht vermeiden konnte, wenn er so vor den Papst träte und zum Königshof zurückkehrte.
»Du meinst, ein paar verkohlte Haare …«
»… sind besser als ein halber Schnurrbart!«
»Verdammt, verdammt!«, murmelte Bernhard. »Aber der Papst könnte jeden Augenblick um den Felsen kommen.«
»Dahinten ist er schon«, stieß Karl unnachgiebig und ein wenig atemlos hervor. »Na los, Onkel Bernhard!«
»Dass ein so kleiner Kerl so grausam sein kann …«
»Ich bin viel größer als alle anderen in meinem Alter!«, stellte Karl fest. »Außerdem ist mein Gedanke nur gut für dich!«
»Ja, ja, das weiß ich doch!«
»Und warum wartest du dann?«
»Weil ich mich erst daran gewöhnen muss, dass dieses Kind vor mir nicht nur klar denken, sondern auch herrschen und befehlen kann!«
»Ich habe nichts gesagt, was du nicht machen könntest.«
»Genau das ist es!«, stieß Bernhard rau und irgendwie vergnügt hervor. »Man darf nur das befehlen, was man auch durchzusetzen weiß. Merk dir das, Karl! Es ist die erste Regel jedes Herrschertums.«
Bernhard kraulte noch einmal seinen malträtierten Bart, dann stampfte er zum Feuer, ließ sich einen Becher mit heißem Wein geben, trank ihn, ohne zu pusten, mit einem langen Schluck leer, rülpste, wie um sich Mut zu machen, und rutschte so vollendet aus, dass niemand merkte, wie er mit voller Absicht unter dem Weinkessel ins Feuer glitt.
Mehrere Männer schrien auf. Einige sprangen hoch und griffen nach Bernhards Beinen. Sie zogen ihn auf dem Rücken liegend heraus, warfen Schnee über sein Gesicht und löschten gleichzeitig mit heißem Rotwein die vielen kleinen Flammen seines Pelzes. Graf Rupert schlug Bernhard mehrmals ins Gesicht. Der schon vom heißen Wein rotnasse Schnee wurde durch die verkohlten Bartreste und Wollfäden immer schmutziger.
Karl ging vorsichtig um das Feuer und seinen Onkel herum. Ihre Blicke trafen sich, und Karl erkannte sofort die große Frage in den Augen seines Onkels.
»Gut so!«, meinte er. Er wandte sich an Graf Rupert. »Meine Mutter sagt immer: ›Mit Ringelblumen auf den Wunden ist zum März der Schmerz verschwunden.‹«
Als der Papst mit seinem frierenden, völlig erschöpften Gefolge ankam, musste keine Seite große Worte machen. Doch dann geschah etwas sehr Sonderbares, denn niemand bei den Franken war darauf vorbereitet, an Bernhards Stelle zu treten. Es war Karl, der kaum zwölfjährige Sohn des Frankenkönigs, der den Papst aus Rom ohne Furcht begrüßte.
»Salve, Pontifex Maximus!«, rief er so, wie es sein Vater tat, wenn er beim Märzfeld über die Köpfe von vielen hundert Kriegern hinwegbrüllen musste. »Sei höchst willkommen bei uns im Frankenreich! Gibt es bei euch in Rom auch so Schnee?«
Der Papst zuckte bei jedem Wort wie unter einem Peitschenschlag zusammen. Er verzog sein Gesicht, als würde ihm die helle Kinderstimme trotz seiner pelzbesetzten roten Kappe sehr schmerzhaft in den Ohren klingen. Derartig überrascht, hockte er in all seiner Pracht und Würde wie erstarrt auf seinem Zelter und ließ wie ein Weib beide Beine nach einer Seite hängen. Er öffnete den Mund, bewegte die Lippen und brachte dennoch keinen Ton hervor. Bischof Burchard und Abt Fulrad warfen sich ziemlich entsetzte Blicke zu. Mit einer derartigen Begrüßung hatten auch sie niemals gerechnet.
»Ein Kind!«, keuchte Papst Stephan II. schließlich. »Bin ich den Franken etwa nur so viel wert, dass mir weder ihr König noch einer ihrer Großen entgegenkommt?«
»Darf ich dir Karl vorstellen?«, rief der schmalgesichtige, asketisch wirkende Abt von Sanct Denis geistesgegenwärtig. »Er ist der Sohn von König Pippin …«
»Der Thronfolger?«, fragte der Papst misstrauisch.
»Ja«, bestätigte Bischof Burchard mühsam. Sein vor Kälte gerötetes, fleischiges Gesicht wurde noch roter. Er griff sich an die Brust und begann zu keuchen. »Er und sein kleiner Bruder Karlmann … sind König Pippins einzige Söhne.«
Noch ehe der Papst etwas entgegnen konnte, brach Bischof Burchard zusammen. Megingaud, sein ebenfalls rotgesichtiger engster Vertrauter, versuchte ihn aufzufangen. Es war, als hätte der erste Bischof von Würzburg gerade noch die Kraft gehabt, den Papst über die Alpen zu begleiten.
Die Sonne senkte sich den ehedem weiß-blau strahlenden Gipfeln der Berge zu. Die Schatten in den Tälern wurden dunkler, und Kälte zog wie ein Gespenstertuch über soeben noch helle Schneematten.
Fast hundert Reiter, Edle, Geistliche, Bedienstete und Sklaven zogen im Tal der Rhone zum Genfer See hinab. Voran ritt Bernhard mit vier Waffenknechten. Ihm folgten Karl, fränkische Reiter und ein Gemisch frierender Römer. In ihrer Mitte hing Papst Stephan wie eine hohe Dame auf seinem Zelter, der auch bei Schnee und Eis den Passgang nicht vergaß. Es hatte lange gedauert, bis er durch die vereinten Bemühungen Bernhards und der fränkischen Kirchenfürsten wieder milder gestimmt war. Zuerst hatte Karl nicht verstanden, worum es eigentlich ging, doch dann war ihm klar geworden, dass er mit seinem guten Willen fast eine Katastrophe verursacht hatte. Den Abschluss bildeten die leise betenden Würzburger mit dem bewegungsunfähigen Korpus ihres Bischofs und Abt Fulrad mit den Mönchen seines Klosters, die sie von Anfang an begleitet hatten.
Kurz vor Sanct Moritz schloss sich schreiend und singend fränkisches Fußvolk an. Die Männer schlugen das Kreuzzeichen vor Brust und Kopf, warfen sich vor dem Pferd des Papstes in den Schnee und krochen dessen Spuren wie einer heiligen Blutspur hinterher.
Der Papst hatte seinen wärmenden Fellmantel über den Rücken seines Zelters gelegt. Hoch aufgerichtet und eingehüllt in den roten Ornat für höchste Feiertage, thronte er wie ein König auf seiner Mähre. Nach all den Tagen und Wochen der Qual und Erniedrigung genoss er die Anbetung, die seiner würdig war.
Es war längst dunkel im Tal der Rhone, als der Zug aus Reitern und Fußvolk endlich das Ufer des großen Alpensees erreichte. Sie bogen zum Nordufer hin ab. Schneller als üblich wurden Zelte errichtet, drei, vier Feuer entzündet, Kessel an hölzernen Stangen aufgehängt, Schnee, klein geschnittenes Fleisch und teils gefrorenes, teils getrocknetes Wurzelgemüse zusammengeschüttet und zu Suppen gekocht.
Fast alle Männer kamen zur Abendmesse. Papst Stephan segnete und sprach ein Gebet für den daniederliegenden Burchard. Er predigte über die schwere Aufgabe christlicher Missionare in den von Heiden bewohnten Gebieten nördlich des früheren römischen Limes-Grenzwalls und über die gottgewollte Aufgabe der Frankenkönige. Beiläufig verkündete er, dass Megingaud Bischof Burchards Erbe antreten sollte.
Anschließend holten sich alle einen guten Schlag heiße Fleischsuppe, schlürften Schluck um Schluck und wärmten sich die Hände an ihren irdenen Näpfen und Holzschalen, kauten auch ein paar Bucheckern oder den Sterz – das harte, dauerhafte Brot aus Schrot, das nicht so schnell den Schimmel ansetzte. Sie redeten nicht viel dabei. Einige machten sich noch etwas Met heiß, dann zogen sie sich nach und nach zurück und putzten mit Werg, Bienenwachs und Wolle die eisernen Lamellen ihrer Helme und die Ringe der Kettenhemden. Jeder von ihnen pflegte sorgsam den Teil der Ausrüstung, auf den er ganz besonders stolz sein konnte. Einige kämmten Helmschweife aus langem Rosshaar oder von ihren Mädchen. Andere pinkelten vorsichtig in kleine Öllampen aus Ton, rührten mit einem Pfeilende weißen Kalkstaub, Gerbsaft von ausgepressten Eicheln und Bibergeil zu einer glatten Paste. Sorgfältig walkten sie jede Schnur und jeden Fleck aus Leder an Harnisch, Helm und Ausrüstung damit ein. Erst spät blickten die Letzten noch einmal zum Polarstern am kalten Nachthimmel, ehe sie sich endlich unter die schwer gewordenen Felldecken legten.
Bernhard und Karl blieben als Letzte wach. Nur noch ein kleines Öllicht hing an einer Schnur von den Zeltstangen herab.
»Was meinst du, warum dieser Papst mitten im Winter zu deinem Vater kommt?«, fragte Bernhard.
»Das weiß ich doch«, antwortete Karl. Er dachte darüber nach, wie Onkel Bernhard sich fühlen musste: Zuerst verliert er seinen halben Bart, dann brennt er sich die restlichen Gesichtshaare ab, und wie zum Hohn wäre beinahe auch noch der Empfang des Papstes misslungen.
»Lass hören, was du weißt«, hakte Bernhard nach und tat, als wäre der Tag vollkommen normal verlaufen, gähnte und warf sich nochmals zur Seite. Karl wusste es besser. Er war überhaupt nicht müde. Hellwach blickte er zur kleinen Flamme des Öllichtes hinauf. Draußen war fast alles still. Nur ein paar Männerstimmen waren zu hören. Für Karl gehörte es seit seinen frühesten Kindertagen zu den schönsten Ereignissen eines zu Ende gegangenen Tages, wenn er noch ein wenig über Gott und die Welt, die Uralten und Ahnen, über ferne, geheimnisvolle Königreiche und all ihre Geschichten hören und sich später auch unterhalten konnte. Er liebte die Sagen und Märchen, die von den Frauen in der Spinnstube erzählt wurden. Sie gehörten ebenso zu seiner Welt wie das Klirren der Waffen und das Schnauben der Pferde.
Erst vor Kurzem hatte er entdeckt, dass es wahre und unwahre Geschichten gab. Nicht, dass er jede Mär als Lüge empfand, aber es kam ihm vor, als würden die Männer um seinen Vater die gleichen Vorgänge ganz anders beschreiben und beurteilen als Frauen und Kinder. Ihm fiel selbst auf, dass er sich mehr und mehr bemühte, nach Männerart zu antworten und zu berichten.
»Südlich der Alpen hat der neue Langobardenkönig Aistulf von seiner Hauptstadt Pavia aus den Kampf um den Dukat von Rom und die Pentapolis wieder aufgenommen«, sagte der kaum Zwölfjährige ernsthaft und mit großen, blinkenden Augen. »Er ist ein wilder Hund und will ein Königreich Italien mit der Hauptstadt Rom.«
»Gut gelernt«, meinte Bernhard. »Aber so wild ist Aistulf gar nicht. Dein Großvater Karl Martell zum Beispiel hat überhaupt nichts gegen ihn gehabt. Immerhin hat er Pippin, deinen Vater, genau deshalb von einem Langobarden adoptieren lassen.«
»Ging das denn?«, fragte Karl nachdenklich. Er hatte nie verstanden, warum sein eigener Vater nicht nur der Sohn von Karl Martell, sondern auch Adoptivsohn des Langobardenkönigs Liutprand gewesen war. »Wie kann jemand Sohn oder Tochter eines anderen werden, nur weil einige Notare nicken und ein Stück Pergament unterschrieben wurde?«
»Nun, Karl Martell war ziemlich gut befreundet mit dem Langobarden«, sagte Bernhard und reichte ihm einen Holzbecher mit heißem Würzwein. »Beiden ging es um Baiern. Deshalb heiratete Liutprand die Agilolfingerprinzessin Guntrud und dein Großvater Karl Martell ihre Schwester Swanahild. So konnten beide ihren Machtbereich bis nach Baiern ausdehnen. Und in den dreißiger Jahren – nach dem Sieg über die Sarazenen bei Tours und Poitiers – wurde Pippin als Adoptivsohn nach Pavia geschickt.«
»Ja, aber da war Vater schon dreiundzwanzig und kein Kind mehr!«, sagte Karl, nachdem er kurz im Kopf die Jahreszahlen nachgerechnet hatte. »Kann man denn Erwachsene einfach adoptieren?«
»Oh ja«, lachte Bernhard halblaut. »Auch das ist hohe Politik. Immerhin hatte Karl Martell mehrere Söhne, mich eingeschlossen, und Liutprand nur eine Tochter. Wenn alles wie geplant gelaufen wäre, hätte mein Halbbruder Karlmann die Frankenkrone übernommen und dein Vater Pippin wäre König von Italien geworden.«
»Ich später etwa auch?«, fragte Karl entsetzt.
»Vielleicht, vielleicht auch nicht«, sagte Bernhard und nahm laut schlürfend einen großen Schluck heißen Weines. »Liutprand war eigentlich ein guter König. Er konnte weder lesen noch schreiben, aber er unterstützte mehrmals den Papst gegen den Kaiser in Byzanz … bis er selbst gegen die Pentapolis und Rom vorging. Und erst im Alter, als er kränkelte, wurde er nachgiebig und schwach gegenüber den Einflüsterungen seiner Berater. Nach ihm blieb sein Neffe und Mitkönig Hildeprant nur noch wenige Monate im Amt.«
»Was geschah dann?« Karl hatte bisher eher gelangweilt von den Langobarden gehört. Ihn interessierte die Geschichte seiner eigenen Familie viel mehr. Ebenso wie die Geheimnisse und Verschwörungen der Merowingerkönige und der Burgunder mit Siegfried, Hagen von Tronje, Wieland dem Schmied und all den anderen, von denen am abendlichen Kaminfeuer in einer der vielen Pfalzen oft erzählt wurde.
»Die Edlen der Langobarden wählten Ratchis, den furchtlosen Sohn des Herzogs von Friaul, zu ihrem neuen König. Doch nur mit großer Mühe konnte Ratchis seinen Bruder vom Königsmord zurückhalten …«
»Ach so«, sagte Karl. »Jetzt kann ich mir schon denken, was passierte …«
»Na? Was?«, fragte Bernhard und spuckte vom Wein rot gefärbte Kräuter in den Schnee.
»Warte, gleich«, sagte Karl. Er überlegte angestrengt und deutete dabei mit der rechten Hand mehrfach und schnell in verschiedene Richtungen. »Also«, meinte er dann, »erstens muss das lange Bündnis zwischen uns und den Langobarden einen Bruch bekommen haben …«
»Stimmt«, sagte Bernhard. »Ratchis ließ sogar die alten Festungen in den Alpentälern wieder aufbauen.«
»Und zweitens könnte etwas mit Rom passiert sein.«
»Treffer!«, sagte Bernhard und rülpste. »Du bist ein kluges Kerlchen, Karl. Leider lebt Zacharias, dieser weitsichtige Papst aus Griechenland, nicht mehr. Stephan II. ist Römer. Wie er wirkt, hast du ja selbst gesehen! Trotzdem … wenn alles wie verhandelt und geplant verläuft, erhält der Papst das gesamte Land südlich von Padua einschließlich der byzantinischen Provinzen.«
»Und wir?«
»Pst!«, zischte Bernhard und lachte leise. »Na, was wohl?«
»Den Rest?«, fragte Karl.
»Aber schweig darüber, verstanden? Das alles ist so streng geheim, dass selbst die Zeltleder abgewaschen werden müssten, die meine Worte jetzt gehört haben!«
Draußen waren die Feuer bis auf die Glut vor drei vermummten Wachtposten längst im geschmolzenen Schnee erloschen. Ein paar der Frankenkrieger in ihren Zelten schnarchten, furzten innig oder knirschten noch eine Weile mit den Zähnen. Dann legte sich die Stille der sternklaren Winternacht über das Lager und schloss das Buch jenes Tages, der auch in mehr als tausend Jahren unvergessen sein sollte …
Der lange Weg durch die verschneiten Wälder und über die eisigen Berge Burgunds bis zur Königspfalz von Ponthion in der Champagne dauerte zwölf Tage. Zweimal lagen Getötete am Wegesrand, einmal ein nackter Gefrorener, dessen Mund noch immer wie ein vornehmer jüdischer Mercatore lächelte, ein andermal konnte niemand mehr die Gesichter des Paares in blutigen Lumpen erkennen, das wohl vergeblich versucht hatte, sein kleines Kind zwischen sich vor räuberischen Nachtvögeln oder Bären zu schützen.
Erst in den letzten Tagen, nachdem sie die vereiste Marne überquert hatten, kamen der Papst, sein Gefolge und die Abordnung des Frankenkönigs fast ohne Zwischenfälle voran. Nur einmal hatte kurz vor Sonnenaufgang ein Haufen halb verhungerter Pilger versucht, ein paar Vorräte zu stehlen. In einer anderen Nacht, dicht vor Chalons an der Marne, waren hungernde Wölfe im Mondlicht aufgetaucht. Feurige Fackeln hatten schnell beide Ereignisse beendet.
Am Tag darauf schickte Bernhard einen Boten voraus. Und dann geschah, was die Berater Pippins schon vor Monaten rund um die Truhe mit dem halben Mantel des heiligen Martin geplant hatten …
Am 6. Januar des Jahres 754, dem Dreikönigstag, näherte sich Papst Stephan mit seinen Begleitern dem Hofgut, in dem der neue Frankenkönig überwinterte. Von einem flachen Hang aus wirkte der erste Blick auf das Geviert aus langen Wohnhäusern mit umlaufenden Balkonen, Stallungen, Höfen mit bunten Zelten und kahlen Obstbäumen wie das Gemälde aus einer fremden Welt. Der innere Bereich wurde durch einen hohen Palisadenzaun geschützt. Überall stiegen dünne Rauchfahnen in den blassblauen Winterhimmel. Schon von Weitem ließ sich erkennen, dass Pippins Hofstaat sehr viele Menschen umfassen musste.
Immer mehr Reiter und dann auch Fußvolk sammelten sich am Saum des Winterwaldes. Bernhard hatte den rechten Arm gehoben. Niemand wagte, an ihm vorbeizureiten oder den Schnee vor seinem Pferd mit seinen Füßen zu berühren. Nur Karl, der junge Königssohn, verstand nicht, was nun vorging. Er trieb sein Pferd bis an die Seite seines Onkels.
»Warum geht es nicht weiter?«
»Ganz ruhig, Junge!«, befahl Bernhard leise. »Du kannst mich alles fragen, aber nicht jetzt.«
Im gleichen Augenblick sah Karl, wie sich vom Hofgut aus eine seltsame Prozession in Bewegung setzte. Reiter um Reiter kam durch das Haupttor. Helme und Brustharnische blitzten im Licht der frühen Wintersonne. Lanzen mit bunten Bändern und farbenprächtige Fahnen stellten sich auf. Dann kamen Pferde, die die allerhöchsten Berater des Frankenkönigs trugen. Sie wurden angeführt von Graf Rupert von Hahnheim und dem alt und verhutzelt wirkenden, aber von jedermann geachteten und verehrten Bischof Chrodegang von Metz.
Und dann kam Pippin der Kurze – nicht eingehüllt in einen wärmenden Pelz, sondern im vollen farbenprächtigen Glanz seines Königsornats. Obwohl er noch sehr weit entfernt war, erkannte Karl, dass sich sein Vater sogar die goldene Merowingerkrone auf sein wallendes blondes Haar gesetzt hatte.
Dreitausend Doppelschritte waren zu überwinden, und es schien, als hätte Pippin der Kurze sämtliche Männer seines Winterlagers aufgebracht, um jenen Römer zu empfangen, der sich als oberster Apostel der Christen aufgemacht hatte, um ihn, den ehemaligen Verwalter der Frankenkönige, zu sehen.
Es wurde Mittag, ehe Pippin und sein Gefolge den Rand des Waldes erreichten, an dem der Papst seit Stunden wartete. Von Nordwesten her zogen ganz langsam schwere Wolken über den Himmel. Und als der Augenblick gekommen war, griff Bernhard in die Zügel von Karls Stute und führte sie zur Seite. Er brauchte Platz für die historische Begegnung zwischen dem Papst der Christenheit und dem König der Franken.
Mehrere Male wollte Karl fragen, was das alles bedeuten sollte, und jedes Mal hob Bernhard nur die Hand.
»Später, Karl, später!«, wehrte er ab. Karl sah, wie das Pferd seines Vaters bis zu dem kleinen Erdbuckel aufstieg, auf dem der Zelter des Papstes leise schnaubend stand. Und dann geschah etwas ganz Ungeheuerliches – etwas, das Karl so tief verwirrte, dass er fast aufgehört hätte zu atmen …
Sein Vater, der große neue König der Franken, der Held so vieler Schlachten, stieg von seinem reich geschmückten Pferd, ging auf die Mähre des Papstes zu, beugte sich über die beiden zur linken Seite hinunterhängenden Füße von Stephan und küsste sie.
»Nein!«, keuchte Karl. Er spürte, wie die harte Hand seines Onkels ihn zurückhielt. »Sei still!«, befahl Bernhard. »Dein Vater übernimmt jetzt den Marschallsdienst für den Papst aus Rom.«
»Warum? Warum?«
»Du wirst verstehen!«, versprach Bernhard. »Ich schwöre dir, dass du verstehen wirst.«
Karl musste sich zwingen, seiner Tränen Herr zu werden. Er sah, wie sich sein Vater vor dem Papst auf den Boden warf, wie er durch Schnee und Schmutz kroch, dann aufstand und die Zügel des Zelters in die Hand nahm. Pippin führte das Pferd des Papstes wie ein niederer Stallknecht die ganze Strecke bis in den Hof der Winterpfalz.
Und Karl ritt hinter ihm. Er weinte.
2
Ränkespiele
Am nächsten Tag wachte Karl spät auf. Der Kaplan des Hofgutes hatte bereits mehrere Messen gelesen. Überall in den Gebäuden und in den Innenhöfen klangen die Stimmen und der Lärm der Gerätschaften viel leiser und gedämpfter als sonst. Karl blieb noch eine Weile in der Wärme der Bettfelle liegen. Er dachte darüber nach, was er in den letzten Wochen und am vergangenen Tag gesehen und erlebt hatte. Erst als er im Nebenzimmer das Juchzen seines kleinen zweijährigen Bruders Karlmann und dann die warme Stimme seiner Mutter hörte, schlug er die Felle zur Seite und richtete sich auf.
Es war kalt und dunkel in seinem Zimmer. Er zog die Schultern zusammen, rieb sich über die Augen und gähnte. Die Reise bis in die Alpen war doch sehr anstrengend gewesen. Er rutschte von seinem Lager und tappte zum Wasserbecken unter den vom Balkon aus geschlossenen Fensterläden. Mit ausgestreckten Fingern durchbrach er die dünne Eisschicht auf dem Wasser. Ein paar Spritzer für das Gesicht mussten genügen, denn noch am vergangenen Abend hatte er wie alle anderen in einem großen Holzzuber mit heißem Wasser gebadet. Seine Mutter Bertrada selbst hatte ihn mit Seifenkraut gewaschen, liebevoll abgetrocknet und ihm ein neues, selbst gewebtes und genähtes Hemd für die Nacht gegeben. Karl hatte ihr berichtet, was er erlebt hatte – so lange, bis er in ihren Armen eingeschlafen war.
Er trocknete sich mit einem rauen Leinentuch ab, dann öffnete er eines der kleinen Fenster und stieß die Außenluken auf. Draußen fiel Schnee. Die großen, weichen Flocken sanken so dicht nach unten, dass er kaum das Schnitzwerk des Balkongeländers erkennen konnte. Deshalb also klangen die Stimmen und Geräusche von draußen so gedämpft.
Er lief zum Schemel, auf dem ihm seine Mutter neue Kleidungsstücke hingelegt hatte. Sie kamen ihm wie nachträgliche Geschenke zum Weihnachtsfest vor. Es war das erste Mal gewesen, dass er den höchsten Feiertag fern von Vater und Mutter zugebracht hatte. Schnell kleidete er sich an. Er zog ein zweites Leinenhemd über, schlüpfte in lange Strümpfe, legte das Wams aus Schaffell an, das bis zu seinen Oberschenkeln reichte, gürtete sich und band die weichen Lederschuhe um seine Füße.
Als er die Tür zum Nebenzimmer öffnete, kam ihm wohlige Wärme entgegen. Seine Mutter und einige ihrer Hofdamen saßen in einem großen Raum mit einem Kaminfeuer an der Stirnwand. Drei der Frauen spannen, zwei andere stickten, und seine Mutter fütterte Karlmann mit warmem Gerstenschleim.
»Ist seine Amme nicht da?«, fragte Karl. Er merkte sofort, dass er etwas Falsches gesagt hatte. Bertrada trug ein langes, besticktes Hauskleid nach Art der Merowingerkönige, das von einem siebenfach gewebten Gürtel und einer rot emaillierten goldenen Fibel unter dem linken Schlüsselbein zusammengehalten wurde. Ihr blondes Haar fiel in weichen Wellen über ihre Schultern. Sie drehte sich halb zu ihm um und deutete einen Kuss in seine Richtung an.
»Willst du uns keinen Christengruß wünschen?«
»Gelobt sei Jesus Christus«, sagte Karl gehorsam. »Ich wünsche dir, Mutter, und deinen edlen Damen einen Guten Tag.«
»Und deinem Bruder Karlmännchen nicht?«
Karl verzog sein Gesicht. »Er kann doch noch nichts verstehen.«
»Dennoch solltest du dich allmählich daran gewöhnen, dass du einen Bruder hast«, sagte Bertrada. »Karlmännchen wird bald drei Jahre alt, und er ist geboren, als euer beider Vater bereits König war. Demnach werdet ihr euch eines Tages sein Reich teilen müssen.«
»Ich werde zwölf«, sagte Karl trotzig. »Und ich wurde geboren, als Vater noch Hausmeier der Merowinger war … Majordomus, wie es die Gallier im Westen und die Lateiner ganz fein nennen. Aber ich weiß trotzdem, dass ich nur ein Bastard bin! Ihr wart eben nicht verheiratet, als ich geboren wurde. Und Vater hat dich nur deshalb doch noch zu seiner Frau gemacht, weil er König werden wollte.«
»Karl! Wie kannst du so etwas sagen!«
»Stimmt es denn nicht? Vater musste nachweisen, dass er gesunde Nachkommen zeugen kann. Erst da hat er sich an uns erinnert, und schnell: Große Versammlung, Schwertknauf auf Schild geschlagen … da warst du plötzlich die Königin und ich der Thronfolger! Und jetzt soll ich das mit diesem Bettnässer teilen.«
Bertrada übergab Karlmann an eine hereingeschlüpfte Amme. Sie streckte die Arme in Richtung Karl aus. Zögernd und unwillig ging er auf sie zu.
»Allmählich solltest du damit aufhören«, sagte sie sanft. »Ich habe dir doch oft genug erklärt, wie schwierig all das auch für mich und deinen Vater war.«
Karl sehnte sich plötzlich nach der Zeit zurück, als er sie in den schönen und stillen Sommertagen, an den bunten Herbstnachmittagen und den warmen Winterabenden für sich allein gehabt hatte. Er war sieben Jahre alt gewesen, als er den fremden Mann zum ersten Mal gesehen hatte, von dem seine Mutter nur traurig erzählt hatte. Er war mit einer lauten, lärmenden Reiterschar in den Frieden des Waldes eingebrochen, hatte noch von seinem Pferd aus Bertrada aufgehoben, geküsst und lachend vor sich gesetzt.
Kein anderer Tag erschien Karl schlimmer gewesen als jener, an dem er seine geliebte Mutter und Freundin an Pippin den Kurzen, den Räuber, den Herrscher, den Vater, verloren hatte. Bertradas Verrat an ihm war noch grausamer geworden, als er miterleben musste, wie sich ihr Leib wölbte und sie ihm sagte, dass er demnächst ein Brüderchen oder ein Schwesterchen haben würde. Es war ein Bruder geworden, ein kleines, hässliches Tier, das Karl vom ersten Schrei an hasste. Hatte sein Vater nicht ebenfalls seinen Bruder verachtet? Jenen, der auch Karlmann hieß und der nicht in der Lage gewesen war, seinen grausamen, blutrünstigen Sieg über die Alemannen am Lechfeld im Baierischen zu ertragen?
Karlmann, der Ältere, war ins Kloster gegangen. Warum sollte sein eigener Bruder mehr Rechte genießen? Karl starrte auf den Quälgeist und malte sich aus, wie eine Tonsur auf dessen Blondschopf aussehen würde.
»Ist alles wirklich so schwer?«, fragte Bertrada sanft. Sie lächelte verschmitzt, dann legte sie ihren Arm um ihn.
»Ich habe Hunger«, antwortete Karl.
»Möchtest du etwas Gerstenschleim mit Honig?«
»Nein. Ich will Wild, und zwar am Spieß gebraten, wie es die Krieger essen!«
»Doch nicht als Morgenspeise«, meinte Bertrada lachend.
»Als ich mit Onkel Bernhard unterwegs war, haben wir immer Braten gegessen!«, behauptete Karl. »Höchstens mal Fleischsuppe oder Fisch.«
»Ihr seid Verschwender«, seufzte Bertrada und hob scherzhaft drohend den Finger.
Kurz nach der Mittagsruhe hörte der Schneefall auf. Diener und Knechte des königlichen Hofgutes begannen damit, mit Reisigbesen die Wege freizufegen. Und als die Sonne sich rötlich über den Wäldern im Westen niedersenkte, kam König Pippin aus dem Langhaus, in dem er stundenlang mit seinen edelsten Beratern gesprochen und gestritten hatte.
Gut dreißig Männer begleiteten den Frankenkönig in die kleine Kapelle vor den Palisaden. Jeder von ihnen trug die Insignien seiner Stellung. Pfalzgraf und Seneschall, Mundschenk und Kämmerer sowie die Bischöfe Megingaud von Würzburg und Fulrad von Sanct Denis samt Priestern ihrer Klöster traten nacheinander in das schlichte, seit Stunden durch eiserne Feuerschalen vorgeheizte Gotteshaus ein. Ganz zum Schluss schlüpfte auch noch Karl ungesehen in die Kapelle.
Die Edlen und Geweihten des Hofstaates neigten ihre Köpfe vor jener Truhe vor der Apsis, in welcher der halbe Mantel des heiligen Martin aufbewahrt wurde. Die andere Hälfte hatte der ehemalige römische Krieger einem Bettler geschenkt, weil er kein Geld hatte, um es mit ihm zu teilen. Jeder fränkische Schwertträger war fest davon überzeugt, dass Karl Martell die Sarazenen nur deshalb bei Tours und Poitiers überwunden hatte, weil Martins Mantel heilige Kräfte besaß.
Pippin, seine Bischöfe und die Ethelinge des Hofstaates ließen sich im Chorgestühl nieder. Die anderen blieben im leeren, stuhllosen Kirchenraum stehen. Sie alle wussten, dass sie jetzt nur warten mussten. Und dann, nach langem Schweigen, öffnete sich das Hauptportal. Stephan II., der Papst aus Rom, kam leise betend über die Schwelle. Er trug das farblose, bis auf den Grund gebleichte Büßergewand. Unmittelbar vor dem Chorgestühl warf er sich auf die Knie und neigte den Kopf, bis seine Lippen die Schuhe von König Pippin berührten.
»Frieden deiner Seele«, sagte Pippin und schlug das Zeichen des Kreuzes. Nicht einer sah das kurze Aufblitzen in seinen Augen.
»Erhebe dich, Stephan, und berichte uns, was dich bedrückt!«
Der Papst blieb knien. »Ich bitte dich um Hilfe für den heiligen Petrus und seine Kirche«, antwortete er in die atemlose Stille des Kirchenraums. »Du weißt, wir sind bedroht durch vielfältige Gefahren. Südlich der Alpen nimmt Aistulf, König der Langobarden, den Kampf gegen den Dukat von Rom und das Patrimonium wieder auf. Er will ein Königreich Italien mit der Hauptstadt Rom. Das Exarchat Ravenna ist bereits erobert. Damit stehen alle Zufahrtswege nach Rom unter langobardischer Kontrolle. Rom ist praktisch von der Welt abgeschnitten. Ich habe nicht einmal gewagt, eine offizielle Delegation zu schicken, um eure Dankesschuld einzulösen, die ihr Papst Zacharias, meinem geliebten Vorgänger, durch seine Salbung schuldet. Stattdessen musste ich einem per Schiff nach Gallien heimkehrenden Pilger meinen Brief an euch mitgeben.«
»Wir haben diesen Brief gelesen«, sagte Pippin abweisend. »Aber wie konntest du annehmen, dass der König der Franken den Papst heimlich entführen lassen würde, um ihm dann eine Residenz in Gallien, Neustrien oder Austrien zuzuweisen?«
»Hat nicht Zacharias im Jahr 739 das Gleiche vorgeschlagen?«, fragte Stephan II., wie um sich zu entschuldigen.
»Ja, das ist richtig«, meinte Pippin zustimmend. »Rom muss seit ein paar Jahren recht ungemütlich für die Päpste sein. Aber wir haben auch erkannt, wie gefährlich das alles ist. Bei dem geringsten Fehler wären wir Franken als Papstentführer angeprangert worden. Außerdem dürft ihr nicht vergessen, wie wachsam die Zuträger Ostroms sind … Konstantinopel hat genug mit seinen inneren Problemen und mit der Abwehr der immer angriffslustigeren Anhänger dieses angeblichen Propheten Mohammed zu tun, aber es schläft nicht, und Kaiser Konstantin kann noch immer Untertanenpflicht von dir und uns verlangen!«
»Was redest du von diesem … diesem Kopronymus?«, rief der Papst aufbrausend. »Ein Kaiser, der bei seiner Taufe ins Becken gepinkelt hat. Nicht er ist mein Problem, sondern diese langbärtigen Germanen, die vor zweihundert Jahren bis nach Venetien und Ravenna, Pavia und Verona vorgedrungen sind. Ihnen genügt nicht mehr, was sie schon haben. Sie wollen alles – ganz Italien …«
»Vergiss nicht, wen du anklagst«, sagte Pippin streng. »Die Langobarden waren stets bündnistreu. Sie haben meinen Vater bei seiner Schlacht gegen die heidnischen Sarazenen so mutig unterstützt, dass er ihnen sogar seinen jüngsten Sohn und meinen Bruder zur Adoption mitgab.«
»Ich weiß, ich weiß«, seufzte der Papst mit einer unterwürfigen Geste. »Aber ich frage dich, ob du als gesalbter König des großen Frankenreichs es zulassen kannst, dass Aistulf in seiner Rücksichtslosigkeit und Machtgier nicht einmal mehr vor der Heiligkeit Roms und dem Patrimonium zurückschreckt. Ich habe keine Legionen und keine gepanzerten Reiter. Aber du hast sie, Pippin. Kannst du, der du doch ebenfalls Petrus, den Apostelfürsten unseres Herrn Jesus Christus, verehrst, mich, seinen gewählten und damit legitimen Nachfolger, in der Stunde der Gefahr für ein paar schäbige Vorteile im Stich lassen?«
Ein Murren ging durch den hohen Kirchenraum. Einige der Männer griffen bereits nach ihren Waffen. Pippin hob beide Hände. Er wartete, bis wieder Ruhe eingekehrt war.
»Du gehst zu weit, Stephan!«, sagte er warnend. »Außerdem haben viele edle Franken nach gemeinsamen Schlachten Blutsbrüderschaft mit den Langobarden getrunken. Auch wenn ich selbst Aistulf nicht besonders mag – er hat Freunde unter den fränkischen Adeligen, auch hier an meinem Hof. Mächtige Fürsprecher, deren Einfluss ich nicht einfach übergehen kann …«
»Ich bitte nur, dass du erkennst, worum es wirklich geht …«
»Du willst dein Fell retten!«
»Nein, unsere heilige, geliebte Kirche …«
»Dein angenehmes Leben …«
»Ach, bin ich nur für diese Demütigung bereits im Herbst von Rom aufgebrochen?«, klagte der Papst. »Habe ich dafür alle Strapazen auf mich genommen, am Hof von Pavia, wo man mich nicht einmal hören wollte, und in den eisigen Bergen der Alpen?«
»Ich sehe, dass du sehr erschöpft bist«, nickte Pippin. Er neigte seinen Kopf zur Seite und beriet sich leise mit Abt Fulrad und dessen bischöflichem Amtsbruder aus Würzburg. Zum Schluss tuschelten sie auch noch mit Erzbischof Chrodegang von Metz, dem höchsten aller Kirchenfürsten im Reich der Franken.
»Nun gut, Papst Stephan«, sagte Pippin schließlich. »Wir sind einverstanden, dass du ein paar Tage hierbleibst und dich dann in meinem Hofgut in Quierzy erholst. Abt Fulrad lädt dich ein, vor Ostern in sein Kloster von Sanct Denis bei Paris zu kommen. Von dort aus kannst du bis zu deiner Rückkehr nach Italien die Amtsgeschäfte als Oberhaupt der Kirche führen.«
»Ich danke euch«, sagte der Papst. »Doch … was geschieht in der Zwischenzeit mit der Gefahr der Langobarden?«
»Wir werden nachdenken, den Rat der Edlen einholen und eine Lösung finden«, versprach der Frankenkönig.
»In nomine patris et filiii et spiritus sancti«, antwortete der Papst.
Die nächsten Wochen waren mit intensiven Verhandlungen ausgefüllt. Tag für Tag verließen reitende Boten mit bewaffneten Begleitern das Hofgut an der Marne. Andere Botschaften kamen aus Italien in der verschneiten Champagne an. Karl war nicht bei jedem Gespräch dabei. Dennoch wusste er ebenso wie die Großen in der Umgebung des Frankenkönigs, dass sein Vater keinen Krieg wollte.
»Zu viel verbindet uns Franken und die Langobarden«, meinte auch seine Mutter. »Aber ebenso viel steht bei einem Waffengang gegen sie auf dem Spiel. Komm, wir sehen lieber einmal nach, was aus den Würsten von den Schlachttagen geworden ist.«
Ganz genau wusste sie, womit sie ihren Ältesten locken konnte. Er lief sofort los, und sie hatte Mühe, seinem vergnügten Lachen durch Räume mit niedrigen Balkendecken, über Ziegelfußböden verwinkelter Treppenaufgänge und schließlich über die dröhnenden Holzplanken bis zu den Lagerräumen der miteinander verbundenen Wohnhäuser, Ställe und Magazine zu folgen.
Die Königin und ihr Sohn leisteten sich diese Spiele sonst nur, wenn der König ausgeritten oder in ganz anderen Gebäuden beschäftigt war. Dann lief sie leichtfüßig wie ein junges Mädchen in ihrem langen kastanienfarbenen Wollkleid mit dem halb offenen dunkelgrünen Mantel, gefütterten Bundschuhen mit weichen Sohlen und ohne Kopfbedeckung über den gefegten Innenhof der Pfalz.
Auch jetzt hatte sie ihr dichtes Blondhaar nur zu einem losen Knoten im Nacken gebunden und anders all die anderen Frauen nicht einmal ein wärmendes Halstuch umgelegt. Sie hielt nichts von Handschuhen und Kopfbedeckungen. Karl wusste noch, wie gern sie es früher gehabt hatte, wenn ihr der Regen über ihr Gesicht rann. Nur in einem ganz bestimmten schmückenden Kleidungsstück unterschied sich Bertrada durch nichts von den Frauen und Mädchen zwischen der Grenzmark der Bretonen und des Herzogtums Baiern, den Sächsinnen und den Frauen der Langobarden: Denn so wie die Männer Gürtel und Messer und Schwertgehänge trugen, hing bei allen Frauen wie auf eine geheime Verschwörung hin ein langes Band oder ein Lederriemen vom metallverzierten Gürtel hinunter, an dem sichtbar Amulette, durchbrochen gegossene Zierscheiben aus Bronze und kleine Gerätschaften wie Kamm, Scherchen und Nadelbüchsen angesteckt waren.
Karls Mutter hatte so viel Schmuck, Gold und Geschmeide in edelsteinverzierten Schatullen, aber auch in einfachen, mit Goldblech beschlagenen Kästen, wie es sich für eine Königin der Franken gehörte. Karl wusste, wie sehr sie ihre alten Kleinodien mochte, die noch von ihrer Mutter Bertrada, der Schwester von Plektrud aus Colonia, stammten. Letztere war damals mit Pippin dem Mittleren und damit Karls Urgroßvater verheiratet, als dieser mit seiner Nebenfrau Chalpaida seinen Großvater Karl Martell zeugte.
Sie hatte ihm viel von Bertrada der Älteren, ihrer sanften Großmutter, und deren habgieriger Schwester Plektrud erzählt. Diese Großtante hatte vor fünfzig Jahren fast die Familie vernichtet. Vielleicht war es der Hass auf die Bastarde Childebrand und Karl Martell gewesen. Unmittelbar nach Pippins Tod verschwanden beide in Kerkern von Aquis Grana und Colonia am Rhein. Auch ihr eigener Sohn Grimoald war ihr nicht gut genug gewesen. Stattdessen wollte sie selbst anstelle des unmündigen, von ihrem Sohn und Merowingerhausmeier Grimoald mit einer Geliebten gezeugten Enkel Theudobald das Reich regieren. Doch Karl Martell, der Halbbruder von Grimoald, entkam dem Kerker. Er fand eine eingeschworene Gefolgschaft und bezwang Schlag für Schlag die Neustrier in den Ardennen und in Cambrai, dann die Friesen und die Sachsen. Mit seinen großartigen Siegen über die vordringenden Araber hielt dieser Mann das ganze Frankenreich fest in einer Hand. Und mehr denn je waren damit die Merowingerkönige zum Abstieg verurteilt.
Für Karl war Plektrud eine ebenso böse Frau wie jene sagenhafte Brunichild, die als Tochter des Westgotenkönigs Gattin des Merowingerkönigs Sigibert geworden war und nach seiner Ermordung anno 575 für achtunddreißig Jahre anstelle ihres Sohnes, ihres Enkels und ihres Urenkels die Königsmacht in ihren Händen festgehalten hatte. Brunichild war erst in ihrem siebzigsten Lebensjahr, verlassen vom Burgunderadel ihrer Pfalz, an Chlothar II. ausgeliefert worden. Und seine Rache hieß drei Tage Folterung und schließlich das Ende voller Blut und Schrecken, bei dem der Leib der Greisin von wilden Pferden totgeschleift wurde.
Er wusste nicht, warum er gerade jetzt wieder an diese beiden Frauen denken musste. Doch wie so viele Geschichten von den Ahnen und Begebenheiten, wie sie Tag für Tag in den Spinnstuben und abends an den Feuern überall im Frankenreich erzählt wurden, gehörten die Berichte über Brunichild und Plektrud einfach dazu. Karl fand, dass man so schön schaudern konnte, wenn man die bekannten Gräuel und Intrigen immer wieder hörte. Andererseits wusste er längst, dass hinter vielen der Erzählungen aus jenen fernen Zeiten oftmals auch Gleichnisse und Hinweise verborgen waren, die man nur suchen und verstehen musste.
Manchmal, wenn Karl sah, wie seine Mutter irgendwo saß und ihre Finger versonnen am einen oder anderen Erbstück spielten, wünschte er, mehr von fernen Zeiten zu erfahren. Er wollte mehr hören von den Alten der Bibel und den Großreichen der Antike, den Druiden der Kelten und von den ersten Franken, dem sagenhaften König Merowech und den Anfängen seiner eigenen Familie.
Karl hing noch immer sehr an seiner Mutter. Sie war für ihn wie eine Freundin, eine Schwester, die Frau, die er, ohne zu fragen, in die Arme genommen und geheiratet hätte. Er wusste, dass es nicht möglich war, aber er überlegte oft, wenn er nicht schlafen konnte, was wohl geworden wäre, wenn Pippin nicht darum gekämpft hätte, nach dem alten Geschlecht der Merowingerkönige sich selbst und seine Nachkommen zu neuen Königen der Franken zu erheben. Hätte sein Vater ihn dann überhaupt anerkannt?
»Ich hasse, hasse, hasse ihn!«, murmelte er manchmal, obwohl er das eigentlich nicht wirklich meinte. Auch seine Mutter bekam etwas von seinem Zorn ab, dazu der kleine Karlmann, der ganze Hofstaat und alle Edlen, die seinen Vater zum König ausgerufen hatten. Es war schon alles sehr verzwickt, denn gleichzeitig bewunderte er den großen, starken Mann, vor dessen kurz gebelltem Wort selbst Äbte, Bischöfe und Grafen nur noch den Kopf neigten, um ihm Gehorsam anzuzeigen. Und er bewunderte, wie seine Mutter sich verändert hatte.
Sie war vom Mädchen, das verlassen wurde und in den Spinnstuben der Weiber Trost empfangen hatte, zur stolzen, klugen Königin geworden. Bertrada hatte ihm alles gesagt und gezeigt, was sie über die Natur und die Pflanzen, die Tiere des Waldes, die Fische und Vögel, Wetter und Jahreszeiten, Menschen und Sterne wusste. Sie hatten gemeinsam wallende Nebel in Tälern beobachtet und Könige der Feenreiche in ihnen erkannt. Zerbrochen in Baumwipfeln hängende Äste aus den Novemberstürmen waren verlorene Schwerter der Ahnen, Spuren in Steinen Runen und Zeichen der verborgenen Welt. Niemand bestritt die Mächte des Unsichtbaren, und das Geheimnisvolle war überall, im nächtlichen Glühen von vermoderndem Holz, im halb eingestürzten Grabhügel, im ganz zarten Sirren in der Mittagsstille, im Vogelzwitschern und jeder schillernden Blase im Hochmoor.
»Jeder Mensch ist mit sich allein«, hatte sie zu ihm gesagt, »aber wir leben dennoch in einer Echowelt, in der jeder Schmetterling einen Widerhall hat, jedes Wort, das wir sagen, und jede Handlung, die wir begehen oder unterlassen. Alles kommt zurück, im Himmel wie auf Erden. Und selbst den Heerzügen der klirrenden, lauten Lebenden folgt stets die unsichtbare Armee der Toten, die sie antreibt und auslacht, durch Scheinattacken behindert und hochreißt, wenn Pferd und Reiter in Schlamm und Blut nicht weiterkönnen. Der Toten Tatenruhm begleitet uns ebenso wie das Geheul des Bösen, das wir nicht unterlassen haben! Man mag sich weigern und sich mit Bier und Met und grölendem Gesang betäuben, aber es kommt zurück, das Echo jeder guten oder bösen Tat …«
Sie erreichten die große Lagerkammer des Hofgutes, in der Geräuchertes und Geselchtes, Gesäuertes und Gepökeltes aufbewahrt wurde.
»Nun, wie duftet es für deine Nase?«, fragte Bertrada. Ihr Sohn ging langsam an den endlosen Wurstketten, den von Haken herabhängenden Schinken, den irdenen, glasierten und durch Pergament aus gefetteter Schafshaut versiegelten Töpfen mit Sülze und Grützwurst entlang.
»Irgendwas stinkt!«
»Was? Ist das alles?«, fragte sie empört. Er lachte und stieß mit einem Fuß Rattendreck unter einem Sülztopf los.
»Das da riecht nicht so, wie es ein König dulden darf!«, sagte er mit kindlichem Ernst. »Wie soll der Hof einen harten Winter überleben, wenn wir überall Ratten und Mäuse zulassen?«
»Und was willst du dagegen unternehmen?«
»Man müsste die Mönche oder die jüdischen Händler fragen. Es muss doch möglich sein, Vorräte besser zu schützen, als wir es in unseren Pfalzen tun! Außerdem mag ich kein Ungeziefer …«
Sie sahen sich weitere im Halbdunkel liegende Kammern und Vorratsräume an, dann begleitete er sie über den gefegten Innenhof zurück. Pippin und seine engsten Berater kamen ihnen aus den tief eingeschneiten Gebäuden entgegen, die einen Stützpunkt für die gepanzerten Reiter der Scara francisca bildeten. Die meisten waren zu irgendwelchen Aktionen unterwegs oder schützten die strategisch wichtigen Punkte innerhalb des unwegsamen Reiches von den friesischen Katen bis zu den Häfen des Mittelmeeres.
Nur ein paar Dutzend besonders fähige und kampferprobte Söhne von den vierhundert Grafen im Reich und den Besitzern großer Latifundien oder Lehen hatten das Recht und die Verpflichtung, samt ihren Waffen- und Pferdeknechten den König und den Hofstaat bei Tag und Nacht zu schützen. Einige der Anführer hatten Frauen und Kinder, aber die meisten lebten unbeweibt und härter im Zölibat, als es den Priestern vorgeschrieben war. Sie fühlten sich mit Leib und Seele als die »Heilige Schar« und das Schwert des Königs.
Pippin und sein mit bunten Mänteln, Pelzen, schweifgeschmückten Helmen und Handschuhen vermummtes Gefolge trafen mitten im Innenhof der Pfalz auf die Königin und ihren Sohn.
»Warum hast du nichts an?«, fragte der König unwirsch. »Du holst dir den Tod in dieser Kälte!«
»Ich bin daran gewöhnt«, gab Bertrada lächelnd zurück. »Kälte ist nicht so schlimm wie die Nässe, mit der wir uns bei den ewigen Feldzügen plagen müssen. Oder glaubst du, ein Eisenharnisch schützt vor Kopfweh, Husten und Fieber?«
»Ach was!«, wehrte Pippin mürrisch ab. »Darum geht es doch gar nicht. Jetzt aber los und rein ins Haus!«
Bertrada legte ihren Arm über die Schultern ihres Sohnes und führte ihn mit sanftem Druck bis unter den geschnitzten Holzbalkon, der in halber Höhe um den großen Versammlungsraum der Pfalz lief.
»Ärger?«, fragte Bertrada, als sie gemeinsam hineingingen.
»Ja, was denn sonst?«, antwortete der Frankenkönig unwirsch. »Hinter jedem Baum, in jedem Dorf. Aber das Schlimmste von allen Übeln, mit denen mich der Herr wie seinen Knecht Hiob straft, ist dieser verfluchte Langobarde Aistulf! Ich kenne seinen Vater und seinen frommen Bruder Ratchis – mit beiden war genauso gut zu reden wie seinerzeit mit König Liutprand.«
Er ließ sich von seinem Hofmarschall Mantel und Schwertgehänge abnehmen, ging zum lodernden Kaminfeuer und rieb sich wütend die Hände warm. Die anderen legten ebenfalls ab und warfen sich auf knarrende Holzbänke an den Wänden und in die Sesselstühle, die überall herumstanden.
»Mir würde nicht gefallen, wenn die Franken gegen Langobarden ziehen«, sagte Karls Mutter ohne jeden Umweg.
»Mir auch nicht!« Pippin presste seine Lippen zusammen und wollte nichts mehr sagen. Stattdessen erklärte der Marschall die bedrohliche Situation: »Der Langobarde lässt bereits Münzen mit seinem Abbild schlagen und fordert eine Kopfsteuer von einem Goldsolido von jedem Römer im Dukat. Außerdem lässt er alle Italiener mit langobardischem Personenrecht nach Vermögen und Besitz einschätzen. Wer mehr als sieben Hintersassen ernähren kann oder als Händler ebenso wohlhabend genannt wird, muss voll gepanzert und beritten zum Heeresbann erscheinen. Wer vierzig Joch Land oder ein Gleichwertiges an Gut und Geld besitzt, muss mit Pferd, Schild und Lanze kommen. Und selbst Besitzlose müssen sich Schild, Pfeil und Bogen beschaffen und sich als Fußkrieger dem Aufgebot anschließen.«
»Aber dann steht ja fast das ganze Volk der Langobarden bei einem Kriegszug unter Waffen!«, sagte Bertrada kopfschüttelnd.
»Diese Methode taugt nichts!«, sagte Pippin wütend. »Ein Volksheer tritt sich in der Schlacht nur gegenseitig auf die Füße! Und wenn Aistulf noch frecher wird, werde ich ihm beweisen, was ein paar Franken gegen seinen Größenwahn ausrichten können!«
»Ist es das, was der Papst aus Rom von uns verlangt?«, fragte Bertrada. Pippin lachte trocken und erstarrte sofort wieder.
Karl beobachtete das harte Gesicht seines Vaters. Immerhin hatte es dieser Mann mit der wallenden blonden Haarpracht und dem herabhängenden Schnauzbart geschafft, die Merowinger, die ihr Gottkönigtum durch Legenden jahrhundertelang verankert hatten, nach all den gescheiterten Versuchen seiner Vorfahren endgültig zu erledigen.
Aber er hasste und verachtete ihn ebenso sehr. Warum war er zu seiner Mutter nur wie ein wilder Zuchthengst gekommen und dann laut lachend weitergeprescht – irgendwohin in die Wälder, zu fernen Küsten und Stätten des Reichtums, zu Schlachtenglück und den Lagerfeuern, an denen er saufend mit seinen Eroberungen auftrumpfen und prahlen konnte?
Wie und wo hatte er seine Mutter kennengelernt? Im Ardenner Wald? An der Maas bei seinem Familiengut Herstelle? Oder – wie viele sagten – in der Mühle bei Freising in Baiern in einer Nacht, in der die Sternkundigen unter seinen Begleitern ein großes Ereignis voraussagten?
Karl wusste es nicht, und sooft er seine Mutter danach gefragt hatte, war sie ihm kopfschüttelnd und mit einem geheimnisvoll traurigen Lächeln ausgewichen. Warum hatte sein Vater die Jungfrau Bertrada – von der er doch wissen musste, dass ihre Mutter Bertrada die Ältere die Schwester von Plektrud, der ersten Gemahlin eines Urgroßvaters Pippin II. gewesen war –, warum hatte er gerade sie in jener flüchtigen Nacht umfangen, ihr einen dicken Bauch gemacht und sich dann sieben Jahre lang nicht mehr um sie gekümmert?
Schon seit Monaten wälzte Karl diese Gedanken wie schwere Findlinge hin und her. Hätte er, der erste Sohn von Pippin und Bertrada, vielleicht für immer ein Geschätzter wie Onkel Bernhard, ein Geduldeter wie Remigius und Hieronymus, ein Ausgestoßener wie Grifo oder ein von allen Ethelingen und Männern der Kirche nicht einmal wahrgenommener Bastard bleiben können?
Er spürte, wie Tränen und Mordlust in ihm gegeneinander kämpften. Waren er und seine Mutter nur deshalb aufgenommen worden, weil Pippin vor den Großen des Reiches zum richtigen Zeitpunkt ein Weib und einen männlichen Erben vorweisen musste, um vom Hausmeier zum König gewählt zu werden?
Ein kurzer Sonnenschein strich durch die Fenster der kleinen Halle über den Fußboden, löste sich gleich wieder auf und hinterließ einen noch düsteren Grauschleier mitten im Wintertag. In der Halle mussten bereits Kienspanfackeln schräg in die Ringeisen an den Wänden gesteckt werden. Karl beobachtete, wie hoch die Funken an den Spitzen der gelben Flammen flogen, wie sie gegen die Balkendecke stießen und langsam wie Sternschnuppen wieder nach unten fielen.