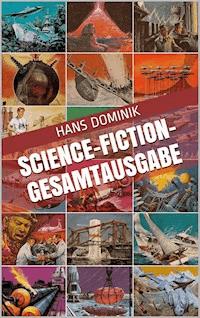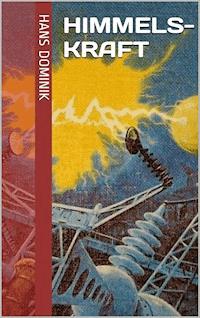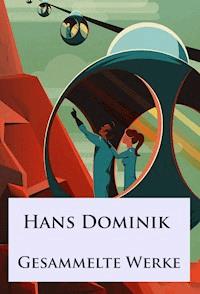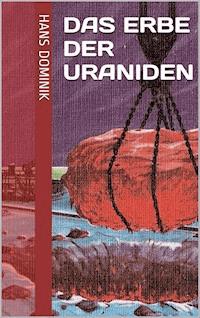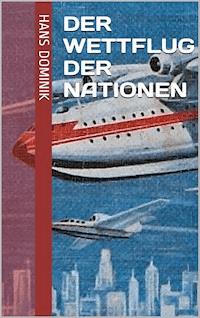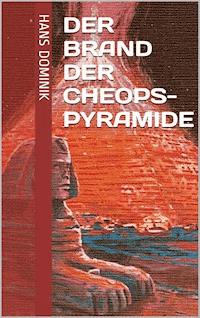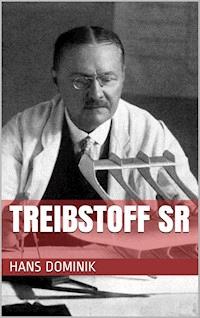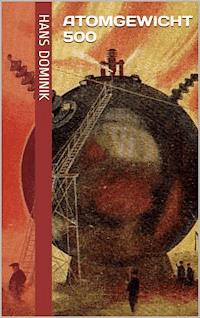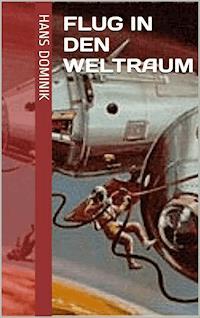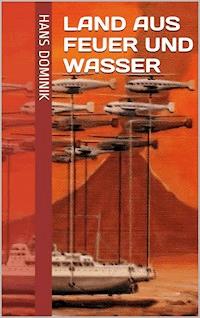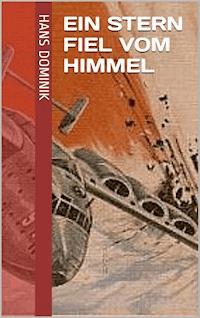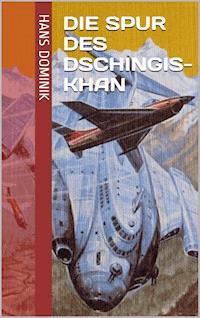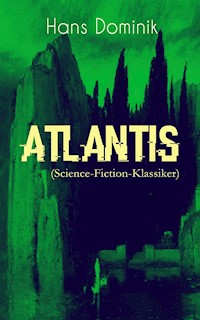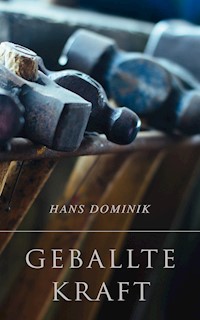1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Kautschuk' ist ein Muss für Leser, die sich für spannende Spionageromane mit politischem Hintergrund interessieren. Hans Dominiks meisterhaft geschriebenes Buch bietet nicht nur kurzweilige Unterhaltung, sondern regt auch zum Nachdenken über die Machtstrukturen und moralischen Dilemmas unserer Welt an. Mit einer Mischung aus Action, Intrigen und politischer Brisanz ist 'Kautschuk' ein Buch, das den Leser bis zur letzten Seite in seinen Bann zieht und lange nach dem Lesen zum Nachdenken anregt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Kautschuk
Inhaltsverzeichnis
»Achtung! Einschalten!« rief Dr. Fortuyn.
Im gleichen Augenblick drückte Dr. Wendt den Schalthebel herab. Fortuyn und seine Assistenten traten näher an die Strom-und Spannungsmesser, während man das tiefe Summen der Atomstromturbine vernahm. 15 Millionen … 18 Millionen … bei 20 Millionen, wo der rote Strich leuchtete, blieb der Zeiger des Spannungsmessers vibrierend stehen. 20 Millionen Volt in höchster Stärke lieferte das Mitteleuropäische Atomwerk.
Da – ein fürchterlicher Knall – ein gewaltiger Blitz schlug aus dem Endverschluß des Riesenkabels. Taumelnd stürzte Dr. Wendt.
Fast lähmend war die Stille danach – um so beängstigender wirkte der starke Qualm, der vom Vorplatz durch die geöffneten Fenster in die Halle zog.
»Da haben wir die Schweinerei wieder!« Dr. Fortuyn fuhr sich mit beiden Händen in die Haare. »Nur gut, Kollege Wendt, daß die automatische Sicherung ausgelöst wurde. Möchte nicht wissen, was sonst passiert wäre …«
Die Herren traten ins Freie. In diesem Moment erschallte eine Stimme im Werklautsprecher: »Dr. Fortuyn, bitte zum Telefon für Generaldirektor Kampendonk!« …
»Dr. Wendt, sehen Sie mal nach, was unser Atomstrom wieder angerichtet hat. Ich komme gleich …« wandte sich Fortuyn an seinen Assistenten und betrat dann die Telefonkabine.
»Hier Fortuyn. Herr Generaldirektor?«
»Was war da los, mein Lieber?«
»Wieder das gleiche. Wie bei den ersten Versuchen. Die Isolation ist zu schwach, Herr Generaldirektor.«
»Ich komme gleich rüber. Will mir den Schaden einmal selbst besehen.«
Wenige Minuten später standen Generaldirektor Kampendonk, Dr. Fortuyn und verschiedene Assistenten neben der gewaltigen Durchschlagsstelle. Meterweit war die mannsstarke Kautschukisolation von der Energie der Atomelektrizität durchschlagen und verkohlt. Noch immer lag der penetrante Geruch von verbranntem Gummi in der Luft.
»Da haben wir nun alle Probleme der Nutzbarmachung von Atomenergie gelöst und können dieses Geschenk der Natur einfach nicht verwenden – weil sich die gewaltigen Elektrizitätsmengen nicht bändigen lassen. Es ist zum Verzweifeln!« Kampendonk blickte versonnen auf das freiliegende schenkelstarke Kupferkabel.
»Dr. Fortuyn, es hilft nichts, wenn wir die Welt und uns mit dem Atomstrom beglücken wollen, müssen wir einen neuen Isolationsstoff schaffen. Sie sehen es selbst. Auch der Neo-Kautschuk reicht noch nicht aus.«
»Wenn wir nun die Isolationsschicht noch mehr verstärken«, wandte Dr. Wendt ein.
»Das ist unmöglich«, erklärte Fortuyn. »Wir können doch nicht meterstarke Kabel verwenden. Nein, Herr Generaldirektor Kampendonk hat schon recht. Wenn der neue Atomstrom der Weltwirtschaft nützen soll, muß er gefahrlos für die Umwelt fließen, ohne daß man den wirtschaftlichen Gewinn für eine maßlose Isolation verwendet. Wir müssen eine völlig neue Kautschuksynthese entwickeln. Das ist der einzige Weg, um eines Tages unseren Atomstrom nutzen zu können!«
Zwei Jahre später.
»United Chemical.«
In Riesenlettern leuchtete das Wort an der Frontseite des City-Building in London. Und tatsächlich waren sämtliche Räume des gigantischen Baues nur von Büros des großen englischen Chemiekonzerns besetzt. Die Buchstaben glänzten noch in frischen Farben. Der Zusammenschluß der beiden größten Gesellschaften, der Scotland Chemical und der Central Chemical, war erst vor einem knappen halben Jahr erfolgt. Der Mann, der das Unmögliche möglich gemacht hatte, die beiden Konzerne, die sich jahrelang bis aufs Blut bekämpft hatten, zu einer Gesellschaft zusammenzuzwingen, war Sir Steve Hopkins.
In einem kleinen Raum im elften Stock saßen Sir Hopkins und sein Mitarbeiter Bronker mit einem Dritten zusammen. Schweigen herrschte in dem Zimmer. Hopkins blickte beharrlich auf die gegenüberliegende Wand, als ob die bizarren Linien der Seidentapete sein ganzes Interesse gefangennähmen; nur daß die schmalen Lippen über dem massiven Kinn sich immer schärfer zusammenpreßten, verriet, daß er angestrengt nachdachte.
Elias Bronker, sein Partner – sein Gegenpart ungefähr in allen anderen Dingen bis auf einen gleich gut entwickelten Geschäftssinn –, überflog mit nervösem Bleistift eine Zahlenaufstellung. Wie an einem Magneten hingen die Blicke des Dritten an dem Stift. Je mehr dieser sich der Schlußsumme näherte, desto unruhiger wurden seine Augen; immer tiefer sank er in sich zusammen, duckte sich, wie vor einem Schlag.
»Unmöglich, Herr Boffin, daß das so weitergeht!« brach Bronker jetzt los. Er sprang auf, maß sein Gegenüber mit zornigem Blick. »Ihr Konto wird immer größer. Unsummen, die wir verschwenden. Ihre Erfolge sind kümmerlich. Ich wiederhole Ihnen: Ihre Kollegen in anderen Ländern arbeiten besser und billiger. Was haben Sie uns denn jetzt Großes mitgebracht?« Bronker hob ein paar Schriftstücke hoch und warf sie verächtlich zur Seite. »Ein verbessertes AE-Verfahren und längst überholte Chemosynthesen …«
»Verzeihen Sie gütigst, Herr Bronker!« warf Boffin schüchtern ein. »Bei unserem Zusammentreffen in Paris vor einem Jahr sagten Sie mir, daß gerade diese Sachen Sie besonders interessierten.«
Bronker wandte sich mit einer ärgerlichen Bewegung zur Seite. »Vor einem Jahr? – Ja, vor einem Jahr, da mag ich das gesagt haben. Sie wissen aber doch ganz genau, daß es jetzt Ihre Hauptaufgabe ist, uns über die Arbeiten der MEA-Werke an dem neuen Fortuynschen Kautschukverfahren beste Informationen zu bringen, und daß alles andere dagegen vorläufig Nebensache ist.«
Als Bronker geendet hatte, drehte sich Hopkins langsam zu Boffin um. Und als der die gefürchteten kalten grauen Augen auf sich gerichtet sah, kroch er noch mehr in sich zusammen, verschwand beinah in dem weiten Klubsessel.
»Ich würde Zweifel an Ihren Fähigkeiten bekommen, Herr Boffin, wenn ich mich genötigt sehen müßte, Ihnen nochmals die Bedeutung des Fortuyn-Verfahrens klarzumachen. Sie wissen, daß diese neue Synthese des Kautschuks alle anderen bisher bekannten Verfahren schlagen wird. Die Zweifel, die von mancher Seite ausgesprochen wurden, halte ich für törichtes Konkurrenzgewäsch. Ich habe mich über den Mann eingehend erkundigt. Meine Meinung über ihn steht fest. Früher oder später wird er siegen, und die Unterlegenen – dazu würden auch wir gehören, Herr Boffin – werden die Zeche bezahlen müssen. Was, nebenbei gesagt, für uns ungefähr – ich denke da an notwendige Lizenzen – mit zwei Millionen Pfund in Rechnung zu stellen wäre; von den Prestigegründen ganz zu schweigen, deren Wert eventuell noch höher anzuschlagen wäre. Sie wissen genau – wer zuerst seine Atomhochspannung sicher isolieren kann, hat den Schlüssel zur wirtschaftlichen Nutzbarmachung aller billigen Atomkraftquellen in der Hand. Was sage ich? Zwei Millionen Pfund? Mann, der Schaden ginge in die zwanzig, dreißig Millionen, in der Auswirkung, wenn wir hinterherhinken. —
Bisher hatte ich bezüglich Ihrer Geschäftstüchtigkeit keine Bedenken. Sie waren stets großzügig, sogar großzügiger als … nun, lassen wir die alten Geschichten! Mir kommt es so vor, als ob Sie in dieser Angelegenheit Ihre Großzügigkeit vermissen lassen.«
Bei Hopkins letzten Worten hatte sich der eingezogene schwarze Schopf Boffins wie der Kopf einer Schildkröte vorsichtig ein Stück vorgeschoben. Er wollte sprechen, da fiel ihm Hopkins wieder ins Wort: »Ich weiß schon, was Sie sagen wollen! Verdoppelte Sicherungsmaßnahmen … Unbestechlichkeit der Assistenten … verschärfte Überwachung des Personals und so weiter …«
Hier schoß der Schildkrötenhals mit einer verzweifelten Kraftanstrengung weit vor. »Noch nicht das Schlimmste, Herr Hopkins! Es gibt ja keinen außer Fortuyn selbst, der über das Verfahren vollkommen Bescheid weiß. Seine Assistenten machen nur Einzeluntersuchungen, ohne das Gesamtproblem zu beherrschen. Die Ergebnisse werden von Fortuyn allein ausgewertet. Es ist unmöglich …«
»Unmöglich ist nichts auf dieser Welt, mein lieber Boffin! Das Wort kenne ich nicht. Tausend Wege führen nach Rom. Nicht immer auf den alten, ausgetretenen Pfaden gehen! Neue Gedanken, neue Ideen müssen Sie haben! – Ah, zum Beispiel: Was ist es mit diesem einen Direktor der MEA-Werke? Wie hieß er doch gleich?«
»Meinen Sie Direktor Düsterloh? Unmö…« Boffin verschluckte erschrocken den Rest des verpönten Wortes.
»Ja, richtig! Den meine ich. Es ist mir bekannt, daß er ein Gegner Fortuyns ist. Schon das allein läßt gewisse Schlüsse zu. Was wissen Sie weiter über ihn?«
»Seine Verhältnisse sind glänzend. Er ist Junggeselle, ein hoher Vierziger, hat außer der Jagd keine besonderen Passionen, liebt Wein und Weib …«
»Wein und Weib«, murmelte Hopkins vor sich hin. »Sogar zwei Schwächen … Angriffspunkte, Herr Boffin – sollt’ ich denken.«
Boffin nickte bestätigend. »Gewiß. Die eine Schwäche habe ich auch schon benutzt. Manches, was er in der Weinlaune gesprochen, war zweifellos von Interesse. Auf diese Weise erfuhr ich ja auch, daß er in einer gewissen Gegnerschaft zu Fortuyn steht.«
»So versuchen Sie es doch mal an der anderen schwachen Position ›Weib‹!« warf Bronker ein. »Ich erinnere mich, daß Sie damit während Ihrer Tätigkeit als Leiter unseres Nachrichtenbüros schon ganz gut operiert haben.«
Boffin kniff die Augen zusammen, als käme ihm plötzlich eine Idee. »Ich glaube, meine Herren … vielleicht … es wäre durchaus möglich, wenn mir ein geeignetes Objekt zur Verfügung stünde … worüber ich mir im Augenblick nicht klar bin …«
»Nun gut! Überlegen Sie sich die Sache gründlich!« fuhr Bronker fort. »Haben Sie sich übrigens unsern Chemiker Smith unten im Büro angesehen, auf den ich Sie aufmerksam machte?«
»Ja, Herr Bronker. Es ist ausgeschlossen, den Mann nach Deutschland zu bringen. Er spricht zwar korrektes Deutsch, aber sein Akzent würde ihn sofort verraten. Das ist, wie schon früher gesagt, die größte Schwierigkeit: ausgebildete Chemiker zu bekommen, die geeignet sind, für uns bei den MEA-Werken zu arbeiten. Es ist nicht nur die Angst vor Strafe. Sie scheuen auch das entbehrungsreiche Leben dort. Nur als gewöhnliche Arbeiter kann man sie reinbringen – und wie solche müssen sie auch leben, um sich nicht zu verraten. Das paßt nicht jedem.«
»Hm!« Hopkins stieß es durch die Zähne. »Da hätte ich …«
»Was meinen Sie?« fragte Boffin.
»Schon gut! Ich dachte eben an etwas. Später davon!«
»Noch eine Frage«, wandte sich Bronker an Boffin. »Wissen Sie Näheres über die Gegnerschaft dieses Direktors Düsterloh gegen Fortuyn?«
Boffin machte eine zweifelnde Handbewegung. »Darüber kann ich nicht mal Vermutungen aussprechen.«
»Es wäre wichtig, Herr Boffin, ob außer Düsterloh etwa noch andere Mitglieder des Direktoriums persönliche Gegner Fortuyns sind. Bitte, merken Sie sich diesen Punkt genau und geben Sie uns darüber sobald wie möglich Bericht!«
Hopkins stand auf. »Ich muß jetzt fort. Kommen Sie morgen um diese Zeit noch einmal hierher, Herr Boffin! Vielleicht, daß ich Ihnen noch etwas zu sagen hätte.«
Er verließ mit kühlem Gruß den Raum. Ein kurzes Telefongespräch noch, bei dem eine weibliche Stimme ihm antwortete; dann stand er auf der Straße. Blieb plötzlich stehen, sah auf die Uhr. »Ah, Teufel! Hätte ja bald mein ›Paket‹ vergessen!« Er ging in das Gebäude zurück und trat nochmals in die Telefonzelle. Wieder war’s eine Frauenstimme, die ihm antwortete; doch jene andere als vorher.
»Unmöglich, teuerste Dolly!« sagte Hopkins. »Ich habe noch eine wichtige Konferenz. In zwei Stunden spätestens sehen Sie mich zu Ihren Füßen … Werden wir allein sein? Wie? Nein? Maud Russel wird da sein? O – schade … Wie meinen Sie, Dolly? Aber gewiß doch! Warum soll ich lügen? Ich kann ihr langweiliges Milchgesicht nicht ausstehn. Nun, vielleicht geht sie bald … Auf Wiedersehen in zwei Stunden!«
Er eilte zu seinem Wagen. »Erst mal zu Juliette!« Er nannte dem Chauffeur eine Adresse, sprang in den Wagen. »Damned – wenn ich Dolly vergessen hätte!« Dolly, Dolly Farley – Schwergewicht an Körper und Aktien – war die nächste Position, die Hopkins auf seinem Eroberungsplan vorgemerkt hatte. An dem Tag, an dem sie die Seine würde, konnte er in der Generalversammlung ihre vereinigten Aktienpakete in die Waagschale werfen. Wer Dollys Bild sah, hätte allerdings an Hopkins gutem Geschmack zweifeln können. Aber dem war nicht so: Hopkins war sogar ein Mann von feinstem Geschmack. Doch er konnte den auch verleugnen – wie er es eben getan, als er Maud Rüssel, deren Schönheit er bewunderte, ein langweiliges Milchgesicht nannte … »Zu Juliette!« sagte er nochmals vor sich hin. »Möglich, daß ich’s mit ihrer Hilfe schaffe. Wird ja nicht ganz einfach sein, aber es muß versucht werden!« —
Juliette Hartlaub lag noch zu Bett, als der Telefonanruf Hopkins sie weckte. Sie überlegte kurz: Sollte sie ihn im Bett empfangen oder sollte sie sich schnell ankleiden? Ehe sein Auto durch das Gewühl des Straßenverkehrs hierherkäme, mochte eine gute Viertelstunde verstreichen.
Da fiel ihr das neue Neglige ein, in dem Steve sie noch nicht gesehen hatte. Sie eilte zu einem Schrank und warf es über. Trat vor den Toilettenspiegel, drehte und beschaute sich von allen Seiten. Je länger sie stand, um so heiterer ward ihre Stirn. Ja – sie konnte zufrieden sein mit dem Bild, das der Spiegel ihr zuwarf.
Sie klingelte. Die Zofe kam herein. »Schnell, Bessie! Meine Frisur! Mr. Hopkins kommt!«
Während die Zofe mit dem Haar beschäftigt war, griff Juliette mechanisch nach dem Lippenstift – hielt zögernd inne. Steve liebte geschminkte Lippen nicht. Würde er sie heute auf den Mund küssen, wie früher? Oder wieder nur auf die Stirn? Wie so manchmal in der letzten Zeit, wo er kam, sich nach ihrem Befinden erkundigte, ein paar gleichgültige Worte sprach und wieder von ihr ging, ohne ihre Reize zu beachten.
Sie war viel zu klug, um nicht zu merken, wie er ihr allmählich entglitt. Vergeblich hatte sie sich, als sie die ersten Anzeichen merkte, dagegen gewehrt; hatte vergeblich versucht, ihn in immer neuer Weise wieder stärker an sich zu fesseln.
Ihr bangte um die Zukunft. Wohl würde Hopkins für sie sorgen, wenn er sie verließ. Aber ein Leben in kleineren Verhältnissen erschien ihr unerträglich. Eine Zeit in Glanz und Luxus, wie sie sie an Steve Hopkins’ Seite verlebt hatte, war ihr Traum von Jugend an gewesen. Diesen Traum zu erfüllen, hatte sie ihren Mann verlassen, an dem sie auf ihre Art doch gehangen hatte. Zu teuer wäre dies Glück erkauft, wenn es jetzt schon zu Ende ging.
Hopkins’ Besuch heute … Was wollte er von ihr? Trieb liebe ihn her – oder …? Noch einmal betrachtete sie sich im Spiegel. Die Zweifel schwanden von ihrem Gesicht. Befriedigt schaute sie auf ihr Bild. Kein Mann mit Blut in den Adern dürfte widerstehen.
Ein paar Minuten, dann trat er ins Zimmer. Juliette hatte sich so gestellt, daß das Tageslicht der hohen Fenster auf sie fiel. Hopkins begriff sofort ihre Absicht. Gewohnt, jeden Vorteil wahrzunehmen, ging er darauf ein, um sie leichter seinen Plänen gefügig zu machen. Und er brauchte nicht zu heucheln, als er auf sie zueilte und sie in seine Arme nahm. Voll stürmischer Freude empfand Juliette den Sieg ihrer Reize.
Als sie sich aus ihrer Umarmung lösten, kehrten seine Gedanken zu seinem Plan zurück. Ohne Umschweife begann er zu sprechen.
Schon bei seinen ersten Worten ging ein jähes Erschrecken über Juliettes Züge. Je weiter er sprach, desto größer ihr Entsetzen. »Unmöglich!« rief sie, als er geendet, und brach in lautes Weinen aus. »Zu Wilhelm Hartlaub soll ich? Zu dem Mann, den ich deinetwegen verlassen habe?«
»Warum nicht, Juliette? Du bringst ihm doch Hilfe. Er kommt nach Deutschland zurück – in eine gutbezahlte Stellung. Unter falschem Namen natürlich; aber das tut ja nichts zur Sache.«
»Nein, Steve! Ich kann das nicht. Ich ertrage es nicht, mit ihm zusammenzukommen. Du sagst, er sei in Not und Elend? Wie würde ich mir vorkommen? Zu Tode müßte ich mich schämen, käme ich aus diesem Wohlleben zu ihm, der vielleicht darbt und hungert … Nimm irgendeinen andern für deinen Auftrag!« Sie warf sich schluchzend auf eine Couch.
Hopkins setzte sich neben sie, legte die Hand auf ihre Schulter. »Juliette! Ich vergaß, zu sagen, daß du mir einen großen Dienst leistest, wenn du es tust. Sieh mich bitte an!«
Der Ton seiner Stimme, die Berührung seiner Hand ließ sie gehorsam den Kopf wenden.
»Juliette! Gewiß, es mag dir schwerfallen, deinen früheren Gatten wiederzusehen. Aber würdest du es nicht über dich gewinnen – mir zu Gefallen? Aus Liebe zu mir?«
Er legte die Arme um ihre Schultern, zog sie leicht an seine Brust, küßte sie wieder und wieder. »Du mußt es tun, Juliette! Mir zuliebe wirst du deine Furcht überwinden. Wenn es dir gelänge – niemals würde ich dir diesen Dienst vergessen!«
Langsam entwand sie sich seinen Armen. »Laß mir Zeit bis morgen! Meine Nerven möchten versagen, wenn ich jetzt zu Hartlaub ginge.«
»Gewiß, Liebste. Aber den heutigen Abend verbringen wir zusammen. Du ziehst das rote Abendkleid an, das dir so gut steht. Ich werde wieder dein Kammerdiener sein. Du weißt doch, wie oft …«
Dicker Morgennebel braute über dem Themseviertel. Die Lichter auf den Pieren und an den Ladekranen vermochten den milchigen Dunst kaum zu durchdringen. Eine Uhr begann zu schlagen. Eine zweite, eine dritte. Sechs Uhr morgens.
Für Minuten wurde das Knarren der Krane vom Stampfen vieler schwerbeschuhter Füße übertönt. Die Tagesschicht rückte an; die Nachtschicht zog ab. Schwarz strömte es aus den Lagerhäusern auf die Hafenstraßen. Zwei aus der Menge schlugen den Weg in eine enge Hafengasse ein.
»Verflucht kalt heute morgen!«
»Wollen mal sehn, ob Old Joe seine Giftbude schon auf hat!«
Sie gingen über den Damm auf die andere Straßenseite. »Refreshment Room« stand da über den herabgelassenen Jalousien eines Ladens. »Verdammt! Das alte Biest schläft noch!«
»Unsinn! Ich sehe Licht!« Der es gesagt hatte, trommelte kräftig gegen das niedrige Fenster. Gleich darauf ging ein Rolladen in die Höhe; die Tür öffnete sich. »Mach schnell, Joe! Schwer geschuftet heute nacht. Her mit deinem Saustoff!«
»Die Gentlemen wünschen ein Glas Whisky!« Der Wirt wandte sich an eine alte Negerin, die schon unter den Bartisch gegriffen hatte und aus einer Flasche zwei Gläser füllte.
Der Wirt war zu einem Wandbrett gegangen und nahm einen Schlüssel. Die beiden Gäste leerten mit einem Zug ihre Gläser. Schüttelten sich, verzogen das Gesicht, schnalzten dann befriedigt mit den Lippen. »Bravo, Joe! Neue Sorte, wie’s scheint. Verflucht! Der hat’s in sich! Schnell noch einen, alter Giftmischer!«
Der Wirt strich gleichmütig, ohne sich um Lob oder Tadel seiner Gäste zu kümmern, ihr Geld ein und schlurfte nach hinten. Hier tastete er sich im Dunkeln eine lange Steintreppe zum Keller hinab, öffnete eine schwere Eisentür und trat in einen Raum, der durch eine starke Lampe taghell erleuchtet war. Die feucht glitzernden Wände warfen das Licht in tausend Reflexen zurück. Geblendet schloß er einen Moment die Augen. Beim Knarren der Tür erhob sich im Hintergrund ein Mann.
»Nun – fertig, Herr Hartlaub?« Der Wirt deutete auf einen großen Destillierapparat, der in der Mitte des Raumes stand.
»Das übliche Quantum, Herr Pitman. Auch gleich aromatisiert.«
Befriedigt schlug der Wirt ihm mit der gewaltigen Pranke auf die Schulter, daß der andere leicht zusammenknickte. Eine kümmerliche Gestalt: die dürftigen Kleider schlotterten um magere Glieder; das hagere Gesicht zeigte in der grellen Beleuchtung eine krankhafte Blässe; unter dem wirr über der Stirn liegenden Haar aber leuchteten ein paar intelligente Augen in fiebrigem Glanz.
»Mensch, daß Sie mir nur nicht zusammenklappen!« brummte der Wirt und musterte den anderen mitleidigen Blicks. »Der Teufel soll Sie holen, wenn Sie mir eines Tages wegbleiben! Ihr Elixier ist Honig für die Saufbrüder von den Schiffen. Das neue Aroma, das Sie da zusammengestellt haben, macht unseren Sprit so schmackhaft, daß nur die Zunge eines Lords noch den Brennspiritus rausfinden könnte.«
Der Wirt füllte sich ein Glas aus dem Destillierapparat und ließ den Inhalt mit Behagen über seine Zunge gleiten. »Verteufelt gut, das Zeug! Sollen auch ‘ne Extravergütung kriegen! Ist aber eigentlich zwecklos. Statt was Ordentliches in die Rippen zu stecken, werden Sie’s ja doch bloß verwenden, um Ihre blödsinnigen chemischen Versuche weiterzuführen. Quatsch! Tausendmal Quatsch das alles! Ist dieser Stoff nicht tadellos?« Ein zweites Glas folgte dem ersten.
Kopfschüttelnd sah er dem anderen nach, der sich wortlos wieder an seine Arbeit begeben hatte; schob dann den mit Sprit gefüllten Ballon unter den Arm und ging nach oben.
Hartlaub rückte sich einen Schemel an seinen Arbeitstisch, entzündete die Flamme unter dem Apparat und beobachtete die Vorgänge in der Blase, in der jetzt leichte Dämpfe aufstiegen. Die Augen, unverrückt auf das glitzernde Glas geheftet, begannen zu schwimmen, je länger er schaute. Die webenden Schleier schienen feste Gestalt zu gewinnen. Bilder formten sich, wechselten kaleidoskopartig.
Das Vaterhaus … der Rhein mit den Umrissen von Ludwigshafen … ein Laboratoriumssaal, er selber an einem der Arbeitstische … ein schöner Garten – er tritt hinein – zwei Mädchenarme umschlingen ihn – zwei Lippen suchen die seinen – zwei goldene Ringe an ihren Händen … Und dann? … Die bittere Gegenwart hier …
Der Ausschank Joe Pitmans ist brechend voll. Der Wirt muß immer neue Gläser mit Whisky füllen. Er steckt Hartlaub, als der am Bartisch vorbeigeht, einige Pfundnoten in die Rocktasche. »Hier das Versprochene! Feines Geschäft heute!«
Hartlaub war an der nächsten Straßenecke angekommen, als ein großes Polizeiauto in die Hafengasse einbog. Unwillkürlich blieb er stehen, starrte in banger Ahnung dem Wagen nach. Da! Wahrhaftig! Er hielt vor Pitmans Laden!
Hartlaub sah noch, wie der Wirt von ein paar Polizisten herausgeholt wurde. Dann eilte er die Straße zum Fluß hinab, wo sein Heim lag.
Er stand nun vor seiner Tür im Hinterhaus einer Mietskaserne, fingerte im Dunkel nach dem Schloß, riß ungeduldig ein Streichholz an, wie um sich zu vergewissern, daß er recht gegangen und sah die kleine Visitenkarte: »Wilhelm Hartlaub, Dr. phil. et chem.« Eine frühere Adresse dick durchgestrichen.
Noch ehe das Streichholz erlosch, hatte er das Schloß gefunden, tastete sich durch das fast lichtlose Zimmer zu seiner Lagerstatt und warf sich darauf.
»Was nun?!« Die Frage, die ihn unterwegs ohne Unterlaß bewegt, kam immer wieder auf seine Lippen. In kurzer Zeit stand er mittellos da; und wo inzwischen Arbeit finden, die er leisten konnte? Die monatelangen Strapazen in dem dumpfen, feuchten Keller hatten ihn körperlich völlig heruntergebracht. Einen anderen Barkeeper aufzutreiben, den seine dunklen Künste interessierten, würde nicht leicht sein. War doch das Renaturieren von Brennspiritus ebenso unter drakonische Strafen gestellt, wie der Verkauf von unversteuertem Alkohol.
Wieviel mochte Pitman ihm in die Tasche gestopft haben? Er entzündete eine Kerze und zählte die Scheine und sah dann nach einem kleinen Kalender an der Wand. Der vierte Tag des Monats. Er überlegte kurz – bis zum Monatsende kam er mit dem Geld noch aus. Aber dann –?
Der Vierte … Seine Hand fuhr über die Augen. Ein grelles Lachen: Heute war Juliettes Geburtstag! Wie mochte sie ihn feiern? Noch als Hopkins Geliebte? Dann würde wohl ein reich gedeckter Geburtstagstisch ihrer warten. Aber vielleicht war Hopkins ihrer längst wieder müde. Was war dann aus Juliette geworden?
Er blies den Lichtstumpf aus. Warf sich wieder aufs Bett und versuchte vergeblich zu schlafen. Die Fülle der Gedanken und Erinnerungen, die Sorge um die Zukunft hielten ihn wach.
Er überhörte, wie es an die Tür klopfte, wie diese sich öffnete und merkte erst auf, als eine Frauenstimme suchend rief: »Wohnt hier Herr Hartlaub?«
Juliettes Stimme?! Er glaubte, sich getäuscht zu haben. »Juliette?« kam es, unsicher fragend, von seinen Lippen.
»Ja, Wilhelm! Ich komme, um dir zu helfen.«
Er antwortete nicht.
»Willst du nicht licht machen, damit ich dich sehen kann, Wilhelm?« Vergeblich suchte sie das Beben ihrer Stimme zu unterdrücken. Sein Schweigen begann sie zu ängstigen.
Endlich klang es aus der finsteren Ecke zurück: »Wozu Licht, Juliette? Was du mir zu sagen hast, kannst du mir auch so sagen. Oder willst du etwa mit mir deinen Geburtstag feiern?« Er lachte laut heraus. »Ist er deiner überdrüssig geworden, der ehrenwerte Herr? Oder bist du gekommen, mich zu verhöhnen, du –?«
Der drohend-verächtliche Ton seiner Stimme ließ sie erschauern. »Nein – nein, Wilhelm!« stotterte sie. »Es soll dir geholfen werden. Ich möchte dir ein Angebot machen …«
»Ein Angebot? Von dir – oder von …?«
»Ja – von Hopkins!«
»Von Hopkins?« Hartlaub war aufgesprungen. »Du wagst es, den Namen hier auszusprechen! Den Namen des Mannes, der mein ganzes Unglück verschuldet hat!« Er riß ein Streichholz an, hielt es in die Höhe. »Sieh dich um, wie ich lebe! Ist es nicht herrlich hier? Guck mich an! Bin ich nicht schön, jung, frisch? Haha! Komm her! Umarme mich! Küsse mich! Wir wollen deinen Geburtstag feiern! … Ah, du willst nicht? Ich bin dir nicht fein genug?«
Sie hob bittend die Hand. »Um Gottes willen, Wilhelm! Sprich nicht so! Ich ertrage das nicht. Hör mich in Ruhe an!« Sie trat an Hartlaub heran, der auf einen Stuhl gesunken war. »Wilhelm! Du könntest nach Deutschland zurück. Vielleicht, daß …« Ihre Augen hatten sich an das Halbdunkel gewöhnt. Sie sah, wie er sich ihr zuwandte und verstummte kurz, wie gebannt von seinem Blick. Dann fuhr sie zögernd fort: »Man wird in Deutschland weiter für dich sorgen. Dir unter anderem Namen eine Stellung bei den MEA-Werken verschaffen. Die Stellung wird gut, sehr gut bezahlt …« Wieder hielt sie inne und wartete vergeblich auf ein Wort von ihm. »Welcher Art deine Tätigkeit dort sein wird, ist noch ungewiß. Aber sie wird gut bezahlt – sehr gut! Das sag’ ich dir noch einmal.«
»Und weiter?« Hartlaub trat langsam an sie heran. Die Dunkelheit verbarg ihm die glühende Röte auf ihrem Gesicht. Und Juliette, in ihrer Erregung, ward des drohenden Untertons in seinen Worten nicht gewahr. »Sprich weiter!« drängte er. »Die Hauptsache kommt doch wohl noch?«
»Du siehst dort als Chemiker sicherlich viel Interessantes. Dinge, für die man auch hier großes Interesse hat …«
Sie spürte seinen hastigen Atem, schauderte und wollte zurückweichen – da umklammerte er sie, schüttelte sie wie ein leeres Bündel. »Spion!? Spion soll ich werden? Für Hopkins? … Und du, meine Frau – noch sind wir ja nicht geschieden –, du bietest mir an, ich soll für deinen Geliebten arbeiten – als Spion? Erwürgen müßte man dich!«
Ein gellender Schrei. Sinnlos vor Angst, stürzte sie zur Tür, stürmte die Treppe hinab, riß den Schlag des Autos auf, sank halb ohnmächtig in Hopkins Arme. »Fort, Steve! Fort! Er ist wahnsinnig! Er wollte mich umbringen!«
Böse Zeiten kamen für Hartlaub. Und es kam der Tag, da der Vermieter in Begleitung eines Fremden in seiner Wohnung erschien und mit dürren Worten sagte: »Hier ist der neue Mieter. Sie müssen raus, werter Herr!«
Er machte keinen Versuch, den Mann umzustimmen; packte seine Sachen in ein kleines Bündel und verließ das Haus. Tagelang irrte er in den Straßen der Riesenstadt umher und suchte vergeblich nach einer Beschäftigung. Ein paar Mahlzeiten in einer Heilsarmeeküche hielten seine Kräfte eine Zeitlang noch zusammen. Bisweilen gelang es ihm, ungeduldigen Theaterbesuchern nach Schluß der Vorstellung eine Droschke zu besorgen. Die wenigen Pennys, die er dafür bekam, reichten wenigstens hin und wieder für ein Obdach. Manche Nacht aber mußte er auf einer Bank im Freien verbringen.
So stand er eines Abends wieder vor einem Theater und wartete auf Gelegenheit, seine Dienste anzubringen. Während er die Heraustretenden musterte, fiel sein Blick auf ein Paar, das einem Privatwagen zuschritt. Ein Diener öffnete den Schlag.
Hartlaub stieß einen Schrei aus und lief mit erhobenen Fäusten auf die beiden zu. »Steve Hopkins!« Schon stand er dicht bei dem Wagen. Da warf ein Boxhieb des Dieners ihn wie einen Sack aufs Pflaster.
Juliette war bei dem Schrei zusammengefahren. »Was war das, Steve? Wer rief da?«
Der zuckte die Achseln. »Wer weiß? Irgendein Betrunkener.«
Er schob sie schnell in den Wagen. Beim Anfahren warf Juliette ängstlich-neugierig einen Blick durch die Scheibe, stöhnte auf und beugte sich vor. Ein Polizist hatte den zu Boden Gesunkenen ins Licht eines Straßenkandelabers gehoben. Es war ihr Mann.
»Wilhelm!« Noch einmal wollte sie rufen – da ratterte der Wagen schon in voller Fahrt. Hopkins’ Hand zwang sie auf ihren Sitz nieder. —
»Lungenentzündung – Unterernährung dazu!« sagte der Arzt des Krankenhauses, in das Hartlaub eingeliefert worden war.
Lange Wochen, in denen der Patient zwischen Leben und Tod schwebte … Fast ebenso lange dauerte die Zeit der Genesung.
Der Patient fühlte sich wieder voll bei Kräften. Er fürchtete allmorgendlich, das schreckliche Wort zu hören: »Herr Hartlaub, Sie werden morgen entlassen!« Und freute sich dankbar eines jeden Tags, der ihm hier noch geschenkt ward. Die reichliche Kost, das gute Bett, die freundliche Behandlung – nach der Hölle der letzten Monate wähnte er sich im Paradies …
Eines Nachmittags, als er gerade einen Spaziergang im Garten machte, trat eine Schwester zu ihm: Er möge ins Büro kommen. Beklommenen Herzens begab er sich dorthin. Ein freundlicher Herr empfing ihn.
»Sie heißen Hartlaub? Geboren in Deutschland?«
»Jawohl.«
»Und Sie fühlen sich wiederhergestellt?«
»Jawohl.« Fiebernd jagten seine Gedanken. Was sollte das? Entlassen? Nein – das konnte es nicht sein. Polizei? Ein jäher Schrecken: Joe Pitman – Zuchthaus –! Hartlaub sah furchtsam zu dem Beamten auf.
»Sie halten sich auch für kräftig genug, eine Reise ertragen zu können?«
»Eine Reise?« stammelte der Überraschte.
»Ja, Herr Hartlaub. Der Krankenhausverwaltung wurde eine Karte nach Hamburg für Sie zur Verfügung gestellt. Falls Sie bereit sind, das Billet zu benutzen, wollen Sie, bitte, diesen Schein unterschreiben, wobei Sie gleichzeitig den Empfang einer Barsumme von 1000 Mark quittieren.«
Wie vor den Kopf geschlagen, stand Hartlaub einen Augenblick stumm. Dann, mechanisch, ohne zu überlegen, ergriff er die hingehaltene Feder und unterschrieb. Als er gehen wollte, hielt der Beamte ihn lächelnd zurück: »Sie vergessen ja die Hauptsache! Hier das Geld – hier die Fahrkarte!« Er tat beides in einen Umschlag und steckte ihn dem noch halb Betäubten in die Tasche.
Die kurze Fahrt über die See vollendete Hartlaubs Gesundung. Und damit kam auch neuer Lebensmut über ihn, und die Pläne und Träume vieler schlafloser Nächte gewannen von Tag zu Tag festere Gestalt. Das Geld, das wohlverwahrt in seiner Brusttasche ruhte, die Fahrkarte … von wem stammten sie? Wer war der unbekannte Wohltäter? Kaum daß er sich von der ersten Überraschung erholt, war es ihm klar geworden: Nur von Juliette konnte das kommen. Von ihr allein – oder auf Hopkins Veranlassung? Einerlei: aus seiner Tasche kam es jedenfalls!
Im ersten Augenblick der Erkenntnis hatte er es trotzig zurückschicken wollen. Doch da gaukelten ihm wieder die alten Träume durch den Sinn. Schicksalsfügung! Nicht anders konnte, durfte er es auffassen. Hopkins indirekt der Verführer, als er in der schlimmsten Nachkriegszeit seine Stellung in Ludwigshafen bei Nacht und Nebel verließ, um seine dort erworbenen Kenntnisse im Ausland in Devisen umzumünzen. Hopkins wieder war es, der ihn auf die Straße warf, als er alles gegeben, was er besaß; auch Juliette, sein Teuerstes. Berufsehre – Mannesehre – alles hatte er ihm genommen!
Sich rächen! Wenn möglich, wieder gutmachen, was er gefehlt! Das war ihm in den Elendsnächten der letzten Monate als höchstes Lebensziel erschienen. Er war verzweifelt bei dem Gedanken, daß diese Pläne nur immer Träume bleiben, wohl nie verwirklicht werden könnten. Jetzt … eine höhere Macht mußte es sein, die ihm durch den Verführer selbst die Mittel und Wege bot, alles das zur Tat werden zu lassen.
Er wußte, wie wichtig für Hopkins, als den Leiter des großen United-Chemiekonzerns, die Ergebnisse gerade der mitteleuropäischen Werke waren. Dem Paroli bieten, dabei seine Ehre wiedergewinnen – jetzt konnte er’s! Alle Schwierigkeiten dabei hatte er schon bedacht. Zunächst natürlich mußte er sich falsche Papiere besorgen. Denn als Chemiker Hartlaub stand er seit seinem fluchtartigen Abgang von Ludwigshafen auf der schwarzen Liste. Nur unter anderem Namen und in anderer Stellung durfte er es wagen, in einem großen Werk Anstellung zu suchen.
Prüfend hielt Dr. Rudolf Wendt im Laboratorium der MEA-Werke in Langenau ein Reagenzglas gegen das Licht. Kopfschüttelnd betrachtete er die Flüssigkeit darin, während seine Rechte mechanisch im Versuchsprotokoll blätterte. »Verflucht und dreimal zugenäht! Wieder nichts! Es klappt nicht! Wie Fortuyn sich das denkt, möcht’ ich wissen. Was meinen Sie, Kollege Lehnert?«
Der andere Assistent neben ihm zuckte die Achseln und brummte vor sich hin: »Wer weiß, ob sich Fortuyn bei diesem ganzen Kram sehr viel gedacht hat. Ich halte sowieso nichts von der Heptansynthese. Die Butadien-Kohlenwasserstoffe haben sich doch als glänzende Ausgangsbasen für synthetischen Kautschuk erwiesen. Seit Jahren wird Buna S, Perbunan und Neoprene auf diese Weise hergestellt. Gerade das letztere hat sich doch als vorzüglicher Isolationsstoff erwiesen …«
»Aber nicht ausreichend für den starken und hochgespannten Atomstrom«, wandte Dr. Wendt ein.
»Ja, aber warum arbeitet Fortuyn dann nicht auf dieser Linie, vor allem mit dem Grundstoff Azetylen, weiter?« rief Dr. Lehnert. »Hier liegt meiner Meinung nach die Zukunft.«
»Aber nicht nach Doktor Fortuyns Meinung«, erwiderte Wendt. »Er hat doch die Heptansynthese in der Theorie einwandfrei bewiesen. Es kommt eben lediglich auf den Katalysator an, um die geeignete Isolationsfähigkeit zu erreichen.«
»Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, sagte schon der alte Goethe!« gab Lehnert bissig zurück. Sein abweisendes Gesicht ließ Wendt eine weitere Frage unterdrücken. Er wandte sich einem jungen Mädchen zu, das an einer anderen Stelle des Raumes arbeitete. »Einen Augenblick mal, geliebte Ottilie!«
Die Angeredete drehte sich mit einem Ruck um. »H2SO4 gefällig? Sie Frechdachs!« Sie hielt ihm drohend eine Schwefelsäureflasche entgegen. »Wenn Sie mich schon aus Mangel an Respekt nicht ›Fräulein Doktor Gerland‹ nennen, dann«, – sie lachte – »dann wenigstens ›Tilly‹! Im übrigen: Machen Sie ihren Kram ohne mich!«
»Haben Sie mir schon oft genug gesagt! Soll meinen Dreck alleene machen! Aber, Tillychen, dies eine Mal noch: Nur ‘ne kurze Frage! Die Sache klappt absolut nicht bei mir. Soll ich zu Fortuyn reingehen und es ihm sagen?«
»Das würde ich mir an Ihrer Stelle reiflich überlegen, Rudi!« Sie strich sich das blonde Haar aus der Stirn und ging mit ihm zu seinem Platz. »Was haben Sie denn da? Zeigen Sie mal das Protokoll! Reaktionsversuch Heptan, mit Katalysator B 4876! Hm! Die Reaktion scheint tatsächlich nicht da zu sein.« Sie hob das Reagenzglas und beroch die Flüssigkeit. »Heptan ist vorhanden. Tja – dann kann’s doch nur noch am Katalysator liegen. Haben Sie den richtig eingefüllt?«
Dr. Wendt schlug sich vor die Stirn. »Herrgott! Ich Kamel! Ich …«
»Bemühen Sie den zoologischen Garten nicht, Rudi! Was ist denn?«
»Ich hab’ ja den Katalysator vergessen. Schappmann sollte ihn holen. Weiß der Teufel, wo der steckt! Da hab’ ich in Gedanken einfach das reine Heptan genommen.«
»Na also, Rudi!« Mit einer unzweideutigen Handbewegung nach der Stirn ging sie zu ihrem Tisch zurück.
»Verflucht noch mal!« brummte Dr. Wendt vor sich hin. »Das hätte ‘ne schöne Blamage gegeben, wenn ich damit zu Fortuyn … Na endlich, Schappmann! Haben Sie das Zeug?«
Ohne ein Wort zu verlieren, stellte der Laboratoriumsdiener ein Fläschchen mit blaugrünem Inhalt vor Dr. Wendt hin und ging zu Tillys Tisch. Er sprach halblaut mit ihr. Die anderen – die jungen Dachse, wie Schappmann sie bei sich titulierte – brauchten nicht zu hören, was er ihr mitzuteilen hatte.
»Fräulein Doktor! Der Mann, der mein Nachfolger werden möchte – Sie wissen, der schon ein halbes Jahr in der Packerei gearbeitet hat –, ist wieder da.«
»Wär’ es nicht besser, Sie wenden sich an Herrn Doktor Fortuyn persönlich?«
Schappmann wiegte mit einem halb verlegenen, halb verschmitzten Grinsen den Kopf. »Wenn Sie ja sagen, Fräulein Doktor, sagt Herr Doktor Fortuyn auch ja. Guter Fürspruch kann nie schaden. Liebes Fräulein Gerland, wenn ich Sie bitten dürfte … aber Sie können ihn sich ja erst noch mal ansehn!« Er öffnete die Tür und trat mit ihr hinaus.
Prüfend blieb ihr Auge an dem Gesicht des Mannes hängen. Sie hatte ihn schon mehrmals flüchtig gesehen. Er wohnte bei Schappmann im Hinterhaus des Gebäudes, in dem sie mit ihrer Mutter Wohnung genommen hatte. Auch der nähere Eindruck war nicht schlecht. Doch schien er viel älter, als Schappmann gesagt. Sein Schicksal mochte wohl nicht immer leicht gewesen sein. Das hagere, von Falten durchzogene Gesicht, von einem dichten, leicht ergrauten Vollbart umgeben, sprach von manchem Schweren, das er durchgemacht.
»Ja, Herr …? Wie war doch Ihr Name?«
»Wittebold, Fräulein Doktor.«
»Ah, richtig! Nun – Ihre Zeugnisse sind ja wohl in Ordnung? Die Auskunft, die man über Sie eingeholt hat – ich sagte Ihnen ja schon, daß wir dazu verpflichtet sind –, ist befriedigend ausgefallen. Dazu die Fürsprache unseres Freundes Schappmann …«
»Er wohnt schon ein halbes Jahr bei uns, Fräulein Doktor. Meine Luise hat mehr als einmal gesagt: ›Ein so solider Mieter, ‘nen besseren können wir nicht kriegen.‹ Also, von mir aus …«
Tilly lachte. »Na, da Sie nichts dagegen haben, Schappmann, will ich mal gleich bei Herrn Doktor Fortuyn nachfragen, wie weit die Sache ist.«
»Oh, das wäre sehr liebenswürdig, Fräulein Doktor!«
Dr. Fortuyn saß an seinem Tisch, als sie eintrat. Ein Schreibblock, mit Formeln und Ziffern bedeckt, lag vor ihm. Es waren jene schwierigen analytischen Untersuchungen über die Eigenschwingungen von Atomgruppen, auf denen Fortuyn eine neue Theorie der Kautschukdarstellung begründet hatte.
Jetzt ließ er den Bleistift sinken. Ein freundliches Lächeln glitt über das schmale, scharfprofilierte Gesicht. Wie um sich aus den Gefilden der mathematischen Spekulation in die Wirklichkeit zurückzufinden, strich er sich über die Stirn und das leicht angegraute Haar. »Was bringen Sie mir, Fräulein Gerland? Entsprechen die Ergebnisse mit B 680 der Prognose?«
»Ich bin mit der Versuchsreihe noch nicht durch. Die ersten Versuche scheinen die Theorie zu bestätigen. Aber, Verzeihung – im Augenblick komm’ ich aus einem anderen Grund.« Tilly legte Wittebolds Papiere vor sich hin und begann, Dr. Fortuyn den Fall vorzutragen.
Noch während sie sprach, hatte der seinen Kopf schon wieder halb über seine Zahlen und Formeln geneigt. »Ist gut!« sagte er, ohne aufzublicken. »Wenn über seine Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen, nehmen wir ihn. Wie heißt er? Wittebold? Also, bereiten Sie alles vor und lassen Sie die nötigen Formulare ausschreiben!«
»Danke schön, Herr Fortuyn. Ich werde das weitere besorgen.« —
»Alles in Ordnung, Herr Wittebold! Sie müssen nun noch allerhand lernen. Die vielen fremden Namen werden Ihnen im Anfang Schwierigkeiten machen. Aber Herr Schappmann bleibt ja noch einige Zeit und kann Sie mit Ihrer Tätigkeit bekannt machen.«
»Ich weiß nicht, Fräulein Doktor, wie ich Ihnen danken soll. Ich kann Ihnen nur das Versprechen geben, daß ich Ihrer Empfehlung keine Unehre …«
Sie drückte flüchtig die Hand, die der Mann ihr dankbar entgegenstreckte. »Schon gut, Herr Wittebold! Dann also morgen früh! Pünktlich um acht!« —
Am nächsten Tage wurde Wittebold von seinem Vorgänger in den Obliegenheiten seines Dienstes unterwiesen. Als sie mittags am Tor vorbeikamen, ließ Schappmann ihn beim Zeitungshändler ein paar Blätter kaufen. Schrieb auf jedes einen Namen und sagte: »Also an diese Herren liefern. Das Geld lassen Sie sich gleich wiedergeben.«
Während Schappmann in das Verwaltungsgebäude ging, brachte Wittebold die Zeitungen in die Laboratoriumssäle. Er war gerade damit beschäftigt, ein paar leere Ballons zusammenzustellen, um sie mitzunehmen, als von Dr. Lehnerts Platz ein lauter Ausruf der Überraschung erklang.
Lehnert sprang auf, die Zeitung in der Hand. »Kinder, zuhören! Eine große Neuigkeit, wenn’s keine Ente ist!« Alle Köpfe wandten sich zu ihm. »Ich lese da eben folgenden Bericht: ›Nach einer Meldung des Wiener Journals stehen die MEA-Werke mit Dr. Moran von den Iduna-Werken in Wien in Unterhandlung, um ihn für sich zu verpflichten. Dr. Moran arbeitet in den Iduna-Werken an einem verbesserten Verfahren der Kautschuksynthese. Herr Dr. Moran war früher bei der Scotland Chemical beschäftigt, schied aber bei der Fusionierung der dortigen chemischen Industrie aus seiner Stellung. – Soweit die Meldung des Wiener Journals. Unser chemischer Mitarbeiter, Professor Janzen, der Kautschukspezialist ist, teilt uns dazu mit, das Moransche Verfahren sei ihm aus eigener Anschauung bekannt. Er messe ihm große Bedeutung bei …‹«
Einen Augenblick Stille. Dann brach es von allen Seiten los. »Unmöglich, undenkbar! Und davon weiß man hier bei uns gar nichts? Daß Fortuyn uns das nicht gesagt hat –!«
»Ich bin überzeugt, für Fortuyn ist es ebenso eine Überraschung wie für uns«, warf Fräulein Dr. Gerland dazwischen.
»Ja, dann muß er’s sofort erfahren!« rief Dr. Wendt.
»Bitte, Herr Kollege!« Lehnert reichte ihm das Blatt hin. »Wenn Sie’s tun wollen …«
Wendt hielt die Hand verlegen zurück.
»Na, ich seh’ schon, die Herren der Schöpfung sind alle zu feige!« meinte Tilly. »Muß ich’s ihm schon bringen! Geben Sie her, Kollege Lehnert!«
Fortuyn war im Begriff, fortzugehen. Er hatte schon den Mantel an, als Tilly eintrat. »Nun, Fräulein Gerland, was haben Sie noch Schönes?«
Tilly, die eben noch über den mangelnden Mut ihrer männlichen Kollegen gespottet hatte, bereute jetzt ihren raschen Entschluß. Sie stand verlegen. Daß gerade sie es sein mußte, die dem verehrten Chef eine solche Nachricht brachte –! Wenn er sie wirklich noch nicht kannte – wie würde er den Schlag aufnehmen?
Das Zeitungsblatt entglitt ihren Händen. Fortuyn bückte sich danach. »Ist das für mich?«
»Ja gewiß, Herr Doktor! Eine Nachricht darin … Wir lasen sie eben im Laboratorium … Unfaßlich! Keiner will es glauben.«
»Nanu, Fräulein Gerland? Zeigen Sie mir doch den Artikel!«
Er entfaltete das Blatt und las die angestrichenen Zeilen. Las sie noch einmal, wandte sich dann, ging mit schweren Schritten zum Schreibtisch und legte die Zeitung dort nieder. So sah Tilly nicht, welchen Eindruck die Nachricht auf ihn machte. Als er zurückkehrte, konnten Gesicht und Haltung einem Unbeteiligten unverändert erscheinen. Nur Tillys geschärftes Empfinden spürte die Wandlung: die Augen schmal zurückgekniffen, die Lippen aufeinandergepreßt, das ganze Gesicht schärfste Abwehr.
»Die Nachricht, Fräulein Gerland, trifft mich ebenso überraschend wie Sie und Ihre Kollegen. Mein erster Gedanke: eine Zeitungsente. Jetzt« – er zuckte die Achseln – »halte ich’s nicht für unmöglich. Sie erinnern sich an meine wissenschaftlichen Fehden mit Professor Janzen, meinem Vorgänger? Sie endeten damit, daß er uns verließ. Aber er hat – das mußte ich schon mehrmals erfahren – einflußreiche Freunde, die zu ihm halten. Hier können Sie sehen, wie die arbeiten! Ich werde mich an geeigneter Stelle darüber informieren. Ihnen aber danke ich vielmals, Fräulein Gerland!«
Als Fortuyn allein war, ging er ans Telefon und verlangteVerbindung mit Generaldirektor Kampendonk. Ärgerlich legte er den Hörer zurück. Der Geheimrat sollte schon vor einer Stunde das Werk verlassen haben.
Er griff nach seinem Hut, da schrillte der Apparat. Er nahm den Hörer ans Ohr. »Ah – guten Tag, Frau Johanna! Ja – ich bin noch hier – wollte gerade zu Ihnen … Ja, gewiß, sehr gern … Wie? Eine wichtige Nachricht? Hm – hm, meinen Sie etwa die aus Wien? Ja – eben wurde sie mir mitgeteilt. In einer Viertelstunde bin ich dort!« —
»Villa Terlinden!« sagte er seinem Chauffeur.
Der Wagen rollte durch die Ausläufer der Vorstadt zu der Villenkolonie, die von den Werken für ihre höheren Beamten errichtet worden war. Clemens Terlinden war einer der Direktoren. Sproß einer jener Dynastien, die vor zwei Menschenaltern am Rhein die Grundlagen der deutschen chemischen Industrie gelegt hatten. Auch Johanna, seine Frau, entstammte solchem Geschlecht. Finanzpolitik, Werkräson hatten zum Zustandekommen ihrer Ehe stark beigetragen.
Bis vor Jahresfrist hatte Fortuyn nur geschäftlich mit Direktor Terlinden zu tun gehabt. Da kam der Tag, der ihre Geschikke für immer verknüpfte. Ein Gastank im Werk war undicht geworden – Terlinden in unmittelbarer Nähe des Behälters bewußtlos zusammengebrochen. Fortuyn drang als erster in den vergasten Raum und rettete den Ohnmächtigen ins Freie. Zwar hatte ärztliche Kunst vermocht, Terlinden am Leben zu erhalten; seine Gesundheit jedoch war für immer zerstört. Ein siecher Mann, verbrachte er seine Tage zwischen Bett und Rollstuhl. Und mit der Hartnäckigkeit, die hoffnungslos Kranken oft eigen ist, drang er darauf, seinen Lebensretter immer wieder in seinem Hause zu sehen.
Fortuyn kam, sooft Clemens Terlinden nach ihm verlangte. Kam aus tiefer Teilnahme für den Mann, den ein grausames Geschick noch bei Lebzeiten aus der Reihe der Schaffenden gestrichen hatte. Doch trotz seiner häufigen Besuche gewann er zunächst keinen tieferen Einblick in Terlindens Ehe. Wenn er kam, empfing ihn regelmäßig Frau Johanna. Nach einem kurzen Gespräch über Tagesneuigkeiten, gelegentliche Theaterbesuche und dergleichen geleitete sie ihn dann ins Krankenzimmer, holte eine kleine Erfrischung, ließ mit einem Scherzwort die beiden allein. Bei alledem war Fortuyn Johanna Terlinden niemals einen Schritt nähergekommen. Kaum einmal ein Wort, das über die konventionelle Unterhaltung hinausging. Wenn er sich dann später verabschiedete, brachte sie ihn wieder zur Tür, entließ ihn mit freundlichem Händedruck.
Eine seltsame Frau, diese Johanna Terlinden! Jung, schön, voller Lebenslust, mußte sie ihre besten Jahre an der Seite eines hoffnungslos Kranken vertrauern, dessen Ende nicht abzusehen war. Sollte es nicht Stunden geben, in denen ihr Lebensmut versagte? Je öfter Fortuyn mit Johanna in Berührung kam, desto mehr reizte es ihn, hinter das Geheimnis ihrer ewig gleichen Maske zu schauen. Ja, es geschah sogar, daß mitten in seiner Arbeit plötzlich das Bild dieser Frau mit ihrem unenträtselbaren Lächeln vor ihm auftauchte. Eine übermenschliche Selbstbeherrschung mußte sie besitzen. Obgleich er sie auf das schärfste beobachtete, war es ihm nie gelungen, einen Blick in ihr Innerstes zu tun, der ihm ihr wahres Wesen enthüllt hätte. Wie mußte sie leiden! Immer tiefer wurde sein Mitleid mit solch qualvollem Martyrium – immer stärker, immer wärmer drängten seine Gefühle zu ihr hin.
Ein trüber Novembertag endlich sollte ihm die Lösung bringen. Das erste Mal, daß Johanna ihn nicht bei seinem Eintritt empfing. Die Stimmung des Kranken, in der letzten Zeit schon stark wechselnd, war außerordentlich gereizt. Fortuyn verabschiedete sich bald. Zum Abend war eine Einladung zu einem großen Fest bei Kampendonk an ihn ergangen – als Auftakt zu den Winterfestlichkeiten. Als Fortuyn den Kranken verließ, blickte er sich beim Durchschreiten der Vorzimmer vergeblich nach Johanna um. Da glaubte er aus einem verdunkelten Nebenzimmer ein unterdrücktes Weinen zu hören. Er schob den Vorhang beiseite und erkannte Frau Terlinden, die auf einer Couch lag, das Antlitz in den Händen vergraben.
Zögernd trat er näher. Der dicke Teppich dämpfte seine Schritte. »Frau Johanna!« Er faßte ihre Hände, schob sie zur Seite.
Sie richtete sich hastig auf, mühte sich um Fassung und Haltung. Ihre Hand tastete nach dem Taschentuch. »Verzeihung, Herr Fortuyn!« stammelte sie gequält. »Ich wußte nicht, daß Sie …«
»Gnädige Frau! Ich bitte Sie … was ist Ihnen? Kann ich Ihnen helfen? … Alles will ich tun – für Sie, Johanna!«
Waren’s seine Worte, war’s seine Stimme, war’s seine Nähe? Sie schlang ihre Arme um seinen Hals, drängte sich an seine Brust. Die Maske war gefallen. Hemmungslos floß über ihre Lippen, was ihr Herz so lange verschlossen. »Ich ertrag’ es nicht länger – dies Leben einer Verdammten! Wärest du nicht, wo wäre ich längst? Dich immer wiedersehen, deine Stimme hören! Für Tage gibt es mir Trost … Wenn du wüßtest, was ich all die Zeit erduldet – wie ich gekämpft, mich gezwungen hab’ –! Oft, wenn du fortgingst und wir draußen standen, du den Mantel umhängtest – mein Herz nach dir schrie … zerschlagen hätte ich den Spiegel mögen, der mir mein gemacht gleichgültiges Gesicht mit seinem ewigen Lächeln zuwarf. Deinen Arm hätt’ ich nehmen mögen und mit dir gehen – fort aus diesem Gefängnis! Der Folter entrinnen, die Leib und Seele martert!«
Sie warf sich auf die Couch zurück. Ihr Weinen verstummte. »Verzeih, du Lieber! Ich konnte nicht länger … Es war zuviel heute, was auf mich eindrang, mich alle Beherrschung verlieren ließ.« Sie schmiegte die Hand auf seinen Arm. »Das Fest heute abend … Wochenlang hatt’ ich mich drauf gefreut. Heute morgen begann’s: Er sah wohl die Vorfreude bei mir. Mit Klagen und Sticheln und Jammern und Ächzen brachte er mich zur Verzweiflung. Das Festkleid, das ich gerade anprobiert hatte, riß ich mir in Fetzen, vom Körper, warf’s ihm vor die Füße … Oh, er hat mich gequält!«
Von neuem brach sie in Schluchzen aus, suchte Halt und Trost an seiner Brust … Lange saßen sie so. Dann machte sie sich frei, sah ihm voll in die Augen. Ihre Blicke tauchten ineinander – und ihre Lippen fanden sich … —
Wochen, Monate waren verstrichen. Wenn Clemens Terlinden rief, kam Fortuyn, wie früher. Wie früher empfing ihn Johanna. Wie früher begleitete sie den Scheidenden. Doch niemals wieder fanden sich ihre Lippen im Kuß. Ein Druck der Hände nur – ein Winken der Augen …
Als Fortuyn jetzt eintrat, drängte Johanna ihn in das leere Herrenzimmer und legte den Arm um seine Schulter. »Du Liebster, du Armer, was hat man dir getan!«
Angst und Sorge ließ sie die Schranken durchbrechen, die sie selbst stillschweigend zwischen sich errichtet hatten. Sie führte ihn zu einer Couch und setzte sich neben ihn. »Du wußtest es schon, als ich dich anrief?«
Er nickte. »Eine Angestellte brachte mir das Blatt in mein Zimmer.«
»Durch eine Angestellte! Oh, wie häßlich das alles! Was hast du gesagt? Was denkst du? Sprich doch!«
Fortuyn fuhr mit der Hand beschwichtigend über ihre heiße Stirn. »Gewiß! Es ist ein böser Streich, den mir meine Gegner gespielt haben!«
»Ein Schurkenstreich! Wie Kampendonk dazu seine Hand bieten konnte? Ich verstehe es nicht. Ich rief vorhin Onkel Düsterloh an, um Näheres zu erfahren, konnte ihn aber nicht erreichen.«
»Hm – Düsterloh?« murmelte Fortuyn vor sich hin.
»Du sagst das so zweifelnd? Meinst du, daß er vielleicht …«
»Ich traue ihm nicht. Daß er nicht mein Freund ist, weiß ich bestimmt. Und ich hab’ auch das Empfinden, daß er meine Besuche bei euch ungern sieht.« Er spürte, wie ihr Arm leicht zusammenzuckte. »Kampendonk war nicht mehr zu erreichen«, fuhr er fort. »Ich wäre sonst gleich zu ihm hin.«
»Kampendonk?« fragte sie mit unruhiger Stimme. »Wie wirst du mit ihm sprechen?«
Er zuckte die Achseln. »Ebenso wie mit dir. Das eine weiß ich: Falls auch er sich in seinem Vertrauen zu meiner Arbeit hat erschüttern lassen, dann …«
»Wirst du fort von hier gehen? Wirst mich verlassen?« Sie umschlang ihn mit beiden Annen. »Nein – das nicht! Ich werde wahnsinnig, wenn ich hier allein bleibe. Ich gehe mit dir!«
Er strich ihr das wirre Haar aus der Stirn, neigte sich zu ihr und sprach begütigend auf sie ein. Allmählich fühlte er, wie ihre Glieder weicher wurden und sie ruhiger atmete. Er zog sie sanft empor, legte den Arm um ihre Schulter, wandelte mit ihr im Zimmer auf und ab. »Wir dürfen Clemens nicht vergessen. Hast du mit ihm schon über alles gesprochen?«
»Nein. Sein Befinden ist heute nicht gut. Es würde ihn sicher sehr erregen – unnötigerweise vielleicht … Denn, Walter, du wirst ja gar nicht fortgehn. In meiner Angst sah ich wohl schwärzer als nötig. Man wird dich nicht ziehen lassen – wird dir goldene Brücken bauen … Und wir werden zusammenbleiben, uns immer wiedersehn – und lieben!«
Er hatte schon Abschied genommen, da raunte er ihr noch zu: »Hüte dich vor Düsterloh! Er …«
»Ich weiß«, flüsterte sie mit abgewandtem Gesicht zurück. »Besser als du!«
Noch ehe am nächsten Morgen Fortuyn sich beim Generaldirektor Kampendonk melden lassen konnte, bat ihn dessen Privatsekretärin, um neun Uhr bei Kampendonk zu erscheinen.
»Ich muß es aufs lebhafteste bedauern, Herr Doktor, daß Sie von der bevorstehenden Neuerung im Werk indirekt durch die Zeitung Kenntnis erhielten. Die Notiz wurde ohne unser Zutun veröffentlicht. Ich bin bereit, Ihnen volle Aufklärung zu geben.«
Fortuyn verneigte sich kurz. »Bitte, Herr Generaldirektor …« »Schon vor längerer Zeit erfuhren wir von den uns nahestehenden Iduna-Werken in Wien, daß man dort einen gewissen Doktor Moran als Mitarbeiter verpflichtet habe, der im Begriff war, sich als Dozent zu habilitieren. Seine Forschungen auf dem Gebiet der Chemosynthese des Kautschuks seien vielversprechend. Gelegentlich eines Besuches in Wien nahm unser Direktor Lindenberg von den Moranschen Arbeiten Kenntnis und gab uns einen so glänzenden Bericht, daß wir auch noch Direktor Bünger hinschickten. Auf Grund der übereinstimmend günstigen Gutachten beschloß das Direktorium, nach weiterer genauer Prüfung aller Unterlagen, einer Anstellung Doktor Morans näherzutreten. Dieser verhielt sich zunächst ablehnend, wobei rein persönliche Verhältnisse maßgebend waren. Mit Rücksicht auf die größeren Mittel und besseren Forschungsbedingungen in unseren Werken erklärte er sich aber schließlich bereit. Erst vor drei Tagen kam der formelle Vertragsabschluß zustande. Da dies auf den ersten Blick als eine gewisse Desavouierung Ihrer Person erscheinen könnte, war ich sofort entschlossen, Sie darüber zu informieren. Leider hat die voreilige Zeitungsnachricht nun meine Absicht vereitelt. Ich glaube, das dürfte Ihnen genügen?«
»Gewiß, Herr Generaldirektor. Es genügt mir vollkommen. Obgleich ich …«
»Ich weiß: Sie wollen zum Ausdruck bringen, daß, wenn zwar nicht Ihre Person, so doch Ihr Verfahren dadurch beeinträchtigt würde. Dem ist nicht so. Sie arbeiten an Ihrer Heptansynthese ruhig weiter, wenn auch mit verkleinertem Assistentenstab. Was nun das Moransche Verfahren betrifft, so liegt die Sache folgendermaßen: Wir produzieren, ebenso wie viele andere Werke, nun schon seit Jahren Kautschuk auf der bekannten Butadienbasis. Angesichts der ungenügenden Rentabilität der bisherigen Methoden erschien es unbedingt geboten, die Moransche Erfindung, die einen bedeutenden Fortschritt verspricht, uns zu sichern. Dürften wir natürlich in absehbarer Zeit einen guten Enderfolg Ihrer Arbeiten erwarten, so hätten wir vermutlich von Morans Engagement absehen können. Aber Sie werden selbst eingestehen müssen, Herr Doktor, daß vom kaufmännischen Standpunkt aus unser Schritt durchaus verständlich ist. Sobald Ihre Synthese vollständig entwickelt ist, sind selbstverständlich alle anderen Verfahren überholt.«
Fortuyn erhob sich. »Gewiß, Herr Generaldirektor – ich gebe das zu. Es lag mir ja nur daran, die Klarheit zu bekommen, die Sie mir in so dankenswerter Weise gaben.«
Wittebold war nach dem Abendessen zu Schappmanns hinübergegangen. Die gute Luise saß neben dem Ofen in einem Korbstuhl, einen Strickstrumpf in den Händen. Aber die müden Finger wollten nicht recht. Immer wieder nickte sie ein, bis sie es schließlich satt bekam, die verlorenen Maschen aufzunehmen, und den grauen Kopf in das Kissen mit dem ›Ruhe sanft!‹ zurücklehnte.
Wittebold hatte zur Feier seines Dienstantritts ein paar Flaschen Bier mitgebracht. Sie saßen und sprachen über das Werk. Für Schappmann der einzige Gesprächsstoff.
»Was Sie mir da vorhin sagten, Kollege Wittebold, über einen neuen Herrn Moran aus Wien … ja, das ist doch ‘ne merkwürdige Sache. Konkurrenz für Herrn Fortuyn oder Nachfolger? – Das ist man so mit den Herren Gelehrten. Da hat einer so’n feines Ding gedreht – schon holen se’n her. Aber wie lange dauert die Herrlichkeit, da haben sie wieder ‘nen Besseren gefunden. Wie viele Leiter von den Laboratorien hab’ ich schon kommen und gehen sehn!«
»Wie lange ist denn Doktor Fortuyn hier?« fragte Wittebold.
»Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Er kam gerade am sechzigsten Geburtstag von meiner Luise – macht also drei Jahre und acht Monate. Sollte mir leid tun um Herrn Fortuyn, wenn er wegmüßte. War ‘n kulanter Mann! Na – ich werd’ nicht mehr die Ehre haben, unter dem Neuen zu dienen.«
Wittebold schaute nachdenklich dem blauen Rauch seiner Pfeife nach.
»Ist auch Zeit, daß ich gehe!« fuhr Schappmann fort. »Den ganzen Tag auf’n Beinen – da wollen die alten Knochen nicht mehr. Und wenn denn noch so’n Haufen Ärger dazwischenkommt, da freut man sich, daß jetzt alles ein Ende hat. Na, prost, Kollege Wittebold! Spülen wir den Kummer weg! Es hat mich lange genug gewurmt!«
»Na, was ist Ihnen denn für ‘ne Laus über die Leber gelaufen?« fragte Wittebold.