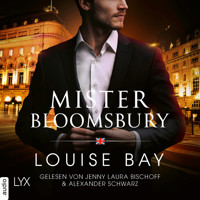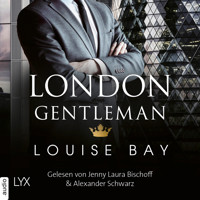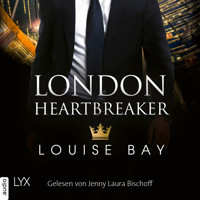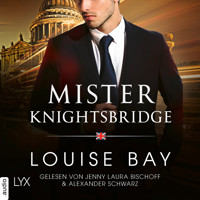9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: New York Royals
- Sprache: Deutsch
Max King ist der König der Wall Street. Ganz New York liegt ihm zu Füßen.
Fast ganz New York. Denn nach Feierabend gibt seine Tochter Amanda den Ton an. Seit sie bei ihm wohnt, sind Familie und Firma zwei strikt getrennte Welten - für etwas Anderes ist in seinem Herzen kein Platz.
Bis er Harper trifft. Seine neue Mitarbeiterin bringt ihn jeden Tag um den Verstand und nachts um den Schlaf. Und als er ihr eines Abends im Aufzug zu seinem Penthouse begegnet - und sie küsst -, geschieht, was er um jeden Preis vermeiden wollte: Seine beiden Welten prallen unwiderruflich aufeinander!
"Erotisch und herzzerbrechend zugleich!" USA Today
Band 1 der sinnlich-heißen Kings-of-New-York-Reihe von USA-Today-Bestseller-Autorin Louise Bay
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem Buch1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. KapitelDie AutorinDie Romane von Louise Bay bei LYXImpressumLOUISE BAY
King of New York
Roman
Ins Deutsche übertragen von Anja Mehrmann
Zu diesem Buch
Max King ist der erfolgreichste und einflussreichste Unternehmer der Wall Street. Er gilt als der König von New York, doch die junge Harper Jayne bringt sein Imperium plötzlich gefährlich ins Wanken. Seine neue Mitarbeiterin reizt ihn vom ersten Tag an bis aufs Blut. Zu klug, zu begabt, zu wunderschön bringt sie Max bei jedem Meeting um den Verstand und nachts um seinen wohlverdienten Schlaf. Sie jeden Tag um sich zu haben, treibt Max nahezu in den Wahnsinn. Dabei ist Ablenkung das Letzte, was er gerade gebrauchen kann. Seit seine Tochter Amanda zu ihm gezogen ist, ist sie der Mittelpunkt seines Lebens. In seinem Herzen ist kein Platz für eine andere Frau. Firma und Familie sind zwei Welten, die strikt getrennt bleiben müssen. Doch die Grenze verschwimmt, als Max herausfindet, dass Harper die Wohnung unter seinem Penthouse bewohnt. Und als er ihr eines Abends im Aufzug begegnet, sie küsst und auf ihrer Etage aussteigt, geschieht, was er um jeden Preis verhindern wollte: Seine beiden Welten prallen unwiderruflich aufeinander!
1. KAPITEL
HARPER
Volle. Zehn. Minuten. Das klingt nicht gerade nach einer langen Zeitspanne, aber ich saß Max King gegenüber, dem angeblichen König von New York. Schweigend las er den ersten Entwurf eines Berichts über die Textilindustrie in Bangladesch durch, den ich angefertigt hatte. Und deshalb fühlten sich die zehn Minuten an wie ein ganzes Leben.
Ich widerstand dem Drang, mich wieder in mein vierzehnjähriges Selbst zu verwandeln und ihn zu fragen, was er dachte. Stattdessen sah ich mich um und versuchte, irgendwas zu finden, worauf ich mich konzentrieren konnte.
Max’ Büro passte perfekt zu ihm – die Klimaanlage war auf die mittlere Temperatur eines Iglus eingestellt, Wände, Decke und Fußboden leuchteten in grellem Weiß und verstärkten den arktischen Eindruck. Sein Schreibtisch bestand aus Glas und Chrom, und die Sonne New Yorks bahnte sich einen Weg durch den Spalt zwischen den blickdichten Rouleaus in dem vergeblichen Versuch, den Frost, von dem der Raum durchdrungen schien, zum Schmelzen zu bringen. Ich hasste ihn. Jedes Mal, wenn ich dieses Büro betrat, verspürte ich den Impuls, meinen BH hervorblitzen zu lassen oder die Wände mit grellrotem Lippenstift zu beschmieren. Das hier war der Ort, an dem der Spaß zum Sterben kam.
Max seufzte und lenkte meine Aufmerksamkeit damit wieder auf seinen langen Zeigefinger, der über die Zeilen meiner Forschungsarbeit fuhr. Er schüttelte den Kopf. Mein Magen schlug einen Salto. Ich wusste, es war ein aussichtsloses Unterfangen, ihn beeindrucken zu wollen, aber dennoch hatte ich insgeheim gehofft, dass es mir gelingen würde. Ich hatte so hart an diesem Bericht gearbeitet, meiner ersten Recherche für Max King – den Max King. Ich hatte kaum geschlafen und in Doppelschichten gearbeitet, um daneben meine Aufgaben im Büro nicht zu vernachlässigen. Ich hatte mir alles ausgedruckt, was in den letzten zehn Jahren über diesen Industriezweig geschrieben worden war. Ich hatte über Statistiken gebrütet, versucht, Muster zu erkennen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Und ich hatte die Archive von King & Associates nach alten, von der Firma durchgeführten Recherchen durchsucht, damit wir mögliche Ungereimtheiten erklären konnten. Ich hatte wirklich an alles gedacht, oder? Als ich den Bericht frühmorgens ausgedruckt hatte, lange bevor die anderen ins Büro kamen, war ich glücklich, ja, sogar stolz gewesen. Ich hatte meine Sache gut gemacht.
»Haben Sie mit Marvin über die aktuellen Zahlen gesprochen?«, fragte er.
Ich nickte, doch er blickte nicht auf, also fügte ich hinzu: »Ja. Sämtliche Diagramme beruhen auf den jüngsten Zahlen.« Sahen sie etwa falsch aus? Hatte er etwas anderes erwartet?
Ich wollte doch nur ein »Gut gemacht!« von ihm hören.
Schon bevor ich mich an der Wirtschaftsfakultät einschrieb, hatte ich mir sehnlichst gewünscht, für Max King zu arbeiten. Er war die Macht auf dem Thron hinter vielen Wall-Street-Erfolgsgeschichten der letzten Jahre. King & Associates versorgten Anlagebanken mit wichtigen Rechercheinformationen und erleichterte ihnen so die Entscheidung über Investitionen. Mir gefiel die Vorstellung, dass sich jede Menge Investmentbanker in schicken Anzügen mit ihrem Reichtum brüsteten, während der Mann, der ihnen das ermöglicht hatte, sich in aller Ruhe seinem Geschäft widmete, das er hervorragend beherrschte. Subtil, zielstrebig und höchst erfolgreich – Max war alles, was ich gern sein wollte. Als ich im letzten Studiensemester das Angebot bekam, als Nachwuchsanalystin für King & Associates zu arbeiten, war ich begeistert, und gleichzeitig hatte ich das seltsame Gefühl, dass sich das Universum verhielt wie vorgesehen, so als handelte es sich einfach um den nächsten Schritt, den das Schicksal mir zugedacht hatte.
Das Schicksal konnte mich mal. Die ersten sechs Wochen an meiner neuen Stelle waren ganz anders verlaufen als erwartet. Ich hatte damit gerechnet, von ehrgeizigen, intelligenten, gut gekleideten Menschen zwischen Mitte zwanzig und Mitte dreißig umgeben zu sein, und in dieser Hinsicht hatte ich mich nicht geirrt. Auch die Auftraggeber, für die wir arbeiteten – fast jede Investmentbank in Manhattan –, waren fabelhaft und entsprachen voll und ganz den Erwartungen, mit denen ich angetreten war. Max King jedoch hatte sich als riesiger Reinfall entpuppt. Tatsache war: Trotz seiner Cleverness, obwohl er an der Wall Street von allen respektiert wurde und außerdem aussah, als gehörte er auf ein Poster an der Wand meines Jugendzimmers, trotz alledem war er …
Kalt.
Schroff.
Kompromisslos.
Ein richtiges Arschloch.
In natura sah er genauso gut aus wie auf dem Titelblatt von Forbes oder all den anderen Werbefotos, die ich durchgeklickt hatte, als ich ihn während meines MBA-Studiums in Berkeley gestalkt hatte. Eines Morgens war ich besonders früh ins Büro gekommen und sah ihn in seinen Laufklamotten – verschwitzt, keuchend und in Lycra gehüllt. Oberschenkel, so muskulös, dass sie aus Marmor zu bestehen schienen. Breite Schultern, eine kräftige römische Nase, dunkelbraunes glänzendes Haar – reine Verschwendung an einem Mann! – und eine Ganzjahresbräune, die förmlich schrie: Ich fahre vier Mal im Jahr in den Urlaub! Im Büro trug er maßgeschneiderte Anzüge. Diese Anzüge umspielten die Schultern auf eine spezielle Art, die ich von den wenigen Treffen mit meinem Vater kannte. Sein Gesicht und sein Körper entsprachen vollkommen meinen Erwartungen. Die Zusammenarbeit mit ihm weniger.
Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er so ein Tyrann war.
Wenn er morgens zwischen den Schreibtischen des Großraumbüros hindurch in sein Büro stürmte, sagte er uns nicht einmal guten Morgen. Regelmäßig brüllte er so laut ins Telefon, dass er schon im Vorraum bei den Aufzügen zu hören war. Und am Dienstag zuvor? Da war ich im Büro an ihm vorbeigegangen und hatte ihn angelächelt. Die Adern an seinem Hals fingen an zu pochen, und er musterte mich, als würde er mich am liebsten erwürgen.
Ich strich den Stoff meines Rocks von Zara glatt. Vielleicht irritierte es ihn, dass ich nicht so aalglatt war wie die anderen Frauen im Büro. Ich trug nicht die vorgeschriebenen Prada-Klamotten. Sah ich aus, als wäre mir mein Outfit egal? Nun, ich konnte mir im Augenblick einfachnichts Besseres leisten.
Wie die meisten jüngeren Kollegen befand ich mich am unteren Ende der Hackordnung. Was bedeutete, dass ich wusste, welches Sandwich ich für Mr King bestellen musste, wie ich den Kopierer wieder in Gang bekam und dass ich sämtliche Kurierdienste im Kurzwahlregister gespeichert hatte. Aber damit hatte ich gerechnet, und ich war einfach glücklich, für den Mann arbeiten zu dürfen, zu dem ich seit Jahren aufgeschaut und den ich bewundert hatte.
Und jetzt saß er vor mir und schwang kopfschüttelnd den Füller mit der rötesteten Tinte, die ich je gesehen hatte. Bei jedem Kringel, jedem Kreuz und jedem übertrieben großen Fragezeichen, das er am Rand anbrachte, schien ich ein kleines bisschen zu schrumpfen.
»Wo sind denn Ihre Quellen?«, fragte er, ohne aufzublicken.
Quellen? In den anderen von King & Associates erstellten Berichten waren keine Quellen angegeben. »Die liegen drüben auf meinem Schreibtisch …«
»Haben Sie mit Donny gesprochen?«
»Ich warte noch auf seinen Rückruf.«
Er hob den Blick, und ich gab mir Mühe, nicht zusammenzuzucken. Zwei Mal hatte ich versucht, Max’ Kontaktmann bei der WTO, der Welthandelsorganisation, zu erreichen. Ich konnte den Typ schließlich nicht zwingen, mit mir zu reden.
Immer noch kopfschüttelnd griff Max nach seinem Telefon und begann zu wählen. »Hallo, du Teufelskerl!«, sagte er. »Du musst mir unbedingt erzählen, wie eure Haltung zu Everything But Arms ist. Ich habe gehört, ihr setzt die EU unter Druck?« Max schaltete den Lautsprecher nicht ein, also konnte ich nur zusehen, wie er Notizen auf meine Abhandlung kritzelte. »Das wäre sehr hilfreich für dieses Ding über Bangladesch, das ich hier in Arbeit habe.« Max grinste. Er hob kurz den Kopf, sah mir in die Augen und dann sofort wieder weg, als ärgerte ihn mein bloßer Anblick. Großartig.
Er legte auf.
»Ich habe zwei Mal angerufen …«
»Ergebnisse werden belohnt, Bemühungen nicht«, sagte er kurz angebunden.
Hieß das, dass er meine Versuche nicht anerkannte? Hätte ich den Typ etwa an seinem Arbeitsplatz aufsuchen sollen? Ich war nicht Max King. Warum sollte jemand von der WTO den Anruf einer unterbezahlten Kanzleimitarbeiterin annehmen?
Himmel, will er mir denn überhaupt keine Chance geben?
Bevor ich antworten konnte, vibrierte auf dem Schreibtisch sein Handy.
»Amanda?«, bellte er ins Gerät. Jesus. Das Büro war überschaubar, darum wusste ich, dass Amanda nicht bei King & Associates arbeitete. Es verschaffte mir eine merkwürdige Genugtuung, dass er nicht nur mir gegenüber so bissig war. Ich sah ihn nur selten im Umgang mit anderen, aber irgendwie nahm ich sein Verhalten mir gegenüber persönlich. Allerdings schien er Amanda ebenso schroff zu behandeln. »Darüber diskutiere ich nicht mehr mit dir. Ich habe Nein gesagt.« Seine Freundin? In den Klatschspalten stand nie etwas über irgendwelche Dates. Aber es musste sie geben. Ein Mann, der so gebaut war, ob Arschloch oder nicht, musste einfach Dates haben. Es klang, als hätte Amanda die Ehre, ihn außerhalb der Bürozeiten ertragen zu müssen.
Er legte auf, warf das Telefon auf den Schreibtisch und sah zu, wie es über die Glasplatte schlitterte und vor seinem Laptop liegen blieb. Dann nahm er die Lektüre wieder auf und rieb sich mit schmalen, gebräunten Fingern die Stirn. Offenbar hatte Amanda dafür gesorgt, dass er Kopfschmerzen bekam. Mein Bericht würde dagegen vermutlich auch nicht helfen.
»Tippfehler sind inakzeptabel, Miss Jayne. Wenn es um etwas geht, bei dem man sich lediglich Mühe geben muss, gibt es keinen Grund, schlechter als hervorragend zu arbeiten.« Er schlug meinen Bericht zu, lehnte sich im Stuhl zurück und starrte mich an. »Aufmerksamkeit fürs Detail erfordert weder Scharfsinn noch die Fähigkeit zum Querdenken noch Kreativität. Wenn Sie schon die grundlegenden Anforderungen nicht erfüllen, warum sollte ich Ihnen dann etwas Komplizierteres anvertrauen?«
Tippfehler? Ich hatte dieses Gutachten doch tausendmal durchgelesen!
Er legte die Fingerspitzen aneinander. »Überarbeiten Sie das meinen Anmerkungen gemäß, und legen Sie es mir erst wieder vor, wenn es fehlerfrei ist. Für jeden Fehler, den ich finde, werde ich Sie zur Kasse bitten.«
Zur Kasse bitten? Ich hätte gern erwidert, dass ich innerhalb von drei Monaten in Rente gehen könnte, ließe ich ihn jedes Mal bezahlen, sobald er sich wie ein Scheißkerl benahm. Arschloch.
Zögerlich griff ich nach dem Dokument und wartete, ob er noch etwas hinzufügen würde, ermutigende Worte oder vielleicht sogar einen Dank.
Aber nein. Ich nahm den Packen Papier an mich und steuerte auf die Tür zu.
»Ach übrigens, Miss Jayne?«
Okay. Er lässt mir also doch noch einen Rest Würde. Ich hielt die Luft an und drehte mich zu ihm um.
»Pastrami auf Roggenbrot, ohne Essiggurke.«
Wie angewurzelt stand ich da und atmete tief durch, um den unerwarteten Schlag in die Magengrube zu verarbeiten.
Was. Für. Ein. Arschloch.
»Zum Lunch«, fügte er hinzu. Offenbar konnte er überhaupt nicht verstehen, warum ich noch da war.
Ich nickte und öffnete die Tür. Wenn ich diesen Raum nicht sofort verließ, würde ich wahrscheinlich gleich über den Schreibtisch springen und ihm seine perfekten Haare ausreißen.
Als ich die Tür hinter mir geschlossen hatte, fragte mich Donna, Max’ Assistentin: »Wie ist es gelaufen?«
Ich verdrehte die Augen. »Ich weiß nicht, wie du es schaffst, für ihn zu arbeiten. Er ist so …« Ohne den Satz zu beenden fing ich an, im Bericht nach den Tippfehlern zu suchen, von denen er gesprochen hatte.
Donna rollte auf ihrem Stuhl hinter dem Schreibtisch zurück und stand auf. »Bellende Hunde beißen nicht. Gehst du zum Deli?«
»Ja. Heute will er Pastrami.«
Sie zog ihre Jacke an. »Ich komme mit. Ich brauche eine Pause.« Sie schnappte sich ihr Portemonnaie, und wir gingen hinaus in das Stadtzentrum von New York. Natürlich gefiel Max keiner der Sandwichläden in der Nähe des Büros. Stattdessen mussten wir fünf Blocks weit nach Norden zu Joey’s Café laufen. Wenigstens schien die Sonne, und es war noch zu früh im Jahr, als dass feuchte Luft dafür hätte sorgen können, dass der Marsch zum Deli sich anfühlte wie eine mittägliche Wanderung durch die Straßen von Kalkutta.
»Hey, Donna. Hey, Harper«, begrüßte uns Joey, der Inhaber, als wir durch die Glastür eintraten. Dieses Deli war genau das Gegenteil eines Ortes, von dem ich geglaubt hätte, dass Max dort sein Mittagessen bestellen würde. Es war eindeutig ein Familienbetrieb, und der Laden war seit der Zeit, in der die Beatles noch zusammen gespielt hatten, nicht mehr modernisiert worden. Diese Räume hatten nichts von der cleveren, modernen, rücksichtslosen Fassade, die Max King so gern zur Schau stellte.
»Wie geht’s dem Boss?«, fragte Joey.
»Na ja«, erwiderte Donna. »Er arbeitet zu viel, wie immer. Was wollte er noch mal haben, Harper?«
»Pastrami auf Roggensandwich. Mit extra viel Gurke.« Es gibt nichts Schöneres als passiv-aggressive Rache.
Joey hob die Brauen. »Extra viel Gurke?«
Himmel, natürlich kannte er Max’ Vorlieben!
»Also … nein«, stotterte ich und wand mich vor Verlegenheit. »Natürlich ohne Gurke.«
Donna stieß mich mit dem Ellbogen an. »Und ich möchte Truthahnsalat auf Sauerteigbrot«, sagte sie, und zu mir gewandt: »Komm, wir essen hier, dann können wir reden.«
»Für mich dasselbe, bitte«, sagte ich zu Joey.
In dem Deli gab es mehrere Tische mit Stühlen, die bunt zusammengewürfelt waren. Die meisten Gäste nahmen ihre Bestellungen mit, aber heute war ich dankbar für ein paar Minuten mehr außerhalb des Büros. Ich folgte Donna, die mir zu einem der hinteren Tische voranging.
»Extra viel Gurke?«, fragte sie und grinste.
»Ich weiß«, sagte ich seufzend. »Das war kindisch. Tut mir leid. Ich wünschte nur, er wäre nicht so ein …«
»Erzähl mir, was passiert ist.«
Ich fasste mein Meeting mit Max zusammen – seine Verärgerung, weil ich nicht mit dem Kontaktmann bei der WTO gesprochen hatte, sein Vortrag über Tippfehler, der Mangel an Anerkennung für meine harte Arbeit.
»Sag deinem Boss, die Yankees haben an diesem Wochenende bekommen, was sie verdienen«, sagte Joey. Er stellte das Essen vor uns ab und schob zwei Dosen Mineralwasser über die mit Melamin beschichtete Tischplatte, obwohl wir gar nichts zu trinken bestellt hatten. Redete Joey mit Max über Baseball? Kannten sie sich überhaupt?
»Ich werd’s ihm ausrichten«, sagte Donna und lächelte. »Aber dann verlegt er seinen Laden vielleicht woanders hin. Du weißt doch, wie empfindlich er ist, wenn die Mets gut abschneiden.«
»Daran wird er sich in dieser Saison wohl gewöhnen müssen. Und ich habe absolut keine Angst, ihn zu verlieren. Er kommt schon seit mehr als zehn Jahren zu mir.«
Mehr als zehn Jahre?
»Du weißt, was er dazu sagen würde, oder?«, fragte Donna, während sie das Päckchen aus Wachspapier auf dem Teller vor sich auswickelte.
»Ja, schon klar, man soll seine Kundschaft nie als selbstverständlich betrachten.« Joey ging wieder hinter den Tresen und fragte über die Schulter: »Weißt du, wie ich ihn immer zum Schweigen bringe?«
Donna lachte. »Indem du ihm sagst, er soll wiederkommen, wenn sein Geschäft drei Generationen überlebt hat und immer noch weiterläuft?«
Joey richtete den Zeigefinger auf Donna. »Genau so.«
»Max kommt also schon sehr lange hierher?«, fragte ich sie, als Joey sich wieder zum Tresen wandte und sich um die Schlange von Leuten kümmerte, die sich seit unserer Ankunft gebildet hatte.
»Seitdem ich für ihn arbeite. Und das sind jetzt fast sieben Jahre.«
»Ein Gewohnheitstier also. Verstehe.« Nach allem, was ich bisher gesehen hatte, war Max nicht besonders spontan.
Donna legte den Kopf schief. »Eher ein ausgeprägter Sinn für Loyalität. Als diese Gegend hier aufgeblüht ist und an jeder Ecke ein Imbiss aufmachte, bekam Joeys Laden leichte Schwierigkeiten. Aber Max ist nie woanders hingegangen. Er hat sogar neue Gäste mitgebracht.«
Donnas Beschreibung passte nicht zu dem Bild des kalten Egomanen, dem ich mich im Büro gegenübersah. Ich biss in mein Truthahnsalat-Sandwich.
»Er kann fordernd und anspruchsvoll sein und einem tierisch auf die Nerven gehen, aber genau das hat ihn so erfolgreich gemacht.«
Ich wollte auch erfolgreich sein, dabei aber ein anständiger Mensch bleiben. War es naiv zu glauben, dass so etwas an der Wall Street möglich war?
Mit den Fingerspitzen drückte Donna die obere Brotscheibe auf den Truthahnsalat, sodass das Sandwich etwas schmaler wurde. »Er ist nicht so schlimm, wie du glaubst. Ich meine, wenn er gesagt hätte, dass dein Bericht völlig in Ordnung ist, was hättest du dann gelernt?« Sie hob ihr Sandwich an den Mund. »Du kannst nicht erwarten, dass du beim ersten Mal schon alles richtig machst. Und was die Tippfehler betrifft – hat er sich da geirrt?« Sie biss ab und wartete auf meine Antwort.
»Nein«, sagte ich und kaute auf meiner Unterlippe herum. »Aber du musst zugeben, dass seine Vorträge ganz schön nerven.« Ich zog ein Stück Truthahnfleisch unter der Brotscheibe hervor und schob es mir in den Mund. Ich hatte so hart gearbeitet; dafür erwartete ich wenigstens ein bisschen Anerkennung.
»Ja, manchmal. Bis du deine Fähigkeiten unter Beweis gestellt hast. Aber sobald du das getan hast, steht er bedingungslos hinter dir. Er hat mir diesen Job gegeben, obwohl er wusste, dass ich eine alleinerziehende Mutter bin, und er hat dafür gesorgt, dass ich kein Spiel, kein Fest und kein Treffen des Lehrer-Eltern-Ausschusses verpasse.« Sie riss eine Dose Mineralwasser auf. »Meine Tochter bekam die Windpocken, als ich gerade hier angefangen hatte, und ich bin damals trotzdem ins Büro gegangen. So wütend habe ich Max noch nie erlebt. Als er mich entdeckte, hat er mich aus dem Gebäude geführt und nach Hause geschickt. Hm … meine Mutter hat auf die Kleine aufgepasst, es ging ihr also gut, aber er bestand darauf, dass ich zu Hause blieb, bis sie wieder zur Schule gehen konnte.«
Ich schluckte. Das klang nicht nach dem Max, den ich kannte.
»Er ist ein anständiger Mensch. Aber er ist immer hochkonzentriert und wie getrieben. Und er nimmt seine Verantwortung für die Angestellten ernst – vor allem, wenn sie vielversprechend sind.«
»Ich habe nicht den Eindruck, dass er seine Verantwortung besonders ernst nimmt, wenn es darum geht, kein herablassendes Arschloch zu sein.«
Donna kicherte. »Du bist hier, um zu lernen, um besser zu werden. Er wird dir vieles beibringen, aber es hilft dir nicht, wenn er dir nur sagt, dass du deine Sache gut gemacht hast.«
Ich nahm eine Serviette aus dem altmodischen Spender am Tischrand und wischte mir die Mundwinkel ab. Hatte der heutige Tag noch etwas anderes bei mir bewirkt, als mein Selbstvertrauen komplett zu untergraben?
»Wenn du vorher gewusst hättest, wie das Gespräch heute verläuft, was hättest du dann anders gemacht?«, fragte Donna.
Ich zuckte mit den Schultern. Ich hatte gute Arbeit geleistet, aber Max weigerte sich, das anzuerkennen.
»Komm schon. Du kannst mir nicht erzählen, dass du alles genauso gemacht hättest.«
»Okay, nein. Ich hätte die Quellen ausgedruckt und sie zum Meeting mitgebracht.«
Donna nickte. »Gut. Was noch?«, fragte sie und biss erneut in ihr Sandwich.
»Wahrscheinlich hätte ich häufiger versucht, Max’ Kontaktmann bei der WTO zu erreichen – vielleicht hätte ich ihm eine E-Mail geschrieben. Ich hätte mir mehr Mühe geben können, um ihn zu erwischen. Und ich hätte das ganze Ding zum Korrekturlesen schicken sollen.« Uns stand ein Dienstleister zur Verfügung, der so etwas über Nacht erledigte, aber weil ich so lange mit dem Bericht beschäftigt gewesen war, hatte ich die Deadline verpasst. Ich hätte dafür sorgen müssen, rechtzeitig fertig zu werden.
Ich blickte von meinem Sandwich hoch und hörte auf, es zu zerpflücken. »Ich behaupte ja nicht, ich hätte nichts von ihm gelernt. Ich finde nur, er könnte netter sein. Ich wollte schon lange für ihn arbeiten. Hätte nur nicht gedacht, dass ich mir so oft vorstellen würde, wie meine Faust in seinem Gesicht landet.«
Donna lachte. »Tja, Harper, so ist das eben, wenn man einen Chef hat.«
Okay, ich konnte akzeptieren, dass Max zu Donna und offensichtlich auch zu Joey nett war. Aber zu mir war er das nicht. Und das machte alles noch schlimmer. Was hatte ich ihm denn getan? Hatte er für mich etwa eine spezielle Behandlung vorgesehen? Ja, mein Bericht war verbesserungsfähig, aber trotz all dem, was Donna gesagt hatte, hatte ich eine solche Reaktion nicht verdient. Er hätte mir wenigstens ein bisschen entgegenkommen können.
Jetzt, wo sich meine Erwartungen an die Zusammenarbeit mit Max voll und ganz zerschlagen hatten, musste ich mich darauf konzentrieren, alles Nützliche aus dieser Erfahrung mitzunehmen und dann weiterzuziehen. Ich würde meinen Bericht durchsehen und ihn vervollkommnen. Ich würde so viele Vorteile wie möglich aus diesem Job bei King & Associates ziehen, jede Menge Kontakte knüpfen, und zwei Jahre später wäre ich in der Lage, mein eigenes Unternehmen aufzuziehen oder direkt für eine Bank zu arbeiten.
Wie ich es geschafft hatte, meine beste Freundin Grace dazu zu überreden, mir beim Einzug in meine neue Wohnung zu helfen, wusste ich nicht mehr. Sie war an der Park Avenue aufgewachsen, ohne je körperliche Arbeit verrichten zu müssen.
»Was ist denn da drin, eine Leiche?«, fragte sie, und in dem dünnen Schweißfilm auf ihrer Stirn spiegelte sich das Licht des Aufzugs wider.
»Ja, meine ehemalige beste Freundin.« Ich deutete mit dem Kopf auf die alte Truhe aus Kiefernholz zu unseren Füßen, den letzten Gegenstand, der sich noch in dem Transporter befand. »Da drin ist genug Platz für noch eine«, sagte ich und lachte.
»Schade, dass kein Wein im Kühlschrank ist.« Grace fächelte sich Luft zu. »Ich bin es nicht gewöhnt, mich so anzustrengen, jedenfalls nicht, wenn ich Klamotten anhabe.«
»Weißt du was? Du solltest mir eigentlich dankbar sein. Durch mich erweitert sich dein Horizont«, entgegnete ich und grinste. »Weil ich dir zeige, wie ganz normale Mädels leben.«
Ich hatte bei Grace gewohnt, seit ich vor fast drei Monaten von Berkeley nach New York gezogen war. Sie war unglaublich verständnisvoll gewesen, als meine Mutter meine ganzen Sachen zu ihrer Wohnung in Brooklyn schicken ließ, aber jetzt, wo sie mir helfen sollte, alles in meine neue Wohnung zu verfrachten, war sie mit ihrer Geduld allmählich am Ende. »Für einen Kühlschrank bin ich übrigens zu arm. Und für Wein auch.« Die Miete für meine Einzimmerwohnung war horrend. Aber sie lag in Manhattan, und das war das Einzige, das mich interessierte. Ich wollte keine New Yorkerin werden, die in Brooklyn wohnte. Ich wollte diese Erfahrung auskosten, so gut es ging, also hatte ich Geräumigkeit gegen Lage eingetauscht – ein kleines viktorianisches Gebäude an der Ecke Rivington Street/Clinton Street in Lower Manhattan. Die Häuser auf beiden Straßenseiten waren mit Graffiti bedeckt, aber dieses hier war kürzlich saniert worden, und man hatte mir versichert, dass nur junge Berufstätige dort wohnten. Aber welchem Beruf gingen sie nach? Dem des Auftragsmörders?
»Das hier wird bestimmt sehr … gemütlich«, sagte Grace. »Bist du dir sicher, dass ich dir nicht das Schlafzimmer auf der anderen Flurseite bei mir anbieten soll?«
Meine Wohnung in Berkeley war mindestens doppelt so groß gewesen wie die neue. Und Graces Wohnung in Brooklyn war im Vergleich ein Palast, aber mir machte die Enge nichts aus. »Nein. Das gehört schließlich alles zur Erfahrung New York, stimmt’s?«
»Ja, genau wie die Kakerlaken, aber nach denen musst du nicht lange suchen. Geht eher darum, ihnen aus dem Weg zu gehen.« Grace war ein Mensch, der jedem das Leben ein bisschen leichter machen wollte, und das war einer der Gründe, warum ich sie liebte.
»Kann schon sein, aber ich will nun mal mittendrin sein. Außerdem ist im Keller ein Fitnessstudio, also spare ich da schon mal Geld. Und das Pendeln fällt auch weg. Von hier aus kann ich zu Fuß zur Arbeit gehen. Verdammt, vom Schlafzimmerfenster aus kann ich das Büro fast sehen.«
»Ich dachte, du hasst deine Arbeit. Wäre es da nicht besser, weiter weg zu wohnen?«, fragte Grace in dem Moment, als der Aufzug hielt und sich die Tür mit einem Ping auf meiner Etage öffnete.
Ich griff unter den Boden der hölzernen Truhe. »Ich hasse nicht die Arbeit. Ich hasse meinen Chef.«
»Diesen heißen Typ?«, fragte Grace.
»Kannst du sie auf deiner Seite bitte auch anheben?«, fragte ich. Ich wollte nicht an den Punktestand meines Chefs auf dem Hot-o-Meter erinnert werden. Ich streckte ein Bein aus, damit die Fahrstuhltür sich nicht wieder schloss. »Scheiße. Hast du sie?« Wir stolperten vorwärts und bogen dann nach links zu meiner Wohnung ab.
»Für diesen Mist hier bräuchten wir einen Mann«, schimpfte Grace, als ich mit meinen Schlüsseln kämpfte.
»Männer brauchen wir für Sex und Fußmassagen«, entgegnete ich. »Unsere Möbel tragen wir selbst.«
»In Zukunft trägst du deine Möbel. Ich suche mir einen Mann.«
Ich öffnete die Tür, und wir schoben die Truhe in den Wohnbereich. »Lass sie einfach hier stehen, bis ich mich entschieden habe, ob sie am Fußende des Betts stehen soll oder nicht.«
»Wo ist der Wein, den du mir versprochen hast?« Grace schob sich an mir vorbei und ließ sich auf die kleine zweisitzige Couch fallen.
Entgegen meinen Beteuerungen enthielt mein Kühlschrank tatsächlich zwei Flaschen Wein und ein Stück Parmesankäse.
»Was hast du da gerade über deinen heißen Chef gesagt? Ich dachte, du wärst schon in Berkeley zur Church of King konvertiert. Was ist denn jetzt auf einmal anders?«
Ich reichte Grace ein Glas Wein, setzte mich und streifte meine Sneakers ab. Ich wollte nicht an Max denken oder daran, wie er dafür sorgte, dass ich mich unzulänglich, fehl am Platz und unbehaglich fühlte. »Ich glaube, ich muss meine Garderobe für die Arbeit aufpeppen.« Je länger ich darüber nachdachte, was ich bei der Besprechung mit Max getragen hatte, desto klarer wurde mir, dass ich aus all dem Max Mara und Prada der Wall Street hervorstechen musste wie ein entzündeter Daumen.
»Du siehst gut aus. Du bist immer total geschniegelt. Versuchst du etwa, deinen tollen Chef zu beeindrucken?«
Ich verdrehte die Augen. »Das ist unmöglich. Er ist der arroganteste Mensch, den du dir vorstellen kannst. Nichts ist jemals gut genug für ihn.«
Mein Gespräch mit Donna beim Lunch am Tag zuvor hatte meine Wut auf Max vorübergehend besänftigt, aber heute war sie wieder voll da. Er mochte der Beste sein in dem, was er tat, und so heiß aussehen, dass man schon zu schmoren begann, wenn man ihm nur nahe kam, aber das entschuldigte nicht sein mieses Verhalten. Ich würde mich nicht unterkriegen lassen. Ich hasste ihn. Fest entschlossen, ihm zu beweisen, dass er im Unrecht war, hatte ich den Bericht über Bangladesch mit nach Hause genommen, um ihn am Wochenende zu überarbeiten. Manche seiner Kommentare ließen mich vermuten, dass er viel mehr als ich über die Textilindustrie in Bangladesch wusste, selbst nach all meinen Recherchen. War das gesamte Projekt nur ein Test gewesen? Wie auch immer, ich würde jedenfalls den Rest des Wochenendes damit verbringen, aus meiner Arbeit das Beste zu machen, das er je gesehen hatte.
»Nichts ist ihm gut genug?«, fragte Grace. »Kommt mir irgendwie bekannt vor.«
»Okay, ich bin vielleicht ein bisschen perfektionistisch, aber im Vergleich zu diesem Typen ist das gar nichts. Glaub mir. Ich habe mir an diesem Stück Arbeit, das er mir da gegeben hat, die Zähne ausgebissen, und er zerreißt es einfach in der Luft. Er hatte kein einziges gutes Wort dafür übrig.«
»Warum macht dir das so viel aus? Schüttele es einfach ab.«
Warum sollte es mir nichts ausmachen? In meinem Job wollte ich gut sein. Max sollte sehen, dass ich gut darin war.
»Aber ich habe wirklich hart gearbeitet, und ich habe es gut hinbekommen. Er ist einfach ein Arschloch.«
»Ach ja? Wenn er so ein Wichser ist, warum bedeutet dir seine Meinung dann etwas?« Grace hatte seit ihrem fünften Lebensjahr in den USA gelebt, aber gelegentlich blitzte noch das Britische hervor. Ihr kaum merklicher Akzent beim Gebrauch des Wortes Wichser gefiel mir besonders gut. Vor allem, weil es hervorragend zu Max King passte.
»Ich sage ja nicht, dass sie mir etwas bedeutet. Sie macht mich nur stinksauer.« Aber seine Meinung bedeutete mir sehr wohl etwas, so sehr ich es auch zu leugnen versuchte.
»Was hast du denn erwartet? Ein Mann, der so reich ist und so gut aussieht, muss einfach eine Schattenseite haben.« Sie zuckte mit den Schultern und trank einen Schluck Wein. »Du darfst das nicht derart nah an dich herankommen lassen. Deine Erwartungen an Männer sind viel zu hoch. So wirst du dein Leben lang immer wieder enttäuscht.«
Mein Handy klingelte. »Da wir gerade von Enttäuschung reden«, sagte ich und zeigte Grace das Display. Es war der Anwalt meines Vaters.
»Harper«, meldete ich mich.
»Miss Jayne, hier ist Kenneth Bray.« Warum rief er mich am Wochenende an?
»Hallo, Mr Bray. Was kann ich für Sie tun?« Ich blickte Grace an und verdrehte die Augen.
Allem Anschein nach hatte mein Vater einen Treuhandfonds für mich eingerichtet. Die Briefe, die ich in dieser Sache erhalten hatte, lagen in der Truhe, die wir gerade aus dem Transporter gezerrt hatten. Auf keinen davon hatte ich geantwortet. Ich hatte das Geld meines Vaters nie gewollt. Ich akzeptierte es erst, als ich auf dem College war. Ich fand, das war er mir schuldig, aber nach einem Jahr nahm ich einen Job an und löste seine Schecks nicht mehr ein. Von einem Fremden wollte ich kein Geld nehmen, selbst wenn er genetisch mit mir verbunden war.
»Ich würde mich gern mit Ihnen in meinem Büro verabreden, damit wir im Detail über das Geld sprechen können, das Ihr Vater für Sie zur Seite gelegt hat.«
»Ich weiß Ihre Beharrlichkeit zu schätzen, aber ich bin am Geld meines Vaters nicht interessiert.« Alles, was ich mir je gewünscht hatte, war ein Typ, der sich bei Geburtstagen und Schulaufführungen blicken ließ oder überhaupt bei irgendeinem Event, das etwas mit mir zu tun hatte. Grace irrte sich; meine Erwartungen an Männer waren bereits auf dem absoluten Tiefpunkt angelangt. Dafür hatte die Abwesenheit meines Vaters während meiner Kindheit gesorgt. Von Männern erwartete ich nichts als Enttäuschungen.
Mr Bray versuchte mich zu einem Treffen zu überreden, aber ich weigerte mich. Schließlich vertröstete ich ihn, indem ich behauptete, ich hätte mir den Papierkram durchgelesen und käme demnächst wieder auf ihn zu.
Ich legte auf und atmete tief durch.
»Alles okay?«, fragte Grace.
Mit dem Daumen fuhr ich über den Rand meines Glases. »Ja«, sagte ich. Es war einfacher gewesen, als ich noch so tun konnte, als gäbe es meinen Vater gar nicht. Wenn ich von ihm oder auch nur von seinem Anwalt hörte, fühlte ich mich wie Sisyphos, der zusehen muss, wie der Felsblock den Berg hinunterpoltert. Hinterher stand ich immer wieder am Nullpunkt, und all die Grübeleien, dass ich mir einen anderen Vater, ein anderes Leben, eine andere Familie gewünscht hätte, Gedanken, die ich normalerweise unterdrücken konnte, drängten an die Oberfläche.
Mein Vater hatte meine Mutter geschwängert und sich dann geweigert, das einzig Richtige zu tun und sie zu heiraten. Er hatte uns beide verlassen. Er hatte uns regelmäßig Geld geschickt – so waren wir wenigstens finanziell versorgt. Aber im Grunde wollte ich einen Vater. Irgendwann hatten sich all die nicht eingehaltenen Versprechen zu einem Berg aufgetürmt, über den ich nicht mehr hinwegsehen konnte. Die Geburtstagsfeiern, auf denen ich zur Tür starrte in der Hoffnung, dass er auftauchen würde, forderten ihren Tribut. Ein Mal zu oft hatte ich mir vom Christkind nichts anderes gewünscht als meinen Dad. Sein Nichtvorhandensein in meinem Leben war das wahre Problem, denn es fühlte sich an, als gäbe es immer jemand anders, der zuerst an der Reihe war, einen Ort, an dem er lieber war als bei mir. Das ließ mich mit dem Gefühl zurück, es nicht wert zu sein, dass andere Menschen ihre Zeit mit mir verbrachten.
»Willst du darüber reden?«, fragte Grace.
Ich lächelte. »Nein, ganz sicher nicht. Jetzt will ich mich mit meiner besten Freundin in meiner neuen Wohnung betrinken. Vielleicht Eis essen und ein bisschen plaudern.«
»Das können wir eindeutig am besten«, antwortete Grace. »Wollen wir über Jungs reden?«
»Wir können gern über Jungs reden, aber ich warne dich: Wenn du mich zu verkuppeln versuchst, trete ich dir in den Arsch, dass du bis nach Brooklyn fliegst.«
»Dabei weißt du nicht mal, mit wem ich dich verkuppeln will.«
Ich lachte. Grace war dermaßen leicht zu durchschauen. »An Dates bin ich nicht interessiert. Ich konzentriere mich voll auf meine Karriere. Auf diese Art kann ich nicht enttäuscht werden.« Max Kings Worte – Ergebnisse werden belohnt, Bemühungen nicht – klangen mir noch in den Ohren. Ich würde es einfach besser machen, härter arbeiten müssen. Für Dates oder Kuppeleiversuche meiner Freundin hatte ich keine Zeit.
»Mann, bist du zynisch. Es sind doch nicht alle Männer wie dein Vater.«
»Das habe ich auch nicht gesagt. Spiel hier bloß nicht die Hobbypsychologin. Ich will mich in New York etablieren, darum steht Dating nicht oben auf meiner Liste. Das ist alles«, sagte ich, trank einen Schluck Wein und zog die Beine an.
Ich würde Max King von mir überzeugen – oder bei dem Versuch sterben. Seinen Werdegang hatte ich so aufmerksam verfolgt, dass ich das Gefühl hatte, ihn zu kennen. Aber in meiner Fantasie hatte ich mich immer als seinen Schützling gesehen. Ich würde anfangen, für ihn zu arbeiten, und er würde zu mir sagen, dass ihm noch nie jemand mit derart viel Talent begegnet war. Im Grunde hatte ich angenommen, dass wir nach wenigen Tagen schon in der Lage sein würden, unsere Sätze füreinander zu beenden und dass wir uns nach Meetings abklatschen würden. Und vielleicht – ich geb’s zu – hatte ich sogar einen erotischen Traum mit ihm. Oder zwei.
All das war passiert, bevor ich ihn kennenlernte. Ich war eine Idiotin gewesen.
»Sex«, platzte ich heraus. »Dafür sind Männer gut. Vielleicht nehme ich mir einfach einen Liebhaber.«
»Ist das alles?«, fragte Grace.
Erneut fuhr ich mit einem Finger um den Rand des Glases. »Wofür sollten wir sie sonst brauchen?«
»Freundschaft?«
»Dafür hab ich dich«, sagte ich.
»Emotionale Unterstützung.«
»Auch das ist dein Job. Du teilst ihn dir mit Eis, Wein und gelegentlichen übertriebenen Einkäufen.«
»Und diesen Job nehmen wir vier sehr ernst. Aber was ist, wenn du Kinder haben willst?«, fragte Grace.
Kinder waren das Letzte, woran ich dachte. Meine Mutter war aus der Finanzwirtschaft ausgestiegen und Lehrerin geworden, um mehr Zeit mit mir verbringen zu können. Ich wusste, ein solches Opfer könnte ich niemals bringen. »Falls und wenn ich jemals über so etwas nachdenke, gehe ich zu einer Samenbank. Hat bei meiner Mutter auch funktioniert.«
»Deine Mom war nicht bei einer Samenbank.«
Ich trank einen großen Schluck Wein. »Wäre aber auf dasselbe hinausgelaufen.« Soweit es mich betraf, hatte ich keinen Vater.
»Gib mir mal dein iPad. Ich will diesen heißen Boss noch mal sehen, den du da hast.«
Ich stöhnte. »Lass es«, sagte ich, griff aber nach dem Tablet auf dem Couchtisch und reichte es widerstrebend an sie weiter.
»Max King, richtig?«
Ich antwortete nicht.
»Er sieht geradezu lächerlich gut aus.« Grace tippte auf das Display und wischte ein paarmal darüber, aber ich sah bewusst nicht hin. Dieser Typ verdiente meine Aufmerksamkeit nicht.
»Tu das weg. Es reicht, dass ich mich von Montag bis Freitag mit ihm abgeben muss. Lass mich mein Wochenende bitte ohne dieses arrogante Gesicht genießen.« Ich warf einen Blick auf das Titelbild der Forbes, das Grace angeklickt hatte. Verschränkte Arme, unfreundlicher Gesichtsausdruck, üppige, schmollende Lippen.
Arschloch.
Über mir krachte etwas, und ich blickte an die Zimmerdecke. Die hübsche Lampe aus Glas schwang hin und her. »Ist da gerade eine Bombe explodiert?«, fragte ich.
»Hört sich an, als hätte dein Nachbar gerade den Amboss auf Road Runner fallen lassen.«
Ich hielt mir einen Finger vor den Mund und lauschte angestrengt. Graces Augen weiteten sich, denn was als unzusammenhängendes Gemurmel begonnen hatte, verdichtete sich nun zu den unmissverständlichen Geräuschen einer Frau, die Sex hatte.
Keuchen. Stöhnen. Betteln.
Wieder ein Krachen. Was zum Teufel war da oben los? Waren mehr als zwei Leute an der Sache beteiligt?
Körper prallten aufeinander, gefolgt vom Schrei einer Frau. Hitze kroch mir den Nacken hinauf und breitete sich auf meinen Wangen aus. Jemand amüsierte sich an diesem Samstagnachmittag weitaus besser als wir.
Eine unverkennbar männliche Stimme rief: »Fuck!«, und die Schreie der Frau kamen jetzt schnell nacheinander und klangen verzweifelt. Immer lauter schlug das Kopfende des Betts gegen die Wand. Das atemlose Stöhnen der Frau klang beinahe panisch. Mein kleiner Kronleuchter schwang noch heftiger hin und her, und ich schwöre: Die Vibrationen des Möbelstücks, das gegen die Wand prallte, pflanzten sich von der Decke aus direkt in meine Leistengegend fort. Ich presste die Schenkel zusammen, als der Mann laut schreiend den lieben Gott anrief und sie einen letzten Schrei ausstieß, der durch mein mit Kartons vollgestelltes Apartment hallte.
In der darauffolgenden Stille fühlte ich mein Herz unter dem Pulli heftig schlagen. Einerseits war ich erregt von dem, was ich gehört hatte, andererseits machte es mich verlegen, dass ich absichtlich etwas so Persönliches belauscht hatte.
Weniger als drei Meter von mir entfernt war gerade jemand für Amerika gekommen.
»Ich glaube, den Typ muss ich mal kennenlernen«, sagte Grace, als klar wurde, dass die Sexkapade zu Ende war. »Der klang, als wüsste er, was er tut.«
»Die beiden scheinen ziemlich … kompatibel zu sein.« Hatte ich mich beim Sex jemals so verzweifelt angehört, so hungrig auf meinen Orgasmus? Ich kannte die Geräusche einer Frau, die im Schlafzimmer übertrieb. Die Frau über uns hatte nichts vorgespielt. Ihre Laute waren ebenso unwillkürlich gekommen, wie wenn jemand bei den gruseligen Szenen eines Horrorfilms aufschreit.
»Die klingen, als hätten sie wunderbaren Sex. Vielleicht solltest du mal anklopfen und ihnen einen Dreier vorschlagen.«
Ich verdrehte die Augen. »Ja, klar, und um eine Tasse Zucker bitten.«
Schritte trippelten an der Zimmerdecke entlang. »Sie hat ihre High Heels anbehalten«, sagte Grace. »Nett.«
Das klickende Geräusch über der Decke näherte sich meiner Truhe. Oben quietschte eine Tür, dann fiel sie ins Schloss. Die Schritte waren verschwunden.
»Tja, sie hat bekommen, was sie wollte, und jetzt ist sie abgehauen. Einen Fernseher wirst du hier nicht brauchen. Du kannst einfach die Seifenoper deiner Nachbarn verfolgen.«
»Glaubst du, dass das eine Prostituierte war?«, fragte ich. Eine Frau, die fünf Minuten nach einem Orgasmus einfach so verschwand, das war nicht normal. Eigentlich müsste sie doch noch bleiben, um wieder zu Atem zu kommen oder meinetwegen auch für eine zweite Runde? Verdammt, ich wusste nicht mal, ob ich es nach dem, was sie gerade erlebt hatte, in weniger als einer Stunde wieder in eine aufrechte Position geschafft hätte, noch dazu in High Heels.
»Eine Prostituierte? Wenn sie eine ist, hat sie Glück gehabt.« Grace kicherte. »Aber das glaube ich nicht. Ein Typ, der eine Frau so klingen lassen kann, muss dafür nicht bezahlen.« Sie beugte sich vor und stellte ihr leeres Glas auf einem der vielen Kartons ab, die in meiner Wohnung verteilt waren. »Okay, ich fahre dann mal nach Hause zu meinem Vibrator.«
»Das ist viel mehr, als ich wissen wollte.«
»Und halte mich auf dem Laufenden wegen deiner Nachbarn. Falls du ihnen begegnen solltest, versuch ein Foto zu machen.«
»Schon klar, wenn du beim Masturbieren von meinen Nachbarn träumst, geht das mit Bild natürlich besser«, sagte ich sarkastisch und schüttelte den Kopf. »Du bist echt pervers, weißt du das?«
Grace zuckte mit den Schultern und stand auf. »Das war besser als ein Porno.«
Sie hatte recht. Ich hoffte nur, dass ich nicht regelmäßig in den Genuss dieser Show kommen würde. Unzulänglich fühlte ich mich schließlich schon bei der Arbeit, zu Hause konnte ich dieses Gefühl nicht auch noch gebrauchen.
2. KAPITEL
MAX
Harper Jayne ging mir wirklichauf den Sack.
Sie reizte mich seit dem Moment, in dem sie zwei Monate zuvor ihre Arbeit aufgenommen hatte. Bis jetzt hatte ich es geschafft, auf Distanz zu bleiben.
Sie war clever. Das war kein Problem.
Und mit ihren Kollegen kam sie auch ziemlich gut klar, da gab es nichts zu meckern.
Sie schien nicht mal was dagegen zu haben, Donna am Kopierer zu helfen. An ihr war nichts Größenwahnsinniges, über das ich mich beklagen müsste.
Sie war lernbegierig. Das war eins der ersten Dinge, an denen ich mich rieb. Sie war zu eifrig. Die Art, wie sie mich aus diesen großen braunen Augen ansah, machte mich verrückt – als wäre sie bereit, so ziemlich alles zu tun, was ich ihr vorschlug. Immer, wenn ich sie anblickte – und sei es, dass ich sie nur kurz beim Hereinkommen in der Küche stehen sah –, jedes Mal stellte ich mir vor, wie sie in meinem Büro auf die Knie ging, ihren roten, feuchten Mund öffnete und um meinen Schwanz bettelte.
Und das war ein Problem.
Ich hatte immer streng zwischen Geschäft und Privatleben getrennt, ohne von dieser Regel je eine Ausnahme zu machen. Ich war der Boss und hatte einen Ruf zu verlieren. Mein Privatleben sollte nicht mehr Interesse wecken als mein Berufsleben.
Ich tippte mit dem Füller auf den Schreibtisch. Irgendeine Lösung musste ich finden, ob ich sie nun feuerte oder sie einfach vergaß. Aber ich musste etwas unternehmen.
Im Büro ertappte ich mich dabei, dass ich immer mehr Zeit hinter geschlossenen Türen verbrachte, um für Abstand zwischen Harper und mir zu sorgen. Normalerweise mischte ich mich draußen auf dem Flur gern unter die Leute und erkundigte mich, wie die Dinge liefen. Aber der Bereich um das Großraumbüro herum fühlte sich für mich an wie kontaminiertes Land. Wenn ich mit ihr reden musste, sprach ich sie mit Miss Jayne an, um sie mir vom Leib zu halten. Es funktionierte nicht. Ich fuhr mir mit den Händen durchs Haar. Ich brauchte einen Plan. Auf keinen Fall durfte ich zulassen, dass irgendeine Nachwuchsanalystin meine Art, Geschäfte zu machen, veränderte, denn genau diese Art hatte King & Associates auf ihrem Gebiet zu den Besten gemacht, und die gesamte Wall Street wusste das.
Ablenkungen waren im Moment das Letzte, das ich gebrauchen konnte. Meine Aufmerksamkeit war ohnehin schon geteilt. Mit Amanda zusammenzuleben war herausfordernder, als ich erwartet hatte, und es bedeutete zudem, dass ich viel öfter als zuvor nicht im Büro war, weil ich mehr Zeit in Connecticut verbrachte.
Außerdem versuchte ich gerade, einen neuen Kunden an Land zu ziehen, eine Investmentbank, für die King & Associates noch nicht gearbeitet hatten, und mir stand ein entscheidendes Treffen mit einem Insider bevor.
»Herein«, rief ich, als es an der Tür klopfte. Ich hoffte inständig, dass es nicht Harper mit ihrem überarbeiteten Bericht war.
»Guten Morgen, Max«, sagte Donna, schlüpfte ins Büro und schloss die Tür hinter sich.
»Danke.« Ich nahm ihr die große Kaffeetasse ab, die sie mir hinhielt, und versuchte, ihre Miene zu deuten. »Wie geht es Ihnen?«
»Mir geht’s gut. Wir haben heute einiges durchzugehen.« Donna und ich besprachen uns täglich um die Mittagszeit.
Ich griff mir an den Kragen und fragte: »Liegt es an mir, oder ist es hier drin wärmer als sonst?«
Donna schüttelte den Kopf. »Nein, und ich stelle die Klimaanlage auch nicht noch kälter ein. Es ist unglaublich kalt hier.«
Ich seufzte. Es lohnte sich nicht, deswegen Streit mit meiner Assistentin anzufangen. Das lohnte sich fast nie. So viel hatte ich von den Frauen in meinem Leben gelernt: Überlege dir gut, worum du kämpfen willst.
»Also«, sagte Donna und ließ sich auf den Stuhl vor meinem Schreibtisch gleiten. Denselben Stuhl, auf dem Harper am Freitag gesessen hatte, mit übereinandergeschlagenen Beinen, die Arme fest auf die Lehnen gedrückt, fast, als bereitete sie sich auf eine holprige Landung vor. Aber damit hatte sie mir eine wundervolle Aussicht auf ihre festen hohen Brüste und das lange braune Haar eröffnet, das ihr sanft über die Schultern fiel.
»Was ist los?«, fragte Donna.
»Hä?«, entgegnete ich, hob den Kopf und sah ihr ins Gesicht.
»Alles in Ordnung? Sie wirken abgelenkt.«
Ich schüttelte den Kopf und lehnte mich im Stuhl zurück. Ich musste mich konzentrieren. »Alles okay. Ich habe nur so viele Dinge im Kopf, um die ich mich kümmern muss. Diese Woche ist viel zu tun.«
»Also gut, fangen wir an. Morgen treffen Sie sich mit Wilson von D&G Consulting zum Lunch. Es ist auf zwölf Uhr im Tribeca Grill terminiert.«
»Ich nehme an, das können wir nicht einfach absagen?« Wilson war ein Konkurrent und ein solcher Egomane, dass eine Absage ein Problem gewesen wäre. Und weil er nicht anders konnte als zu prahlen, sprangen bei den Geschäftsessen mit ihm normalerweise nützliche Informationen für mich heraus.
»Ja, dafür ist es zu spät. Sie haben schon die letzten drei Male abgesagt.«
»Können wir nicht einfach zu Joey’s gehen?«
Donna runzelte nur die Stirn. Ich seufzte, als mir wieder einfiel, dass auch dies ein Kampf war, der sich nicht lohnte.
»Und Harper möchte heute Nachmittag etwas Zeit haben, weil sie ihren Bericht überarbeitet hat.«
Ich fing an, in meinem Kalender herumzuklicken. Harper hatte ich schon am Freitag gesehen. Ich wollte ihr seltener begegnen, nicht häufiger.
»Was machen Sie da? Ich habe Ihren Kalender doch hier.« Donna deutete auf ihr Tablet. »Heute Nachmittag um vier haben Sie Zeit.«
»Ich glaube nicht, dass wir einen Besprechungstermin brauchen. Sie soll ihre Arbeit einfach bei Ihnen hinterlegen, und ich sehe sie mir an, wenn ich Zeit dazu habe.« Ich starrte auf meinen Notizblock, und ohne jeden Grund schrieb ich: Lunch mit Wilson.
»Normalerweise vereinbaren Sie gern ein Folgetreffen.«
»Ich bin aber beschäftigt und habe keine Zeit, eine Arbeit durchzusehen, die wahrscheinlich nicht gut genug ist.« Das war unfair. Harpers Bericht war nicht schlecht. Es gab ein paar Fehler darin, aber nichts, was ich nicht erwartet hätte von jemandem, der noch nie für mich gearbeitet hatte – von neuen Nachwuchsanalysten war ich wesentlich schlampigere Qualität gewöhnt, und ich war anspruchsvoll, das war mir klar. Sie hatte zwar Donny nicht erwischt, aber der war ein hierarchisch denkender Scheißkerl. Zu verlangen, dass sie mit ihm sprach, hieß, etwas fast Unmögliches zu verlangen.
Wie sich zeigte, war sie gut in ihrem Job – manchmal hatte sie sogar richtig kreative Einfälle –, also sah es nicht danach aus, dass sie mir in nächster Zeit einen Grund geben würde, sie zu feuern.
Das konnte ein Problem werden.
»War der Bericht denn wirklich so schlecht?«, fragte Donna.
»Nein, aber trotzdem soll sie nicht hier rumsitzen und mir zusehen, wenn ich ihn durchlese.« Ich hatte es am Freitag äußerst verwirrend gefunden, dass sie nur einen Meter von mir entfernt gesessen hatte. Ich konnte mich kaum konzentrieren, denn ich versuchte, ihren Duft einzuordnen – irgendwie moschusartig, ziemlich sexy. Die Art, wie ihre Hände die Stuhllehnen umklammerten und sich dann wieder entspannten … Ich ertappte mich dabei, dass ich hart wurde bei der Vorstellung, dass diese Hände mir über die Brust fuhren und sich um meinen Schwanz schlossen.
Fuck, sie war wirklich ein Problem.
»Vor allem, weil Sie mich auch noch zwingen, mich mit Wilson zum Lunch zu treffen«, fügte ich hinzu und sah Donna ins Gesicht, die mich aus schmalen Augen musterte. Auf keinen Fall sollte sie mir wegen Harper weitere Fragen stellen, auch wenn es nur um die Qualität ihrer Arbeit ging.
Sie atmete tief durch. »Wissen Sie, ich möchte nichts Unpassendes sagen …«
»Dann tun Sie das auch nicht«, schnauzte ich. Was hatte sie sagen wollen? Ahnte sie, dass ich Harper anders behandelte? Dass ich mich von ihr angezogen fühlte?
Angezogen.