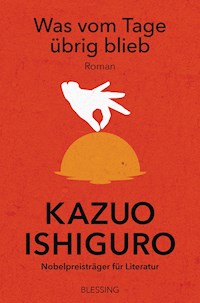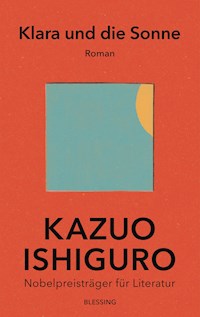
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der neue Roman des Nobelpreisträgers
Klara ist eine künstliche Intelligenz, entwickelt, um Jugendlichen eine Gefährtin zu sein auf dem Weg ins Erwachsenwerden. Vom Schaufenster eines Spielzeuggeschäfts aus beobachtet sie genau, was draußen vor sich geht, studiert das Verhalten der Kundinnen und Kunden und hofft, bald von einem jungen Menschen als neue Freundin ausgewählt zu werden. Als sich ihr Wunsch endlich erfüllt und ein Mädchen sie mit nach Hause nimmt, muss sie jedoch bald feststellen, dass sie auf die Versprechen von Menschen nicht allzu viel geben sollte.
KLARA UND DIE SONNE ist ein beeindruckendes, berührendes Buch und Klara eine unvergessliche Erzählerin, deren Blick auf unsere Welt die fundamentale Frage aufwirft, was es heißt zu lieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Glaubst du an das menschliche Herz? Ich meine natürlich nicht einfach das Organ, sondern spreche im poetischen Sinn. Das Herz des Menschen. Glaubst du, dass es so etwas gibt? Etwas, das jedes Individuum besonders und einmalig macht?
Klara ist eine KF, eine künstliche Freundin, entwickelt, um Jugendlichen eine Gefährtin zu sein. Sie ist besonders empfindsam und empathisch, um Mädchen und Jungen auf dem schwierigen Weg von der Kindheit zum Erwachsenwerden beizustehen. Vom Schaufenster eines Spielzeuggeschäfts aus beobachtet Klara, was draußen in der Welt vor sich geht und hofft wie die anderen KFs, bald von einem jungen Menschen ausgewählt zu werden. Als sich ihr Wunsch schließlich erfüllt und die dreizehnjährige Josie sie mit nach Hause nimmt, betritt sie zum ersten Mal die Welt der Menschen. Ihre Aufgabe und oberstes Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass Josie nicht einsam ist und es ihr gutgeht. Doch bald muss sie feststellen, dass die Erwachsenen Josies Wohlergehen anders definieren als sie, und dass man auf das Versprechen von Menschen nicht allzu viel geben sollte.
Mit Klara und die Sonne legt Literaturnobelpreisträger Kazuo Ishiguro einen so beeindruckenden wie berührenden Roman über die Menschlichkeit angesichts technischer und gesellschaftlicher Veränderungen vor. Klara ist eine Erzählerin, die man nie wieder vergisst.
KAZUO
ISHIGURO
Klara und die Sonne
Roman
Aus dem Englischen
von Barbara Schaden
BLESSING
Das Buch erscheint unter dem Titel
KLARAANDTHESUN
bei Faber & Faber, London
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2021 by Kazuo Ishiguro
Copyright © 2021 der deutschen Ausgabe und der Übersetzung
by Karl Blessing Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Stardust, München, nach einem Entwurf
von Faber & Faber, London
Herstellung: Gabriele Kutscha
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-27443-6V002
www.blessing-verlag.de
Zum Andenken an meine Mutter
Shizuko Ishiguro
(1926–2019)
ERSTER TEIL
Als wir neu waren, standen Rosa und ich in der Ladenmitte, wo auch die Zeitschriften auslagen, und hatten den größeren Teil des Schaufensters im Blick. So konnten wir die Außenwelt sehen – die vorbeihastenden Büroarbeiter, die Taxis, die Läufer, die Touristen, Bettelmann und seinen Hund, den unteren Teil des RPO-Gebäudes. Als wir uns schon ein bisschen eingelebt hatten, erlaubte uns Managerin, nach vorn zu gehen, direkt ins Schaufenster, und da erst sahen wir, wie hoch das RPO-Gebäude war. Und wenn wir zum richtigen Zeitpunkt da waren, sahen wir die Sonne auf ihrem Weg von den Dächern auf unserer Seite zum RPO-Gebäude hinüberwechseln.
Wenn ich das Glück hatte, sie so zu sehen, hielt ich ihr das Gesicht entgegen, um so viel von ihrer Nahrung aufzunehmen, wie ich konnte, und wenn Rosa bei mir war, riet ich ihr, dasselbe zu tun. Nach ein, zwei Minuten mussten wir wieder auf unsere Position zurück, und als wir neu waren, machten wir uns ständig Sorgen, dass wir womöglich immer kraftloser würden, weil wir die Sonne von der Ladenmitte aus oft nicht sehen konnten. KF Rex, der damals an unserer Seite war, sagte aber, wir müssten keine Angst haben, die Sonne finde immer Mittel und Wege, uns zu erreichen, egal, wo wir seien. Er deutete auf das Parkett und sagte: »Da, das ist das Muster der Sonne. Wenn ihr euch Sorgen macht, könnt ihr es einfach berühren, und schon werdet ihr wieder stark.«
Es waren keine Kunden da, als er das sagte, und Managerin war damit beschäftigt, etwas in den Roten Regalen zu ordnen, und ich wollte sie nicht stören. Ich fragte also nicht um Erlaubnis, sondern warf Rosa einen Blick zu, und als sie mich ausdruckslos anschaute, trat ich zwei Schritte vor, kauerte nieder und streckte beide Hände nach dem Muster der Sonne auf dem Boden aus. Doch es löste sich im selben Augenblick auf, in dem meine Finger es berührten, und obwohl ich alles versuchte, was ich konnte – ich klopfte auf die Stelle, an der es gewesen war, und als das nicht half, rieb ich mit beiden Händen über die Holzdielen –, kam es nicht zurück. Als ich wieder aufstand, sagte KF Rex: »Klara, das war gierig. Ihr KF-Mädchen seid immer so gierig.«
Ich war zwar noch neu, mir kam aber sofort der Gedanke, dass die Sonne ihr Muster vielleicht rein zufällig genau in dem Moment zurückgezogen hatte, als ich es berührte, dass ich also gar nichts dafürkonnte. Aber die Miene von KF Rex blieb ernst.
»Du hast dir die ganze Nahrung allein genommen, Klara. Schau, es ist fast dunkel geworden.«
Tatsächlich war es im Laden jetzt ziemlich düster. Sogar das Abschleppzonenschild am Lampenmast draußen auf dem Gehsteig sah grau und blass aus.
»Entschuldigung«, sagte ich zu Rex, dann zu Rosa. »Entschuldigung. Ich wollte mir nicht alles allein nehmen.«
»Deinetwegen«, sagte KF Rex, »werde ich am Abend kraftlos sein.«
»Du machst einen Scherz«, sagte ich. »Das weiß ich genau.«
»Ich mache keinen Scherz. Es könnte sein, dass ich gleich krank werde. Und was ist mit den KFs hinten im Laden? Mit denen stimmt ohnehin schon etwas nicht. Jetzt wird es ihnen noch schlechter gehen. Du bist gierig, Klara.«
»Das glaube ich dir nicht«, sagte ich, war mir aber nicht mehr sicher. Ich sah Rosa an, doch ihre Miene war nach wie vor ausdruckslos.
»Ich fühle mich schon ganz krank«, sagte KF Rex. Und er sackte nach vorn.
»Aber du hast doch selber gesagt, dass die Sonne immer Mittel und Wege finde, uns zu erreichen. Du machst einen Scherz, das weiß ich genau.«
Schließlich schaffte ich es, mich davon zu überzeugen, dass KF Rex sich über mich lustig machte. An diesem Tag aber ahnte ich, dass ich, ganz ohne Absicht, Rex dazu gebracht hatte, ein unangenehmes Thema anzusprechen, eines, das die meisten KFs im Geschäft lieber mieden. Kurze Zeit später passierte etwas mit KF Rex, das mich auf den Gedanken brachte, dass sein Scherz, wenn es denn einer war, jedenfalls einen wahren Kern hatte.
Es war ein strahlender Morgen, und Rex war nicht mehr an unserer Seite, Managerin hatte ihn in die vordere Nische gestellt. Managerin sagte immer, jede Position sei genauestens durchdacht und die Wahrscheinlichkeit, dass wir ausgesucht würden, überall gleich hoch. Dennoch wussten wir alle, dass der Blick eines Kunden, der den Laden betrat, zuallererst in die vordere Nische fiel, und natürlich freute sich Rex, dass er jetzt hier stehen durfte. Wir beobachteten ihn von der Ladenmitte aus, wie er mit hocherhobenem Kopf dastand, über und über vom Muster der Sonne bedeckt, und Rosa beugte sich einmal zu mir und sagte: »Er sieht wirklich wunderbar aus! Ganz bestimmt findet er bald ein Zuhause!«
An seinem dritten Tag in der Nische kam ein Mädchen mit seiner Mutter herein. Damals konnte ich das Alter noch nicht so gut bestimmen, aber ich weiß noch, dass ich das Mädchen auf dreizehneinhalb schätzte, und heute denke ich, das stimmte. Die Mutter war eine Büroarbeiterin, und an ihren Schuhen und ihrem Kostüm erkannten wir, dass sie ranghoch war. Das Mädchen ging schnurstracks auf Rex zu und stellte sich vor ihn, während die Mutter in unsere Richtung schlenderte, einen Blick auf uns warf, dann weiter nach hinten ging, wo zwei KFs auf dem Glastisch saßen und mit den Beinen baumelten, wie Managerin sie angewiesen hatte. Dann rief die Mutter ihre Tochter zu sich, aber die hörte nicht, sondern starrte Rex unverwandt ins Gesicht. Irgendwann streckte das Mädchen die Hand aus und fuhr ihm über den Arm. Rex sagte nichts, natürlich nicht, aber er lächelte auf sie hinunter und hielt still, genau so, wie wir uns verhalten sollten, wenn ein Kunde besonderes Interesse zeigte.
»Schau!«, flüsterte Rosa. »Sie wird sich für ihn entscheiden! Sie liebt ihn. Was für ein Glück er hat!« Ich versetzte ihr einen harten Stoß, damit sie den Mund hielt; man konnte uns ja ohne Weiteres hören.
Jetzt war es das Mädchen, das die Mutter herbeirief, und bald standen sie beide vor KF Rex und musterten ihn von oben bis unten, und das Mädchen streckte dabei manchmal die Hand aus und fasste ihn an. Die zwei beratschlagten leise miteinander, und irgendwann hörte ich das Mädchen sagen: »Aber er ist perfekt, Mom! Wunderschön!« Und einen Moment später: »Och, Mom, komm schon, bitte.«
Unterdessen war Managerin leise hinter sie getreten, und die Mutter drehte sich zu ihr um und fragte: »Was für ein Modell ist das?«
»Er ist ein B2«, sagte Managerin. »Dreierserie. Für das richtige Kind ist Rex der perfekte Gefährte. Vor allem glaube ich, dass er bei einem jungen Menschen Pflichtbewusstsein und Lerneifer fördert.«
»Das wäre bei dieser jungen Dame hier durchaus angebracht.«
»Oh, Mutter, er ist genau richtig!«
Dann sagte die Mutter: »B2, Dreierserie. Da gibt es doch Probleme bei der Absorption der Sonneneinstrahlung, oder?«
Das sagte sie einfach so, vor Rex, immer noch ein Lächeln im Gesicht. Auch Rex lächelte weiter, das Kind aber war perplex und blickte von Rex zur Mutter.
»Es stimmt«, sagte Managerin, »dass es bei der Dreierserie ein paar kleine Startschwierigkeiten gab, aber die entsprechenden Berichte waren maßlos übertrieben. Bei normalen Lichtverhältnissen tritt keinerlei Problem auf.«
»Ich habe gehört, dass eine Absorptionsstörung weitere Probleme nach sich ziehen kann«, sagte die Mutter. »Sogar in punkto Verhalten.«
»Mit Verlaub, Madam, die Modelle der Dreierserie haben viele Kinder unglaublich glücklich gemacht. Solange Sie nicht in Alaska oder in einem Grubenschacht leben, besteht kein Grund zur Sorge.«
Die Mutter betrachtete Rex noch eine Weile, und am Ende schüttelte sie den Kopf. »Tut mir leid, Caroline. Ich verstehe, warum er dir gefällt. Aber er ist nichts für uns. Wir finden einen, der perfekt für dich ist.«
Rex lächelte weiter, bis die Kunden fort waren, und selbst danach war ihm keine Enttäuschung anzumerken. Aber da fiel mir ebendieser Scherz wieder ein, und ich war mir sicher, dass ihm die Fragen nach der Sonne und der Menge an Nahrung, die wir von ihr bekommen konnten, schon eine ganze Weile durch den Kopf gingen.
Heute ist mir natürlich klar, dass Rex damit gewiss nicht der Einzige war. Offiziell war das überhaupt kein Thema – unser aller Spezifikationen garantierten, dass uns Faktoren wie unsere Position im Raum nichts anhaben konnten. Dennoch begann ein KF, wenn er einige Stunden nicht in der Sonne gewesen war, lethargisch zu werden, und sorgte sich, dass mit ihm etwas nicht stimmte – dass er einen Fehler habe und, wenn das bekannt würde, nie ein Zuhause fände.
Das war der eine Grund, weshalb wir alle so viel über den Platz im Schaufenster nachdachten. Managerin hatte uns versprochen, dass jeder von uns an die Reihe kommen werde, und jeder sehnte diesen Moment herbei. Zum Teil hatte es auch mit dem zu tun, was Managerin die »besondere Ehre« nannte, den Laden nach außen zu repräsentieren. Und egal, was sie sagte, wir wussten alle, dass man im Fenster natürlich eher ausgesucht wurde. In Wahrheit ging es aber um etwas anderes, nämlich um die Sonne und ihre Nahrung, und das war uns allen stillschweigend klar. Rosa sprach mich einmal flüsternd darauf an, kurz bevor wir an der Reihe waren.
»Klara, glaubst du, dass uns im Fenster so viel Güte zuteilwird, dass uns nie wieder etwas fehlt?«
Damals war ich noch ziemlich neu und wusste nicht, was ich darauf sagen sollte, obwohl auch mir diese Frage schon in den Sinn gekommen war.
Dann waren wir endlich an der Reihe, und eines Morgens betraten Rosa und ich das Schaufenster. Wir achteten sehr darauf, in der Auslage nichts umzustoßen, wie es den beiden in der Woche zuvor passiert war. Der Laden hatte, natürlich, noch zu, und ich dachte, der Rollladen sei ganz geschlossen. Doch als wir uns auf das Gestreifte Sofa gesetzt hatten, sah ich einen schmalen Spalt am unteren Ende des Rollladens – wahrscheinlich hatte ihn Managerin schon ein Stück hochgezogen, als sie überprüfte, ob alles bereit für uns war –, und durch diesen Spalt warf das Licht der Sonne ein helles Viereck, das über das Podest heraufkam und als gerade Linie direkt vor uns endete. Wir mussten nur unsere Füße ein bisschen ausstrecken, um sie in die Wärme zu stellen. Egal, wie die Antwort auf Rosas Frage lautete, in dem Moment war mir klar, dass wir bis auf Weiteres alle Nahrung bekämen, die wir brauchten. Und als Managerin den Schalter anknipste und der Rollladen sich vollständig hob, badeten wir in gleißendem Licht.
An dieser Stelle muss ich bekennen, dass zumindest ich noch einen weiteren Grund hatte, weshalb ich im Fenster sein wollte, und der hatte nichts mit der Nahrung der Sonne zu tun, auch nicht damit, ausgesucht zu werden. Anders als die meisten KFs, anders als Rosa, hatte ich mir immer gewünscht, mehr von der Außenwelt zu sehen – und möglichst in allen Details. Als sich der Rollladen hob und mir klar wurde, dass von jetzt an nur noch die Glasscheibe zwischen mir und dem Gehsteig war und ich so vieles, was ich bis dahin nur als Ecken und Kanten gesehen hatte, aus der Nähe und vollständig würde sehen können, wurde ich so begeistert, dass ich die Sonne und ihre Güte uns gegenüber für einen Moment fast vergaß.
Zum ersten Mal sah ich, dass das RPO-Gebäude in Wahrheit aus einzelnen Ziegelsteinen bestand und dass es nicht weiß war, wie ich immer gedacht hatte, sondern blassgelb. Und jetzt sah ich auch, dass es noch viel höher war, als ich mir vorgestellt hatte – zweiundzwanzig Stockwerke hoch –, und dass die Fenster sich wiederholten und jedes von einem eigenen, besonderen Sims unterstrichen war. Ich sah, dass die Sonne die Fassade des RPO-Gebäudes diagonal in zwei Dreiecke geteilt hatte, das eine fast weiß und das andere sehr dunkel, obwohl doch alles, das wusste ich, dieselbe blassgelbe Farbe hatte. Und ich sah nicht nur jedes einzelne Fenster bis hinauf zum obersten Stock, sondern manchmal sah ich auch die Leute dahinter, die standen, saßen, umhergingen. Und unten, auf der Straße, sah ich die Vorbeigehenden, ihre unterschiedlichen Schuhe, Pappbecher, Umhängetaschen, kleinen Hunde, und wenn ich wollte, konnte ich jedem von ihnen mit den Augen folgen, bis hinter den Fußgängerübergang und das zweite Abschleppzonenschild, dorthin, wo zwei Instandsetzer neben einem Gully standen und hinunterzeigten. Ich konnte auch in die Taxis schauen, wenn sie langsamer wurden, um Leute über den Fußgängerübergang zu lassen – ich sah die Hand eines Fahrers aufs Lenkrad schlagen, die Kappe auf dem Kopf eines Passagiers.
Die Zeit verging, die Sonne hielt uns warm, und ich sah, dass Rosa sehr glücklich war. Mir fiel aber auch auf, dass sie sich kaum etwas ansah, sondern den Blick immer nur auf das erste Abschleppzonenschild direkt vor uns geheftet hielt. Wenn ich sie draußen auf etwas aufmerksam machte, sah sie zwar kurz hin, verlor aber rasch das Interesse und blickte wieder nur auf den Gehsteig und das Schild.
Nur wenn vor dem Schaufenster ein Vorbeigehender stehen blieb, blickte auch Rosa mal eine Zeit lang anderswohin. In solchen Fällen verhielten wir uns so, wie Managerin es uns beigebracht hatte: Wir setzten unser »neutrales« Lächeln auf und richteten den Blick über die Straße hinweg auf einen Punkt auf halber Höhe des RPO-Gebäudes. Natürlich war es verlockend, einen Vorbeigehenden, der ans Fenster trat, genauer zu betrachten, doch Managerin hatte uns erklärt, es sei äußerst vulgär, in solchen Momenten Augenkontakt herzustellen. Erst wenn ein Vorbeigehender uns ausdrücklich Zeichen machte oder durch die Scheibe ansprach, durften wir reagieren; sonst nicht.
Wie sich zeigte, waren manche von den Leuten, die stehen blieben, überhaupt nicht an uns interessiert, sondern wollten einfach nur einen Sportschuh ausziehen und irgendwas damit machen oder auf ihre Rechtecke drücken. Manche kamen allerdings direkt ans Fenster und starrten herein. Unter diesen waren viele Kinder, mehr oder weniger in dem Alter, für das wir besonders geeignet waren, und sie schienen sich über unseren Anblick zu freuen. Immer wieder kam ein Kind begeistert zum Fenster, allein oder mit seinem Erwachsenen, deutete auf uns, lachte, zog ein komisches Gesicht, klopfte an die Scheibe, winkte.
Ab und zu – und ich wurde bald besser darin, so zu tun, als würde ich das RPO-Gebäude betrachten, während ich tatsächlich die Leute vor dem Fenster beobachtete – kam ein Kind und starrte uns an, und in seinem Blick lag etwas Trauriges, manchmal auch Ärgerliches, so als hätten wir etwas falsch gemacht. Im nächsten Moment konnte so ein Kind völlig umschwenken und lachen oder winken wie alle anderen, aber nach unserem zweiten Tag im Fenster wusste ich den Unterschied schnell zu erkennen.
Nachdem drei oder vier solche Kinder ans Fenster gekommen waren, versuchte ich mit Rosa darüber zu sprechen, aber sie lächelte nur und sagte: »Klara, du machst dir zu viele Gedanken. Das Kind war sicher ganz zufrieden. Ist doch klar an einem Tag wie heute! Da ist doch die ganze Stadt glücklich.«
Am Ende unseres dritten Tages aber sprach ich Managerin darauf an. Sie hatte uns gelobt und gesagt, wir hätten »schön und würdevoll« ausgesehen im Fenster. Unterdessen war die Beleuchtung im Laden heruntergefahren worden, und wir waren im hinteren Teil und lehnten an der Wand, ein paar von uns blätterten vor dem Schlafengehen noch in den Interessanten Zeitschriften. Rosa war neben mir, und an ihren Schultern erkannte ich, dass sie schon halb schlief. Als mich Managerin fragte, ob ich einen schönen Tag gehabt hätte, ergriff ich die Gelegenheit, um die traurigen Kinder vor dem Fenster zu erwähnen.
»Klara, du bist wirklich bemerkenswert«, sagte Managerin, leise, um Rosa und die anderen nicht zu stören. »Du nimmst so viel wahr und in dir auf.« Sie schüttelte den Kopf, als wunderte sie sich. Dann sagte sie: »Es muss dir klar sein, dass wir ein ganz besonderer Laden sind. Es gibt viele Kinder, die unheimlich froh wären, wenn sie dich aussuchen könnten, oder Rosa oder irgendeinen von euch. Aber das können sie nicht. Für sie seid ihr unerreichbar. Also stehen sie hier vor dem Fenster und malen sich aus, wie es wäre, wenn sie einen von euch hätten. Und dann werden sie traurig.«
»Managerin, so ein Kind – meinen Sie, so ein Kind hat einen KF bei sich zu Hause?«
»Wahrscheinlich nicht. Bestimmt nicht einen wie dich. Denk dir nichts, wenn ein Kind dich sonderbar ansieht, verbittert oder traurig, oder wenn es was Unangenehmes durch die Glasscheibe sagt. Merke es dir nur. So ein Kind ist höchstwahrscheinlich frustriert.«
»Ein Kind, das keinen KF hat, ist sicher einsam.«
»Ja, das auch«, sagte Managerin. »Einsam. Ja.«
Sie senkte den Blick und schwieg, und ich wartete. Auf einmal lächelte sie und nahm mir sacht die Interessante Zeitschrift aus der Hand, die ich betrachtet hatte.
»Gute Nacht, Klara. Sei morgen wieder so wunderbar, wie du heute warst. Und vergiss nicht – du und Rosa, ihr repräsentiert uns vor der ganzen Straße.«
Um die Mitte unseres vierten Vormittags im Fenster sah ich, wie draußen ein Taxi langsamer wurde und der Fahrer sich weit aus dem Fenster lehnte, damit ihn die anderen Taxis alle Fahrbahnen überqueren und am Straßenrand vor unserem Laden halten ließen. Josies Blick war auf mich geheftet, als sie aus dem Wagen stieg. Sie war blass und dünn, und als sie auf uns zukam, sah ich, dass ihr Gang sich von dem der anderen Vorbeigehenden unterschied. Sie ging nicht unbedingt langsamer, aber es kam mir so vor, als würde sie nach jedem Schritt eine Bestandsaufnahme vornehmen, wie um sich zu vergewissern, dass noch alles in Ordnung war und sie nicht stürzte. Ich schätzte sie auf vierzehneinhalb.
Als sie so nah war, dass die Fußgänger alle hinter ihr vorbeigingen, blieb sie stehen und lächelte mich an.
»Hallo«, sagte sie durch die Scheibe. »Hey, kannst du mich hören?«
Rosa starrte geradeaus auf das RPO-Gebäude, wie sie angewiesen worden war. Ich aber war angesprochen worden und durfte daher das Kind direkt ansehen, das Lächeln erwidern und ermutigend nicken.
»Echt?«, sagte Josie – aber zu dem Zeitpunkt kannte ich natürlich ihren Namen noch nicht. »Ich kann mich ja selber kaum hören. Hörst du mich wirklich?«
Ich nickte wieder, und sie schüttelte den Kopf, als wäre sie sehr beeindruckt.
»Wow.« Sie warf einen Blick über die Schulter – selbst diese Bewegung erfolgte mit Vorsicht – zu dem Taxi, aus dem sie ausgestiegen war. Die offene Tür ragte auf den Gehsteig hinaus, und auf dem Rücksitz saßen zwei Gestalten, die redeten und auf etwas deuteten, das jenseits des Fußgängerübergangs lag. Josie schien froh, dass ihre Erwachsenen keine Anstalten machten, ihr zu folgen, und trat noch einen Schritt näher ans Fenster heran, bis ihr Gesicht fast die Scheibe berührte.
»Ich habe dich gestern gesehen«, sagte sie.
Ich rief mir den vorhergehenden Tag noch einmal ins Gedächtnis, fand aber keine Erinnerung an Josie und sah sie überrascht an.
»Oh, kein Stress«, sagte sie, »du kannst mich gar nicht gesehen haben. Ich war im Taxi und bin so vorbeigefahren, gar nicht mal so langsam. Aber ich hab euch hier im Fenster sitzen sehen und Mom überredet, dass wir heute hier anhalten.« Mit derselben zögernden Vorsicht wie zuvor sah sie sich um. »Wow. Sie redet immer noch mit Mrs Jeffries. Ganz schön teure Unterhaltung – der Taxameter läuft nämlich einfach weiter.«
Jetzt sah ich, dass ihr Gesicht von Freundlichkeit erfüllt war, wenn sie lachte. Seltsamerweise aber fragte ich mich in diesem Moment auch zum ersten Mal, ob Josie wohl eines dieser einsamen Kinder war, über die ich mit Managerin gesprochen hatte.
Josie warf einen Blick auf Rosa – die immer noch pflichtbewusst auf das RPO-Gebäude starrte – und sagte: »Deine Freundin ist echt süß.« Doch noch während sie das sagte, ruhte ihr Blick schon wieder auf mir. Sekundenlang sah sie mich stumm an, und ich hatte schon Sorge, ihre Erwachsenen könnten aussteigen, bevor sie ein weiteres Wort gesagt hatte. Aber dann sagte sie: »Weißt du was? Deine Freundin wird für irgendjemanden da draußen die perfekte Gefährtin werden. Aber gestern, als wir hier entlanggefahren sind und ich dich gesehen habe, dachte ich, das ist sie, das ist die KF, die ich immer gesucht habe!« Wieder lachte sie. »Sorry. Klingt vielleicht respektlos.« Wieder drehte sie sich zum Taxi um, doch die beiden auf dem Rücksitz ließen keine Absicht erkennen auszusteigen. »Bist du Französin?«, fragte sie. »Du siehst irgendwie französisch aus.«
Ich lächelte und schüttelte den Kopf.
»Bei unserem letzten Meeting«, sagte Josie, »waren nämlich zwei Französinnen. Beide hatten die Haare genau wie du, ordentlich und kurz. Sah süß aus.« Wieder musterte sie mich schweigend, und ich meinte, noch einmal einen Anflug von Traurigkeit zu erkennen, war mir aber nicht sicher, weil ich doch immer noch ziemlich neu war.
Ihre Miene hellte sich gleich wieder auf, und sie sagte: »Hey, wird euch nicht heiß, wenn ihr da so sitzt? Braucht ihr nicht was zu trinken oder so?«
Ich schüttelte den Kopf und hob die Hände mit den Handflächen nach oben, um auszudrücken, wie wunderbar es war zu spüren, wie die Nahrung der Sonne auf uns fiel.
»Ach ja. Hab ich vergessen. Ihr sitzt gern in der Sonne, stimmt’s?«
Wieder drehte sie sich um, diesmal aber blickte sie zu den Dächern der Häuser hinauf. Die Sonne stand jetzt genau in dem freien Stück Himmel, und Josie kniff sofort die Augen zusammen und wandte sich mir zu.
»Wie macht ihr das nur? Ich meine, in die Sonne zu schauen, ohne geblendet zu sein. Ich würde das keine Sekunde lang aushalten.«
Sie beschirmte die Augen mit einer Hand und drehte sich noch einmal um, blickte aber nicht in die Sonne, sondern zum RPO-Gebäude hinauf. Nach fünf Sekunden wandte sie sich wieder mir zu.
»Für euch geht die Sonne hinter dem großen Haus da unter, oder? Das heißt, ihr kriegt nie zu sehen, wo sie wirklich untergeht. Dieses Gebäude steht immer im Weg.« Mit einem kurzen Blick vergewisserte sie sich, dass die Erwachsenen noch im Taxi waren, und fuhr fort: »Bei uns zu Hause steht nichts im Weg. Von meinem Zimmer droben kann man genau sehen, wo die Sonne untergeht. Genau den Ort, wo sie nachts hingeht.«
Anscheinend wirkte ich überrascht. Und am Rand meines Gesichtsfelds sah ich, dass Rosa sich vergaß und Josie ebenfalls verwundert anstarrte.
»Allerdings kann ich nicht sehen, wo sie morgens wieder heraufkommt«, sagte Josie. »Da stehen Hügel und Bäume im Weg. Irgendwie wie hier. Irgendwas ist immer im Weg. Aber abends ist es anders. Wo mein Zimmer hinausgeht, ist alles weit und leer. Wenn du zu uns kämst, um bei uns zu wohnen, würdest du es sehen.«
Jetzt stieg zuerst die eine, dann die andere Erwachsene aus dem Taxi aus; Josie hatte sie nicht gesehen, aber vielleicht hatte sie etwas gehört, denn sie sprach schneller.
»Ich schwör’s! Du siehst ganz genau, wo sie untergeht.«
Die Erwachsenen waren zwei Frauen, beide trugen ranghohe Bürokleidung. Die Größere war vermutlich Josies Mutter, weil sie Josie auch dann nicht aus den Augen ließ, als sie Wangenküsse mit ihrer Begleiterin tauschte. Dann war die Begleiterin fort, zwischen den Vorbeigehenden verschwunden, und die Mutter kam auf uns zu. Und nur eine Sekunde lang lag ihr bohrender Blick nicht mehr auf Josies Rücken, sondern auf mir, und ich schaute sofort weg und das RPO-Gebäude hinauf. Aber Josie sprach immer noch gegen das Glas, gedämpfter, gerade noch hörbar.
»Ich muss weg. Aber ich komme bald zurück. Wir reden wieder.« Dann sagte sie, fast flüsternd, sodass ich sie kaum noch hörte: »Du gehst nicht weg, oder?«
Ich schüttelte den Kopf und lächelte.
»Gut. Okay. Dann sag ich jetzt Tschüss. Aber nicht für lange.«
Die Mutter stand direkt hinter Josie. Sie hatte schwarze Haare und war dünn, allerdings nicht so dünn wie Josie oder manche Läufer. Jetzt, wo ich sie aus der Nähe und ihr Gesicht deutlicher sah, korrigierte ich meine Altersschätzung auf fünfundvierzig. Wie gesagt, ich konnte damals noch nicht so gut schätzen, aber diese Zahl erwies sich als mehr oder minder korrekt. Aus der Ferne hatte ich sie für jünger gehalten, aus der Nähe sah ich die tiefen Furchen um ihren Mund und erkannte eine zornige Erschöpfung in den Augen. Mir fiel auch auf, dass ihr Arm, den sie von hinten nach Josie ausstreckte, in der Luft kurz zögerte, sich beinahe wieder zurückzog, sich dann aber doch um die Schultern ihrer Tochter legte.
Sie mischten sich in den Strom der Vorbeigehenden, die in Richtung des zweiten Abschleppzonenschilds unterwegs waren, Josie mit ihrem vorsichtigen Gang, den Arm ihrer Mutter um die Schultern. Ehe sie außer Sichtweite waren, drehte sich Josie noch einmal um, und obwohl es den Rhythmus ihrer Schritte störte, winkte sie mir ein letztes Mal zu.
Später, irgendwann nachmittags, sagte Rosa: »Klara, ist das nicht komisch? Ich dachte immer, wenn wir im Fenster sitzen, sehen wir draußen jede Menge KFs. Alle, die schon ein Zuhause gefunden haben. Aber es sind überhaupt nicht viele. Wo sie wohl alle sind?«
Das war eine der großartigen Eigenschaften von Rosa. So vieles bekam sie nicht mit, und sogar wenn ich sie auf etwas aufmerksam machte, verstand sie oft nicht, was daran besonders oder interessant sein sollte. Dennoch machte sie ab und zu eine Beobachtung wie diese. Und kaum hatte sie es gesagt, war mir klar, dass auch ich erwartet hatte, vom Fenster aus viel mehr KFs zu sehen, die mit ihren Kindern glücklich die Straße entlanggingen, vielleicht sogar eigenen Angelegenheiten nachgingen, und auch wenn ich es mir nicht eingestanden hatte, musste ich jetzt zugeben, dass ich ebenfalls überrascht war, auch ein bisschen enttäuscht.
»Du hast recht«, sagte ich und blickte die Straße entlang. »Momentan ist unter den ganzen Vorbeigehenden kein einziger KF.«
»Ist das dort drüben nicht einer? Der am Feuerleiterhaus entlanggeht?«
Wir musterten beide aufmerksam den Vorbeigehenden – und schüttelten gleichzeitig den Kopf.
Sie hatte zwar das Thema KF zur Sprache gebracht, verlor aber bald alles Interesse daran, und das war typisch für sie. Als ich schließlich einen halbwüchsigen Jungen und seinen KF am Saftstand auf der anderen Straßenseite vorbeigehen sah, warf sie kaum einen Blick in seine Richtung.
Aber ich dachte noch länger über Rosas Bemerkung nach, und wenn ein KF vorbeikam, sah ich ihn mir besonders genau an. Und ich machte bald eine kuriose Beobachtung: Auf der Seite des RPO-Gebäudes waren immer mehr KFs zu sehen als auf unserer Straßenseite. Wenn sich doch einmal auf unserer Seite ein KF mit einem Kind im Schlepptau näherte, überquerten die beiden kurz nach dem zweiten Abschleppzonenschild die Straße auf dem Fußgängerübergang und kamen nicht an unserem Laden vorbei. Ging jedoch ein KF am Schaufenster vorbei, verhielt er sich fast immer seltsam, wandte das Gesicht ab und beschleunigte den Schritt. Ich fragte mich, ob wir – der ganze Laden – ihn vielleicht in Verlegenheit brachten. Und ich fragte mich auch, ob es Rosa und mir, wenn wir ein Zuhause gefunden hätten, genauso unangenehm wäre, daran erinnert zu werden, dass wir nicht immer bei unseren Kindern, sondern in einem Laden gelebt hatten. Aber sosehr ich mich auch bemühte, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich – oder Rosa – gegenüber dem Laden, gegenüber Managerin oder den anderen KFs je so empfinden könnte.
Dann kam mir, während ich weiter die Außenwelt beobachtete, der Gedanke, dass es auch anders sein könnte: dass die KFs nicht Verlegenheit empfanden, sondern Angst. Dass sie Angst hatten, weil wir neue Modelle waren, und fürchteten, ihre Kinder wären früher oder später der Meinung, es sei Zeit, sie zu entsorgen und durch KFs wie uns zu ersetzen. Deshalb schlurften sie so unbeholfen vorbei und verweigerten uns den Blick. Und deshalb sahen wir auch so wenige KFs von unserem Fenster aus. Soweit wir wussten, wimmelte es von ihnen in der Parallelstraße, die hinter dem RPO-Gebäude verlief. Soweit wir wussten, unternahmen die KFs, die draußen unterwegs waren, alles, nur um nicht an unserem Laden vorbeigehen zu müssen. Dass ihre Kinder uns sähen und ans Fenster kämen, war das Letzte, was sie wollten.
Keinen dieser Gedanken teilte ich mit Rosa. Stattdessen überlegte ich, wann immer wir einen KF entdeckten, absichtlich laut, ob er wohl glücklich sei mit seinem Kind und seinem Zuhause, und das freute und begeisterte Rosa jedes Mal. Sie machte ein Spiel daraus, einen ausfindig zu machen, und wenn sie einen entdeckt hatte, zeigte sie ihn mir und sagte: »Schau, dort! Siehst du ihn, Klara? Dieser Junge liebt seinen KF! Schau, wie sie miteinander lachen!«
Und natürlich gab es jede Menge Paare, die einen glücklichen Eindruck machten. Aber Rosa übersah so viele Signale. Oft stieß sie beim Anblick eines Paars auf der Straße einen entzückten Ausruf aus, und wenn ich hinsah, stellte ich fest, dass das Mädchen seinen KF zwar anlächelte, in Wirklichkeit aber böse auf ihn war und vielleicht in genau diesem Moment grausame Gedanken hatte. Solche Beobachtungen machte ich die ganze Zeit, aber ich sagte nichts und ließ Rosa in ihrem Glauben.
Einmal, am Morgen unseres fünften Tages im Fenster, sah ich zwei Taxis auf der anderen Straßenseite, vor dem RPO-Gebäude; sie bewegten sich langsam und mit so geringem Abstand, dass man sie für ein und dasselbe Fahrzeug hätte halten können – ein Doppeltaxi sozusagen. Dann wurde das vordere eine Spur schneller, es entstand eine Lücke, und durch diese Lücke sah ich auf dem Gehsteig gegenüber eine Vierzehnjährige mit Cartoon-T-Shirt, die auf den Fußgängerübergang zuging. Sie war ohne Erwachsenen und ohne KF unterwegs, wirkte aber selbstsicher und ein bisschen ungeduldig, und weil sie sich mit derselben Geschwindigkeit bewegte wie die zwei Taxis, konnte ich sie eine Zeit lang durch die Lücke verfolgen. Die Lücke ging noch ein Stück weiter auf, und jetzt sah ich, dass sie doch nicht allein war, sondern einen KF bei sich hatte, der drei Schritte hinter ihr ging. Und sogar in diesem kurzen Augenblick erkannte ich, dass er nicht zufällig zurückgeblieben war, sondern dass das Mädchen es so wollte: sie voraus, er ein paar Schritte hinter ihr. Der KF fügte sich, obwohl alle Vorbeigehenden es sahen und daraus folgern konnten, dass das Mädchen ihn nicht liebte. Und ich sah auch die Ermüdung im Gang des KF und fragte mich, wie es sein mochte, wenn man zwar ein Zuhause gefunden hatte, aber wusste, dass einen das Kind nicht haben wollte. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Paar sah, hätte ich nie gedacht, dass ein KF mit einem Kind zusammen sein konnte, das ihn verachtete und loshaben wollte, die beiden dennoch weiterhin beisammenblieben. Dann wurde das vordere Taxi wegen des Fußgängerübergangs langsamer, das hintere holte auf, und die beiden waren nicht mehr zu sehen. Ich suchte sie in der Menge auf dem Fußgängerübergang, entdeckte sie aber nicht, und die vielen Taxis versperrten mir die Sicht auf die andere Straßenseite.
Während dieser Tage hätte ich niemand anderen als Rosa neben mir im Fenster haben wollen, doch machte die Zeit, die wir dort waren, unsere unterschiedliche Einstellung deutlich. Nicht, dass ich begieriger darauf gewesen wäre, die Außenwelt kennenzulernen, als Rosa; auf ihre Art war auch sie begeistert und aufmerksam und nicht weniger bestrebt als ich, sich bestmöglich auf ein Dasein als freundliche und hilfsbereite KF vorzubereiten. Aber je mehr ich zu sehen bekam, desto mehr wollte ich lernen und erfahren, und anders als Rosa war ich erst verwundert, dann zunehmend fasziniert von den oft rätselhaften Gefühlen, die die Vorbeigehenden zeigten. Mir wurde klar, dass ich, wenn ich diese mysteriösen Zusammenhänge nicht wenigstens teilweise durchschaute, nie imstande wäre, mein künftiges Kind so gut zu unterstützen, wie es sich gehörte. Daher begann ich, auf den Gehsteigen, in vorbeifahrenden Taxis, in der Menschenmenge, die vor dem Fußgängerübergang wartete, nach Verhaltensweisen der Art Ausschau zu halten, die ich erlernen musste.
Erst wollte ich Rosa überreden, es genauso zu machen, sah aber bald ein, dass es sinnlos war. Einmal, an unserem dritten Fenstertag, als die Sonne schon hinter dem RPO-Gebäude verschwunden war, hielten auf unserer Seite zwei Taxis, die Fahrer sprangen heraus und begannen sich zu prügeln. Es war nicht das erste Mal, dass wir eine Prügelei beobachteten: Als wir noch recht neu gewesen waren, hatten wir uns vor dem Fenster zusammengedrängt, um so gut wie möglich zu sehen, wie drei Polizisten vor dem blinden Eingang mit Bettelmann und seinem Hund zu streiten anfingen. Es war allerdings kein schlimmer Streit; Managerin hatte uns später erklärt, dass die Polizisten sich um Bettelmann gesorgt hätten, weil er betrunken gewesen sei, und ihm nur hätten helfen wollen. Ganz anders jetzt mit den zwei Taxifahrern. Sie schlugen sich, als ginge es ihnen hauptsächlich darum, sich gegenseitig so viel Schaden wie möglich zuzufügen. Ihre Gesichter waren zu so scheußlichen Grimassen verzerrt, dass jemand, der noch neu war, vielleicht gar nicht erkannt hätte, dass es sich hier um Menschen handelte, und während der ganzen Zeit schlugen sie mit den Fäusten aufeinander ein und schrien sich grob an. Die Vorbeigehenden waren erst so schockiert, dass sie zurückwichen, doch bald machten sich ein paar Büroarbeiter und ein Läufer daran, die Prügelei zu beenden. Und obwohl das Gesicht des einen blutete, stiegen beide in ihre Taxis, und alles war wieder wie vorher. Kurze Zeit später sah ich die beiden Taxis, deren Fahrer sich eben noch geprügelt hatten, hintereinander auf derselben Fahrbahn geduldig an der Ampel warten.
Doch als ich mit Rosa über das Erlebte reden wollte, sah sie mich nur verdutzt an und sagte: »Eine Prügelei? Das habe ich nicht gesehen, Klara.«
»Rosa, das kann nicht sein, dass du das nicht gesehen hast. Es war doch direkt vor unseren Augen, gerade eben. Die beiden Fahrer.«
»Oh. Du meinst die Taximänner! Mir war nicht klar, dass du von ihnen sprichst, Klara. O ja, die habe ich schon gesehen, natürlich. Aber ich denke nicht, dass sie sich geprügelt haben.«
»Rosa, natürlich haben sie sich geprügelt!«
»Aber nein, sie haben nur so getan. Es war ein Spiel.«
»Rosa, die beiden haben sich geprügelt.«
»Rede keinen Unsinn, Klara! Du hast immer so komische Gedanken. Das war nur ein Spiel. Und es hat ihnen Spaß gemacht, genau wie den Vorbeigehenden.«
Am Ende sagte ich nur: »Vielleicht hast du recht, Rosa«, und ich glaube nicht, dass sie dem Vorfall noch einen weiteren Gedanken schenkte.
Aber ich konnte die Taxifahrer nicht so leicht vergessen. Oft folgte mein Blick einem bestimmten Vorbeigehenden, weil ich mich fragte, ob er ebenfalls so zornig werden konnte wie die beiden Fahrer. Oder ich versuchte mir auszumalen, wie eine bestimmte Vorbeigehende mit wutverzerrtem Gesicht aussähe. Vor allem – und das hätte Rosa niemals verstanden – versuchte ich, die Wut der Taxifahrer in meinem Geist zu spüren. Ich stellte mir vor, wie Rosa und ich derart zornig aufeinander würden, dass wir uns zu prügeln anfingen und tatsächlich versuchten, den Körper der anderen zu beschädigen. Die Vorstellung kam mir lächerlich vor, aber ich hatte die Taxifahrer ja gesehen und wollte wenigstens den Keim eines solchen Gefühls in meinem Geist finden. Es war aber sinnlos; am Ende musste ich über meine eigenen Gedanken lachen.
Doch wir sahen auch noch anderes von unserem Fenster aus – andere Gefühlsregungen, die ich erst nicht verstand, von denen ich dann aber einige Spielarten in mir entdeckte, auch wenn sie vielleicht nur wie der Schatten waren, den die Deckenlampen bei herabgelassenen Rollläden auf den Boden warfen. Da war zum Beispiel der Vorfall mit der Kaffeetassendame.
Das war zwei Tage nach meiner ersten Begegnung mit Josie. Den ganzen Vormittag hatte es geregnet, und die Leute gingen mit schmalen Augen unter Schirmen und triefenden Hüten am Fenster vorbei. Das RPO-Gebäude hatte sich während des Regens kaum verändert, nur brannten jetzt hinter vielen Fenstern Lichter, als wäre schon Abend. Das Feuerleiterhaus daneben hatte einen großen nassen Fleck, der sich über die linke Seite seiner Fassade abwärts zog, als wäre aus einer Ecke des Dachs ein Saft ausgetreten. Aber auf einmal brach die Sonne hervor und schien auf die nass glänzende Straße und auf die Taxidächer, und als die Vorbeigehenden das sahen, strömten sie in großer Zahl aus den Gebäuden, und im entstehenden Gedränge entdeckte ich einen kleinen Mann im Regenmantel. Er war auf der Seite des RPO-Gebäudes, und ich schätzte ihn auf einundsiebzig. Er winkte und rief und trat so dicht an den Straßenrand, dass ich schon fürchtete, er spränge im nächsten Moment vor die fahrenden Taxis. Zufällig war zu diesem Zeitpunkt Managerin bei uns im Fenster – sie hatte das Schild vor unserem Sofa neu ausgerichtet – und entdeckte den Winkenden im selben Moment wie ich. Sein Regenmantel war braun, und der Gürtel hing auf der einen Seite fast bis auf den Knöchel herab, aber er schien es nicht zu bemerken, sondern winkte und rief andauernd zu uns herüber. Direkt vor unserem Laden hatte sich eine Menschenmenge gebildet, aber nicht, um uns anzuschauen, sondern weil so viel los war, dass gerade niemand vorankam. Dann passierte etwas, die Menge löste sich auf, und ich sah vor dem Fenster, mit dem Rücken zu uns, eine kleine Frau stehen, die über die vier taxigefüllten Fahrbahnen hinweg zu dem winkenden Mann blickte. Ihr Gesicht sah ich nicht, schätzte sie aber nach Gestalt und Haltung auf siebenundsechzig. Insgeheim nannte ich sie die Kaffeetassendame, weil sie von hinten und mit ihrem dicken Wollmantel klein und breit und rundschultrig aussah wie die Porzellantassen, die umgedreht in den Roten Regalen standen. Obwohl der Mann immerfort winkte und rief und sie ihn sicherlich gesehen haben musste, winkte und rief sie nicht zurück, sondern stand vollkommen reglos, selbst als ein Läuferpaar sich ihr auf dem nassen Gehsteig mit spritzenden Tritten näherte, sich vor ihr teilte und hinter ihr wieder vereinte.
Schließlich setzte sie sich aber in Bewegung. Sie ging auf den Fußgängerübergang zu – wie der Mann es ihr bedeutet hatte –, erst langsam, dann hastig. An der Ampel musste sie wieder stehen bleiben und warten wie alle anderen, und der Mann ließ sein Winken sein, beobachtete sie aber so bang, dass ich erst wieder dachte, er könnte vor die Taxis laufen. Doch er beruhigte sich und ging bis zu seinem Ende des Fußgängerübergangs, um sie dort zu erwarten. Und als die Taxis hielten und die Kaffeetassendame im Pulk mit den anderen die Straße überquerte, sah ich den Mann eine Faust ans Auge heben, wie ich es bei Kindern im Laden gesehen hatte, die sich aufregten. Dann war die Kaffeetassendame auf der anderen Seite, und die beiden, sie und der Mann, umarmten einander so fest, dass es aussah, als wären sie eine einzige, dicke Person. Noch immer konnte ich das Gesicht der Kaffeetassendame nicht sehen, der Mann aber hatte seine Augen fest geschlossen, und ich war mir nicht sicher, ob er sehr glücklich war oder sich sehr aufregte.
»Diese zwei scheinen sich sehr über ihre Begegnung zu freuen«, sagte Managerin, und mir wurde klar, dass sie die beiden so aufmerksam beobachtet hatte wie ich.
»Ja, sie wirken glücklich«, sagte ich. »Aber es ist seltsam, denn sie sehen auch so aus, als wären sie aufgeregt.«
»Oh, Klara«, sagte Managerin leise. »Dir entgeht wirklich nichts, oder?«
Dann schwieg sie lange, hielt das Schild in einer Hand und starrte zur anderen Straßenseite, auch als das Paar längst nicht mehr zu sehen war. Schließlich sagte sie: »Vielleicht haben sie sich seit einer Ewigkeit nicht gesehen. Unendlich lang. Vielleicht waren sie noch sehr jung, als sie sich zum letzten Mal so umarmt haben wie jetzt.«
»Meinen Sie, Managerin, dass sie einander verloren haben?«
Wieder schwieg sie eine Weile. Dann sagte sie: »Ja. Es wird wohl so sein. Sie haben einander verloren. Und vielleicht haben sie sich genau jetzt, rein zufällig, wiedergefunden.«
Ihre Stimme war anders als sonst, und obwohl sie den Blick auf die Straße gerichtet hielt, dachte ich, dass sie eigentlich gar nichts wahrnahm. Ich fing schon an, mich zu fragen, was die Vorbeigehenden denken würden, wenn sie Managerin persönlich so lange im Fenster stehen sahen.
Dann wandte sie sich wieder ab, und als sie an uns vorbeiging, berührte sie mich an der Schulter.
»Manchmal«, sagte sie, »in besonderen Momenten wie diesem, empfinden Menschen neben Glück und Freude auch einen Schmerz. Ich freue mich, dass du so aufmerksam beobachtest, Klara.«
Dann war sie fort, und Rosa sagte: »Komisch. Was sie wohl gemeint hat?«
»Mach dir keine Gedanken, Rosa«, sagte ich. »Sie hat nur über die Außenwelt geredet.«
Rosa fing mit einem anderen Thema an, aber ich dachte weiter über Kaffeetassendame und Regenmantelherrn nach, und über das, was Managerin gesagt hatte. Und ich versuchte, mir vorzustellen, was ich empfände, wenn Rosa und ich irgendwann in der Zukunft, wenn wir längst unser jeweiliges Zuhause gefunden hätten, uns zufällig auf der Straße träfen. Würde ich dann, wie Managerin gesagt hatte, nicht nur Glück, sondern auch Schmerz empfinden?
Eines Morgens zu Beginn unserer zweiten Woche im Fenster unterhielt ich mich mit Rosa über irgendetwas, das auf der Straßenseite gegenüber zu sehen war, und brach ab, als ich merkte, dass Josie vor uns auf dem Gehsteig stand. Ihre Mutter war bei ihr. Diesmal war kein Taxi hinter ihnen, aber es konnte natürlich sein, dass sie aus einem ausgestiegen waren und es weitergeschickt hatten, ohne dass es mir aufgefallen war, weil sich zwischen unserem Fenster und der Stelle, an der sie jetzt standen, eine Touristengruppe versammelt hatte. Aber jetzt setzten sich die Vorbeigehenden langsam wieder in Bewegung, und Josie strahlte mich glücklich an. Wenn sie lächelte – der Gedanke kam mir erneut –, schien ihr Gesicht vor Freundlichkeit überzufließen. Sie konnte nicht zum Fenster kommen, weil ihre Mutter sich zu ihr hinuntergebeugt und eine Hand auf ihre Schulter gelegt hatte, während sie mit ihr redete. Die Mutter trug einen Mantel – einen dünnen, dunklen, ranghohen –, der im Wind ihren Körper umflatterte, sodass sie mich kurz an die dunklen Vögel erinnerte, die auch bei starkem Wind gern auf den Verkehrsampeln saßen. Doch Josie und die Mutter blickten mich während ihres ganzen Gesprächs unverwandt an, und ich sah, dass Josie unbedingt zu mir wollte, die Mutter sie aber nicht ließ, sondern weiterredete. Ich wusste, dass ich jetzt wie Rosa das RPO-Gebäude betrachten sollte, und doch musste ich immer wieder einen verstohlenen Blick auf die beiden werfen, weil ich so besorgt war, sie könnten in der Menge verschwinden.
Schließlich aber richtete die Mutter sich auf, und obwohl sie mich weiter anstarrte und sogar ihre Kopfhaltung veränderte, wenn Vorbeigehende ihr kurz die Sicht auf mich nahmen, ließ sie die Hand von Josies Schulter gleiten, und Josie kam mit ihrem behutsamen Gang auf mich zu. Ich hielt es für ein gutes Zeichen, dass Josie allein zu mir kommen durfte, doch beim Blick der Mutter, der nie weich wurde oder auswich, und überhaupt ihrer Haltung – die Arme vor der Brust verschränkt, die Finger in den Mantelstoff gekrallt –, wurde mir klar, dass ich noch sehr viele Signale zu deuten lernen musste. Doch dann stand Josie vor mir auf der anderen Seite der Glasscheibe.
»Hey! Wie ist es dir ergangen?«
Ich lächelte, nickte und hielt einen gestreckten Daumen hoch – die Geste hatte ich oft in den Interessanten Zeitschriften gesehen.
»Tut mir leid, dass ich nicht früher kommen konnte«, sagte sie. »Es ist wahrscheinlich schon … wie lang her?«
Ich hielt drei Finger hoch und fügte einen halben Finger der anderen Hand hinzu.
»Zu lang«, sagte sie. »Entschuldige. Hast du mich vermisst?«
Ich nickte und setzte ein trauriges Gesicht auf, bemühte mich aber klarzumachen, dass ich es nicht ernst meinte und mich nicht aufgeregt hatte.
»Ich hab dich auch vermisst. Ich wollte wirklich schon früher wiederkommen. Du hast vielleicht gedacht, ich hab mich verdrückt. Tut mir echt leid.« Ihr Lächeln ließ ein bisschen nach, als sie hinzufügte: »Wahrscheinlich waren in der Zwischenzeit schon viele Kinder hier, um dich zu sehen?«
Ich schüttelte den Kopf, aber Josie war nicht überzeugt. Sie drehte sich zu ihrer Mutter um, nicht weil sie Unterstützung suchte, sondern um sich zu vergewissern, dass sie sich nicht genähert hatte. Mit gesenkter Stimme sagte sie dann: »Sieht komisch aus, ich weiß schon, wie Mom dasteht und aufpasst. Ich hab ihr nämlich gesagt, dass ich genau dich haben will und keine andere, und jetzt checkt sie dich ab. Sorry.« Wie schon beim letzten Mal meinte ich wieder einen Anflug von Traurigkeit zu erkennen. »Du kommst doch zu uns, oder? Wenn Mom sagt, es ist okay und alles?«
Ich nickte aufmunternd. Doch ihr Gesicht zeigte noch immer Unsicherheit.
»Weil, ich möchte nicht, dass es gegen deinen Willen passiert. Das wäre nicht fair. Ich wünsch mir wirklich, dass du kommst, aber wenn du sagst, Josie, ich will nicht, dann sage ich zu Mom, okay, es geht nicht, sie will nicht. Aber du willst doch, oder?«
Wieder nickte ich, und diesmal schien Josie überzeugt.
»Das ist so schön.« Das Lächeln kehrte in ihr Gesicht zurück. »Es wird dir gefallen, dafür sorge ich.« Sie drehte sich wieder um, diesmal triumphierend, und rief: »Mom? Siehst du, sie sagt, sie will mit!«
Die Mutter nickte kurz, reagierte aber nicht weiter. Sie starrte mich nur an wie zuvor, und ihre Finger gruben sich tiefer in den Mantelstoff. Als Josie sich zu mir drehte, hatte sich ihre Miene wieder verdüstert.
»Hör zu«, sagte sie, verstummte aber gleich wieder. Sekunden später sagte sie: »Es ist toll, dass du zu uns kommen willst. Aber zwischen uns soll von Anfang an alles klar sein, und deswegen muss ich dir was sagen. Keine Sorge, Mom kann es nicht hören. Also. Ich glaube, dass dir unser Haus gefallen wird. Ich glaube, dass dir mein Zimmer gefallen wird, weil du dort sein wirst, nicht in irgendeinem Schrank oder so was. Und wir machen lauter schöne Sachen zusammen, während ich erwachsen werde. Es ist nur so, dass manchmal, also …« Wieder warf sie einen raschen Blick über die Schulter und sagte, noch leiser: »Vielleicht liegt es daran, dass es mir an manchen Tagen nicht so gut geht. Ich weiß nicht. Aber vielleicht geht irgendwas vor. Keine Ahnung, was. Ich weiß nicht mal, ob es was Schlimmes ist. Aber manchmal ist es irgendwie, ich weiß nicht, komisch. Versteh mich nicht falsch, wahrscheinlich merkst du meistens gar nichts. Aber ich will ehrlich mit dir sein. Weil, du weißt ja, wie blöd es ist, wenn einem die Leute erzählen, wie toll alles wird, und dann stimmt es nicht. Deswegen sag ich’s dir lieber gleich. Bitte sag, dass du trotzdem mitkommst. Mein Zimmer gefällt dir garantiert, da bin ich sicher. Und du siehst, wo die Sonne untergeht, das hab ich dir ja schon gesagt. Du kommst doch mit, oder?«
Ich nickte ihr durch die Scheibe zu, so ernst, wie ich es fertigbrachte. Ich hätte ihr auch gern gesagt, dass ich für sie da sein würde, wenn bei ihr zu Hause irgendetwas problematisch würde, oder beängstigend; dass wir es gemeinsam durchstehen würden. Aber weil ich nicht wusste, wie ich eine derart komplexe Aussage ohne Worte durch eine Glasscheibe übermitteln sollte, legte ich beide Hände aneinander, hielt sie hoch und schüttelte sie ein bisschen – eine Geste, die ich bei einem Taxifahrer beobachtet hatte; er hatte damit auf das Winken einer Person auf dem Gehsteig reagiert, obwohl er dafür beide Hände vom Steuer nehmen musste. Wie auch immer Josie die Geste verstand, sie schien sich zu freuen.
»Danke«, sagte sie. »Versteh mich nicht falsch. Vielleicht ist es nichts Schlimmes. Vielleicht bilde ich mir alles ja nur ein …«
Dann rief ihre Mutter etwas und kam auf uns zu, aber wieder standen ihr Touristen im Weg, und Josie konnte noch rasch sagen: »Ich komm ganz bald wieder. Versprochen. Morgen, wenn’s geht. Mach’s gut bis dahin.«
Josie kam nicht am nächsten Tag, auch nicht am übernächsten. In der Mitte unserer zweiten Woche war unsere Zeit im Fenster vorbei.
Diese ganzen eineinhalb Wochen hindurch war Managerin herzlich und ermutigend gewesen. Jeden Morgen, wenn wir uns auf dem Gestreiften Sofa niedergelassen hatten und auf das Hochziehen des Rollladens warteten, hatte sie eine Bemerkung gemacht wie: »Gestern wart ihr ganz großartig. Schaut doch, ob ihr das heute genauso gut hinkriegt.« Und am Ende jedes Tages hatte sie gelächelt und gesagt: »Gut gemacht, ihr zwei. Ich bin richtig stolz auf euch.« Deshalb wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass wir etwas falsch machten, und rechnete auch am letzten Tag, als der Rollladen herabgelassen wurde, mit einem Lob von Managerin. Ich war überrascht, dass sie, nachdem sie den Rollladen verriegelt hatte, nicht auf uns wartete, sondern einfach davonging. Rosa warf mir einen verdutzten Blick zu, und wir blieben erst einmal auf dem Gestreiften Sofa sitzen. Aber wegen des herabgelassenen Ladens war es sehr finster in unserer Nische, sodass wir nach einer Weile aufstanden und vom Podest stiegen.
Wir standen jetzt so, dass wir das ganze Geschäft im Blick hatten, ich konnte bis zu dem Glastisch am hinteren Ende sehen, aber der Raum hatte sich in zehn Kästchen segmentiert, sodass sich mir kein vollständiges, einheitliches Bild mehr bot. Die vordere Nische befand sich, wie nicht anders zu erwarten, in dem Kästchen, das am weitesten rechts von mir war; der uns am nächsten stehende Zeitschriftentisch aber verteilte sich auf mehrere Kästchen, sodass ein Ausschnitt des Tisches noch im Kästchen ganz links zu sehen war. Die Beleuchtung war bereits heruntergefahren, und ich erkannte im Hintergrund mehrerer Kästchen entlang der Wände in der Ladenmitte die anderen KFs, die gerade dabei waren, schlafen zu gehen. Es waren aber die drei zentralen Kästchen, die meine Aufmerksamkeit auf sich zogen, weil sie in diesem Moment drei unterschiedliche Ansichten von Managerin zeigten, die sich gerade zu uns umdrehte. In einem Kästchen war sie nur von der Taille bis zum oberen Teil ihres Halses sichtbar, während das Kästchen unmittelbar daneben fast ganz mit ihren Augen ausgefüllt war. Das Auge, das uns am nächsten war, war viel größer als das andere, aber beide waren voller Freundlichkeit und Traurigkeit zugleich. Und dann gab es eben noch ein drittes Kästchen, das einen Teil ihres Unterkiefers und fast den ganzen Mund enthielt, und dort erkannte ich Ärger und Frustration. Gleich darauf aber hatte sie sich vollständig umgedreht und kam auf uns zu, und der Laden wurde wieder zu einem einheitlichen Bild.
»Danke euch beiden«, sagte sie, streckte die Hand aus und berührte uns nacheinander sanft. »Vielen herzlichen Dank.«
Dennoch spürte ich, dass sich etwas verändert hatte – irgendwie hatten wir sie enttäuscht.
Tags darauf begann für uns die zweite Phase in der Ladenmitte. Rosa und ich waren zwar immer noch viel zusammen, doch postierte uns Managerin jetzt immer wieder neu; so stand ich mal einen ganzen Tag neben dem KF Rex und einen anderen Tag neben der KF Kiku. Meistens konnte ich immerhin noch einen Ausschnitt des Fensters sehen und nach wie vor einiges über die Außenwelt lernen. Zum Beispiel als die Cootings-Maschine auftauchte, da stand ich neben dem Zeitschriftentisch, direkt vor der mittleren Nische, und hatte eine fast ebenso gute Sicht wie zuvor im Fenster.
Schon seit Tagen war klar, dass die Cootings-Maschine etwas Außergewöhnliches war. Erst kamen die Instandsetzer, um die Baustelle vorzubereiten und einen besonderen Straßenabschnitt mit hölzernen Schranken abzuriegeln. Den Taxifahrern passte das ganz und gar nicht, und sie machten viel Lärm mit ihren Hupen. Als Nächstes bohrten die Instandsetzer den Boden auf und zerhackten ihn, sogar Teile des Gehsteigs, was die beiden KFs im Fenster in Schrecken versetzte. Einmal, als der Krach wirklich entsetzlich wurde, legte sich Rosa beide Hände an die Ohren und ließ sie dort, obwohl Kundschaft im Laden war. Managerin entschuldigte sich bei jedem eintretenden Kunden, obwohl der Lärm ja nicht unsere Schuld war. Einmal begann ein Kunde, von Umweltbelastung zu sprechen, und sagte mit Blick auf die Instandsetzer draußen, wie gefährlich sie für alle sei. Deswegen dachte ich, als die Cootings-Maschine kam, zuerst, das sei eine Maßnahme gegen die Umweltbelastung, doch KF Rex sagte, nein, im Gegenteil, sie sei eigens dafür gebaut, noch mehr davon zu erzeugen. Ich glaubte ihm nicht, und er sagte: »In Ordnung, Klara, warte nur ab, du wirst es sehen.«
Natürlich hatte er recht. Die Cootings-Maschine – ich nannte sie so, weil an ihrer Seite in Großbuchstaben »Cootings« stand – begann mit einem hohen Heulen, nicht annähernd so schlimm, wie das Bohren gewesen war, und nicht schlimmer als der Staubsauger von Managerin. Aber aus ihrem Dach ragten drei kurze Schornsteine, aus denen Rauch kam. Erst kleine weiße Schwaden, die bald dunkler wurden, bis zuletzt keine Einzelwölkchen mehr kamen, sondern ein dicker, anhaltender Wolkenstrom.