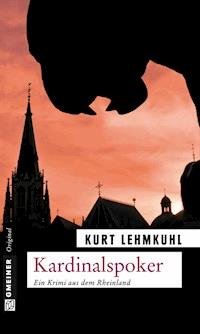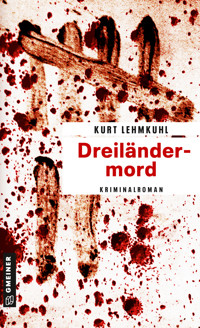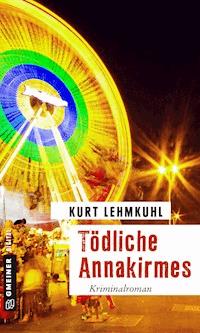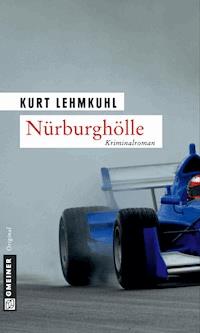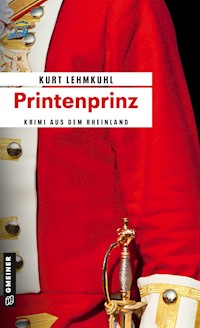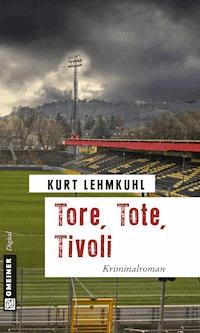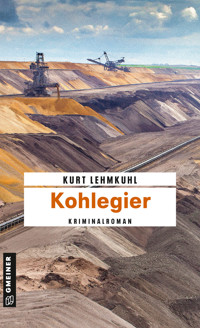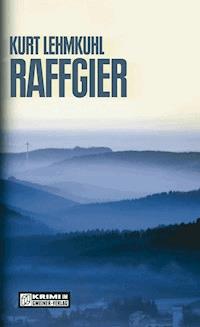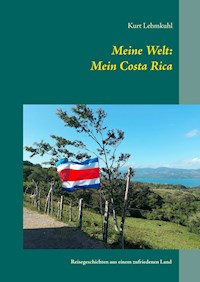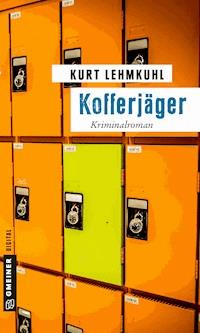
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Nach einer Brandkatastrophe auf dem Düsseldorfer Flughafen verliert der Feuerwehrmann Robert Schumann den Halt und wird zum Sozialfall. Der Fund eines Geldkoffers soll für ihn zum Wendepunkt werden. Doch er irrt sich. Unbekannte wollen ihm das Geld abspenstig machen und scheuen auch nicht vor Morden zurück, die sie ihm in die Schuhe schieben. Bei seiner Flucht und seinem Kampf ums Überleben kann Schumann auf die Unterstützung seiner resoluten Freundin Ruth Weberknecht zählen. Sie wird zum Rachengel an seiner Seite.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurt Lehmkuhl
Kofferjäger
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-digital.de
Gmeiner Digital
Ein Imprint der Gmeiner-Verlag GmbH
© 2016 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlagbild: © © laterjay – pixabay.com
Umschlaggestaltung: Simone Hölsch
ISBN 978-3-7349-9446-3
Robert Schumann
Immer, wenn es ihm schlecht ging, machte Robert Schumann sich auf zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Dort, in dem gigantischen, unübersichtlichen Gebäude, wo die Welten der Penner und Urlaubsreisenden, der Drogensüchtigen und Geschäftsleute im hektisch pulsierenden Leben aufeinanderprallaten, dort wurde ihm stets nachhaltig bewusst, dass es vielen Menschen noch viel schlechter ging als ihm. Dann bekam er Mitleid mit den alkoholtrunkenen Berbern und den still in einer Ecke zusammengekauerten Junkies, dann fühlte er sich trotz des eigenen Missgeschicks doch ganz wohl in seiner Haut.
Es gab viele Flecken im glitzernden Hauptbahnhof, wo, zumeist unbeachtet von den herumeilenden Bahnreisenden, die Gestrandeten und Verlorenen ein vorübergehendes Dasein fristeten, ehe sie in jeder Nacht von der unerbittlichen Bahnhofsaufsicht auf die Plätze der Großstadt hinausgedrängt wurden.
Robert Schumann kannte alle diese versteckten Orte in dem unübersehbaren Gewirr von Sälen, Gängen, Schächten und Tunnels, und er kam inzwischen sehr oft hierhin. Der Anblick der gesellschaftlichen Außenseiter machte ihm immer wieder aufs Neue die eigene Situation bewusst. Was will ich eigentlich mehr?, redete er sich ein. Ich bin gesund, habe ein Dach über dem Kopf und werde leidlich satt. Und dennoch sah er in seiner Lebensgeschichte durchaus auch Parallelen zu den Abgeschobenen der bürgerlichen Gesellschaft.
Eine Familie hatte Robert Schumann nicht, seinen Job hatte er aufgegeben, das Arbeitslosengeld war längst zur Arbeitslosenhilfe verkümmert. Mit seinen fast 50 Jahren stand Schumann beschäftigungslos auf der Straße, konnte nicht mehr zurück in seinen Beruf, wollte auch nicht mehr zurück in seinen Beruf.
Unscheinbar, unbehelligt und unbeachtet stromerte er seit seinem freiwilligen Einstieg in die Isolation als Einzelgänger durch seine Geburtsstadt, durch die Stadt, die er liebte, die er nie verlassen hatte und in der er sein Leben lang ein Nichts sein würde.
Die verfluchte Katastrophe draußen in Lohausen, die hatte ihn aus seiner harmonischen, überschaubaren Lebensbahn geschleudert. Den 11. April 1996, vor mehr als fünf Jahren, würde Robert Schumann, damals seit rund 20 Jahren Mitglied der Flughafenfeuerwehr, nie vergessen.
Schumann war an diesem Tag in seinem Dienst turnusgemäß als Aufsicht eingesetzt gewesen, damals, als bei Schweißarbeiten flüssiges Bitumen einen Schwelbrand verursachte, der schließlich zum Großbrand wurde, bei dem sechzehn Menschen ihr Leben lassen mussten. Schumann hatte zeitgleich an mehreren Stellen Schweißarbeiten zu kontrollieren, diejenigen auf der Fahrbahn über der Halle, die die Katastrophe verursachten, aber auch andere, die gleichzeitig auf dem Rollfeld durchgeführt wurden. Er war gerade auf dem Weg zurück zum Gebäude, als das verhängnisvolle Geschehen seinen tödlichen Verlauf nahm.
Schumann würde nie den ohrenbetäubenden Lärm vergessen, den die Staubexplosionen auf den Zwischendecken auslösten. Er würde nie die Giftgaswolke aus Blau- und Salzsäure vergessen, die sich so schnell zu Boden senkte und Passagieren und Flughafenpersonal die Atemluft und das Licht raubte.
Schumann hatte sich ohne Zögern in das rabenschwarze Chaos der Flughafenhalle gestürzt. Mit einer Stablampe und einer Sauerstoffmaske ausgerüstet, war der schmächtige, aber austrainierte Mann über die herabgestürzten Deckenelemente auf dem Boden gekrabbelt und hatte einen Menschen zu packen bekommen, der zusammengekrümmt vor einem verschlossenen Ausgang lag.
Die junge Frau lebte und starrte mit weit aufgerissenen Augen voller Panik in die Lampe. Schumann hatte ihr hastig die Sauerstoffmaske umgeschnallt, hatte sie gepackt und nach draußen gezerrt. Er konnte sich später nicht mehr daran erinnern, wie er es geschafft hatte, er wusste nur, dass er mit der Frau ins Freie gekommen war. Ermattet hatte er sich auf die Straße gehockt und die Sanitäter beobachtet, die sich um die Frau kümmerten.
»Du hast ihr das Leben gerettet«, sagte einer von ihnen anerkennend zu Schumann, der die Augen schloss und weinte.
Als er die Augen nach einer Viertelstunde wieder öffnete, sah er, wie die Frau in einen Leichensack gelegt wurde. Schumann stand auf und ging. Nie wieder war er seitdem auf dem Rhein-Ruhr-Flughafen gesehen worden.
Er fühlte sich schuldig.
In seiner kleinen Junggesellenwohnung schrieb er noch am Abend die Kündigung.
Schumann kam finanziell mehr schlecht als recht über die Runden. Er hatte es gelernt, bescheiden zu sein. Ansprüche hatte er nie gestellt, er erwartete nicht viel vom Leben, aber er würde, da war er sich sicher, garantiert nicht so enden wie sein berühmter Namensvetter aus Düsseldorf, der nach einem Sprung in den Rhein in eine Irrenanstalt eingeliefert und dort aus dem Leben gedämmert war.
Die große Hinweistafel in der Bahnhofshalle erinnerte zwangsläufig an einen Flughafen. Fast im Minutentakt ratterten hier die Buchstaben und Ziffern zu immer neuen Kombinationen. Schumann tat diese Attraktion des modernisierten, weitläufigen Bahnhofs als überflüssigen Humbug ab, damit konnte man allenfalls den Dörflern imponieren, die zum ersten Mal in ihrem Leben in die Landeshauptstadt kamen. Er registrierte die Namen der Zielbahnhöfe, sie konnten in ihm aber ebenso wenig das Fernweh wecken wie die Flughäfen, die in Lohausen auf den Abflugtafeln genannt wurden.
Schuhmann konnte sich nur schwach daran erinnern, je einmal Düsseldorf verlassen zu haben. Das muss vor mehr als dreißig Jahren, fast sogar schon vierzig Jahren, gewesen sein, als seine Eltern mit ihm an einem Wochenende in die Eifel, nach Monschau und zum Rursee, gefahren waren.
Als bodenständig bezeichnete Schumann seine fehlende Bereitschaft, aus Düsseldorf wegzufahren.
Ruth Weberknecht hingegen, schon seit mehr als einem Jahrzehnt seine Nachbarin und einzige Gesprächspartnerin, betrachtete seine Weigerung, sie bei gelegentlichen Ausflügen oder jährlichen kurzen Urlaubsfahrten zu begleiten, als kleinkariertes Spießertum.
Wenn, dann fuhr sie in die deutschen Mittelgebirge, zu mehr reichte es auch bei ihr nicht. Aber sie hatte immerhin noch mehr Tatendrang als er.
Schumann widersprach seiner Nachbarin nicht. Schumann widersprach fast nie. Er lebte schweigsam sein bescheidenes Leben, akzeptierte, wie andere ihr Leben lebten, und erwartete lediglich, andere sollten akzeptierten, wie er sein Leben lebte.
Mehr wollte er nicht, und er fand, dass er viel hatte im Leben, viel mehr als die armen Schlucker, die da im Hauptbahnhof umhergammelten.
Schumann ließ sich langsam von der Rolltreppe zum Bahnsteig hinauffahren und näherte sich gemächlich einer Bank. Einer der beiden Männer, die dort saßen, sah ihn kommen, stand auf und hinkte, riesengroß und, trotz des milden Septemberwetters, in einen dunkelgrünen Lodenmantel gekleidet, erstaunlich schnell in die bereitstehende S-Bahn Richtung Dortmund, die fast im gleichen Moment abfuhr, in dem er hineingesprungen war.
Der Unbekannte hatte zu Schumanns Freude die Zeitung liegen gelassen. Es gab immer irgendjemand, der auf dem Bahnsteig, in einem der Restaurants oder in den Zügen eine Zeitung liegen ließ. Aus dieser Erfahrung heraus verzichtete Schumann längst schon darauf, selbst eine Zeitung zu kaufen. Er fand fast jeden Tag mindestens ein aktuelles Blatt, wenn nicht im Bahnhof, dann in einem der Papierkörbe auf den Straßen oder in den Parks.
Mit einem leise gemurmelten Gruß setzte sich Schumann neben den dicken Mann, der ihn aber nicht weiter beachtete. Er schläft, dachte sich Schumann und rückte vorsichtig ein wenig zur Seite, als könne das Rascheln der Blätter den anderen wecken.
Schnell war Schumann im Express versunken. Er redete sich ein, dass ihn die attraktiven, fast nicht bekleideten Mädchen überhaupt nicht beeindruckten. Den Sportteil, der fast wie immer nur tatsächliche oder vermeintliche Skandale und Skandälchen bei der Fortuna oder der DEG behandelte, überflog Schumann desinteressiert. In Düsseldorf war nichts los, so lautete sein Fazit, nachdem er die Tratschseiten gelesen hatte. Die Politiker waren gerade erst aus der Sommerpause zurückgekehrt, im Landtag wie im Rathaus heckten sie und ihre Berater wohl noch die neuen Intrigen aus, mit denen sie dem politischen Gegner Schaden zufügen konnten.
Der Dicke neben ihm auf der Bank bewegte sich. Schumann spürte, wie er immer mehr auf seine Seite kippte und ihn fast vom Sitz schob. Schumann sprang auf, der Mann fiel längs auf die Bank und rollte ungelenk zu Boden.
Der ist tot! Schumann erschrak für einen Moment, doch er hatte sich schnell wieder unter Kontrolle. »Einmal ist jeder dran«, sagte er sich leise. Er rüttelte an dem Körper, schlug dem Mann leicht ins Gesicht, doch der Dicke reagierte nicht. Der ist tatsächlich tot!, sah sich Schumann bestätigt.
Er blickte sich auf dem Bahnsteig um. Offensichtlich war er mit dem Toten allein, neugierig musterte er daraufhin den leblosen Menschen, der der Länge nach ausgestreckt vor ihm lag. Auf fast sechzig Jahre schätzte Schumann den Mann, der unauffällig, aber sauber gekleidet war und einen ordentlichen Eindruck machte. Die buschigen, grauen Augenbrauen, die fast ununterbrochen ineinander übergingen, fielen ihm auf. Ansonsten war der Tote ein ganz normaler Mensch wie ich, dachte Schumann, während sein Blick auf die linke, zusammengeballte Hand des Dicken fiel. Noch einmal schaute sich Schumann um, dann bückte er sich und öffnete die warmen Finger.
Einen Schlüssel hatte der Mann festgehalten, den Schlüssel eines Schließfachs im Bahnhof.
Ehe sich Schumann versah und ehe er sich über seine ungewohnte Unverfrorenheit Gedanken machen konnte, hatte er den Schlüssel in seine Hosentasche gesteckt. Er warf noch einen letzten Blick auf den Toten, schlenderte mit aufgesetzter Gelassenheit zur Rolltreppe und ließ sich in die Unterführung fahren.
Schumann wunderte sich über die innere Ruhe, als er nach längerem Suchen einen Bahnbediensteten gefunden, ihm den Todesfall gemeldet und den zweifelnden Mann zur Bank auf dem Bahnsteig begleitet hatte.
Schumann erschrak heftiger als eben noch. Der Bahnsteig war menschenleer. Der Dicke lag nicht mehr auf dem Boden. Verunsichert drehte sich Schumann bei seiner Suche um die eigene Achse, aber es änderte sich nichts daran: Der Mann war verschwunden.
»Schöner Toter«, spöttelte der Bundesbahner, der sich in seiner Auffassung bestätigt sah, den mittelgroßen, hageren Biedermann nicht ernst nehmen zu müssen.
Es gebe doch bestimmt eine Kameraüberwachung, da müsse man den Toten gesehen haben, regte Schumann an. Auf den Filmen müsste er zu sehen sein.
Der Bundesbahner schüttelte unmissverständlich den Kopf. Kameras soll es zwar bald an allen Bahnsteigen wie an der Schließfachanlage geben. Das Programm zur Sicherheit sei beschlossen, jedoch noch nichts umgesetzt worden. Aber selbst, wenn die Kameras installiert würden, habe die Bahn garantiert nicht das Personal, alle Monitore, über die die Aufnahmen liefen, gleichzeitig zu besetzen. Auch zukünftig würden an den Gleisen gewiss keine Filme gemacht. Das wäre viel zu aufwändig.
Er wollte der Beteuerung von Schumann nicht glauben und empfahl ihm beschwichtigend, den Rausch auszuschlafen. Einen Sonnenstich könne er ja wohl nicht haben, meinte der Bedienstete ironisch mit einem Blick zum wolkenverhangenen Himmel und ließ Schumann grußlos stehen.
Schumann schwieg, verstand nicht, was geschehen war. Ich habe doch nicht geträumt, sagte er sich und griff in die Hosentasche, um sich zu vergewissern, und atmete fast schon erleichtert auf, als seine Hand den kleinen, kalten Schlüssel umfasste.
Wo war nur der Tote? Langsam schlich Schumann um die Bank herum, auf der er eben noch mit dem anderen gesessen hatte. Er lief den Bahnsteig auf beiden Seiten ab, suchte nach einem Hinweis, einer Spur, ohne zu wissen, was er finden könnte. Der war tot, redete sich Schumann ein. Aber wo war er geblieben?
Ich weiß es nicht, antwortete sich Schumann schließlich, es hat keinen Zweck, sich deswegen den Kopf zu zerbrechen. Ich weiß es nicht und werde es vielleicht nie erfahren. Aber was soll’s? Der ist tot und ich lebe, besser als umgekehrt. Er schaute noch einmal zur leeren Bank und verließ erneut den Bahnsteig.
Für einen Augenblick war Schumann unschlüssig, dann wandte er sich doch der Schließfachanlage zu und suchte das Fach mit der auf dem Schlüssel angegebenen Nummer 237. Er fühlte sich beobachtet von den vielen Menschen, die um ihn herumschwirrten. Er glaubte, sämtliche Blicke magisch auf sich zu ziehen, als sei er ein Punkt, auf den sich alle anderen konzentrierten. Sein Herz klopfte heftig, als er das Fach mit zittrigen Fingern öffnete und schnell eine einfache Aktentasche aus dunkelbraunem Kunstleder herauszog. Sie erinnerte ihn an seine eigene Tasche, in der er gelegentlich Brote oder Unterlagen mit zur Arbeit genommen hatte.
Schumann hütete sich davor, seiner Neugierde zu folgen und die Tasche auf der Stelle zu öffnen. Das mache ich zu Hause, gab er sich vor, als er über den Haupteingang den Bahnhof zum Konrad-Adenauer-Platz verließ und zur Bushaltestelle ging.
Er spürte, wie die Beklemmung verschwand, fühlte sich wieder besser und wieder unbeobachtet. Er war wieder der Normalbürger, brav und bieder, arbeitslos und einfach; ein Mann, wie so viele in Düsseldorf. Die Tasche fest unter dem Arm geklemmt, wartete Schumann auf den Bus, der ihn in die Nähe seiner Wohnung im Norden der Stadt bringen sollte.
Schumann wunderte sich über seine Ruhe, als er die Wohnungstür aufschloss und sein kleines, privates Reich in dem alten, unauffälligen Mietblock betrat. Der Lack war längst ab von den einfachen Möbeln, für neue fehlte ihm einfach das Geld. Die geringe finanzielle Unterstützung aus dem Arbeitsamt reichte gerade einmal für die Miete.
Aber es war sauber in den Räumen, und das reichte ihm, zumal auch Ruth als einzige Besucherin eher über die alten Möbel als über Staub und Unordnung hinwegsehen konnte.
Behutsam legte Schumann die fremde Aktentasche auf den kleinen Küchentisch und setzte sich auf den hölzernen Stuhl. Für einen Moment hatte er überlegt, ob er nicht seine Nachbarin hinzurufen sollte, doch belehrte ihn der Blick auf die Küchenuhr. Ruth würde noch nicht von der Arbeit in der Produktion bei Henkel zurückgekehrt sein.
Na, dann nicht, seufzte Schumann und klappte die Aktentasche auf. Sie enthielt eine weiße, augenscheinlich gefüllte Plastiktüte mit einem gelb-blau-roten Lidl-Aufdruck. Interessiert blickte Schumann hinein, und zum wiederholten Male erschrak er heftig am heutigen Tage. Er rieb sich mit beiden Händen die Augen, denen er nicht trauen wollte.
Das konnte doch nicht sein!, sagte er sich. Aber es war so: In der Tüte befanden sich Geldscheine, Hunderter, die ungeordnet hineingestopft worden waren. Schumann nahm die Aktentasche vom Tisch, kippte mit vor Aufregung hochrotem Kopf das Papiergeld auf die leere Platte und begann zu sortieren.
Schließlich hatte er glatte 50.000 Euro gezählt, und er wunderte sich, dass für diesen Betrag nur ein relativ kleiner Berg von Scheinen erforderlich war. Er hatte eine größere Menge im Sinn, wenn er sich 100.000 Mark vorgestellt hatte. Er rechnete immer noch die neue Währung in die alte um.
Für Schumann stand fest, er würde das Geld spätestens am nächsten Tag abgeben, entweder bei der Polizei, im Fundbüro oder im Bahnhof.
Wieder blickte er zur Uhr. Fast eine Stunde lang hatte er gezählt, jetzt war Ruth bestimmt zu Hause. Sollte er ihr sein Erlebnis berichten, ihr das Geld zeigen?
Er hätte es gerne getan, alleine schon aus dem Gefühl heraus, einem anderen Menschen zu erklären, dass er nichts Unlauteres oder Verbotenes getan hatte. Er wollte sich rechtfertigen für sein Handeln, für die Mitnahme des Schlüssels und des Aktenkoffers.
Der Koffer, das Geld, sie gehörten ihm nicht. Sie gehörten allem Anschein nach dem Mann, von dem er irrtümlich geglaubt hatte, er sei tot. ›Ich konnte ihm den Schlüssel im Bahnhof nicht zurückgeben‹, rechtfertigte Schumann sich im leisen Selbstgespräch.
Andererseits? Würde Ruth vielleicht versuchen, ihn davon abzubringen, das Geld abzuliefern? Robert, denk ’mal! 100.000 Mark nur für dich, was könnten wir alles damit machen?, hörte er sie sagen. So würde sie resolut auf ihn einreden, er würde schweigen und er würde das tun, was sie wollte.
Nein! Er hatte sich entschieden, Ruth nichts zu sagen. Morgen, das nahm er sich vor, als er das wieder in Plastiktüte und Aktentasche gepackte Geld im Kleiderschrank verstaute, morgen gebe ich das Geld ab. Vielleicht sprang ja eine Art Finderlohn heraus. Und wenn nicht, so war das auch nicht weiter schlimm.
Wieder hatte er ein Geheimnis vor sich liegen, kam es Schumann in den Sinn. Wem gehörten die 50.000 Euro und woher stammten sie?
»Ich weiß es nicht«, sagte er laut vor sich hin, »ich weiß es nicht und werde es vielleicht auch nie erfahren.«
Erst jetzt fiel ihm ein, dass er sich diese Antwort heute schon einmal gegeben hatte.
Das Klingeln an der Tür riss ihn aus seinen Gedanken. Ruth kam, wie an fast jedem Tag, mit einem warmen Abendessen und setzte sich zu ihm an den Küchentisch. Die große, stämmige Mitvierzigerin, die fast einen Kopf größer war als er, kochte für ihn; er, der gelernte Elektriker, reparierte für sie, wenn in ihrem kleinen Haushalt etwas nicht funktionierte. Damit waren sie im stillen Einvernehmen quitt.
Unaufhörlich redete die rastlose Nachbarin auf Schumann ein, der wie immer schweigend zuhörte und kauend nickte. Was Ruth ihm sagte, bekam er gar nicht mit. Der Tote, das Geld, das alles beschäftigte ihn doch mehr, als er sich eingestehen wollte.
Er hatte das ungewisse Gefühl, dass die Geheimnisse um den vermeintlichen Toten und um den ominösen Geldfund für ihn zum Problem werden könnten.
Horst Müller
Erstaunlich gut hatte Schumann die Nacht verbracht, worüber er sich wunderte. Er konnte sich nicht daran erinnern, geträumt zu haben, was er als Zeichen wertete, tief und fest geschlafen zu haben. Ein ruhiges Gewissen ist eben das beste Ruhekissen, machte er sich das Sprichwort zu eigen.
Punkt sechs Uhr hatte ihn der Radiowecker aus dem Schlaf geholt. Schumann stand an jedem Werktag so früh auf. Daran hatte auch der freiwillige Verlust des Arbeitsplatzes nichts geändert. Er hörte sich stets mit geschlossenen Augen die fünfminütige Nachrichtensendung im Morgenmagazin an und sprang dann aus dem Bett. Tag für das Tag das gleiche Ritual: Toilette, Kaffeemaschine, Rasierapparat, Dusche, Frühstück, während auf dem Küchenschrank im alten Kofferradio Antenne Düsseldorf plärrte.
Pünktlich um halb sieben schellte es, wie an jedem Werktag seit fast zehn Jahren; ausgerechnet immer dann, wenn es die Lokalnachrichten gab. Mit der Schwarzbrotschnitte in der Hand öffnete Schumann die Wohnungstür und grüßte seine Nachbarin, die sich auf den Weg zur Arbeit machte.
»So wissen wir wenigstens, dass wir beide noch leben«, hatte Ruth einen praktischen Grund für diese allmorgendliche Übung gefunden.
Nur einmal in all den Jahren ihres Nebeneinanderlebens hatte Schumann nicht sofort geöffnet. Das war am Tag nach der Katastrophe auf dem Rhein-Ruhr-Airport gewesen. Ruth hatte ihn wach klingeln müssen und war dann bei ihm geblieben. Es war das erste und auch einzige Mal gewesen, dass sie sich zu ihm ins Bett gelegt hatte und ihn in ihren kräftigen Armen tröstete.
Sie hatten niemals mehr über diesen Morgen gesprochen, und Schumann wusste längst nicht mehr, was er Ruth alles gesagt hatte. Er hätte es gerne erfahren, aber er traute sich nicht, sie danach zu fragen.
Nach dem Wetterbericht schien es trocken zu bleiben, wie Schumann erleichtert feststellte. Dann konnte er wenigstens in die Stadt laufen. Er hatte sich entschlossen, die Aktentasche bei der Polizei abzuliefern, nicht direkt in der Wache bei ihm um die Ecke, sondern im Polizeipräsidium.
Dort würde er nicht so auffallen, bestand nicht die Gefahr, dass seine Nachbarschaft binnen weniger Tage bestens informiert war. Das Getratsche nach dem Großbrand, als er von Mitbewohnern dabei beobachtet wurde, wie er zu einem Gespräch in die Wache ging, reichte ihm. Letztlich wurde damals sogar behauptet, es habe der Verdacht bestanden, er sei der Brandstifter gewesen, der die sechzehn Menschen auf dem Gewissen habe. Erst Wochen später hatte Ruth auf die ihr eigene, energische Art das böse Gerücht endgültig aus der Welt geschafft, indem sie den Nachbarn im Haus mit Verleumdungsklagen drohte.
Ruth stand zu ihm; er würde ihr vertrauen können, wenn es erforderlich wäre, dachte sich Schumann bei seinem langen Spaziergang ins Zentrum. Aber noch war es nicht erforderlich. Er würde die leidige Angelegenheit schon ohne fremde Hilfe aus der Welt schaffen.
Langsam schlenderte Schumann über die Straßen, den Kopf stets zu Boden geneigt, den Blick geradeaus nach unten. Dennoch verstand er es stets, eiligen Fußgängern, umherwuselnden Skatern, lärmenden Boardern oder Hindernissen geschickt auszuweichen. Schumann eckte nirgendwo an. Nur an den Papierkörben oder Sitzgelegenheiten blickte er auf; ein Tag ohne eine gefundene Zeitung war ein verlorener Tag.
Es gab nichts Schöneres, als abends im Wohnzimmer Zeitungen zu lesen und im Hintergrund klassische Musik zu hören. Dann störte selbst Ruth nicht, die oft strickend und plappernd neben ihm saß. Er hörte ihr einfach nicht zu, was sie wohl gar nicht bemerkte.
Kurz vor dem Polizeipräsidium war Schumann immer noch ohne Zeitung, was ihn aber nicht allzu sehr beunruhigte. Der Tag war lang, erfahrungsgemäß ließen die meisten Leser die Zeitung gedankenlos oder sogar absichtlich irgendwo liegen, wenn sie nachmittags nach der Arbeit heimwärts strebten. Bild, Express, NRZ, Rheinische Post, Westdeutsche Zeitung, die bekam er mehr als einmal in der Woche alle zusammen mit, manchmal gelang ihm der Fund einer FAZ, WAZ, des Handelsblatts; oder sogar von Focus, Spiegel oder Stern. Und es machte überhaupt nichts, wenn diese Zeitschriften nicht aktuell waren. Damit ließen sich dennoch immer noch viele Abende auf angenehme Weise verbringen. ›Mir geht’s wirklich nicht schlecht‹, trichterte sich Schumann ein. ›Ich sollte zufrieden sein.‹
Um seine Mundwinkel zog sich ein flüchtiges Lächeln. Aus dem Papierkorb neben der Bank aus einem stabilen, dunkelgrünen Drahtgeflecht, die fast unmittelbar vor dem Polizeipräsidium stand, stakte ein Düsseldorfer Express. Schumann setzte sich und langte nach der Zeitung, die er schnell an sich zog.
Er lehnte sich zurück, legte die Beine übereinander, drückte die Aktentasche an sich und faltete die Zeitung auseinander. So würde ihn niemand erkennen, falls ihn jemand beobachtet haben sollte.
Das alibimäßige Überfliegen der Seiten endete abrupt, als Schumann auf den Lokalteil stieß. Er starrte auf ein großes Foto, das den Mann zeigte, dem er gestern den Schlüssel abgenommen hatte. Solche Augenbrauen hatte Schumann sonst noch nirgends gesehen, daran erkannte er den Dicken sofort wieder.
»Wer kennt diesen Toten?«, fragte der Express.
Atemlos überflog Schumann die wenigen Textzeilen. Aber erst beim zweiten Lesen wurde ihm der Inhalt bewusst. Der tote Mann war am späten Abend im Grafenberger Wald von liebestollen Heranwachsenden im Gebüsch gefunden worden. Ausweispapiere hatte er nicht bei sich. Da er nicht polizeibekannt war, wollte die Polizei über einen Aufruf in den Zeitungen nähere Angaben über den Unbekannten erhalten.
Also doch! Schumann wusste nicht, ob er erleichtert sein sollte oder irritiert. Gedanken schwirrten ihm durch den Kopf, verunsichert erhob er sich. Jetzt musste er allein sein, bei einem Spaziergang das Gedankenchaos ordnen.
Wie war der Mann gestorben? Wo war er gestorben? Warum stand nichts über die Todesursache? Wusste jemand von dem Schlüssel? Wem gehörte das Geld, jetzt, nachdem offensichtlich war, dass der Mann tot war? War es überhaupt sein Geld gewesen? Oder war es etwa kriminelles Geld? Fragen über Fragen türmten sich auf.
Und Schumann hatte für sich nur eine Antwort: Ich weiß es nicht.
Aber er konnte sich diesmal damit nicht abfinden. Er steckte mittendrin im Schlamassel. Wer würde ihm schon glauben, dass er das Geld abgeben wollte, dass er nichts mit dem Ableben des Dicken zu tun hatte?
Das Einfachste wäre es vielleicht, das Geld irgendwo in einem Abfalleimer verschwinden zu lassen, die Aktentasche mit Steine zu füllen und von einer Brücke in den Rhein zu werfen. Dann kann mir keiner etwas anhaben, sagte sich Schumann.
Oder? War er etwa zufälligerweise von einer Videoanlage an der Schließfachanlage beobachtet oder aufgenommen worden? Hatte ihn vielleicht doch jemand gemeinsam mit dem Dicken auf dem Bahnsteig gesehen?
Der hinkende Riese im Lodenmantel fiel ihm ein, der hatte ihn garantiert gesehen.
Was sollte er tun? Unschlüssig lief Schumann in Richtung Rhein, stolperte gedankenverloren am Platz des Landtags beinahe über einen Menschen, der ihn an einen bekannten Landespolitiker erinnerte, und war froh, als er an der Uferpromenade fast alleine unterwegs war.
Abwarten. Ich werde abwarten, entschied Schumann für sich. Das Geld kommt wieder zurück in den Schlafzimmerschrank. Er würde niemandem etwas darüber sagen und er würde es niemals anrühren. Das war immer noch besser, als von der Polizei unbequeme Fragen gestellt zu bekommen.
Die Befragung nach dem Flughafenbrand hatte ihm gereicht. Die Polizisten hatten ihm einfach nicht glauben wollen. Und jetzt? Sie würden zuerst seine Akte herauskramen, ihn wieder mir Fragen löchern und ihm wieder nicht glauben.