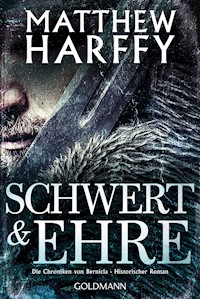9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Chroniken von Bernicia
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Große Schlachten, klirrende Schwerter, mutige Krieger – der Kampf um England hat begonnen.
Im Britannien des Jahres 634 kämpfen die angelsächsischen Könige erbittert um die Herrschaft. Nach einem überwältigenden Sieg gegen die Waliser kehrt der Krieger Beobrand als Held in seine nordenglische Heimat zurück. Für seine Tapferkeit wird er von König Oswald von Northumbria mit Reichtum und Ländereien belohnt. Erschöpft zieht er sich mit seiner Braut Sunniva auf seinen neuen Landsitz zurück. Doch schon bald ist Beobrand von Feinden umzingelt und fürchtet, alles zu verlieren, was ihm lieb und teuer ist. Im Kampf gegen seine Widersacher übernimmt er schließlich das Amt des Lords und führt seine Männer in blutige Schlachten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 740
Ähnliche
Buch
Im Britannien des Jahres 634 kämpfen die angelsächsischen Könige erbittert um die Herrschaft. Nach einem überwältigenden Sieg gegen die Waliser kehrt der Krieger Beobrand als Held in seine nordenglische Heimat zurück. Für seine Tapferkeit wird er von König Oswald von Northumbria mit Reichtum und Ländereien belohnt. Erschöpft zieht er sich mit seiner Braut Sunniva auf seinen neuen Landsitz zurück. Doch schon bald ist Beobrand von Feinden umzingelt und fürchtet, alles zu verlieren, was ihm lieb und teuer ist. Im Kampf gegen seine Widersacher übernimmt er schließlich das Amt des Lords und führt seine Männer in blutige Schlachten.
Autor
Matthew Harffy wuchs in Northumberland auf, wo ihn die zerklüftete Landschaft, die Burgruinen und die felsige Küste zu seinen historischen Romanen inspirierten. Heute lebt der Autor mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in Wiltshire, England. »Kreuz und Fluch« ist der zweite Band einer Reihe um den jungen Krieger Beobrand.
Weitere historische Romane von Matthew Harffy sind bei Goldmann in Vorbereitung.
Weitere Informationen zum Autor unter
matthewharffy.com
und unter facebook.com/MatthewHarffyAuthor.
Matthew Harffy
Kreuz und Fluch
Die Chroniken von Bernicia
Historischer Roman
Aus dem Englischen
von Leo Strohm
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »The Cross and the Curse« bei Aria, an imprint of Head of Zeus, London.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Erstveröffentlichung November 2022
Copyright © der Originalausgabe 2016 by Matthew Harffy
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Gestaltung des Umschlags und der Umschlaginnenseiten:
UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Lorado/getty images; FinePic®, München
Redaktion: Susanne Bartel
BH · Herstellung: ik
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN: 978-3-641-29596-7V001
www.goldmann-verlag.de
Für meine Eltern,
in Liebe
ORTSNAMEN
Die Ortsbezeichnungen im Britannien des frühen Mittelalters fallen je nach Zeit, Sprache, Dialekt und jeweiligem Schreiber zum Teil recht unterschiedlich aus. Ich habe mich bei der Wahl der Ortsnamen nicht an eine bestimmte Konvention gehalten, sondern in der Regel die Bezeichnung gewählt, die meines Erachtens am ehesten der im siebten Jahrhundert gebräuchlichen entspricht. Doch genau wie die Schreiber der damaligen Zeit habe auch ich mir gelegentlich eine gewisse künstlerische Freiheit genommen und mich für den Namen entschieden, der mir am besten gefällt.
Albion
Großbritannien
Bebbanburg
Bamburgh
Bernicia
Königreich im nördlichen Teil von Northumbria, das sich vom River Tyne im Süden bis zum Firth of Forth im Norden erstreckt und in etwa dem Gebiet der heutigen Grafschaften Northumberland und Durham entspricht
Cantware
Kent
Cantwareburh
Canterbury
Dál Riata
Kleinkönigreich, das Gebiete an der schottischen Westküste sowie die Grafschaft Antrim im Nordosten Irlands umfasst und Heimat der keltischen Skoten ist
Deira
Königreich im südlichen Teil von Northumbria, das sich ungefähr vom Humber im Süden bis zum River Tyne im Norden erstreckt
Dor
Dore in Yorkshire
Dun
der Fluss Don
Elmet
unabhängiges britisches Königreich, dessen Gebiet in etwa dem westlichen Verwaltungsbezirk der heutigen Grafschaft Yorkshire entspricht
Engelmynster
fiktiver Ort in Deira
Eoferwic
York
Frankia
Frankreich
Gefrin
Yeavering, ein kleiner Ort in Northumberland, etwa 15 Kilometer von Bebbanburg entfernt
Gwynedd
Gwynedd in Nordwales
Hefenfelth
Heavenfield
Hibernia
Irland
Hii
Iona
Hithe
Hythe in Kent
Lindisfarena
Lindisfarne
Mercia
Königreich im Zentrum des heutigen England in den östlichen Midlands rund um die Stadt Leicester gelegen, im Gebiet des Trent und seiner Nebenflüsse
Muile
Mull vor der Nordwestküste Schottlands
Northumbria
angelsächsisches Kleinkönigreich, das die Gebiete der heutigen Grafschaften Yorkshire und Northumberland sowie den Südosten Schottlands umfasst
Pocel’s Hall
Pocklington in Yorkshire
Scheth
der Fluss Sheaf, der die Grenze zwischen Mercia und Deira bildet
Tuidi
der Fluss Tweed
Ubbanford
Norham in Northumberland
PROLOG
ANNODOMINI 619
»Wir brauchen euren neuen Gott nicht. Er ist schwach. Wurde er nicht von Menschen getötet?« Grausam lächelnd wandte sich die schwarzhaarige Schönheit zu ihren Zuhörern um. Doch die Augen der Männer und Frauen, die sie anstarrten, waren stumpf und düster, wie tiefe, kalte Seen.
»Was ist das für ein Gott, der von Sterblichen getötet werden kann?«, stieß die Frau höhnisch hervor.
»Ich will mich nicht mit dir streiten«, erwiderte der hagere Mann mit der Habichtsnase, der vor ihr stand. »Ich verkünde dir und deinem Volk lediglich die Botschaft des einen, wahren Gottes. König Edwin hat mir das Recht dazu verliehen.« Seine Worte waren schwer zu verstehen. Sein seltsamer Akzent veränderte die einzelnen Laute, dennoch war die Bedeutung seiner Worte klar.
Vor einigen Wochen war zum ersten Mal seit der Schneeschmelze ein fahrender Händler das Tal heraufgekommen und hatte von märchenhaften Ereignissen im Land berichtet. König Edwins Braut hatte aus ihrer Heimat Cantware einen heiligen Mann mitgebracht. Dieser Priester stammte aus einem noch weiter entfernten Land, falls so etwas überhaupt möglich war. Angeblich kam er aus dem Land der Riesen, die den Großen Wall errichtet hatten, aber das war lächerlich. Jeder wusste schließlich, dass die Riesen längst tot waren.
Außerdem war dieser Mann nicht besonders groß. Aber aus seiner ganzen Haltung sprach die unerschütterliche Gewissheit, dass andere Menschen seinem Weg folgen würden.
»Ein wahrer Gott?«, spie die Frau aus »Nur ein einziger Gott? Du bist von Sinnen. Was ist mit dem Himmel und dem Wasser? Der Schlacht und der Frucht auf den Feldern? Alles hat seinen eigenen Gott, das wissen wir.« Erneut wanderte ihr Blick zu den Dorfbewohnern, doch deren Reaktion bestand auch jetzt wieder nur aus eisernem Schweigen.
»Es gibt nur einen Gott«, wiederholte der hagere Priester. Seine Stimme klang wie die eines Vaters einem kleinen Kind gegenüber. »Er hat mit Jesus Christus seinen einzigen Sohn geopfert, damit kein Mensch mehr den Tod erfahren muss, sondern alle das ewige Leben empfangen.«
Die Frau zuckte zusammen, als hätte er sie geschlagen.
»Mutter?« Ein Junge trat zu der Frau und legte ihr behutsam die Hand auf den Arm. Er hatte dunkle Haut und war in jenem schwierigen Alter zwischen Kindheit und Erwachsensein, war bereits groß und stark, doch noch ohne die körperliche Masse, die erst mit dem Alter kam.
Er wusste, dass seine Mutter diesem Fremdling niemals freiwillig gestatten würde, den Dörflern von seinem Gott zu erzählen.
Vorher würde sie ihn umbringen.
Der Junge blickte zu den Kriegern hinüber, die den Priester begleiteten. Sie standen nervös etwas abseits und hielten die Zügel ihrer Pferde fest. Dazu hatten sie grimmige Mienen aufgesetzt, waren jederzeit bereit zu töten. Das Licht spiegelte sich in den Heften ihrer Schwerter und ihren polierten Kettenhemden. Der Zauber seiner Mutter war stark, und es war gut möglich, dass sie damit den Priester tötete, doch danach wäre auch ihr der Tod gewiss.
»Mutter«, wiederholte er.
»Schweig still, Hengist«, zischte sie und schob ihn weg. Dann wandte sie den Blick zum Himmel und stieß einen durchdringenden Schrei aus.
Als die Pferde scheuten und anfingen zu schnauben, packten die Krieger die Zügel ihrer Pferde fester.
»Verlasst diesen Ort!«, kreischte sie, das schöne Gesicht zu einer Fratze des heiligen Zorns verzerrt. »Verschwindet und kehrt nie wieder zurück! Nehmt euren schwachen Gott und seinen Sohn und macht euch davon in das Land, aus dem ihr gekommen seid.«
Mit einem Mal erhob sich ein kräftiger Wind und blies ihr die schwarzen Haare ins Gesicht. Ihr Kleid schmiegte sich so eng an ihren Körper, dass ihre Rundungen sichtbar wurden.
Sie begann zu zittern, bis sie am ganzen Leib bebte. Hengist hatte sie schon unzählige Male dabei beobachtet. Das geschah immer, wenn die Götter durch sie sprachen. Er schauderte. Gleich würden die Götter ihre Stimme erheben, und er fürchtete sich vor ihren Worten.
Ein Mann mit breiten Schultern, ergrauendem Haar und strenger Miene schüttelte die Hand seiner Frau ab, die ihn zurückhalten wollte, und trat einen Schritt vor.
»Warte, Nelda«, sagte er. »Ich möchte hören, was dieser Mann zu sagen hat. Ein Gott, der keine Opfer fordert und nicht den Tod, sondern das Leben verspricht, das ist ein Gott, von dem ich mehr erfahren will.«
Nelda funkelte den Mann etliche Augenblicke lang an.
»Du solltest nicht einmal daran denken, mir vorzuschreiben, was ich tun soll, Agiefan«, erwiderte sie dann. Ihre Stimme triefte vor Verachtung. Begleitet von einem Schrei, der noch lauter war als der erste, wirbelte sie herum und baute sich erneut vor dem schwarz gekleideten Priester auf.
»Nein! Du bringst nur Lügen zu uns, um unseren Geist zu vergiften. Lügen!« Sie steckte die Hand in den Lederbeutel an ihrem Gürtel und holte mehrere kleine Gegenstände hervor. Ohne zu zögern, schleuderte sie sie dem Fremdling entgegen.
Der Priester zuckte zusammen, als die kleinen weißen Dinger die schwarze Wolle seines Gewandes trafen und anschließend zu Boden fielen. Es waren menschliche Fingerknochen. Dann berührte er mit den Fingerspitzen erst seine Stirn, dann die Brust und zum Schluss beide Schultern. Es schien sich um eine Art magisches Ritual zu handeln.
Nelda schrie Worte in einer Sprache, die niemand verstand. Der Wind riss sie aus ihrem Mund und verzerrte sie. Ein großer Krähenschwarm flog über sie hinweg, schwarz vor dem dunkler werdenden Himmel. Staub, vom Wind aufgewirbelt, brannte in Hengists Augen. Gewalt lag in der Luft. Mütter zogen ihre Kinder beiseite und bedeckten mit den Händen ihre Augen. Nelda beschwor mit ihren Worten die Macht der Götter, und alle, die sich hier versammelt hatten, traten einige Schritte zurück.
Alle mit Ausnahme des Priesters.
Regungslos und mit geschlossenen Augen stand er da. Seine Lippen bewegten sich, aber er sprach so leise, dass die Umstehenden ihn nicht verstehen konnten.
Seine Beharrlichkeit schien Neldas Zorn nur weiter anzustacheln. Ihre Stimme brach, als würde ihre Kehle von der Wucht ihrer geheimnisvollen Worte entzweigerissen.
Einer der Krieger trat vor und zog sein Schwert. Der Priester, der die Bewegung gespürt hatte, gebot ihm mit ausgestrecktem Arm Einhalt.
Neldas Schreie und Götterbeschwörungen dauerten noch einige Zeit an, dann erstarben ihre Worte schließlich, und sie stand keuchend, mit wildem Blick und Schaum vor dem Mund vor dem Fremdling.
Er öffnete die Augen, dieser Mann, der von einem neuartigen Gott sprach, und streckte der Hexe seine rechte Hand entgegen. Mit seiner linken umfasste er ein silbernes Amulett, das an einem Lederriemen um seinen Hals hing. Hengist sah, dass es Ähnlichkeit mit dem Hammer Thunors aufwies – es war ein Kreuz. Das gleiche Zeichen, das der Priester auch vor seiner Brust gemacht hatte.
Nelda atmete immer noch schwer infolge der großen Anstrengung. Einen Augenblick lang herrschte Stille. Nur der Wind, der heulend durch das Tal fegte, war zu hören.
Dann sagte der Priester mit klarer Stimme: »Im Namen unseres Herrn Jesus Christus befehle ich, Paulinus, dir, diesen Ort zu verlassen, damit diese Menschen die wahre Botschaft Gottes erfahren können.«
Niemand rührte sich von der Stelle. Der Wind ließ nach. Ruhe legte sich über das Tal. Neldas Lippen zuckten und verzogen sich zu einem Lächeln. Der Gott dieses Fremdlings schien keine Macht zu haben.
Und dann leuchtete das schattige Tal im grellen Glanz eines gleißenden Blitzes auf. So dicht in der Nähe schlug er ein, dass die Menschen Angst um ihr Leben hatten und aufschrien. Ein so lauter Donnerschlag, als würden Berge zusammenbrechen, folgte. Es war, als würde der Himmel über ihren Köpfen einstürzen. Frauen warfen sich zu Boden, um ihre Kinder mit ihren eigenen Leibern zu schützen. Etliche Pferde rissen sich los und galoppierten den Pfad ins Tal hinab, die Augen vor Entsetzen weit aufgerissen.
Der Donner war ohrenbetäubend. Zuerst schien es, als würde jemand die Luft zerreißen, dann folgte unmittelbar ein weiterer Hammerschlag von göttlicher Dimension. Der Widerhall rollte durch das Tal. War das etwa ein Zeichen für Thunors Zorn? Hatte er Neldas Schreie, ihr trotziges Aufbegehren gegen diesen neuen Gott vernommen?
Schwarze Wolken ballten sich bedrohlich über ihren Köpfen. Neldas Lächeln wurde breiter. Die Götter waren erzürnt.
Doch als sie sah, wo der Blitz eingeschlagen hatte, schlich sich Furcht in ihre Miene.
Auf der einen Talseite stand die heilige Esche. Sie war das Symbol des Allvaters Woden. Nahe diesem Baum fanden die Rituale zu Ehren der Götter statt. Dort wurden die Opfer dargebracht.
Der Blitz hatte den Baum in zwei Hälften gespalten. Ein Teil seines gewaltigen Blätterdachs fiel krachend zu Boden, wo es als Haufen aus Ästen und vom Wind abgepflückten Blättern liegen blieb. Der Baumstamm stand in Flammen. Riesige Feuerzungen leckten gen Himmel, vom Wind angefacht.
Kein zweiter Blitz zuckte vom Himmel, kein Tropfen Regen fiel, aber der Wind heulte von Neuem durch das Tal, während Flammen die heilige Esche verzehrten.
Die Menschen erholten sich nur allmählich von dem plötzlichen Entsetzen, das der Blitzschlag ausgelöst hatte. In kleinen Gruppen kauerten sie sich eng zusammen, als könnten sie sich durch die Nähe vor dem Zorn der Götter schützen.
Da ergriff Agiefan das Wort. Seine Stimme war schneidend. »Der neue Gott hat sich offenbart. Seht doch, die heilige Esche ist Vergangenheit. Genauso wie die Macht der alten Götter. Und was haben sie uns auch gebracht außer Tod und Pein?«
Neldas Antlitz war weiß wie Frost. Niemand hatte sie je so gesehen.
So voller Angst.
Die Götter hatten gegeneinander gekämpft, und Neldas Götter hatten verloren.
»Nein!«, sagte sie. »Ihr könnt die Zeichen der Götter nicht deuten. All die Jahre habe ich euch geleitet, ich habe euch dabei geholfen, eure Säuglinge zur Welt zu bringen, ich habe …«
Ihre Worte erstarben, als eine ausgemergelte Frau mit ausgeprägten Wangenknochen, über denen sich bleiche Haut spannte, auf sie, die Hexe, zutrat und ihr einen kräftigen Faustschlag auf den Mund versetzte. Nelda taumelte, hielt sich jedoch auf den Beinen. Dann wirbelte sie herum, stellte sich der Frau entgegen und riss die Fäuste empor, um sich zur Wehr zu setzen, doch auch die Dörfler rückten näher. Nelda zügelte sich.
»Sprich nicht davon, Kinder auf die Welt zu holen, Nelda«, spie die Frau aus. Ihre Augen lagen tief in dunklen Höhlen, wie bei einem Menschen, der Schrecken erlebt hat, die nie wieder aus seiner Erinnerung gelöscht werden können. Erneut holte die Frau zum Schlag aus, so übermächtig war ihre Wut. Doch dann ließ sie die Schultern sinken und sagte matt: »Sag nicht, dass du uns helfen willst, Hexe.«
Die Dörfler kannten den Schmerz dieser Frau, wussten um die Finsternis, die sie seit den kältesten Wintertagen umfangen hielt. Und sie wussten auch, dass sie alle ihren Teil dazu beigetragen hatten. Sie dachten an Gēola, die schwärzeste Nacht, zurück, als sie sich hilfesuchend an die Seherin gewandt hatten. Nelda hatte ihnen ein Ende der Hungersnot prophezeit, und sie hatten ihren Worten gelauscht und in ihrer Verzweiflung auch dem Opfer zugestimmt, das sie verlangt hatte.
Sie hatten den Preis akzeptiert, doch dieser lastete nun schwer auf ihren Seelen.
Und jetzt hatten die Götter der Hexe sie verlassen.
So wie ein Feuer schlagartig zum Leben erwacht, wenn ein Atemhauch auf die richtige Art und Weise in die Flamme fährt, so erwachten jetzt die Wut, Verbitterung und Scham der Dörfler.
Eine weitere Frau trat vor und versetzte Nelda einen kräftigen Hieb, der ihre Lippe aufplatzen ließ. Ein Mann schubste die Hexe, sodass sie stolperte und zu Boden stürzte. Die Dorfbewohner scharten sich um sie, traten sie in ihrem plötzlich aufwallenden Zorn mit Füßen und bespuckten sie.
Hengist schrie so laut, dass die Menge verstummte. Er stürmte los und stieß die Männer und Frauen beiseite, die ihm den Weg versperrten. Er war kräftig, und seine Wut verlieh ihm zusätzliche Kraft. Mehrere Männer verloren unter dem wütenden Ansturm des Jungen das Gleichgewicht und fanden sich auf dem Erdboden wieder.
»Lasst meine Mutter in Ruhe!«, schrie er, nachdem er sich schützend über Neldas gekrümmten Körper gestellt hatte.
Agiefan trat einen Schritt vor. Ohne nachzudenken, schlug Hengist zu und traf die Nase des Älteren mit voller Wucht. Blut spritzte, und Agiefan taumelte rückwärts, bis er in die Arme der anderen Dorfbewohner sank.
»Hengist«, sagte er, während er sich die Hand vors Gesicht hielt, um das Blut zu stoppen, das aus seiner Nase quoll. »Wir haben nichts gegen dich, aber deine Mutter ist hier nicht mehr willkommen.« Er spuckte Blut auf den Schotterpfad. »Sie muss uns verlassen.« Kurz sah er zu seinem eigenen Sohn, Hengists bestem Freund, der die Szene entgeistert verfolgte. »Du kannst gerne weiterhin bei uns leben, Hengist. Aber sie muss gehen.«
Hengist ließ den Blick über die Menschen schweifen, die ihn umringten. Die Menschen, die er schon sein ganzes Leben lang kannte. Freunde und Feinde. Alte und Junge. Agiefans Sohn, der ihn flehend anstarrte. An der strahlenden Schönheit des Mädchens namens Othili blieb er hängen. Sie war genauso erblasst wie die anderen, aber in ihren Augen erkannte er keinen Hass, sondern etwas anderes. Erregung?
Dann begegnete Hengist dem starren Blick des seltsamen Mannes, Paulinus, des Priesters, der aus einem fernen Land gekommen war. In seiner Miene erkannte er Düsternis und Härte, seine Augen ähnelten aus Granit gehauenen Höhlen. Einen Moment lang konnte Hengist seinen eigenen Zorn spüren, der laut schreiend danach verlangte, freigelassen zu werden. Am liebsten hätte er sich auf Paulinus gestürzt, um ihm die Kehle zu zerfetzen oder ihm das Genick wie einen vertrockneten Zweig zu brechen.
Da spürte er die beschwichtigende Hand seiner Mutter auf seinem Bein.
Es hätte keinen Sinn gemacht, Paulinus zu töten. Die Krieger, die ihn begleiteten, hätten Hengist nur niedergeworfen. Darum starrte er den Priester lediglich hasserfüllt an. Er würde sich an diesem Mann und seinem König bitterlich rächen. Später.
Schließlich zog er seine Mutter auf die Füße.
»Sei mir behilflich, meine Sachen zu packen«, flüsterte sie ihm zu.
Er schluckte und brachte keinen einzigen Ton heraus. Im Beisein dieser Menschen würde er keine Tränen vergießen.
Sie entfernten sich von der Menge. Der stechende Geruch von brennendem Holz lag in der Luft, das Knacken der lodernden Esche schien sie zu verfolgen.
»Ich komme mit dir«, sagte Hengist.
»Nein.« Nelda drehte sich mit wild funkelnden Augen zu ihm um. Blut tropfte von ihrer Lippe, und ihr Gesicht war mit Wunden und Prellungen übersät, aber Hengist war fest davon überzeugt, dass er noch nie eine schönere Frau gesehen hatte. »Nein, mein Sohn, du bleibst hier und wirst Großes vollbringen! Du wirst Königen dienen, so wie dein Vater es getan hat. Und du wirst sie stürzen, Hengist.« Sie packte ihn so fest am Arm, dass es wehtat. »Bleib hier und bring die zu Fall, die den schwachen Christusgott anbeten.«
Er wurde von einer Woge der Erleichterung erfasst und schämte sich sofort dafür. Der Gedanke, die Heimat verlassen zu müssen, hatte ihn mit Angst und Schrecken erfüllt.
»Dein Vater war ein ruhmreicher Recke«, fuhr sie fort. »Aber du wirst noch mächtiger sein. Du wirst Königen dienen und mit den Opfern deines Schwertes die Wölfe füttern. Mein Sohn, du wirst grausamen Schrecken unter deinen Feinden verbreiten. Du wurdest von Woden berührt, welcher viele Namen trägt und vielerlei Gestalt annimmt. Doch der Name, der am besten zu dir passt, ist ›Blutrausch‹.«
Sie zog ihn dicht zu sich heran und strich ihm zärtlich die dunklen Haare aus der Stirn. Die Berührung war erregend und verstörend zugleich. Ihr Atem roch metallisch.
»Denk immer daran«, sagte sie, wobei ihm aus ihrem Mund winzige Blutstropfen ins Gesicht spritzten, »du bist Blutrausch. Von Woden berührt.«
Hengist starrte wieder zu dem Christuspriester hinüber. Hinter Paulinus brannte die heilige Esche, eine Fackel aus Feuer und Rauch.
Ja, er würde bleiben. Aber den Tag, an dem der neue Christengott ins Dorf gekommen war, würde er niemals vergessen. Hengist würde niemals vergessen, und er würde dafür sorgen, dass Paulinus und sein König Edwin sich an ihn erinnerten, sobald ihre Zeit gekommen war.
Anno Domini Nostri Iesu Christi
Im Jahre unseres Herrn Jesus Christus 634
ERSTER TEIL
THUNORS ZORN
KAPITEL 1
»Finger weg von meiner Frau, du Hurensohn!«
Beim Anblick des grauhaarigen Kriegers, der Sunniva begrapschte, spürte Beobrand, wie die Wut sich in ihm regte. Der Ältere hob den Blick, ohne jedoch seine Hand von Sunnivas schmaler Taille zu nehmen. Als sie sich befreien wollte, lösten sich ihre Zöpfe, und ihr goldenes Haar fiel in schimmernden Wellen über ihre Schultern. Doch der Mann besaß schlanke, aber kräftige Arme, die zahlreiche Reifen zierten. Sie waren beredtes Zeugnis seiner Tapferkeit im Kampf. Jahrelange Übung mit Schild und Speer hatten die Arme stark wie die Äste eines Baumes werden lassen.
Der Lärm im Saal erstarb genauso schnell wie ein Feuer, das mit Wasser übergossen wird. Es wurde gezischt und geflüstert, während die Männer auf den Bänken um die Plätze mit der besten Sicht rangelten. Ein Kampf versprach Spannung und Unterhaltung.
Erneut ergriff Beobrand das Wort, allerdings mit etwas leiserer Stimme als zuvor. »Finger weg, habe ich gesagt.« Er war im ganzen Saal zu verstehen, genau wie seine Androhung von Gewalt.
»Und wie willst du mich daran hindern, Halbhand?« Erneut drückte der Krieger Sunniva an sich.
Sie wand sich in alle Richtungen, tat ihm jedoch nicht den Gefallen, einen Laut von sich zu geben.
Beobrand blickte auf seine linke Hand hinab. Seine Schildhand. Erst wenige Wochen waren vergangen, seit er den kleinen Finger sowie den größten Teil des Ringfingers verloren hatte. Die Wunden waren immer noch nicht verheilt und stark gerötet. Er ballte die versehrte Hand zur Faust. Die frische Haut spannte sich und platzte auf. Blut quoll aus der Wunde, und der Schmerz wanderte in Wellen seinen Arm entlang, doch er verzog keine Miene. Die Verletzung hätte ihn um ein Haar das Leben gekostet. Er hatte hohes Fieber bekommen, und alles hatte danach ausgesehen, als stünde sein Abschied von diesem Leben unmittelbar bevor. Doch sein Geist hatte sich an das irdische Leben geklammert, und er war seinen Angehörigen nicht ins Tal des Todes gefolgt.
»Der mächtige Krieger Hengist hat mir die Finger genommen, und dennoch lebe ich noch immer, während er zu Rabenfutter geworden ist«, entgegnete Beobrand. »Um elende Pisseschläuche wie dich zu töten, brauche ich nicht mehr als eine halbe Hand.«
Die Stimmung im Saal schlug um. Beobrands Worte machten allen wieder klar, wie schnell selbst kleinere Dispute eskalieren konnten. Zwar waren im Großen Saal keine Waffen erlaubt, doch mit Speisemessern konnte man ebenso gut töten wie mit einem Sachsmesser oder einem Schwert.
»Mich willst du umbringen, sagst du? Ich bin Athelstan, Sohn des Ethelstan, und ich habe so viele Männer getötet, dass ich mich gar nicht mehr an alle erinnern kann.« Athelstan stieß Sunniva von sich und richtete sich mit vorgerecktem Kinn und gesträubtem, schon leicht weißem Bart zu voller Größe auf. Er war breitschultrig und von beeindruckender Gestalt, dennoch musste Beobrand den Kopf neigen, um ihm in die Augen zu blicken.
»Es ist traurig mitanzusehen, wenn die Erinnerung einen Graubart im Stich lässt.« Das leise Lächeln auf Beobrands Lippen erreichte seine kalten blauen Augen nicht. »Mag sein, dass du einst ein Krieger von gewissem Ruf warst. Aber jetzt bist du nur noch alt. Setz dich lieber wieder hin, bevor deine körperlichen Schmerzen übermächtig werden.«
Ein Raunen ging durch den Saal. Die Männer waren vom Wagemut des Jüngeren beeindruckt und gleichzeitig auf Athelstans Reaktion gespannt. Viele kannten ihn als einen Mann, der schnell gekränkt war und nur selten einem Streit aus dem Weg ging. Darüber hinaus hatte er den Ruf eines tödlichen Gegners.
»Alt bin ich? Das werden wir ja sehen. Ich reiße dir das Herz aus dem Leib, und noch bevor du kalt geworden bist, nehme ich mir dein Mädchen.«
Mit einem Satz ging Athelstan auf Beobrand los und stieß ihm seine mächtige Faust entgegen. Athelstans Masse und seine Muskelkraft machten sie zu einer grausamen, gewaltigen Waffe, verwandelten sie in einen Schmiedehammer, der Beobrand von den Beinen reißen würde.
Falls sie ihn traf.
Doch Beobrand verfügte über die Reaktionsfähigkeit der Jugend. Er hatte sich zwar noch nicht vollkommen von seinen Verletzungen erholt, die er sich im Schildwall im Schatten der Festung Bebbanburg zugezogen hatte, aber als Krieger war er ein Naturtalent. Die Eiseskälte der Schlacht hatte ihn erfasst. Athelstans Bewegungen waren die eines Mannes, der durch einen Sumpf watet, sie waren träge und ungelenk.
Beobrand ließ den Angriff an seinem linken Oberarm abprallen und machte einen Schritt auf seinen Gegner zu. Gleichzeitig nutzte er seine eigene sowie Athelstans Vorwärtsbewegung zu seinem Vorteil, riss sein rechtes Knie nach oben und versetzte dem Älteren einen Stoß in die Lenden. Er war von solcher Wucht, dass Athelstans Füße den mit Binsen ausgelegten Boden verließen.
Alle im Saal Versammelten verzogen schmerzerfüllt das Gesicht. Athelstan gab eine Mischung aus Keuchen und Stöhnen von sich, während sämtlicher Kampfgeist in ihm erlosch. Mit beiden Händen hielt er sich das Zentrum seines Schmerzes und sackte zu Boden.
»Ich … ich werde …«, stöhnte er.
»Was denn?«, erwiderte Beobrand. »Mich mit Blut besudeln?«
Gelächter hallte durch den Saal.
Athelstan rang um Haltung und Fassung. »Ich werde dich töten!«, presste er mit zornrotem Gesicht hervor, dann zog er ein kleines Messer aus seinem Gürtel, mit dem er Beobrand bedrohte.
Erneut wurde es still. Tod lag in der Luft.
»Hier wird heute niemand getötet.« Die Stimme gehörte Scand, Beobrands Lehnsherrn. Sie dröhnte laut wie eine Ohrfeige.
Alle Blicke wandten sich Scand zu. Er stand am Saalende, wo er an der Hohen Tafel gesessen hatte. Jetzt beherrschte seine Gestalt den gesamten Raum. Das Licht der Fackeln und die Flammen der großen Feuerstelle ließen goldene Punkte über seinen silbergrauen Bart huschen. Sein zerfurchtes Gesicht wirkte in der Düsternis schroff und mürrisch.
»Wir alle haben unseren Eid auf König Oswald geleistet. Ihr solltet euch nicht vergessen. Bald schon werdet ihr die Gelegenheit zum Kampf haben. Die Waliser verwüsten unser Land, und Cadwallon versammelt sein Heer vor dem Großen Wall. Wenn wir im Schildwall stehen, wirst du froh sein über Athelstans Kräfte, Beobrand. Und du, Athelstan … du bist alt genug, um zu wissen, dass du die Finger von der Frau eines Jüngeren zu lassen hast. Insbesondere wenn dieser junge Mann ein solch vorzüglicher Kämpfer ist wie Beobrand, Sohn des Grimgundi.«
Beobrand blickte erst zu Scand und dann wieder zu Athelstan. Er spürte, wie die aufgeheizte Atmosphäre sich allmählich abkühlte, doch in ihm wallte immer noch so viel Zorn, dass er zitterte.
Athelstan richtete sich auf, sah Beobrand in die Augen und ließ das Messer sinken.
»Steck deine Waffe weg, Athelstan«, sagte Scand. »Und entschuldige dich.«
Athelstan zögerte, schien aber keine andere Möglichkeit zu sehen. Er ließ das Messer in die Scheide zurückgleiten und senkte den Blick. »Ich bitte dich um Verzeihung«, murmelte er.
Beobrand bebte immer noch vor aufgestauter Wut. Er hasste Männer, die ihre körperliche Überlegenheit nutzten, um andere zu drangsalieren, und besonders schändlich war so ein Verhalten, wenn es sich bei diesen anderen um Frauen handelte. Er hatte immer noch die Fäuste geballt und musste alle Kraft aufbieten, um Athelstans betrunkene Fratze nicht zu einer blutigen Masse zu schlagen. Sunniva, die hinter Athelstan stand, blickte ihn mit im Feuerschein leuchtenden Augen an. Sie war ohne jeden Zweifel die schönste Erscheinung im ganzen Saal. Ihr Haar glänzte wie geschmolzene Bronze, und ihr Gesicht schien von innen heraus zu strahlen. Unter all den Kriegern wirkte sie wie die einzige schöne Blume inmitten eines Feldes aus Steinen und Schlamm.
Und sie war sein.
Sowohl Beobrand als auch Sunniva hatten keine lebenden Angehörigen mehr, und so füllten sie diese Lücke in ihren Leben gegenseitig aus.
Sie schien zu spüren, dass er erneut zuschlagen wollte, und schüttelte beinahe unmerklich den Kopf. Und weil er es nicht ertragen konnte, sie unglücklich zu machen, schluckte er die zornigen Worte hinunter, die er gerne herausgeschrien hätte.
»Ich verzeihe dir, Athelstan. Wahrscheinlich war es der Met, der dir die Worte in den Mund gelegt hat.«
Athelstan grinste reumütig und rieb sich den Lendenbereich. Er hatte immer noch Mühe, sich aufrecht zu halten. »Ich wünschte, das wäre dir klar geworden, bevor du mir die Eier zerquetscht hast.«
Alle Anspannung verflüchtigte sich. Einige Männer kicherten. Athelstan ließ sich auf seine Bank zurückfallen und griff ein weiteres Mal nach seinem Methorn.
»Du hast eine interessante Methode, Freundschaften zu schließen, Beobrand.« Acennan lachte laut und klopfte Beobrand auf die Schulter. Acennan war deutlich kleiner als der junge Mann aus Cantware. Er hatte ein rundliches Gesicht und lächelte gerne und oft, dennoch war er als Krieger nicht zu unterschätzen. Sie hatten Schulter an Schulter im Schildwall gestanden, und es gab niemanden, dem Beobrand in einer Schlacht mehr vertraut hätte. Beobrand betrachtete das Antlitz seines Freundes. Acennans Nase trug immer noch die Narben ihrer ersten Begegnung.
Acennan war betrunken gewesen und hatte Beobrand bedroht, was er bald schon bereut hatte. Eine ganze Zeit danach waren sie einander mit Abneigung begegnet, doch gemeinsame Erfahrungen hatten schließlich zu gegenseitigem Respekt geführt, aus dem das Fundament ihrer Freundschaft geworden war. Sie waren Waffenbrüder.
Beobrand erwiderte Acennans Lächeln. Der kalte Nordseewind brannte in seinen Augen und ließ sie tränen.
»Bei uns hat es funktioniert, oder etwa nicht?«, meinte er.
»Stimmt. Nachdem du mir demonstriert hattest, dass du im Kampf nicht völlig nutzlos bist«, gab Acennan grinsend zurück.
Die Wege des Schicksals waren unergründlich. Hätte irgendjemand Beobrand nach seiner ersten Begegnung mit dem bulligen Krieger prophezeit, dass sie später Freunde werden würden, er hätte denjenigen für verrückt erklärt.
Sie standen auf der östlichen Palisade von Bebbanburg. Vor ihnen erstreckte sich die graue See. Die Inseln im Süden waren als düstere Schatten gerade noch erkennbar. In der anderen Richtung lag die deutlich größere Insel Lindisfarena. Im Augenblick war sie ganz vom Wasser umgeben, doch bei Ebbe war sie vom Festland Bernicias aus erreichbar.
Die beiden Freunde standen häufig hier. Manchmal unterhielten sie sich. Vielfach riss Acennan seine Witze. Und oft genug erfreuten sie sich lediglich an der Gesellschaft des anderen. Innerhalb der Festung ging es meist lebhaft und laut zu. Immer noch waren zusätzlich zu König Oswalds Hofstaat und all den Angestellten, Leibeigenen und Dienern, die nach König Edwins Tod hiergeblieben waren, auch alle Überlebenden aus Gefrin hier untergebracht. Bebbanburg platzte aus allen Nähten. Die Festungsmauer war einer der wenigen Orte, wo man ein wenig Ruhe und Frieden finden konnte, und sei es nur für ein paar Augenblicke.
»Du kannst froh sein, dass Scand eingeschritten ist«, sagte Acennan jetzt. »Mit Athelstan sollte man sich auf keinen Fall anlegen. In Zukunft wirst du vorsichtig sein müssen.«
Beobrand erinnerte sich, wie der alte Krieger Sunniva berührt hatte, und unterdrückte einen Schauder. »Ich weiß. Aber ich konnte auch nicht einfach zusehen und ihn gewähren lassen.«
»Dein aufbrausendes Temperament wird dich eines Tages das Leben kosten.«
»Nun ja, bis jetzt scheint es mir nicht allzu viel zu schaden.«
Acennan legte vorsichtig die Fingerspitzen an seine Nase. »Nein, allem Anschein nach nicht.« Er räusperte sich lautstark und spuckte über die Palisade. Der Wind schleuderte seine Spucke wieder zurück. Eine Möwe flog heran und versuchte, den Batzen im Flug zu schnappen.
»Vermutlich sieht meine Nase jetzt besser aus als vorher. Jetzt ist sie eines echten Kriegers würdig. Zuvor sah ich zu gut aus.« Acennan lachte.
Beobrand reagierte nur mit einem Knurren. Er war nicht in der Stimmung für Scherze. Die Auseinandersetzung mit Athelstan lag noch nicht lange zurück. Der Schorf an seinen verletzten Fingern war aufgeplatzt, und seine Hand schmerzte. Durch die aufgestaute Aggressivität war er immer noch wütend und angespannt. »Wie lange noch, bis wir gen Süden marschieren?«, erkundigte er sich.
»Nicht mehr lange«, erwiderte Acennan. »Ich weiß, dass Oswald auf die Kriegerscharen aus dem Norden warten will, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch viel länger hier ausharren können. Cadwallon ist nicht untätig. Mit jedem weiteren Tag zerstören er und seine Männer mehr Siedlungen, fallen mehr Angeln durch das Schwert oder werden versklavt.«
König Oswald hatte Boten gen Norden entsandt, um Gartnait, den König der Pikten, um Hilfe zu bitten, doch bis jetzt war keine Antwort eingetroffen. Die Krieger vertrieben sich die Zeit mit Waffenübungen, wurden jedoch mit jedem Tag unruhiger. Fast täglich erreichten sie neue Nachrichten, die von Tod und Zerstörung durch die Hand des walisischen Kriegerheeres im Süden berichteten. Und Oswald konnte unmöglich so viele Männer auf unbegrenzte Zeit in Bebbanburg beherbergen. Die Vorräte gingen bereits zur Neige, doch angesichts der Bedrohung, die Cadwallons Heer für Leib und Leben der Bevölkerung von Northumbria darstellte, war es ihm auch unmöglich, die Krieger wegzuschicken.
»Glaubst du, wir können genügend Männer zusammenbringen, um Cadwallon zu besiegen?«, fragte Beobrand.
»Das wissen nur die Götter. Aber wir waren schon einmal deutlich in der Unterzahl, und dennoch stehen wir jetzt hier.«
Beobrand dachte an das Chaos, das im Schildwall geherrscht hatte, und an den Schrecken. Nur die Wendungen des Schicksals hatten ihnen die Flucht gestattet. »Eine Begegnung mit den Walisern unter fairen Bedingungen, das wäre eine willkommene Abwechslung«, sagte er.
»Aye, aber wer will schon ein ruhiges Leben haben, was, Beobrand?«, prustete Acennan und klopfte seinem Freund auf den Rücken. »Die Erzählung von unseren Taten wird sich so viel beeindruckender anhören, wenn wir Cadwallons Kämpfern erneut an Zahl weit unterlegen sind und sie dennoch vernichtend schlagen.«
Die Frage war, ob in Bernicia überhaupt jemand übrig bleiben würde, der später ihre Geschichte erzählen konnte, doch diesen Gedanken behielt Beobrand für sich. Er hatte in der Straße der Wale etwas entdeckt. Dieses Etwas war immer noch weit entfernt im Norden, kam jedoch eindeutig auf sie zu.
Es war ein Schiff, das, von der steifen Brise getrieben, sich ihnen schnell näherte.
Die beiden Krieger schwiegen eine ganze Weile und beobachteten das größer werdende Schiff. Es wurde von Seevögeln umschwirrt. Die geblähten Segel ließen die Masten und Stagen des schlanken Dreimasters ächzen und schoben ihn zügig voran. Sie sahen, wie das Schiff Lindisfarena umrundete und sich der Anlegestelle am Strand unterhalb von Bebbanburg näherte.
»Sieht so aus, als hätte man Oswalds Hilferufe vernommen«, sagte Acennan. »Es scheinen viele Männer an Bord zu sein.«
Der Saal war brechend voll. Oswald bereitete sich auf eine Ansprache vor, und alle in Bebbanburg wollten sie hören. Die Männer waren begierig darauf zu erfahren, ob sie sich marschbereit machen sollten. Sie wollten Bebbanburg endlich verlassen. Manche sehnten sich nach einer Schlacht, nach Ruhm und Gemetzel. Andere beteten lautlos darum, davon verschont zu bleiben, im Schildwall Aufstellung nehmen zu müssen. Aber alle waren sie der Enge der Festung überdrüssig. Die Frauen pressten die Lippen zusammen und waren angespannt. Sie wussten, dass das Leben ihrer Männer in den Händen dieses neuen Königs lag, der nach langem Exil nach Bernicia zurückgekehrt war. Das vergangene Jahr hatte ihr Leben verändert. Die friedliche Herrschaft König Edwins hatte mit der Schlacht von Elmet im Süden abrupt geendet. Viele tapfere Ehemänner, Söhne und Väter hatten an diesem Tag ihr Leben verloren. Und im Verlauf der folgenden Monate waren Cadwallon und die verhassten einheimischen Waliser wie eine Welle des Blutvergießens über das Land hereingebrochen. Keine einzige Familie war von den Gewalttaten verschont geblieben, die mit der Zerstörung des Königssaales in Gefrin und der Ermordung von Oswalds Bruder Eanfrith ihren Höhepunkt gefunden hatten.
Nun bedrohten Krieg und Tod erneut ihr Land, und die Männer würden sich in Marsch setzen. Es war ihre Pflicht. Die Frauen wünschten sich nichts sehnlicher, als dass es einen anderen Weg gäbe, um ihre Heimat zu beschützen. Doch sie konnten sich keinen vorstellen.
Die Deckenbalken des Saals waren schwarz vom Ruß. Ein Schleier aus Rauch und Schweiß erzeugte eine unwirkliche Atmosphäre. Die Flammen der Binsenfackeln flackerten. Das große Kaminfeuer loderte. Diejenigen, die in dessen Nähe saßen, schwitzten, konnten jedoch nicht wegrücken, da dafür einfach kein Platz im Saal war.
Beobrand stand zusammen mit Sunniva und Acennan am hinteren Ende des Raums, weit weg vom Hohen Tisch mit dem König und den Edelmännern. Jetzt sahen sie, wie König Oswald – schmal und blass, aber mit einer gebieterischen Ausstrahlung – sich von seinem Platz erhob und die Arme vor der versammelten Menge ausbreitete. Sein langes kastanienbraunes Haar fiel zur Seite und umrahmte sein Gesicht mit den intelligenten Augen und den hohen Wangenknochen.
Allmählich erstarb das Gemurmel. Oswald stand lange Zeit nur da, die Arme ausgestreckt. Die Anspannung im Saal war mit Händen zu greifen. Die Zuhörer beugten sich erwartungsvoll nach vorn, alle Gespräche verstummten.
Stille.
Endlich ergriff der König das Wort, wählte aber nicht den lautstarken Tonfall eines Kriegsfürsten oder den eines Barden, der von einer vergangenen Schlacht berichtet. Stattdessen sprach er mit leiser Stimme. Die Schar der Zuhörer schob sich noch weiter vor, um die Worte des Mannes, der ihr Schicksal in den Händen hielt, besser zu verstehen. Viele wagten kaum mehr zu atmen.
»Männer und Frauen von Bernicia. Unser gnädiger Herr und Gott hat unsere Gebete erhört. König Gartnait, der Bruder Finolas, hat auf meinen Hilferuf hin etliche seiner besten Krieger gesandt, damit sie uns im Kampf gegen den Heiden Cadwallon beistehen.«
Finola, die Witwe von Oswalds Bruder Eanfrith, saß demütig an Oswalds linker Seite. In Beobrands Augen war sie nach Sunniva die schönste Frau im Saal. Sie hatte einen blassen Teint, war von zierlicher Gestalt, und über ihren Rücken ergoss sich ein Wasserfall aus langen feuerroten Haaren. Regungslos, fast resigniert, so schien es, saß sie da und fügte sich willig in ihre Rolle als strategische Spielfigur in der tödlichen Taflpartie der Könige. Zwischen dem Volk der Angeln in Bernicia und den Pikten herrschte keine Liebe. Eanfrith hatte Finola geheiratet, um eine Allianz zu schmieden, und das machte Oswald sich jetzt zunutze. Sie und ihr junger Sohn Talorcan waren kaum mehr als Geiseln von edler Abstammung. Nun trat der silberbärtige Scand, der hinter Finola gestanden hatte, einen Schritt vor und legte ihr beruhigend die Hand auf die Schulter. Im Gegenzug tätschelte sie leicht die Finger des alten Recken.
Oswald beachtete weder Finola noch Scand. »Wir brechen auf. Die königliche Kriegerschar ist einmal mehr zusammengekommen, um das Land zu beschützen.«
Sunnivas kleine, warme Hand suchte nach Beobrands. Er drückte sie mit festem Griff, während er daran dachte, dass es nur ein Jahr her war, dass er das letzte Mal hier in diesem Saal gestanden hatte. Auch König Edwin hatte damals ein Kämpferheer um sich geschart und versprochen, das Land von Cadwallon zu befreien. Wie viele würden dem Ruf dieses neuen Königs folgen? Doch selbst wenn sich ihm alle anschließen würden … Nach diesem einen Jahr voller Schlachten und Blutvergießen gab es schlichtweg weniger Männer als zuvor, die das Königreich verteidigen und zu Speer und Schild greifen konnten.
Die Nachricht der Verstärkung durch die Pikten wurde wohlwollend aufgenommen, auch wenn Beobrand und Acennan am Nachmittag wider Erwarten nur wenige Dutzend Männer auf dem Schiff gezählt hatten. Sie hatten sich beide bereits Schild an Schild mit Cadwallons Kriegerschar gemessen, und nun sah es mit jeder Stunde, die verging, mehr danach aus, als würden ihnen die Waliser zahlenmäßig wieder einmal weit überlegen sein. Sollten sie die bevorstehende Schlacht tatsächlich überleben, dann würde die Erzählung davon eine wahrhaft große werden.
Oswald fuhr fort: »Ich habe gebetet, und der Herr hat mir geantwortet, dass wir über unsere Feinde obsiegen werden. Nachdem ich viele Jahre im Exil verbracht habe, fern der wunderbaren Landschaft Bernicias, werde ich nicht zulassen, dass sich irgendjemand zwischen mich und das Land stellt, das mir von Geburt aus zusteht. Viele von euch waren während all dieser Jahre an meiner Seite …« Sein Blick wanderte durch den Saal, wo er seine vertrautesten Krieger, die Angehörigen seiner Gefolgschaft, suchte und fand. »Eure treue Ergebenheit, eure Tapferkeit in den Schlachten in Hibernia und euer Glaube an den einen, wahren Gott werden euch nun vergolten werden. Ich werde ein guter König sein. Keiner von euch soll Mangel leiden.«
Einige Männer stampften mit den Füßen oder klatschten in die Hände.
»Und zu denen unter euch, die mich weniger gut kennen, sage ich: Vertraut auf mich und auf Gott, dann werdet ihr reich entlohnt werden, sowohl in diesem Leben wie auch im zukünftigen. Im Schatten des heiligen Kreuzes werden wir in die Schlacht ziehen und die walisischen Heiden vernichten.«
Acennan stieß Beobrand mit dem Ellbogen an und flüsterte: »Wenn er ebenso gut kämpfen wie reden kann, dann müssen wir uns keine Sorgen machen.«
»Warum musst du schon wieder aufbrechen? Das ist nicht richtig. Du bist ja kaum wieder gesund.« Sunniva hörte, wie sich Verzweiflung in ihre Stimme schlich. Sie wollte sich ihre Bedenken nicht anmerken lassen, doch diese lauerten nur darauf, endlich aus ihr herauszubrechen, wie die Glut einer Esse, die mit einigen wenigen Luftstößen des Blasebalgs röhrend zu neuem, heißem Leben angefacht wird.
»Du weißt genau, dass ich keine Wahl habe«, erwiderte Beobrand. Seine Verärgerung über den Verlauf dieses Gesprächs war nicht zu überhören. Schon seit Tagen waren sie dem Thema immer wieder ausgewichen, doch seit Oswalds Ankündigung konnte Sunniva es nicht länger verdrängen.
»Ich weiß«, entgegnete sie leise, ließ sich gegen die Wand sinken und schloss die Augen. Sie saßen auf dem Fußboden ihrer improvisierten Unterkunft in der Ecke eines Lagerschuppens, den Oswald Scands Männern und deren Familien zugewiesen hatte. Wie jeder Fleck in ganz Bebbanburg war auch dieser Schuppen überfüllt und kein Ort der Ruhe, aber sie hatten getan, was sie konnten, um es sich gemütlich zu machen. Sunniva hatte aus Decken und Weidenruten eine Abtrennung angefertigt, die zumindest so etwas Ähnliches wie Privatsphäre ermöglichte, auch wenn ihnen klar war, dass die anderen jedes ihrer Geräusche vernehmen konnten. Für Geheimnisse war in diesem Schuppen voller Menschen jedenfalls kein Platz.
Ihr gesamter Besitz stapelte sich ordentlich auf der kleinen Fläche zwischen der Abtrennung und der Außenwand. Nacht für Nacht lagen sie eng beisammen, flüsterten, küssten sich und erkundeten ihre Körper. In der Dunkelheit klammerten sie sich aneinander und wollten einander aus Angst, sich zu verlieren, nicht mehr loslassen. In diesen Augenblicken, wenn sie in der Düsternis eins wurden und den Atem des anderen einsogen, konnte Sunniva die Wirklichkeit beinahe vergessen. In diesen wenigen Minuten war sie zufrieden. Glücklich darüber, sich in diesem winzigen Zuhause, das sie geschaffen hatte, vor der Welt verkriechen zu können.
Doch kaum brach der nächste Tag an, wurden die Erinnerungen an ihre Mutter und an den Tod ihres Vaters wieder übermächtig. Ihre Mutter war im vorangegangenen Winter einem fiebrigen Husten erlegen. Ihr Vater Strang, der Schmied von Gefrin, war auf grausame Art und Weise ermordet worden. Beobrand hatte seinen Tod gerächt und war anschließend zu ihr zurückgekehrt. Jetzt war er alles, was sie noch hatte. Erst vor wenigen Wochen hatte er mit dem Tod gerungen. Die vielen durchwachten Stunden an seinem Krankenlager spukten immer noch durch ihre Träume. Aber nun würde er gen Süden in die nächste Schlacht ziehen, in den Kampf gegen ein weit überlegenes Heer. Und das Schlimmste daran war, dass er sich darauf zu freuen schien.
Sunniva schlug die Augen auf und blickte Beobrand an. Seine Augen leuchteten im Schein der Binsenfackel, die in einem kleinen getöpferten Halter steckte. Die Schatten verzerrten sein Gesicht und ließen seine Züge hart wirken.
»Warum können wir nicht einfach weggehen?«, flehte sie ihn an. »Irgendwohin, wo unsere Fähigkeiten benötigt werden. Ich könnte schmieden, und du hast dein Schwert. Starke Männer werden überall gebraucht.«
Beobrand seufzte. »Du hast dir die Antwort gerade selbst gegeben. Ich habe mein Schwert. Wofür sind ein starker Arm und eine schöne Klinge denn nütze, wenn sie nicht eingesetzt werden? Ich gehöre jetzt zu Scands Kriegerschar. Wir haben Oswald den Treueeid geschworen, und diesen Eid kann ich nicht brechen.« Er streichelte ihr mit den Fingerspitzen sanft die Wange. »Wäre ich ein Mann, der sein Wort bricht, so würdest du mich nicht lieben.«
Sie nickte. Das war die Wahrheit. Sie liebte ihn, weil er war, wie er war, nicht, obwohl er so war.
»Dann schwöre mir, dass du zurückkehren und mich heiraten wirst.«
Als Beobrand grinste, schienen seine Zähne im trüben Licht zu leuchten. »Es gibt nichts, was mir mehr Freude bereiten würde. Ich verspreche es dir und schwöre bei Thunors Hammer«, er legte die Finger an das aus einem Walzahn geschnitzte Amulett, das er um seinen Hals trug, »dass ich kämpfen werde, um anschließend im Besitz meiner vollen Stärke zu dir zurückzukehren. Dann werde ich dich heiraten, und du wirst mir einen prächtigen Sohn schenken!«
Er streckte die Hand nach ihr aus und zog sie mit seinen kräftigen Armen fest an sich. In der Bewegung blieb er an der wackeligen Abtrennung aus Decken und Weidenruten hängen, sodass sie über ihnen zusammenbrach. Die Flamme der Binsenfackel flackerte kurz, bevor sie erlosch.
Sunnivas anfängliche Freude über die Worte und seine Umarmung verwandelte sich sofort in Leid. Die Götter hatten Beobrands Schwur gehört und als Antwort darauf das Licht erlöschen lassen, ein böses Omen.
»Was hast du getan?« Ihre Stimme überschlug sich. Die Panik, die dicht unter der Oberfläche ihrer Gefühle gelauert hatte, brach sich explosionsartig Bahn.
Andere im Lagerschuppen wurden aus dem Schlaf gerissen. Jemand zischte: »Bei allem, was heilig ist, bring jemand dieses Weib zum Schweigen!«
»Es ist doch nichts, nur die Decken sind runtergefallen«, versuchte Beobrand, Sunniva zu beruhigen. Er griff nach der erloschenen Binsenfackel, schritt behutsam über schlafende Gestalten hinweg hin zu einer brennenden Talgkerze und entzündete sie erneut.
Während sie schweigend die Abtrennung wieder errichteten, strömten Tränen über Sunnivas Gesicht.
Er würde niemals zu ihr zurückkehren. Er würde sterben. Die Götter hatten gesprochen, darum musste es so sein.
Er streckte die Hand nach ihr aus, zärtlich dieses Mal. Sie krallte sich in seinen Kittel und schmiegte sich mit aller Kraft an seinen muskulösen Leib, als könnte sie ihn allein dadurch zurückhalten. Er strich ihr über die Haare und küsste so lange ihren Hals, bis ihr Schluchzen verebbt war. Warm und eng lagen sie beisammen.
»Es war nichts«, flüsterte er. »Nur meine Ungeschicklichkeit.«
Sie konnte sein angestrengtes Lächeln hören. Vielleicht waren sie beide verflucht.
»Ich hätte dich nicht bitten sollen zu schwören«, sagte sie tonlos und verzweifelt. »Man soll die Götter nicht in Versuchung führen.«
»Unsinn.« Er küsste sie. »Thunor wird über mich wachen, und ich werde zu dir zurückkehren. Und dann werden wir heiraten.«
Sie kuschelte sich wieder an ihn. Sie hatte sich benommen wie ein verängstigtes Kind. Überreagiert. Was immer das Schicksal für sie bereithielt, die Zeit würde es ans Licht bringen. Herabgerutschte Decken und eine erloschene Flamme hatten jedenfalls nicht das Geringste zu bedeuten.
Beobrand streichelte ihr den Rücken, und Sunniva spürte, wie sie sich allmählich entspannte.
»Wir werden heiraten«, murmelte sie. »Und ich werde dir einen prächtigen Sohn schenken.«
Beobrand streifte mit seinen Lippen die ihren. Dann veränderte er seine Position und blies einmal mehr die Fackel aus.
Der nächste Morgen war stürmisch und kalt. Der Himmel öffnete seine Schleusen über den Männern, die am Strand am Fuße Bebbanburgs ihre Übungen machten. König Oswald hatte jeden einzelnen seiner Recken angewiesen, sich auf die Schlacht vorzubereiten, und Scand hatte alle Überlebenden aus Gefrin zu diesem Zweck an den nassen Strand beordert. Die Männer kannten einander gut. An der Furt von Gefrin hatten sie Seite an Seite im Schildwall gestanden und die Schlacht überlebt. Es gab unter ihnen keinen, den das Feuer des Kampfes nicht härter gemacht hatte. Sie waren zu allem entschlossen. Die Elemente und das Wissen um die bevorstehende Schlacht belasteten sie gleichermaßen. Doch bereits kurz nachdem sie angefangen hatten, sich mit den Schilden hin und her zu stoßen, lockerte der Schweiß ihre Muskeln und Zungen. Sie scherzten und alberten herum, und der Wind trug ihr Gelächter zu denjenigen empor, die ihnen von der Palisadenanlage der Festung aus zuschauten.
Beobrand fiel in das Lachen ein, war aber nicht bei der Sache. Die anderen hatten ihn bereits kämpfen sehen, und in der Schlacht war er ein exzellenter Kämpfer, gegen den kaum ein Kraut gewachsen war. Doch heute verlor er die Hälfte seiner Sparringskämpfe, viele davon schnell und gegen sehr viel schwächere Gegner.
Scand blickte Acennan mit hochgezogener Augenbraue an, nachdem Beobrand eine besonders ärgerliche Niederlage gegen einen Mann eingesteckt hatte, der doppelt so alt war wie er. Tobrytan, ein untersetzter, finsterer Kerl, war langsam und alles andere als ein eleganter Kämpfer. Jede seiner Attacken war vorhersehbar. Normalerweise hätte Beobrand ihn erledigt, ohne mit der Wimper zu zucken. Heute aber ließ er zu, dass Tobrytan seinen Schild umging und ihm ein übler Schlag auf die Rippen gelang. Beobrand griff sich an die Seite, nickte seinem Gegner zu und schlurfte geschlagen und mit hängenden Schultern davon.
Acennan folgte ihm in den Schutz einer Düne, wo er sich niederließ. Flüsternd verneigte sich der Strandhafer vor dem Wind.
»Was ist los mit dir?«, wollte Acennan wissen und setzte sich neben seinen jungen Freund aus Cantware.
Beobrand hob seine verstümmelte linke Hand, ballte sie zur Faust und schüttelte dabei den Kopf. »Eigentlich nichts. Aber mit der Hand kann ich den Schild nicht mehr so halten wie früher. Mein Griff ist zu schwach.«
»Das ist alles?« Acennan grinste. »Du bist ein hervorragender Kämpfer, und wir können nicht zulassen, dass du wegen ein paar Finger, die du verloren hast, im Selbstmitleid ersäufst. Betrachte sie als Opfer. Einen für Woden und einen halben für Thunor!« Der untersetzte Krieger lachte über seinen eigenen Scherz.
Beobrand lächelte nicht einmal.
»Wir besorgen ein paar Lederriemen, mit denen wir den Schild an deinem Arm befestigen. Allerdings solltest du dich damit ausführlich vertraut machen, denn der Stoß mit dem Schildbuckel wird dadurch vermutlich schwieriger. Aber ein Naturtalent wie du wird damit schon zurechtkommen.« Acennan klopfte Beobrand auf die Schulter. »Darüber hinaus werden Woden und Thunor bestimmt nicht zulassen, dass der Mann stirbt, der ihnen seine Finger geopfert hat.«
»Du solltest dich über solche Dinge nicht lustig machen«, herrschte Beobrand ihn an. »Ich habe auf Thunors Hammer den Eid geleistet, dass ich aus der Schlacht zurückkehren und Sunniva heiraten werde. Doch dann ist unsere Fackel erloschen, und nun ist Sunniva davon überzeugt, dass ich verflucht bin und sterben werde. Vielleicht hat sie ja recht.«
Nach dem Vorfall hatte Beobrand sehr unruhig geschlafen. Die Gewalttätigkeit seines Vaters hatte seine Träume beherrscht. Er war wieder ein kleiner Junge, und sein Bruder Octa war nicht in der Nähe, um ihn zu beschützen. Ihr Vater traktierte Beobrand mit zahlreichen Schlägen, schlug ihn mit Fäusten und trat ihn, nachdem er zu Boden gestürzt war, ins Gesicht und in die Rippen. Zu guter Letzt kam die düstere Vatergestalt näher und zermalmte ihm die linke Hand, sodass er laut aufschrie. Danach war er aufgeschreckt und hatte gemerkt, dass er auf seiner verletzten Hand lag und der Schorf erneut aufgerissen war.
Wie war es möglich, dass sein Vater ihm sogar von jenseits des Grabes immer noch Angst einjagte? Würde er sich denn niemals von ihm frei machen können? Er hatte geglaubt, sein Tod würde der Macht, die dieser Mann über ihn hatte, ein Ende setzen. Seine Mutter, seine Schwestern und Brüder, sie alle hatten diese Welt bereits verlassen, und es blieb ihm nur zu hoffen, dass sein Vater sie nicht auch noch in der Nachwelt peinigen konnte. Nein, das war ausgeschlossen. Außerdem war Octa bereits ebenfalls gegangen, vielleicht, um sie vor Grimgundis Gewalt zu beschützen, wie er es schon im irdischen Leben getan hatte.
Beobrand schauderte. Octas Grab befand sich ganz in der Nähe. Sein Bruder war an einem heiligen Ort gleich hinter den Dünen bestattet worden. Als er beim letzten Mal an der Grabstätte gestanden hatte, hatte er geschworen, Octas Tod zu rächen. Vielleicht sollte er zurückkehren, um ihm zu sagen, dass er Wort gehalten hatte.
»Verflucht, mein Freund? Du?« Angesichts von Beobrands Dummheit konnte Acennan nur den Kopf schütteln. »Ich scherze keineswegs, wenn ich behaupte, dass du vielmehr von den Göttern gesegnet bist. Du hast gegen Hengist gekämpft, einen der übelsten Hurensöhne, die je die Erde bevölkert haben, und nicht mehr verloren als zwei Finger. Du hast das sogenannte Elfenfieber überstanden. Du besitzt ein Schwert, das einem König zur Ehre gereichen würde, und eine Frau, für die andere Männer töten würden. Ganz zu schweigen von deinen wundervollen Freunden.« Er zwinkerte Beobrand zu. »Du hast also versprochen, Sunniva zu heiraten. Das kann doch nicht besonders schwierig sein, oder? Und falls du nicht zurückkehrst, nun, dann hast du vermutlich größere Probleme als einen gebrochenen Schwur.« Acennan zuckte mit den Schultern.
Beobrand nickte. Sein Freund hatte ja recht. Er sollte sich solchen düsteren Gedanken nicht hingeben. Das Schicksal würde ihn auf seinen vorbestimmten Weg führen. Er erhob sich und streckte Acennan die Hand entgegen, um ihn ebenfalls auf die Füße zu ziehen.
»Ich danke dir, mein Freund«, sagte Beobrand. »Ich hatte mich vergessen. Du hast recht, ich bin ein gesegneter Mann.« Dann dachte er an all die Menschen, die er im letzten Jahr verloren hatte, und es gelang ihm nur unter Mühen, sein Lächeln zu bewahren. Schnell schob er die Erinnerungen beiseite und stellte sich mit breiten Schultern hin. »Komm und zeig mir, wie du dir das mit meinem Schild vorgestellt hast«, sagte er.
Gemeinsam kehrten sie zu den Kriegern an den Strand zurück.
KAPITEL 2
Beobrand nahm Abschied und versuchte zu glauben, dass es kein endgültiger war, dass er in der Schlacht nicht sein Leben lassen würde. Doch das Omen der erloschenen Flamme machte ihn immer noch nervös. Was er auch unternahm, er konnte das ungute Gefühl des Verderbens nicht abstreifen. Sunniva schien zu spüren, dass er, solange diese Wolke aus dunklen Gedanken über seinem Haupt hing, kein guter Kämpfer sein konnte, denn sie redete nicht mehr davon. Vielleicht hatte Acennan deshalb mit ihr gesprochen. Beobrand hatte bemerkt, wie die beiden beim Fastenbrechen im Kreise von Scands Gefolgschaft, seiner Kampfgefährten und deren Frauen, die Köpfe zusammengesteckt und immer wieder zu ihm gesehen hatten. Sobald sie Beobrands kühlen Blick bemerkt hatten, hatten sie jedoch so getan, als wären sie in ein bedeutungsloses Gespräch vertieft. Aber Beobrand kannte die beiden viel zu gut.
Er beschloss, Octa einen Besuch abzustatten, bevor er sich von Sunniva verabschiedete. Nicht, dass er besonders erpicht darauf gewesen wäre, zu der Totenstätte zu gehen, doch er verspürte den Wunsch, dem Geist seines Bruders Frieden zu bringen. Die Vorstellung, sein Mord an dem eigenen Vater könnte Octas Übergang aus dieser in die nächste Welt verhindert haben, ließ ihm keine Ruhe.
Er machte sich auf gen Süden. Das Grab lag nicht weit entfernt, und er kannte den Weg. Es war ein kühler, windstiller Morgen. Sobald die Sonne höher stieg, würde es warm werden, aber zwischen den Dünen herrschte noch nächtliche Kälte. Während Beobrand durch den Sand und das Dünengras stapfte, dachte er an Bassus, den Freund seines Bruders, der ihm Octas letzte Ruhestätte gezeigt hatte. Ob er den hünenhaften Krieger jemals wiedersehen würde? Als ihre Wege sich getrennt hatten, hatte Bassus sich auf die Heimreise nach Cantware gemacht. In Beobrands Heimat. Er selbst konnte niemals wieder zurück. Der Schatten seines Vaters war dort zu groß und mächtig.
Umgekippte Grabsteine und aufrecht stehende Kreuze waren die Zeichen dafür, dass er sein Ziel erreicht hatte, und er schauderte. Seit Generationen wurden die Toten hier zur ewigen Ruhe gebettet. Es war still. Es herrschte die Ruhe derer, die schon lange nicht mehr atmeten.
Beobrand schlängelte sich zwischen den Grabstätten hindurch zu der von Octa. In dem Jahr seit seinem letzten Besuch hatte sich für ihn alles verändert, und doch stand er nun wieder hier, wieder unmittelbar vor einer Schlacht. Erneut wollte er zu seinem toten Bruder sprechen.
In den vergangenen Monaten hatte sich der Untergrund ein wenig gesetzt. Gras und ein paar Blumen wuchsen in der umgegrabenen Erde. Beobrands Schatten fiel auf das Grab, sodass die Tautropfen weniger hell glitzerten.
»Nun denn, ich habe versprochen, dich zu rächen«, sagte Beobrand. Es war ihm unangenehm, die Stille zu durchbrechen. Er wollte die, die hier ruhten, auf keinen Fall stören. Dennoch musste er sich Octas Ruhe versichern.
»Ich habe Hengist getötet«, flüsterte er. »Und ich habe mir Hrunting zurückgeholt.« Er zog das Schwert aus seiner hölzernen Scheide. Die Sonne spiegelte sich in der wunderschönen, wellenförmig geschmiedeten Klinge. Sie blitzte wie ein See im Licht der Wintersonne. Strahlend hell und dennoch kalt. Wie jedes Mal war Beobrand auch jetzt beim Anblick der Waffe ergriffen.
»Es ist die vornehmste aller Klingen, und ich werde mein Bestes tun, um sie und dein Andenken in Ehren zu halten.« Er hielt inne, wusste nicht so recht, was er noch sagen sollte. Seine Füße waren eiskalt, die Beinbinden und die Schuhe vom Tau an den langen Grashalmen durchnässt.
»Ruhe in Frieden, Bruder. Halte deine schützende Hand über Mutter, Rheda und Edita.« Er wartete auf ein Zeichen, doch nichts geschah. Kein Omen. Keine Antwort. Was hatte er erwartet? Octa musste mittlerweile nichts weiter als ein Haufen aus verfaulendem Fleisch und Knochen sein. Beobrand unterdrückte einen Schauder.
Er blieb noch einige Augenblicke am Grab stehen, während die Morgensonne ihm den Nacken wärmte. Dann nickte er ihm kurz zu und kehrte nach Bebbanburg zurück. Zu den Lebenden.
Verwundert registrierte er, dass seine Stimmung sich nach dem Besuch von Octas Grabstätte spürbar besserte. Seine Schritte waren nicht mehr so schwer. Als Sunniva sich angsterfüllt in seine Arme warf und ihr die Tränen über die Wangen rannen, brachte er sogar ein Lächeln zustande.
»Denk nicht mehr daran, was in der Dunkelheit geschehen ist«, sagte er und streichelte ihr über das Haar.
Überall um sie herum nahmen Kämpfer Abschied von ihren Lieben. Viele Ehefrauen hatten ausdruckslose Mienen aufgesetzt. Doch vor allem die jüngeren Frauen vergossen wie Sunniva bittere Tränen. In der Festung waren eifrige Vorbereitungen im Gang. Noch bevor die Sonne im Zenit stand, würde Oswald den Befehl zum Aufbruch geben.
»Die Nacht ist ein Ort der Angst«, fuhr Beobrand fort, »doch der Tag bringt Wärme und Licht. Ich bin stark. Ich habe Hrunting, einen stabilen Helm und ein Kettenhemd. Mein Schild wird mich beschützen. Dank sei dir dafür.« Acennan hatte Sunniva gesagt, was notwendig war, und sie hatte sich mit Feuereifer darangemacht, die Lederriemen so am Schildgriff zu befestigen, dass Beobrand sich nicht auf seine versehrte Hand verlassen musste, um den Lindenholzschild festzuhalten. »Darüber hinaus wird Acennan an meiner Seite stehen. Ich werde zu dir zurückkehren, das schwöre ich.«
Sunniva unterdrückte ihr Schluchzen, aber Beobrand merkte, wie ihre Tränen seinen Kittel durchnässten. Dann murmelte sie etwas, ohne dass er die Worte verstehen konnte. Behutsam schob er sie ein wenig zurück, um ihr ins Gesicht zu sehen. Obwohl es tränenfeucht und mit roten Flecken übersät war, bot sie immer noch einen liebreizenden Anblick. Ihr Haar glänzte im hellen Licht des Tages.
»Was hast du gesagt?«
»Dann werden wir heiraten, und ich schenke dir einen prächtigen Sohn«, erwiderte sie.
Der Spätsommer war die Zeit der Ernte und der Vorbereitung auf den Winter. Auf ihrem Marsch gen Süden sah Oswalds Kriegerschar zahlreiche Bauern und Leibeigenen, die das Land beackerten. Einem von einem Ochsen gezogenen Pflug folgte ein riesiger Vogelschwarm. Die Vögel jagten kreuz und quer durch die Luft und stürzten sich auf die Insekten, die aus der frisch umgegrabenen Erde krochen. Der Landmann am Pflug starrte die Krieger mit ausdruckslosem Blick an.
Die Begegnung mit ihm erinnerte sie daran, dass ihre eigenen Felder noch unbestellt waren. Wenn sie nicht schnell nach Hause zurückkehrten, würden sie die Wintergerste nicht mehr aussähen können. Es war durchaus vorstellbar, dass ein Sieg im Schildwall allmählichen Hungertod in den sich anschließenden Monaten nach sich ziehen würde.
Je weiter sie in den Süden vordrangen, desto mehr Gehöfte und Siedlungen fanden sie verlassen vor. Ob die Bewohner wegen der anrückenden Kriegerschar oder aus Angst vor den Überfällen der walisischen Banden, die regelmäßig das Land verwüsteten, geflohen waren, ließ sich nicht sagen. Manche Häuser waren niedergebrannt worden. Sie passierten auch ein großes Anwesen auf einem Hügel mit weitem Blick über die schnurgerade Römerstraße, von dessen Haupt- und Nebengebäuden nur noch verkohlte Reste übrig waren. Wie das Skelett eines riesenhaften Ungeheuers ragten die geschwärzten Stützbalken vor dem blauen Himmel empor. Oswald schickte eine Gruppe los, um die Häuser näher zu untersuchen, und die bewaffneten Krieger kehrten mit grimmigen Mienen und Trauer im Blick zurück. In der Asche hatten sie auch menschliche Gebeine entdeckt.
Oswald befahl der Kriegerschar anzuhalten und ließ die Opfer nach Art der Christusnachfolger bestatten. Einer der in dunkle Talare gekleideten Mönche, die Oswald begleiteten, sprach seine Zauberworte über den Gräbern. Oswald verfolgte die Zeremonie mit gebieterischem Blick. Viele Krieger legten die Finger an ihre Amulette und Talismane, andere machten das Zeichen des Kreuzes. Beobrand berührte Hruntings Heft und spuckte aus.
»Wenn wir alle begraben wollen, die wir unterwegs finden, werden wir nicht weit kommen.« Acennan schüttelte den Kopf. »Dann braucht Cadwallon nichts weiter zu tun, als ein paar Landmänner zu töten und sie uns in den Weg zu legen, und schon hat er alle Zeit, um zu entkommen.«
»Es sei denn, er will gar nicht entkommen«, entgegnete Beobrand.