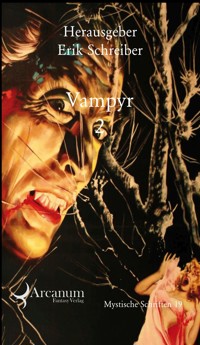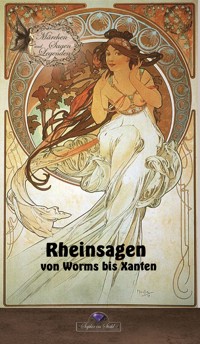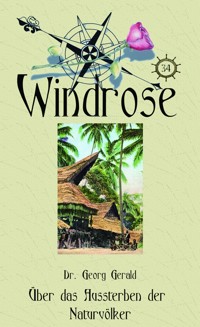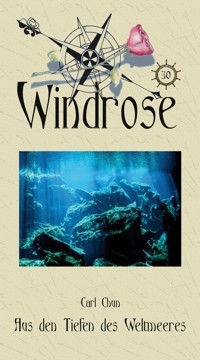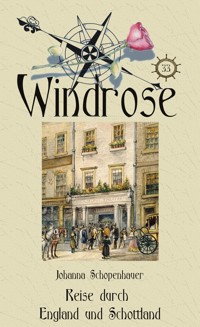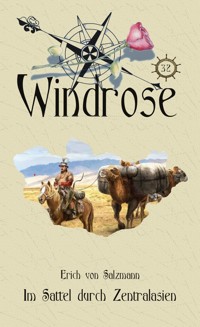4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Holtei versuchte, die deutsche Sprache gegenüber dem Französischen (aus dem damals noch die meisten deutschen Literatur- und Theaterprodukte übersetzt waren) aufzuwerten, indem er verschiedenste Dialekte verwendete. Dieses Stilmittel gab es im Französischen nicht. Die Aufwertung des Dialekts gegenüber der Hochsprache verstand er nicht zuletzt als Aufwertung des Bürgerlichen gegenüber dem Aristokratischen. Obwohl er selbst ein Angehöriger des niederen Adels war, bemühte er sich, zwischen Adel und Bürgertum zu vermitteln, statt die Konflikte zu betonen, die in den Revolutionsjahren 1830 und 1848 zum Ausbruch kamen. Das vorliegende Buch enthält sieben Kurzgeschichten, die dem Krimi-Genre ebenso der Mystery zuzuordnen sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Herausgeber
Erik Schreiber
Das grüne Abenteuerbuch 3
Karl von Holtei
Kriminal- und Schauergeschichten
e-book 223
Das grüne Abenteuerbuch 3
Karl von Holtei - Kriminal- und Schauergeschichten
Neuveröffentlichung 01.02.2023
© Herausgeber Erik Schreiber
An der Laut 14
64404 Bickenbach
Titelbild: Simon Faulhaber
Vertrieb: neobooks
Inhaltsverzeichnis
Der Henker
Ein Mord in Riga
Bella (1828)
Hugos Erzählung
Der Handkuss
Die Kröten-Mühle
Der Taubstumme
Biographie
Der Henker
1
Um einen Menschen aufzuhängen, braucht man viererlei Dinge. Erstens worüber schon die alten Nürnberger im Klaren gewesen sind den Menschen selbst; zweitens einen Galgen oder etwas dem Entsprechendes; drittens einen Strick; viertens einen Henker. An letzterem, behauptet Dumas der Vater mit der ihm eigenen Zuversicht irgendwo, sei niemals Mangel.
Diesem Axiom sehe ich mich zu widersprechen genötigt, und mein Widerspruch gründet sich zum Teil auf die kurze Erzählung, welche hier folgen soll. Ich muss den geneigten Leser im Voraus um Entschuldigung bitten für einen scheinbar frivolen und leichtfertigen Ton, der sich in der kleinen Geschichte hier und da kundgeben möchte. Er entspringt keineswegs aus verhärtetem Gemüt und will durchaus nicht etwa so frech sein, blödsinnigen Scherz zu treiben mit dem Furchtbarsten und Schauerlichsten, was unserer geselligen Zustände eherne Notwendigkeit gebietet, mit der Todesstrafe.
Im Gegenteil, er will unter leichtem Gewande düstern Ernst verbergen, er will versuchen, manchen Gedankenlosen, der zu bequem oder zu zerstreut wäre, selbst darüber nachzusinnen, auf die grässlichen Gegensätze hinzuweisen, die das selbstsüchtige Leben bildet neben einem drohenden Tode durch Hinrichtung. Die Begebenheit ist wahr. Nur an den Mängeln der Darstellung und an der Ungeschicklichkeit des Verfassers könnte es liegen, wenn sie poetisch unwahr erschiene.
Die Stadt Grundau befand sich in fieberhafter Aufregung. Eines bemittelten Bürgers Tochter, ein Mädchen von vielleicht vierzehn Jahren, war verschwunden, ohne irgendeinen wahrscheinlichen Grund ihrer Entfernung, ohne Spur von Wahrscheinlichkeit, sie wieder ausfindig zu machen. Nach acht Uhr des Abends hatte sie ihrer Mutter gute Nacht gesagt und sich unter dem Vorwand heftiger Kopfschmerzen in ihr Schlafzimmer begeben, welches wie sämtliche Gemächer der ländlichen Sommerwohnung zu ebener Erde gelegen war und dessen Fenster nach der hinteren Seite des kleinen Gartens hinausging. Um zehn Uhr war der Vater aus der Stadt gekommen und hatte, bevor er sich schlafen legte, noch einen Blick in Hannchens Stübchen werfen wollen, wie er gewöhnlich zu tun pflegte, weil das Mädchen seinem Verbote zuwider gern im Bette las und er immer befürchtete, sie könne einmal einschlafen, ehe die Kerze gelöscht sei, und dadurch ein Unglück herbeiführen.
Nachdem er sich überzeugt, dass nichts zu besorgen sei und sich schon zurückziehen wollte, entdeckte er, aufmerksam gemacht durch den ins Fenster flimmernden Sternenschein, die offenstehenden äußern Jalousien und fand, näher hinzutretend, auch die inneren Glasflügel nur angelehnt. Er schalt über diese Nachlässigkeit so laut, dass die Mutter es vernahm und mit der Nachtlampe in der Hand hereintrat. Da sahen sie denn ihrer Tochter Bett unberührt, sie selbst war weder im Haus noch im Garten zu finden. Die ganze Nachbarschaft wurde alarmiert. Niemand hatte das Mädchen gesehen. Hannchen war verschwunden.
Mit schwerem Herzen nur entschloss sich der tiefbekümmerte Vater am nächsten Morgen, die Hilfe der Sicherheitsbehörden in Anspruch zu nehmen und dort eine Anzeige niederzulegen, welche den guten Ruf seiner Tochter unwiederbringlich vernichten musste. Die erste Frage, vom Beamten an ihn gerichtet, suchte natürlich zu erforschen, ob ihm bei seinem Eintritt ins Schlafzimmer nicht ein noch so unbedeutender Umstand aufgefallen sei, der sich mit was immer für ein vorhergegangenes Ereignis oder auch nur mit einer unwillkürlichen Äußerung des Mädchens in Verbindung bringen ließe, und wodurch man auf eine folgerichtige Vermutung geleitet werden könne, die weitere Schritte möglich mache.
Auf diese Frage erfolgte zunächst eine gänzlich unbefriedigende Antwort, wie Menschen sie geben, welche von einem unerwartet hereingebrochenen Unglücksfall betäubt und verwirrt sind. Erst nach und nach vermochte der in seinem reinsten Gefühle, in seiner menschlichsten Neigung verratene Vater sich einigermaßen zu sammeln und ging, von der ruhigen Haltung des erfahrenen Beamten gleichsam gestützt, alle Eindrücke des vergangenen Abends in der Erinnerung noch einmal durch. Da besann er sich endlich, dass bei seinem Eintritt in das dunkle Schlafgemach ein fremdartiger Wohlgeruch, wie von parfümierten Haaren herrührend, ihn unangenehm befallen, auch dass er sich vergeblich zu erinnern bemüht habe, wo und an wem er solchen ihm besonders widerlichen Modeduft schon sonst bemerkte; dass er jedoch in diesen Bemühungen unterbrochen worden sei durch die furchtbare Entdeckung, die gleich darauf erfolgte, und dass er auch heute noch nicht anzugeben vermöge, ob wirklich ein ihm Bekannter ähnliches Haaröl benütze oder ob er von seiner Einbildung getäuscht werde. Außerdem wusste der unglückliche Mann keinen Menschen zu nennen, gegen welchen er nur im entferntesten einigen Argwohn wegen Teilnahme an Hannchens Flucht oder wegen Entführung des Mädchens zu hegen berechtigt sei; und somit blieb der Behörde nichts übrig, als ihm ihrerseits die tätigsten und umfassendsten Nachforschungen zu versprechen und ihm einstweilen Geduld anzuempfehlen.
Unter umsichtig getroffenen, dennoch fruchtlosen Maßregeln war der ganze Tag vergangen. Der Polizeikommissar, dem die Untersuchung dieser höchst rätselhaften Begebenheit übertragen worden, empfing noch spät in der Nacht sämtliche darauf Bezug habende Berichte, die übereinstimmend dahin lauteten, dass auch nicht die kleinste Spur der Verlorenen zu entdecken sei. Dann legte er sich, ermüdet von seinen eigenen Anstrengungen und vielen vergeblichen Irrwegen, die er in seinem Diensteifer den Tag über gemacht, zur ersehnten Ruhe nieder. Eine Stunde nach Mitternacht wurde er unsanft aus dem ersten Schlafe geweckt. Hannchens Vater stand vor seinem Lager.
„Ich hab' ihn, den Verführer, den Räuber meiner Tochter. Treffen Sie eiligst Anstalten, ihn gefangenzunehmen; er muss gestehen, wo er sie verborgen hält!“
Der Kommissar wischte sich den schweren Schlaf aus den Augen und ermunterte sich mit sichtbarer Freude. Eiligst sprang er empor, sich anzukleiden, und forderte jenen auf, unterdessen in seinen Mitteilungen fortzufahren.
„Seitdem ich Sie verließ, Herr Kommissar, hab' ich keine Minute zugebracht, ohne darüber nachzusinnen, welcher von unseren Bekannten sich das Haar mit dem bewussten Öl zu salben pflegte, dessen Geruch mir immer so unangenehm war. Jetzt endlich, vor einer halben Stunde, ist mir's auf einmal vors Gedächtnis getreten, dass es der ehemalige Klavierlehrer meiner Tochter gewesen ist, ein Herr Richers, den meine Frau seit einem halben Jahr entlassen hat, weil es ihr vorkam, als herrschte ein allzu vertraulicher Ton zwischen diesem Zierbengel und dem heranwachsenden Mädchen. Ich hatte freilich keine Gelegenheit, sein Benehmen zu beobachten, da mich meine Geschäfte verhinderten, bei den Lektionen gegenwärtig zu sein; aber ich willigte gern in einen Wechsel des Musikmeisters, schon deshalb, um den penetranten Wohlgeruch nicht mehr zu atmen, der am Abend nach jeder Lehrstunde unsere Zimmer erfüllt und den ich gestern seit jener Frist zum ersten Male wieder gespürt habe. Nur der unverschämte Richers, kein anderer, hat die Hand im Spiele, und ich bitte Sie flehentlich, den Verbrecher sogleich verhaften zu lassen, ehe er sich vielleicht durch die Flucht rettet. Hannchen muss bei ihm sein, er hält sie sicher verborgen.“
„Ich kenne Herrn Richers“, erwiderte der Kommissar, „und kenne zufällig auch die Familie genau, welche ihm ein Zimmer ihrer Wohnung zur Miete überlässt. Es ist platterdings unmöglich, dass er dort ein Frauenzimmer heimlich beherberge; und ebenso unmöglich ist es, dass er etwas Ähnliches mit Vorwissen der Hausbewohner zu tun wage. Ohne Zögern glaub' ich Ihnen mit meiner Amtsehre verbürgen zu dürfen, dass Ihre Tochter sich dort nicht befindet.“
„Nun so weiß er doch, wo sie versteckt ist. Nur er kann es entdecken, und er muss es, wenn Sie ihn augenblicklich festnehmen und mit unerbittlicher Strenge gegen ihn verfahren.“
„Ehe wir einen Menschen wie einen Räuber überfallen und ins Gefängnis sperren, müssen denn doch andere Verdachtsgründe gegen ihn vorliegen als der Geruch eines Haaröles, welches höchst wahrscheinlich in jedem Parfümerie-Laden verkäuflich, folglich jedem zugänglich ist, der Neigung hat, es zu benützen. Mag Herr Richers ein wenig Geck und Stutzer sein, er ist sonst ein fleißiger, ordentlicher Jüngling, der sich redlich ernährt. Zu einem so voreiligen Schritte, wie Sie von mir begehren, könnte ich mich nicht entschließen, bevor nicht unzweideutige Anzeigen beweisen, dass er auf irgendeine Art an der Flucht Ihrer Tochter beteiligt sei. Das wird sich morgen finden, und ich werde nichts aus der Acht lassen, die von Ihnen geahnte Spur so eifrig zu verfolgen, als ob ich selbst Ihren Argwohn teilte, was freilich durchaus nicht der Fall ist.“
„Aber bis es wieder Tag wird, kann der Verbrecher entflohen sein!“
„Zum Entfliehen hat er seit vorgestern Abend Zeit gehabt, wenn er sich durch die Flucht retten zu müssen wähnte, obschon ich nicht begreife, wieso Sie ihn eigentlich beschuldigen. Denn entweder ist er mit Ihrem Kinde entwichen, und dann finden wir ihn jetzt gewiss nicht in seiner Wohnung; oder Ihr Kind ist ohne ihn entwichen und dann weiß ich nicht, warum ich denjenigen als Mitschuldigen verhaften soll, dem das Mädchen (wenn es anders eine Neigung dafür hegte), aus dem Wege ging und davonlief. Es ist in dieser Zusammenstellung kein Menschenverstand trotz aller Haaröle und Parfümerien; deshalb ersuch' ich Sie, mir die wenigen Stunden des Schlafes zu gönnen.“
Zornig verließ der Vater den Kommissar und eilte geraden Weges zum öffentlichen Ankläger, den er herauspochte. Bei diesem fand er mit seiner sinnreichen Kombination willigeres Gehör. Wo jener erste Beamte prüfende Kälte einer vieljährigen Praxis ihm entgegengestellt, ergriff der zweite die Sache mit dem feurigen Eifer eines jugendlichen Theoretikers und ging sogleich leidenschaftlich auf alle Möglichkeiten ein. Ihm schien Richers nicht unbekannt. Ja, er gab sogar einen gewissen Groll gegen den Musiklehrer zu erkennen, aus welchem etwas wie Triumph hervorleuchtete, gerade diesen Menschen auf irgendeiner Untat zu ertappen. Deshalb wurden auch seinerseits die Bedenklichkeiten des Kommissars für lächerlich erklärt und augenblickliche Haussuchung und Verhaftung angeordnet, wobei Hannchens Vater Augenzeuge zu sein die Berechtigung erhielt.
2
Das Benehmen des Musiklehrers ließ keinen Zweifel, diesmal habe den alten Praktiker, den Polizeicommissair, sein Scharfblick getäuscht. Bleich, zitternd, stammelnd, fand er kaum Worte, die ihm gestellten Fragen zu erwidern, strafte sich selbst Lügen, indem er anfänglich behauptete, die Ursache dieses nächtlichen Überfalls ebenso wenig zu ahnen, als er Kenntnis erlangt habe von seiner ehemaligen Schülerin Verschwinden. Gleich darauf aber entschlüpfte ihm die Äußerung, er habe sie dringend abgemahnt von der wahnsinnigen Idee einer Flucht. Er verwickelte sich dermaßen in Widersprüche, dass alle Schritte gegen ihn, auch die Verhaftung, hinreichend gerechtfertigt waren.
Nachdem der Beklagenswerte einigermaßen die Besinnung wiedergefunden, legte er vor dem Untersuchungsrichter ein sogenanntes offenes Bekenntnis, wie er es nannte, ab. Dieses lautete so:
„Meine ehemalige Schülerin, von jüdischen, wenngleich schon vor des Mädchens Geburt getauften Eltern abstammend, zeichnet sich vor allen Christentöchtern gleichen Alters durch eine jenem Volke gemeinsame, frühzeitige Entwicklung aus. Soviel ich weiß, erkennt das Gesetz darin keinen Unterschied; aber obgleich sie kürzlich erst ihr vierzehntes Jahr vollendet hat, war sie, im Vergleich mit andern Kindern dieser Stadt, schon vor einem halben Jahre nicht mehr als eine Unmündige zu betrachten. Außerdem hatte sie von frühester Jugend an schon eine Masse verwirrender, moderner Schriften gelesen und sich dadurch in ein verkehrtes, phantastisches Wesen verstiegen, welches mich, den sie durchaus nicht als Lehrer, sondern vielmehr als Geliebten behandeln wollte, in große Verlegenheit brachte. Gerade als ihre Mutter sich bewogen fand, mir die Lektionen aufzukündigen, war ich im Begriffe gewesen, um meine Entlassung zu bitten, weil ich mir doch nicht Festigkeit genug zutraute, auf die Länge jedes unbewachten Augenblickes Herr zu bleiben. Ich wünschte folglich die Trennung. Aber ich muss eingestehen, dass sie nur scheinbar erfolgte; denn von dem Tage an, wo ich die Klavierstunden abbrach, fand Hannchen unzählige Gelegenheiten, mir auf meinen Wegen zu begegnen und fast täglich ein Gespräch mit mir anzuknüpfen, dass ich erstaunen musste, wie es ihr möglich sei, so häufig die Aufmerksamkeit ihrer Mutter zu täuschen und immer schlaue Vorwände zu erfinden, die ihr gestatteten, auf meiner Fährte umherzustreifen. Einige Male war ich schon nahe daran, den Eltern einen Wink davon zugeben wollte Gott, ich hätte es nicht aus törichter Eitelkeit, die sich durch des hübschen Mädchens zärtliche Worte doch wieder geschmeichelt fühlte, unterlassen! Vielleicht stünde ich dann nicht hier. Bis vor etwa acht Tagen zog sich unser Verhältnis in der hier geschilderten Weise hin, ohne dass von ihrer Seite etwas Entschiedenes geschehen wäre. Als wir uns zum letzten Male auf der Straße begegneten, flüsterte sie mir zu, sie werde am Abend des nämlichen Tages in der Dunkelstunde mich auf meinem Zimmer besuchen. Ehe ich ihr noch sagen konnte, wie gefährlich dies sei und wie, wenn meine Wirtsleute ihre Gegenwart bemerkten, daraus die traurigsten Folgen für uns beide entstehen könnten, war sie verschwunden. Und hier beginnt meine Schuld. Anstatt ihre Eltern zu warnen, anstatt wenigstens meine Tür zu schließen und mich zu entfernen, blieb ich, ihrer harrend, daheim. Es war wirklich, als ob ein böser Geist vorsorglich jede gefahrdrohende Schwierigkeit aus dem Wege geräumt habe. Meine Wirtsleute hatten eine Landpartie unternommen und blieben über Nacht aus. Ich befand mich ganz allein in der leeren Wohnung. Wahrscheinlich hatte Hannchen davon Kenntnis erhalten und deshalb diesen Abend gewählt. Sie stellte sich erst ziemlich spät ein, als ich sie schon längst nicht mehr erwartete. Sie leugnete nicht, dass ihre Eltern bereits zu Bette lägen und dass sie durchs Fenster ihres Schlafzimmers entwischt sei. Auf meine ängstlichen Zweifel über die unerhörte Kühnheit eines solchen Schrittes gab sie zu verstehen, es sei heute nicht zum ersten Male, dass sie ihn wage, und nicht jeder junge Mann so zurückhaltend wie ich. Diese Keckheit bei einem so jugendlichen Geschöpfe schreckte mich zurück und verscheuchte alle anmutigen Bilder und Gedanken, die sich meiner vorher ich will es nicht verhehlen, doch bemächtigt hatten. Sie machte mir Vorwürfe über meine Kälte; ich erwiderte dieselben durch Vorwürfe über ihren Leichtsinn und gab ihr zu verstehen, ich müsse nun befürchten, dass ich nicht der einzige, nicht der erste sei, dem sie sich auf unjungfräuliche Weise an den Hals werfe. Dazu lachte sie nur, ging sodann in extravagante Erklärungen von poetischer Leidenschaft über, faselte allerlei Reminiszenzen aus halbverstandenen, überschwänglichen Dichtungen durcheinander, sprach von der Emanzipation des Weibes und machte mir zuletzt den Antrag, mit mir zu entfliehen. Dadurch scheuchte sie mich immer mehr von sich, so dass es mir geradezu unmöglich wurde, eine zärtliche Empfindung für sie zu fühlen oder auch nur zu heucheln. Ich beschwor sie, mich zu verlassen und heimzukehren. Sie brach in Schmähungen wider mich aus und versicherte unter anderem, meine Lieblosigkeit verleide ihr das Dasein und sie sei entschlossen, sich den Tod zu geben. Dann wieder jammerte sie über ihr Unglück, über die Schmach, die sie ihren Eltern bringen werde. Meine Angst stieg mit jeder Minute. Ich bat sie, flehentlich, sie möge mich verlassen. Ich machte sie glauben, der Morgen sei nahe. Endlich gab ich ihr, nur um sie fortzubringen, das Versprechen, sie an einem der nächsten Abende in ihrem Gärtchen zu erwarten, worüber sie mir förmlich einen Eidschwur abzwang. Dann ergriff sie rasch ein Fläschchen jener bereits vor Gericht erwähnten Haaressenz vom Nachttisch, um, wie sie sich ausdrückte, dadurch, auch entfernt von mir, an mich erinnert zu werden. Was weiter geschehen, weiß ich nicht. Ich habe vermieden, die ihr versprochene Zusammenkunft im Garten herbeizuführen. Als ich hörte, dass sie vermisst werde, pries ich das Schicksal, welches mich von jeder Mitwisserschaft ihrer Flucht fernhalte. Ich erinnere mich deutlich ihres Geständnisses, dass jene bei mir zugebrachte Nacht nicht die erste gewesen sei, welche sie außerhalb ihrer Eltern Hause zugebracht, und ich hoffte sicher zu sein, dass ich auf keine Weise in diese gefährliche Geschichte verwickelt werden dürfte. Desto furchtbarer überraschte mich das unerwartete Eindringen der Beamten, welche mir meine Verhaftung ankündigten, und nur dieser Überraschung, diesem Schreck ist es zuzuschreiben, dass ich die Wahrheit nicht sogleich sagte, wie ich sie jetzt zu den Akten gegeben habe.“
Der Untersuchungsrichter verriet durch sein spöttisches Lächeln, dass er in diese Wahrheit keinen besonderen Glauben setze. Doch nachdem er den Gefangenen mehrfach vergebens aufmerksam gemacht, wie unwahrscheinlich die Erzählung klinge und um wie viel klüger es sein würde, durch unumwundene Geständnisse späteren unausbleiblichen Enthüllungen reumütig zuvorzukommen, schloss er das erste Verhör und entließ jenen, ohne auf wiederholte Gegenversicherungen weiter zu achten.
3
Kein Mensch in ganz Grundau (sogar die näheren Bekannten des Herrn Richers) glaubte nach Verlauf einiger Tage etwas anderes, als dass es sich hier um eine abscheuliche Mordtat handle. Der öffentliche Ankläger gestand unverhohlen, dass er nicht daran zweifle. Und demgemäß wurde alles aufgeboten, den üblen Leumund des Angeschuldigten zu bekräftigen und ihn als einen Menschen darzustellen, zu welchem man sich „einer solchen Tat versehen könne“. Dies gelang nun freilich gar nicht, denn trotz aller Bemühungen konnte eigentlich nichts Verdächtigendes bewiesen werden. Aber Herr Streber dies war der Name seines Verfolgers, ließ nicht los, entdeckte immer neue Quellen, aus denen die unverbürgten Gerüchte über Richers geschöpft werden konnten; lauschte darauf, leitete fernere Mutmaßungen daraus her, trieb den Untersuchungsrichter dringend an und entwickelte bei dieser Angelegenheit eine so feindselige Ungeduld, dass jeder, der den edlen Charakter dieses vortrefflichen Herrn nicht besser kannte, zu wähnen versucht wurde, irgendein persönlicher Hass sei es, welcher ihn ansporne. Doch ein solcher Wahn musste sich bald als Irrwahn ausweisen, wenn zur Sprache kam, die beiden Männer hätten sich nie gesehen, niemals ein Wort gewechselt, wären sich nie und nimmer im Leben begegnet.
Richers äußerte selbst in einem der späteren Verhöre: „Gott mag wissen, was diesen Menschen veranlasst, mich so unerbittlich zu verfolgen, denn ich bin mir keiner Schuld gegen ihn bewusst.“
„Desto sicherer dürfen Sie überzeugt sein“, erwiderte der Untersuchungsrichter, „dass Herr Streber nur seinem Pflichtgefühl folgt, um Sie ...“
„Um mich ins Elend, womöglich in den Tod zu bringen“, unterbrach der Inquisit. „Ja, Herr Rat, davon bin ich nachgerade überzeugt. Herr Streber, in seiner neuen Laufbahn, strebt nach Ehren und Ruf; ich soll eine Stufe werden in der Treppe, auf welcher sein Fuß emporsteigt!“
„Nun, nun“, sagte der alte, würdige Rat, „so rasch geht das nicht. Da müssen wir auch dabei sein.“
„Aber die Geschworenen“, rief Richers.
„Ja, die!“, seufzte der Rat. „Freilich, die sind leicht zu verblenden durch eine sogenannte schöne Rede ... doch vor allen Dingen müssen wir das Corpus delicti haben, und ehe nicht des Mädchens Leichnam aufgefunden ...“
Richers fuhr empor wie ein Rasender: „Immer wieder dies schauderhafte Wort! Heilige Gerechtigkeit, wie oft soll ich denn noch bei Gott im Himmel beschwören, dass ich nichts von Hannchen gehört und gesehen, seitdem sie mein Zimmer verließ? Niemand glaubt mir; ich soll ein Mörder sein! Man will mich dazu machen; so sei's denn!“
Der Rat ließ den Verzweifelnden wieder in den Kerker zurückführen. Diese Auftritte wiederholten sich. Unterdessen waren Wochen vergangen. Während dieser Frist hatte Streber nichts versäumt, seinen Zweck zu erreichen. Unermüdlich in Nachforschungen, hatte er sämtliche Behörden der Umgebung aufgeboten, und seit vielen Jahren mag in den Umgebungen von Grundau nicht so emsig nach einem menschlichen Wesen gesucht worden sein als nach jenem Leichnam, an dessen Wiederauffinden Leben oder Tod des Musiklehrers hing.
Schon verzweifelte Streber, seine Anstrengungen durch Erfolg gekrönt und den eklatanten Fall als schändlichen Meuchelmord vor die Assisen gebracht zu sehen, sich als Rächer hingeopferter Unschuld siegreich plädieren zu hören, sein jugendliches Amt mit einem Todesurteil schmücken zu dürfen. Und diese Befürchtung machte ihn missmutig, raubte ihm den heiteren Sinn, dessen er sich stets als ein angenehmer, belebender Gesellschafter gerühmt.
Vier Wochen und darüber hatte Richers bereits im Kerker geschmachtet, als die Leiche der Verlorenen in einem kleinen schilfumwachsenen See unweit der Stadt aufgefunden ward. Die Ärzte begannen ihre wissenschaftlichen Untersuchungen, und das Ergebnis derselben genügte, einen Tatbestand zusammenzustellen, dessen Gewicht über den verbrecherischen Täter die furchtbarste Verdammnis verhängen musste. Dass dieser Täter nach seinen eigenen, wenn auch noch so unvollständigen Bekenntnissen kein anderer sein könne als Richers, davon hielt sich Streber wirklich fest überzeugt und verfuhr solcher Überzeugung gemäß. Unglücklicherweise für den Angeklagten misslangen letzterem seine Versuche, durch Zeugen zu beweisen, dass er am Abend, wo Hannchen verschwand, unmöglich in ihrer Nähe gewesen sein könne. Niemand wollte ihn da gesehen haben, wo er gewesen zu sein versicherte. Diejenigen, die sich etwa noch am günstigsten für ihn äußerten, sagten aus, sie könnten nichts Bestimmtes erklären; möglich wär' es, dass er sich da oder dort gezeigt, aber sie hätten weiter nicht darauf geachtet. Und seine Wirtsleute konnten nicht leugnen, dass er spät heimgekehrt und des andern Tages sichtbar verstört gewesen sei.
Auf diese Weise kam die Sache endlich vor die Geschworenen, und des öffentlichen Anklägers große Rede war ein solches Meisterwerk von Rhetorik, schilderte die reine, kindliche Unschuld des grausam verführten, barbarisch gemordeten Opfers, die Verzweiflung liebender Eltern, die Schwärze der Tat mit so hinreißender Gewalt, dass kein Herz unerschüttert, kein Auge trocken blieb. Die Gegenrede des Verteidigers ließ kalt. Man fand sie überladen von Sophismen und schlauen Verdrehungen. Als aber gar der Angeklagte das Wort zu ergreifen und an die Gerechtigkeit der Herren Geschworenen zu appellieren versuchte, da entstand ein lautes, unwilliges Murren, und einige der Tugendhaftesten wendeten sich empört von dem heuchlerischen Scheusal ab.
Die Beratung war kurz. Das „Schuldig“ ward vollstimmig ausgesprochen.
Der Gerichtshof fällte sein Urteil gleich darauf, und dieses lautete auf Tod durch den Strang.
Richers zuckte mit den Achseln, sah hilflos um sich her, hob dann sein Auge empor und verbeugte sich schweigend.
Als Herr Streber den Saal verließ, empfingen ihn von allen Seiten bewundernde Glückwünsche und Huldigungen für seinen herrlichen Vortrag.
4
„Du siehst in mir einen Feldherrn“, rief er daheim seiner Frau, der schönen Angelika, entgegen, die ihn des Abends mit der Mittagssuppe erwartete. „Einen Feldherrn, der seine erste entscheidende Schlacht gewonnen, der den Sieg der Tugend und Moralität über das Laster davongetragen hat. Das Todesurteil ist gefällt, die Bestätigung kann nicht ausbleiben, nun komm' und lass uns essen.“
„Also der Unglückliche muss sterben?“, fragte Angelika, indem sie ihrem Gemahl vorlegte.
„Unglücklich“, erwiderte Streber fast vorwurfsvoll; „unglücklich nennst du ihn? Wie willst du dann die schändlich Hingemordete, wie willst du die armen Eltern nennen, die das einzige Kind beweinen? Diese sind unglücklich. Dem Missetäter geschieht noch immer zu wenig, wenn er sein niederträchtiges Leben verliert.“
„Aber“, fragte Angelika weiter, „ist es denn auch ganz gewiss, dass er die Tat begangen ich meine, dass er jenes Mädchen ermordet hat?“
Diesmal antwortete ihr Gatte ruhiger, mit stolzer Würde: „Ich hab' es bewiesen, Angelika! Und niemand wagte, meine Gründe zu bezweifeln, niemand, als nur ein antediluvianischer Richter, wie ich vernahm, ein Separat-Votum abgeben wollte, natürlicherweise jedoch überstimmt und zum Schweigen gebracht wurde. Das klebt noch an dem alten Sauerteig von Notwendigkeit eines Eingeständnisses und derlei abgenütztem Formelkram. Torheiten! Da könnten sie lange warten, bis solch ein depravierter Verführer und Weiberjäger, solch ein abgehärteter Frevler in sich geht und Bekenntnisse ablegt. Diesem Burschen ist nichts heilig, für ihn gab es keine Rücksichten; hat er sich doch erfrecht, seinen Blick bis zu ...“
Hier hielt Herr Streber plötzlich inne. Er fürchtete, mehr gesagt zu haben, als dienlich war, weil ihm wünschenswert schien, dass Angelikas Teilnahme für den dem Henker verfallenen Musiklehrer nicht weiter angeregt werde. Er schien zu fürchten, die junge Frau könne dringendere Nachforschungen anstellen. Doch zum Glück hatte sie des Gatten letzte Worte, die er, mit vollem Munde essend, undeutlich vorgebracht, nicht recht verstanden, und sie legte weiter kein Gewicht darauf, gab vielmehr dem Gespräche bald eine andere, vom Galgen und dessen Kandidaten ableitende Wendung.
Streber, wie immer voll zarter Aufmerksamkeit für sie, suchte so lebhaft wie möglich zu sprechen, verfiel aber, nachdem er sich gesättigt, gegen seinen Willen von Zeit zu Zeit in ein nachdenkliches Schweigen. Einige Male versuchte Angelika, ihn ins Gespräch zurückzulocken; dann jedoch, als sie erst zu bemerken meinte, dass es ein bedeutender Gegenstand sein müsse, der den eifrigen Geschäftsmann so mächtig in Anspruch nehme, gönnte sie ihm Ruhe und beobachtete staunend und verstummend die Veränderung, die unterdessen in seinem Antlitz vorging und seinen sonst angenehmen, stets freundlichen Zügen Ausdruck verlieh. Sie erschrak endlich vor ihm, wie er da mit sich selbst zu reden begann und einzelne Worte murmelte, von denen sie nur wenige verstand, als: „Todesurteil wenn es nicht bestätiget würde? Doch, es muss! Hoffen wir das Beste!“
Dergleichen aufregende Gedanken begleiteten den vortrefflichen Rechtsgelehrten in seinem nächtlichen Schlummer. Wahrscheinlich zeigte ihm ein beruhigender Traum freudige Erfüllung seiner Wünsche; denn neu belebt, erwachte Herr Streber zu rüstigem Wirken, und die schöne Angelika wurde nicht mehr durch düstere Monologe geängstigt.
Alle zweckdienlichen Anstalten waren getroffen, alle hohen Verbindungen in der Residenz benützt, alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die ersehnte Bestätigung des Urteils möglichst rasch herbeizuführen. Streber sah in der Exekution eine strahlende Glorie für sich und seine Stellung voraus. Welches Aufsehen musste nicht diese Hinrichtung in einer Stadt machen, wo seit einem halben Jahrhundert niemand gehängt worden war! Und nun gar an einem Menschen, welcher sozusagen der Künstlerwelt angehörig, allgemein bekannt, durch seine musikalischen Lektionen mit manchen angesehenen Häusern mehr oder weniger in Verbindung stand! Ein schöneres Exemplar konnte sich der ehrgeizige, öffentliche Ankläger kaum wünschen. Räuber, Mordbrenner und Mörder gewöhnlicher Gattung verhielten sich zu solchem Verbrecher wie ein plumpes alltägliches Schlachttier zum seltensten, feinsten Wildbret. Es war der eigentliche haut goût der Kriminaljustiz, der sich hier regte und der täglich wuchs, je näher die Aussicht rückte, ihn zu befriedigen.
Wie ein Donnerschlag traf daher den Erwartungsvollen die zufällig an ihn gelangende Kunde, dass die Stadt seines Wirkens gerade denjenigen Diener der Gerechtigkeit entbehre, der in diesem Augenblick für ihn zum wichtigsten wurde. Seit dem Absterben des alten Henkers war diese Stelle unbesetzt geblieben. Der Verblichene hatte keine männlichen Erben hinterlassen, ein Fremder hatte sich zu dem schlecht dotierten Posten nicht gemeldet, und die städtischen Behörden hatten, da es nicht in den Gewohnheiten der Grundauer lag, sich gegenseitig umzubringen, das Fehlen des rächenden Würgeengels bisher nicht empfunden.
Nun war guter Rat teuer. Die amtlichen Berichte des Gefängnisarztes lauteten dahin: Richers befinde sich recht übel, sei schwer krank, welke langsam dahin, und es stehe zu besorgen, dass eine höhere Macht der irdischen Gerechtigkeit vorgreifen werde. Ein im Kerker auf seinem Lager wie jedes gewöhnliche Menschenkind sterbender Mörder welche Satisfaktion konnte diese Todesart dem unermüdlichen Streber gewähren? War es dann nicht eine seltene, mühsam gepflegte und erzogene Frucht, die unreif und ungenießbar vom Baume fiel? Jetzt verwandelte sich des Mannes ungeduldige Sehnsucht nach Erledigung des schwebenden Ausgangs in ängstliche Besorgnis, dass dieselbe sich verzögern könne, ehe noch der hilfreiche Arm gefunden sei, welcher sie vollziehe; dass der Verbrecher boshaft genug sein könne, inzwischen ungehangen zu sterben!
Was tut ein Schauspielunternehmer, wenn er eine große Prachtoper darstellen will, und es fehlt ihm der Heldentenor? Er bemüht sich um einen Gast und scheut keine Kosten.
In Landwinkel, sagte man, befinde sich ein disponibler junger Mann, der dort bei seinen Eltern lebe, auf den Tod des schwachen Vaters wartend, um dessen Platz dereinst einzunehmen. Von diesem hieß es, er habe in ähnlichen Fällen schon mehrfach aus der Not geholfen. Sich dieses Nothelfers beizeiten zu versichern, schien wichtig. Schriftlich hätten die Unterhandlungen lange gedauert. Streber zog es vor, nach Landwinkel zu reisen. Das Wetter war schön, Landwinkel nur dreizehn Meilen entfernt er kam um Urlaub ein, welcher dem Vielbeschäftigten gern erteilt wurde.
Dass er seine junge, schöne Frau nicht allein zurücklassen mochte, begreift jeder, dem ein gleicher Schatz zuteil ward und der nur einiges Talent für Eifersucht in den Ehestand mitgebracht.
Angelika begleitete ihren Gemahl auf der Fahrt nach Landwinkel natürlich ohne ahnen zu dürfen, wem der Besuch gelte. Es war nur die Rede von einer Lustfahrt, auf der nebenbei mehrere kleine Geschäfte zu ordnen wären.
5
Landwinkel ist eine allerliebste Stadt. Die Umgegend hat nicht gerade besondere Reize, wenigstens für jene nicht, die sich der Natur durchaus nicht zu freuen vermögen, wo große Berge fehlen. Nur ein Hügel ist in der Nähe, und dieser heißt, garstig genug, der Galgenberg. Auch finden sich auf diesem Gipfel Überreste des ehemaligen Hochgerichtes; was jedoch die städtischen Einwohner keineswegs abhält, ihre Spaziergänge nach den bemoosten Ruinen zu richten und von dort sich an der heiteren Aussicht in Flur und Feld zu ergötzen.
Dort standen auch Herr Streber und Angelika am Abend ihrer Ankunft beim reinsten Sonnenuntergang. Angelika fand die Ruinen romantisch, so lange, bis dem Gatten ein erklärendes Wort über die ehemalige Bestimmung dieser Mauern entwischte. Dann schüttelte sie sich, klagte über feuchte Abendluft und ersuchte den gefälligsten aller Ehemänner, mit ihr ins Hotel zurückzukehren. Kaum war sie dort in ihrer Bequemlichkeit heimisch geworden, kaum hatten sie ein leichtes Abendbrot miteinander verzehrt und Angelika das reinliche Nachtlager bestiegen, als Streber sich noch einmal zum Ausgehen rüstete.
„Jetzt?“, fragte die ängstliche Frau halb im Schlafe. „So spät?“
„Ich muss, mein Engel! Ich darf nichts versäumen. Was heute noch geschieht, braucht morgen nicht getan zu werden.“
Sorgfältig verschloss er die Eingangstür zum Vorflur, nachdem er sich versichert hatte, dass die Verbindungstüren der glücklicherweise unbesetzten Nebenzimmer gleichfalls fest verschlossen und weder Gefahren noch Schrecknisse für seine geliebte Schläferin zu befürchten waren. Dann verließ er, um unbemerkt zu bleiben, so rasch wie möglich das Gasthaus, lief ein Stückchen Weges, knüpfte fast schüchtern in dunkler Gasse ein flüsterndes Gespräch mit irgendeinem verdächtig aussehenden Herumtreiber an und verlor sich, durch diesen belehrt, in öde, wenig bewohnte Gefilde, wo in menschenleerer Vorstadt vereinzelte Häuser durch weite Zwischenräume voneinander gesondert standen.
Angelika schlief unterdessen aber sie träumte auch. Wir wissen nicht genau anzugeben, was und von wem. Wir hegen nur die bescheidene Vermutung, dass es nicht ihr Gatte gewesen sei, der im Traume ihr beglückend erschien. Wir wiederholen nur, was ihre besten, innigsten Freundinnen behaupteten, wenn wir berichten, sie habe sich ohne sonderliche Neigung vermählt, nur um sich zu verheiraten.
„Der gute Streber“, so pflegte sich eine treue Jugendgespielin zu äußern, „der gute Streber weiß wohl, warum er eifersüchtig ist und warum er meiner teuersten Angelika nicht über den Weg traut.“
„Jawohl“, fügte eine zweite, womöglich noch ›inniger Verbundene‹ hinzu, „sie kokettierte gern nach allen Männern hin, die leidlich aussahen, und wie oft hab' ich sie vom Fenster weggezogen, wenn sie's zu arg machte!“
„Ich begreife nicht“, ergänzte eine Dritte, unter ihren Freundinnen die älteste, „wie der geistreiche, scharfsichtige Mann in diesem Punkte so blind sein konnte. Aber freilich, Gelehrte sind leicht zu täuschen. Ich gönne der lieben Angelika ihr Glück und Gott gebe nur, dass alles gut endet!“
Als ihr Gemahl, von seinem verspäteten Geschäftsgange zurückkehrend, sie weckte, zeigte sie ihm ein, allerdings nur von mattem Nachtlicht beleuchtetes, sehr verdrießliches Gesicht. Unter andern Verhältnissen würde dieser Anblick den zärtlichen Ehemann höchst unglücklich gemacht haben. Diesmal achtete er wenig darauf, denn er selbst befand sich in mürrischer Stimmung. Sein Weg war vergeblich gewesen, vielleicht die ganze Reise. Den er aufzusuchen dreizehn Meilen zurückgelegt, war in Landwinkel nicht anwesend; sein kranker Vater hatte höchlichst erstaunt über so unerwarteten Besuch in einem sonst gemiedenen Haus auf die hastige Frage nach dem Sohne und Substituten mit einiger Verlegenheit erwidert, dieser, sein Sohn, sei abwesend und durchaus nicht mit Bestimmtheit zu sagen, bis wann er heimkehren dürfte. Auf nähere Erörterungen hatte sich der alte, hartnäckige Henker-Papa nicht einlassen wollen, und Streber hatte sich genötigt gesehen, die Privatunterhandlungen, welche er mit der aufknüpfenden Familie anzuknüpfen gewünscht, wenigstens für heute nacht fallenzulassen. Morgendes Tages beschloss er, sich an die Behörden von Landwinkel zu wenden, um deren Vermittlung kollegialisch in Anspruch zu nehmen.
Voll von diesen Plänen und nichts anderes im Sinne, legte er sich verdrießlich neben die verdrießliche Angelika und blieb es, bis der Schlummer sie beide einhüllte und beide träumen ließ. Sie sah einen jungen, ihr sogar dem Namen nach fremden Mann, welcher von der Straße herauf nach ihrem Fenster wehmütig lächelte, ohne dass er zu grüssen wagte. Ersah einen jungen Mann, den ein langer, stiller Zug zum Tode führte.
Aber wie verschieden beider Träume sein mochten, beide erblickten darin einen und denselben Menschen.
6
Als Angelika erwachte, war ihr Gemahl bereits angekleidet und bat dringend, ihm nicht zu zürnen, dass er sie schon wieder allein lasse. „Nur noch einige Stunden“, sprach er, „wolle mir vergönnen, die du leicht mit Lektüre ausfüllen magst, der halbe Koffer liegt voll neuer Bücher, welche ich zu diesem Zwecke mitnahm. Ich begebe mich an meine Geschäftsbesuche und will mich beeilen so viel wie möglich. Dann machen wir einen Spaziergang, speisen im Grünen, fahren auf dem See, gehen abends ins Schauspiel kurz, der ganze Tag gehört dir.“
Gegen diese Vorschläge ließ sich nichts einwenden. Die Gattin ging darauf ein, und der Gatte machte sich davon.
Träume üben eine gar wunderbare Macht auf die menschliche Seele. Man hat wohl Monate, ja ganze Jahre hindurch an diesen oder jenen nicht gedacht; noch weniger, dass man tiefer für ihn empfände. Ein Traum bringt ihn uns in Erinnerung und siehe da, die Erinnerung geht aus dem Schlafe ins Leben hinüber; sie verleiht dem bisher fast gleichgültigen Gegenstand einigen Zauber. Nicht anders erging es der schönen Angelika an jenem Morgen mit dem unglücklichen Musiklehrer, den sie während ihres Brautstandes mehrfach wahrgenommen, dessen glühende und sehnsüchtige Blicke nach ihrem Blumenfenster sie häufig beobachtet, den sie aber sonst nicht kannte, über den sie niemals mit ihren Freundinnen auch nur eine Silbe gewechselt und in welchem den Missetäter, dessen Zukunft ihren Gatten so dringend beschäftigte, auch nur zu ahnen ihr nicht auf das entfernteste in den Sinn kam. Weil er, kurz ehe sie heiratete, von dem Straßenpflaster vor ihrer Eltern Hause verschwunden und nie mehr zu erblicken gewesen, hielt sie ihn wohl für einen Fremden, der Grundau nach kurzem Aufenthalt wieder verlassen habe, und vergaß ihn bald; um so leichter, als sie noch an einige andere zu denken hatte. Erst ein Morgentraum der ersten Nacht im Gasthause zu Landwinkel stellte den Vergessenen in ihrem Gedächtnisse her. Wie gesagt, sie brachte sein Bild zur Toilette mit, und während sie sich langsam und wohlgefällig vor dem Spiegel ankleidete, wiederholte sie von Zeit zu Zeit: Es war eine nicht gewöhnliche Erscheinung; was mag aus ihm geworden sein, und warum ich gerade hier so lebhaft von ihm träumen musste?
Da klopfte es leise an ihre Stubentür, die nach Strebers Fortgehen unverschlossen geblieben.
Wenn dies mein Unbekannter wäre? Wenn er zufällig in Landwinkel lebte? Wenn er mich gestern gesehen, wenn er heute früh meines Gatten Entfernung belauscht hätte? Wenn er käme, unter irgendeinem Vorwand sich uns vorzustellen? Wenn der Traum damit zusammenhinge? Es heißt, dass Träume oft etwas bedeuten! Ob ich „Herein!“ rufe?
Solche Gedanken bewegten Angelika. Eiligst sprang sie auf, bedeckte die Betten, hüllte sich in ihren Schal, und mit jenem leichten Schauder, der uns stets durchrieselt, wenn wir uns ableugnen wollen, dass wir einen Schritt auf falschem Wege tun möchten, ließ sie, doch erst nach dem dritten Pochen, ihr melodisches „Herein!“ ertönen.
Aber nein, das war nicht das schwarze Lockenhaupt mit den düstern, feurigen Augen, deren Glut sie damals in Grundau durchs Fenster zu empfinden geglaubt; das war ein sanfter, blonder, wohlgepflegter Jünglingskopf mit lächelndem Angesicht, der sich hier in Landwinkel vor ihr neigte und ehrerbietig nach dem Herrn Gemahl fragte.
„Mein Mann ist in Geschäften aus. Wollen Sie später wiederkommen? Oder können Sie mir vielleicht anvertrauen ...“
„Auch ich habe Geschäfte mit Ihrem Herrn Gemahl. Er hat mich gestern Abend vergeblich aufgesucht. Ich bin erst in dieser Nacht von einem Ausflug heimgekehrt; weil ich aber hörte, dass es ein sehr dringender Fall sei ... Die gnädige Frau wissen wahrscheinlich ...?“
„Nichts Näheres, mein Herr; ich weiß nur, dass mein armer Mann auch auf einer sogenannten Erholungsreise sich keine Erholung vergönnen will und dass er es gestern abend und heute früh mit seinen Gängen sehr eilig hatte. Gewiss würd' es ihm schmerzlich sein, Sie, den er zuerst aufsuchen wollen, abermals zu verfehlen, und ich möchte Sie deshalb bitten, ihn hier zu erwarten, wenn es Ihre Zeit erlaubt.“
„Ich wüsste nichts Besseres und Angenehmeres zu tun, wenn die gnädige Frau mir wirklich gestatten will, ihr Gesellschaft zu leisten ...“
„Sie gehören wahrscheinlich auch zur Justiz?“
„Gewissermaßen, ja. Euer Gnaden kennen mich also nicht aus Ihres Herrn Gemahls Schilderung?“
„Nein, durchaus nicht; er ist in Geschäftsangelegenheiten sehr einsilbig, und offenherzig gestanden, die wenigsten darunter flößen mir Interesse ein; sie sind meistenteils unangenehmer Natur. Doch freilich, den Herren soll man das nicht sagen; sie lieben ihr Fach. Darf ich vielleicht um ihren Namen ...?“
„Oskar Seelig.“
„Oskar? Ei, das ist ein seltsames Zusammentreffen: Oskar heißt auch mein Mann!“
Angelika schlug die Augen nieder. Der junge Mann setzte sich neben sie auf das Sofa und fing an, eine recht lebendige Unterhaltung zu führen. Er schien im Ausland studiert, mancherlei Reisen gemacht, vielerlei gesehen und nicht minder auch selbst erlebt zu haben. Sein Ton verriet eine auf Erfahrung gestützte Sicherheit im Umgange mit Frauen, die desto gefährlicher wirkt, je bescheidener sie sich geltend macht. Die Sanftmut seines freundlichen Gesichtes, seines zierlich lächelnden Mundes, seiner blauen Augen stand gewissermaßen im Widerspruch zu der männlichen Kraft seines tiefen Sprechorganes, dessen wohlklingende Töne die Lehne des Ruhebettes vibrieren machten, während er, den rechten Arm auf die Lehne gestützt, sich seiner allerliebsten Nachbarin zuneigte und lebhaft erzählte. Eine Stunde war bald verschwatzt. Die zweite verging noch rascher. Angelika vergaß endlich, dass Herr Seelig ihren Oskar erwartete, und Herr Oskar Seelig dachte schon längst nicht mehr daran, dass es außer ihm noch einen Oskar gebe. Sein Arm rückte immer weiter vor auf der Sofalehne. Der Raum zwischen ihm und der schönen Frau ward immer enger. Sie durfte sich nicht mehr zurücklegen, aus Furcht, ihr Nacken werde seine Finger berühren. Sie saß aufrecht und steif, wie dazumal in der Pension. Aber ihr tat der Rücken nicht weh wie dazumal; durchaus nicht. Sie brachte das kleine Opfer ihrer Bequemlichkeit gern, denn das Gespräch fesselte sie. Der junge Mann sagte gewiss nicht alles, was er sagen konnte; er verstand, die Hörerin mehr ahnen zu lassen, als sie hörte. Es lag der Reiz des Verbotenen in allem, was er sprach, und noch mehr in dem, was er verschwieg. Solch einen Menschen, dachte sie, gibt es in ganz Grundau nicht, und wie schade, dass er in Landwinkel stecken muss.
Da platzte der Gemahl zur rasch geöffneten Türe herein. Die Sitzenden erhoben sich zwar, doch konnten sie dies unmöglich so schnell bewerkstelligen, dass der Eintretende nicht doch entdeckt haben sollte, wie nahe seiner Gattin Schultern der Hand eines Fremden gewesen.
Er wurde blass vor Zorn. Seelig blieb vollkommen ruhig, wie ein Mann, der sich nicht zum ersten Male im Leben durch einen Eifersüchtigen überrascht sieht. Angelika fasste sich insoweit, die beiden Herren einander vorzustellen und den Landwinkler mit Namen zu nennen. Nun zuckte ein Blitz der Schadenfreude über Strebers Gesicht. „Ha, Sie sind es?“, rief er frohlockend aus. „Sind Sie da? Das ist schön; so war doch meine Fahrt nicht vergebens. Sieh, Angelika, dies ist der Mann, um deswillen ich hierhergereist. Dies ist der Mann, den ich ängstlich suchte, damit seine Hände meine Bemühungen krönen möchten, der Mann, den wir bei uns zu Hause so schmerzlich entbehrten: Es ist der Henker!“
„Das wäre der Henker?“, stammelte die Zitternde, warf sich halb ohnmächtig in ihre Sofaecke und sprang augenblicklich wieder empor, als ob die fürchterliche Hand noch hinter ihr weile, wo sie vorhin auf der Lehne gelegen.
Streber ließ ihm keine Zeit zu erwidern. Er ging sogleich auf die Sache ein. „Ich habe“, sagte er, „vor wenig Minuten durch Estafette die Nachricht empfangen, dass die Bestätigung des Urteils unmittelbar nach meiner Abreise in Grundau eingetroffen und dass es dem Mörder bereits eröffnet worden ist. Man verlässt sich beim Gericht darauf, dass ich Sie zur Stelle schaffe. Ihre Bedingungen sollen kein Hindernis sein. Fordern Sie, mir liegt alles daran, jeden Aufschub zu vermeiden, wegen vielfacher Gründe. Ja, Sie sehen mich bereit, aus eignen Mitteln die für eine Exekution und für Ihre Reise ausgesetzte Vergütung zu ergänzen. Wollen Sie mir augenblicklich folgen, so lassen Sie mich Ihre Ansprüche vernehmen.“
„Ich bin“, entgegnete der junge Mann, „hier nicht angestellt. Nur aushilfsweise bin ich einige Male für meinen kranken Vater eingetreten, dessen Stelle ich vielleicht künftig einmal samt seiner nicht unbedeutenden Feldwirtschaft übernehme, um der Meinigen willen, die ohne diesen Entschluss von meiner Seite hilflos zurückbleiben würden; zum Teil durch meine Schuld. Denn ich darf es nicht leugnen, ich habe wild gelebt und den größten Teil unseres Vermögens durchgebracht. Ich wollte ...“ (Hier wendete er sich wieder nach Angelika, die schaudernd seinen Worten lauschte.) „Ich wollte studieren. Mit dem Fluch meiner Herkunft belastet, ging ich auf entfernte Hochschulen, ständig zitternd und befürchtend, meine Kameraden möchten entdecken, dass ich der Sohn des Henkers sei, und mich verstoßen. Nicht umsonst war ich der fleißigste Abonnent der hiesigen Leihbibliothek gewesen. Ich hatte überschwängliche Begriffe von Freiknechten und Hochgerichten mitgenommen. Aber bald sollte ich zu meinem Schaden gewahr werden, dass diese Sagen längst ins Reich der Fabel gehören. Als nach und nach bekannt wurde, was ich so ängstlich verheimlichen wollte, lachten mir die Genossen ins Gesicht, und der einzige Unterschied, den sie zwischen mir und anderen Neulingen machten, bestand darin, dass sie mich häufiger die Zeche bezahlen ließen als jeden andern. Weil doch aber das Wunderbare in dieser wunderbaren Welt der Aufklärung stets seine angeborenen Rechte behaupten will, so häuften sie goldene Märchen auf des Freimanns Kind. Mein Vater sollte Gott weiß wie reich sein, sollte fabelhafte Schätze besitzen. Ach, wie viele Mütter bestrebten sich nun, mich zu binden. Ich glaube, sie hätten den Strick eines Gehängten nicht verschmäht, wäre es ihnen gelungen, mich damit an eine ihrer Töchter zu knüpfen. Doch ich ließ mich nicht fangen. Ich setzte mein ungebundenes, tolles Leben so lange fort, bis mir von Hause geschrieben wurde, es gehe nicht länger, der Vater liege darnieder, die Wirtschaft auch man erwarte mich. Die Welt reizte mich nicht mehr. Ich hatte ausgekostet und war satt. Deshalb bin ich heimgekommen, wie der verlorene Sohn von Landwinkel, zu allem bereit. Und obgleich mein Vater zum Feste des Wiedersehens kein Rind schlachten ließ, habe ich doch an seiner Stelle einen Menschen gehängt und mich dabei ganz gut benommen. Aber noch stehe ich in keiner Pflicht. Was ich bisher getan, geschah aus gutem Willen, aus Übermut, aus Trotz und aus Ekel gegen das Leben, gegen die Lügen des Lebens; nennen Sie's, wie Sie wollen! Jetzt brauchen Sie mich. Mein Vater hat mir's in dieser Nacht erzählt. Ich kam in der Absicht zu Ihnen, Ihnen den Spaß zu verderben; ich will's nicht leugnen. Dieser Morgen hat mich auf andere Gedanken gebracht: ich bin bereit, Ihren Wunsch zu erfüllen; aber ohne Aufschub, ehe mir's wieder leid wird. Wir müssen heute noch reisen.“
„Sehr wohl. Sie können augenblicklich ...“ „Wir, hab' ich gesagt. Ich bin bereit, die traurige Notwendigkeit zu erfüllen, doch nur unter der einen Bedingung eine andere leg' ich Ihnen nicht auf, dass ich in Ihrem Wagen mit Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin nach Grundau fahre. Mir liegt daran, mich Ihnen beiden gegenüber zu rechtfertigen wegen der Wahl des Standes, den ich ergreifen werde. Mir liegt daran, mit einem berühmten Juristen wie Sie manches durchzusprechen; die ungeheure Kluft, welche nach Ihrer Ansicht uns trennt, auszugleichen durch meine Ansichten von der Sache. Sie haben die Wahl: Entweder ich reise heute nachmittag mit Ihnen, oder Sie suchen sich anderswo einen Henker!“
Dabei nahm er die Tür in die Hand und wartete der Entscheidung.
Strebers Hochmut geriet in harten Kampf mit seinem Ehrgeiz: Dieser begehrte die Hinrichtung des Delinquenten herbeizuführen, ehe Krankheit und natürlicher Tod der Gerechtigkeit zuvorkämen; jener lehnte sich mächtig auf gegen die kecke Anmaßung eines Unverschämten. Schon war Hochmut im Begriff, über Ehrgeiz den Sieg davonzutragen, als ein Blick auf Angelika den Eifersüchtigen belehrte, dass von einem Henker jedweder gesellige Zauber gewichen sei, den ein junger Unbekannter, welcher sich vorteilhaft einführte, vielleicht geübt haben könnte; von diesem war nichts zu befürchten; dieser konnte keinen Eindruck mehr auf die zarte, sinnige Frau machen. Warum sollte er nicht im Wagen sitzen dürfen? In der äußersten Ecke desselben? Wer sah ihm an, was er sei?
Oskar Streber ging auf Oskar Seeligs Bedingung ein.
7
Wir schildern die Reise nicht. Was geredet, gestritten, geflüstert, auseinandergesetzt, angedeutet, bewiesen, bezweifelt wurde, wir bedecken es mit Stillschweigen.
Ob sich Streber nicht dennoch geirrt habe, als er voraussetzte, es könne dem niedrigsten Knechte der Gerechtigkeit in seiner schmachvollen Stellung nicht mehr gelingen, vor den Augen einer liebenswürdigen Dame wie ein anderer Mensch und Mann zu erscheinen? Auch darüber gestatten wir uns keine Bemerkung. Wir eilen dem Schlusse unserer kurzen Erzählung entgegen.
Soviel ist sicher, dass der öffentliche Ankläger bei Nacht seiner Gattin gegenüber fast zum heimlichen werden wollte und dass er herzlich froh war, Oskars Füße nicht mehr im engen Wagen versteckt, sondern sie über Grundauischen Grund und Boden nach einem Gasthofe zweiten Ranges wandelnd zu wissen. Ehe sie sich trennten, erbat der junge Henker sich Anweisung, wo er einen amtlichen Erlaubnisschein zu fordern habe, damit er die Person und die körperliche Beschaffenheit des Gefangenen für den Zweck seiner furchtbaren Vorkehrungen untersuchen könne.
Doch dies war eigentlich nur ein Vorwand. Ihm lag mehr daran, sich durch eigene Anschauung zu überzeugen, ob dieser Richers derselbe sei, dessen er sich als eines frohen Gefährten aus den flotten Burschentagen zu erinnern meinte; dessen Name ihm beinahe entfallen war; dessen Bild aber durch Strebers Andeutungen in ihm auflebte.
Jawohl, es war derselbe. Derselbe, der so häufig die wilden Bacchanalien jugendlicher Lärmer und Schwärmer mit musikalischen Phantasien begleitet hatte. Doch welch ein schauriges Wiedersehen!
„Musste ich deshalb nach Grundau verschlagen werden“, rief er dem als „Jugendfreund“ bei ihm angemeldeten Oskar entgegen, „damit du mir die letzte Halsbinde umlegst?“ „Wie kommst du darauf, armer Junge?“, fragte Seelig erschrocken.
„Wie ich daraufkomme? Man hat mir mein Urteil als Mörder und noch etwas Schlimmeres gesprochen; man hat mir gestern die Bestätigung mitgeteilt; ich erwarte den verhängnisvollen Morgen und du triffst bei mir ein; du, welchen man damals, da wir studierten, den Sohn des Henkers nannte. Was ist einfacher, als dass du deines Vaters Geschäft übernommen? Es ist so gut wie jedes andere auf dieser schönen Erde. Oskar, schäme dich nicht. Du kamst, meinen Hals zu prüfen? Da betrachte ihn. Nicht wahr, ich bin mager. Ich liege schwer darnieder. Hätte ohnedies kaum noch etliche Tage zu leben: trübe, lange Tage im Kerker. Du wirst sie abkürzen; habe Dank im Voraus! Und der alten Bekanntschaft wegen mache deine Sache gut und rasch. Ich hoff es, du wirst mich nicht lange zappeln lassen.“
Aus Oskars blauen Augen stürzten heiße Tränen. „Nein, Bruder, deshalb kam ich nicht. Nur Gewissheit wollt' ich mir holen, ob du es bist? Ob du es sein konntest, der ... Bekenne; sprich; o ich beschwöre dich: Bist du, was sie dich nennen? Tatest du, wofür du büßen sollst? Ich kann's nicht glauben! Du, unser Orpheus, der uns wilde Bestien mild und weich stimmte durch seine himmlischen Harmonien? Du, der sanfte Künstler, hättest ein schuldloses Mädchen verführt, entehrt, ersäuft, wie ein Kannibale ...“
Richers richtete sich von dem elenden Lager empor, wie sauer es ihm, dem Todmatten, wurde; er erhob sich mit seinem abgezehrten Leibe und saß aufrecht. „Gib mir die Hand“, sprach er; „dieselbe Hand, die morgen den Strick um meine Kehle legen soll; sieh mich an, Oskar: Ich sterbe unschuldig. Ich habe keinen Teil an des Mädchens Ermordung. Was ich beim ersten Verhör aussagte, wobei ich beharrte, es ist wahr; so wahr, als ich an einen Gott glaube und eine Zukunft! Ob sie sich, überspannt und leidenschaftlich, wie sie trotz ihrer zarten Jugend war, den Tod selbst gegeben? Ob derjenige, der sie entehrte, ich bin es nicht! ihre Drohungen fürchtend, sie verlockte in jene sumpfige Einöde und dort ihr Mörder wurde? Außer ihm weiß es nur einer, und dieser eine wohnt nicht auf Erden. Die Menschen halten mich für den Täter; sie werden jubelnd mich zum Tode führen sehen. Oskar, willst du sein wie die übrigen Menschen? Mache du eine Ausnahme: Hänge mich aber glaube mir!“
„Wie ist es möglich“, schrie der junge Henker, „dass die Geschworenen dich schuldig erkannten, wenn du so eindringlich sprachst, wie du jetzt zu mir gesprochen?“
„Ich hatte ihnen ja nichts zu sagen. Ich konnte auch nicht mehr reden; ich war schon mürbe von den Verhören. Mein Verteidiger sprach statt meiner. Der sagte viel, vielerlei; auch viel Gutes, Kluges, glaub' ich nur nicht das Rechte. Er stach Silben, er verdrehte die Gesetze oder legte sie aus, gleichviel. Er traf die Herzen nicht. Dagegen der Ankläger! Ja, wenn du den gehört hättest! Wie der zu reden, zu malen, darzustellen verstand! Es blieb kein Zweifel, konnte keiner bleiben; mit seines Wortes Gewalt hätte er mich selbst überzeugt, dass ich die Schandtaten wirklich begangen; ja, ich selbst hätte mir nicht mehr geglaubt, sondern ihm; wäre nicht durch die Klarheit seiner Rede immer ein giftiger Hauch gedrungen, der mich daran erinnerte, dass dieser Mann mich hasst; dass es ihn entzückt, mich zu verderben. Doch das konnte niemand sonst empfinden außer mir. Was ist da viel zu klagen? Es ist ein Zusammentreffen von Umständen, dem ich nicht gewachsen war. Und was nun weiter? Wem liegt daran? Was ist an mir gelegen? Wird deshalb die Welt stillstehn? Lassen wir's gut sein und hängt mich auf!“
Und er legte sich wieder auf sein moderiges Lager. Oskar begann noch einmal: „Wodurch hast du dir ihn zum Feinde gemacht? Nur das gestehe mir noch. Dann will ich dir die Ruhe gönnen, deren du bedarfst. Sage mir, Richers, habt ihr euch näher gekannt?“
„Wir haben nie eine Silbe miteinander gewechselt. Aber ich habe seine Frau geliebt, da sie noch Braut war. Aus der Ferne nur. Mit Blicken, die sie erwiderte, die er wahrnahm. Als ich erfuhr, wie nahe wirklich die Verbindung sei, zog ich mich zurück um ihres Friedens willen. Ich denke, sie erfuhr niemals, wer ich bin, noch wie ich heiße. Dass er es erfuhr, das hab' ich erfahren, als er mir entgegenstand und seiner Anklagen tödlichen Zorn über mein geschmähtes Haupt ergoss; als er mich selbstsüchtigen Verführer, ruchlosen Schänder, feigen, verworfenen Mörder nannte. Dawider war nicht aufzukommen. Gottes Macht hat den Knoten verwirrt, Menschenfinger lösen ihn nicht. Doch ja, die deinen werden es tun, indem sie einen neuen schlingen. Mach ihn fest, Oskar, und nun: Gute Nacht!“
„Schlafe wohl“, flüsterte der Henker, indem er sich liebevoll über den Leidenden beugte. „Schlafe ruhig und vertraue!“
„Das tu' ich“, sagte Richers. „Schlafe auch du wohl, stärke dich auf morgen! Gute Nacht.“
*
Mit der zur Gewissheit gewordenen Überzeugung, dass Richers die Wahrheit gesprochen habe und ungerecht verurteilt worden, eilte Oskar Seelig in Strebers Arbeitszimmer, welches Angelika in demselben Augenblick verließ. Voll von der Voraussetzung, dass sie nicht unterlassen werde, dem Zwiegespräche zu lauschen, gönnte er seiner starken Stimme ihre ganze Gewalt. Ihm lag daran, dass jene ihn höre. Er teilte ohne Rückhalt mit, wovon sein Herz überfloss, bis auf den kleinsten Umstand und er glaubte zu vernehmen, dass auf seine deutliche Bezeichnung, wer Richers sei, an der Seitentür ein mühsam unterdrückter Schrei lautwerden wollte.
Streber, schon unwillig über des geringgeschätzten Jünglings Eindringen, den er wie ein unentbehrliches Übel in seiner Nähe betrachtete, ließ ihn kurz an und tadelte ihn sehr von oben herab, indem er ihn ermahnte, nicht zu vergessen, welche Stellung im bürgerlichen Leben der Henker einnehme.
„Ich kenne die meinige ebenso gut“, erwiderte Seelig, „als ich die Ihrige zu ehren weiß. Ich habe Bildung und Verstand genug, um einzusehen, was ein öffentlicher Ankläger bedeutet, wie wichtig sein Beruf, wie groß sein Wirkungskreis, wie unantastbar seine Vorrechte, wie heilig seine Pflichten sind. Das Auge des Gesetzes soll er gleichsam vorstellen; an Gottes statt soll er den Frevel aufdecken, die Heuchelei entlarven, den Verbrecher aus geträumter Sicherheit aufschrecken und treffen. Und wer furchtlos dieses Ziel vor seinen klaren Blicken behält, der ist gewiss der höchsten Achtung würdig. Aber es darf auf den Waffen, mit denen er im Schutze seiner gefährlichen Gewalt zum Kampfe zieht, kein Fleckchen haften; kein Stäubchen auf seinem Gewissen. Rein muss er sein und bleiben von persönlichem Groll, von bitterer Parteilichkeit. Nicht bloß ein Verfolger, auch ein Beschützer der Angeklagten beides zugleich! Soll er werden; soll in seiner Seele jedes Körnchen für und wider abwägen. Erfüllt er diese erhabenste aller Berufspflichten nicht; denkt er nur an Befriedigung seiner Eitelkeit; will er nur seinem Ehrgeiz immer neue, womöglich glänzende, weitschimmernde Siege erfechten, unbekümmert um die Opfer, welche im stillen an unheilbaren Wunden (die er schlug) Verbluten müssen, dann tausch' ich nicht mit ihm und bin ungleich lieber der Henker, der als willenlose Körperkraft gehorcht, ohne sein Gewissen zu belasten. Ist das Ihrige in diesem Falle ganz rein; sind Sie wirklich mit sich einig; steht Ihre Überzeugung noch so fest, nachdem ich Ihnen jetzt mitgeteilt habe, was ich um Ihrer selbst willen, nicht verschweigen durfte ... nun, dann wasch' ich meine Hände. Tun oder lassen Sie, was Sie verantworten müssen ...“
„Was soll ich anderes tun“, unterbrach ihn Streber, „als der Gerechtigkeit ihren Lauf lassen? Soll man auf das Leugnen der Verbrecher Wert legen? Und wolle, dürfte man's jetzt ist es zu spät.“
„Noch einmal: Was Sie zu tun haben, müssen Sie bedenken; was ich zu tun habe, das weiß ich.“
Seelig ging. Auf dem Treppenflur empfing ihn Angelika. „Um Gottes Barmherzigkeit willen“, flüsterte sie, „retten Sie ihn!“ Dabei ergriff sie ohne Schauder des Henkers Hand und drückte sie bebend.
„Durch diese Hand stirbt er nicht“, sagte er und küsste die ihrige; „durch die meinige stirbt er nicht, das schwör' ich Ihnen! Retten kann ihn nur Gott, und ich denke, der wird's auch tun; vom Galgen wenigstens.“
Es ist ein wunderlieblicher, klarer Morgen. Sorglose Vögel singen im Grün der Bäume und Sträucher; bunte Schmetterlinge wiegen sich gaukelnd auf Blüten, die Sonne bringt den reinsten Tag.
Ist's denn ein Festtag? Welch ein Gewühl in den Gassen! Lange, dichtgedrängte Züge von Spaziergängern wallen fröhlich durchs Tor. Schelmische Mädchen nicken lustig ihren muntern Freunden zu. Arm in Arm aneinandergehängt, brechen derbe Gesellen sich scherzend Bahn, um früher den Schauplatz der Freuden zu erreichen. Zärtliche Mütter tragen, besorgt, dass sie sich ja nicht verspäten, ihre kleinen Kinder hinaus. Alles wandelt einen Weg. O gewiss ein Volksfest. Eine sommerliche Morgenfeier. Ein blumengeschmücktes Wäldchen, wo Musik ertönt?
Nein, nichts von alledem. Es soll ein armer Sünder aufgehängt werden, weiter nichts. Aber was tut's?
Ist es doch ein Schauspiel wie jedes andere auch und gratis obendrein.
Da stehen sie und harren; murren und harren dennoch. Die Sonne steigt höher und höher; die Hitze wirkt schon lästig; und noch keine Anstalten? Ja, was wird denn das? Wie lange sollen wir denn warten? Schickt sich das, die Leute so zeitig heraus zu narren und dann nicht Stunde zu halten? „Langschläfer von einem Mörder“, lacht eine dicke, behagliche Frau; „kannst du nicht beizeiten aus den Federn kriechen, wenn du eine so große Gesellschaft zum Frühstück geladen hast?“ Und allgemeiner Beifall belohnt den gelungenen Scherz, der auf einige Minuten die Ungeduld verscheucht. Desto lebhafter bricht sie dann wieder aus und macht sich sogar in wilden Drohungen Luft. Doch in diese mischt sich plötzlich Staunen: Wie? Nicht möglich! Na, das war' noch schöner! Ah, das ist stark! Was sagen Sie? Nein, wirklich? Ja, wirklich! Der Henker ist verschwunden; nirgends aufzufinden. Auch die beiden Kerls, die man ihm als Hilfsknechte zugeordnet und die er eiligst einschulen musste, sie sind fort. Wegen eingetretener Hindernisse keine Exekution!
Das wär' der Henker! Schändlich! Abscheulich! Freiwillige vor!
Und mit Spotten, Schelten, Schimpfen, Witzeln verläuft sich die liebe Menschheit.
*
Es bedarf nicht erst der Erwähnung, dass sogleich, als des Herrn Oskar Seelig böswillige Entfernung entdeckt war, zweckmäßige Anstalten getroffen wurden, von einem dritten, nicht allzu fernen Orte den Vollstrecker des diesmal unterbliebenen Strafaktes herbeizuschaffen. Nach wenigen Tagen traf dieser Mann glücklich ein, voll von aufrichtigem Amtseifer. Als er sich bei Gericht meldete, brachte zu gleicher Zeit der Gefangenenwärter die Meldung, dass der zum Tode verurteilte Richers heute gegen Morgen still verschieden sei. Sie hatten ihn tot aufgefunden.
Ein Mord in Riga
1
In der zweiten Hälfte des Monats August (griechischen Stiles) im Jahre 183* fuhr eine mit sieben kleinen litauischen Postpferden bespannte Reisekutsche am Gasthofe des Herrn Zehr, dem besten Hotel von Kurlands Hauptstadt, vor.
Herr Zehr in eigener Person sprang aus der Haustür und öffnete den Kutschenschlag, ehe noch der auf dem hintern Dienstbotensitz schwebende Bursche oder gar die neben ihm in Schachteln und Bündel eingezwängte Kammerjungfer sich erheben konnten.
„Ei, Herr Oberältester Singwald“, rief Herr Zehr, indem er einem bejahrten, doch rüstigen Manne aus dem Wagen half, „willkommen in Mitau; meine gütige Madame Singwald, ich empfehle mich Ihnen; glücklich wieder heimgekehrt von der Badekur? Geht es gleich weiter nach Riga, oder soll ich die Ehre haben, Sie bei mir zu beherbergen?“
„Es ist wohl schon spät“, meinte Herr Singwald, wobei er seine Gemahlin fragend ansah, „bei Nacht zu Hause eintreffen ist auch kein Vergnügen.“
„Und Nacht wird es“, setzte der Gastwirt hinzu, „bis Sie nach Riga kommen, späte Nacht. Sie müssten denn fahren wie neulich Ihr Herr Postmeister von Livland, der wegen einer Wette die Tour von Riga nach Mitau samt nötigem Aufenthalt in Olay mit gewöhnlichen Postpferden in achtundfünfzig Minuten machen wollte. Er hatte gegen Herrn Konsul ich weiß nicht gleich den Namen gewettet.“
„Nun, wer hat gewonnen?“, fragte Singwald gespannt.
„Der Herr Staatsrat von Baranoff; sie waren, glaub ich, fünf Minuten vor der Zeit am hiesigen Schlosse. Der Herr Vizegouverneur von Meitel hielten die Uhr in der Hand.“
„Das nenn ich fahren“, rief Singwald; „das ist nur bei uns zulande möglich. Und wer sieht's den kleinen Hunden von Pferden an? Sechs Meilen in zweiundfünfzig Minuten, wenn wir nur eine aufs Umspannen in Olay rechnen. Ein fixer Kerl, mein Freund Baranoff, freut mich, dass er gewonnen. Aber da ich nicht Gouvernementspostmeister von Livland bin und die Pferde mit uns wahrscheinlich et's langsamer laufen würden ...“
„Darum muss ich auch dringend bitten“, unterbrach ihn Madame Singwald. „Dies Jagen kann mir nicht gefallen. Und wie ungern ich auch so nahe vor der Heimat noch einmal im Gasthause übernachte, ziehe ich's doch einer solchen tour de force bei weitem vor. Bitte, Herr Zehr, lassen Sie uns Zimmer anweisen. Simeon, schnallen Sie die Vache herunter.“
Die letzten Worte galten dem Diener, der bisher, eines bestimmten Befehles harrend, neben der sprechenden Gruppe am Wagen gestanden hatte.
Jetzt erst bemerkte ihn der Gastwirt und fragte: „Ei, mein gütiger Herr Oberältester, wie konnten Sie sich doch von Ihrem alten, wohlbekannten Faktotum trennen? Ich sehe da ein neues Gesicht ...“
„Mein Alter liegt in böhmischer Erde, lieber Zehr; ich habe mich nicht von ihm getrennt, sondern er sich von mir. Es war eigentlich wider die Abrede, denn er hatte mir versprochen, doch was hilft's! Für den Tod wächst kein Kraut, und ich bin mit meiner neuen Akquisition zufrieden!“
Der aufmerksame Hauswirt begleitete seine hochgeachteten Gäste selbst in ihre Gemächer, und nachdem er sich versichert, dass es an nichts fehle, und nachdem Madame Singwald den Wunsch ausgesprochen, eine recht gründliche Wasserbelustigung, welche die exzessiv waschsüchtige Frau seit Berlin hatte entbehren müssen, in ungestörter Abgeschlossenheit an sich vorzunehmen, machte Herr Zehr seinem gütigen Herrn Oberältesten den Vorschlag, den Abend im Garten der Medemschen Villa zuzubringen, wo Konzert, Beleuchtung und feine Gesellschaft zu finden waren.
Singwald ließ sich das nicht zweimal sagen. Seine lieben Freunde, den Prokurator von Kurland, Herrn von Klein, und den Postmeister Herrn von Joung (eigentlich Jung, und zwar Jung-Stillings leiblicher Sohn!), nach dreimonatlicher Abwesenheit wieder zu begrüßen, freute er sich um so mehr, als er dem ersteren Empfehlungen von geistvollen Bekannten aus Deutschland, dem zweiten aber Berichte über alle musikalischen Genüsse, die er in Wien, Prag, Dresden, Berlin gehabt, zu bringen hatte. Und dass beide in Medems Villa nicht fehlen dürften, setzte er voraus. Allgemeiner Willkommen begrüßte den rigischen Handelsherrn und Oberältesten, den gastfreien, gefälligen, klugen Singwald. Die schon genannten Freunde und viele andere beeilten sich, ihm die Hand zu drücken und ihn zu loben, dass er den ersten Abend in der Heimat der Schwesterstadt Mitau schenke. „Wir erwarteten Sie aber viel später“, sagte der Polizeimeister von Mitau, der Obrist von Friede; „wollten Sie nicht gar über September ausbleiben?“
„Freilich wollt ich, Obrist; jedoch, Sie wissen ja: mag es noch so schön sein draußen in der Welt, es ist denn doch nicht zu Hause. Meiner Frau fehlte ihre Sonntagstafel, mir mein Comptoir, meine Börse, meine ›Muße‹; ja, soll ich's ehrlich gestehen, meine Düna. Wir wohnten in Berlin Unter den Linden im schönsten Hotel; wir waren bedient, wie unsere Majestäten es nur sein können, wenn Allerhöchstdieselben auf der Durchreise in Elley bei Gräfin Medem übernachten, und das will viel sagen! Doch bei alledem fehlte mir immer et's, ich wusste nicht was. Wie ich aber mit meiner Frau darüber zu Rate ging, entdeckten wir eines dem andern unsere fabelhafte Sehnsucht nach den engen, krummen, finstern Gassen der geliebten, nordischen Vaterstadt. Ein echt rigisch Kind.“
„Tut Gott alltäglich loben, Dass er das Balt'sche Meer So nah zur Stadt geschoben!“