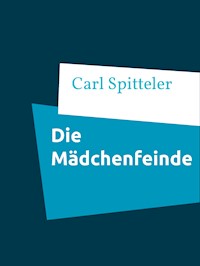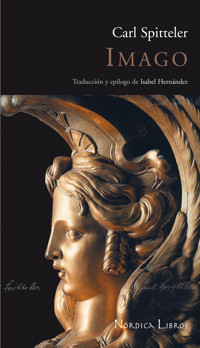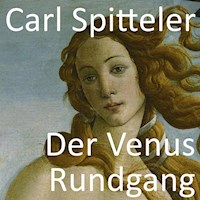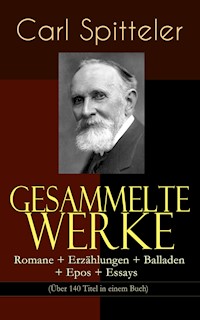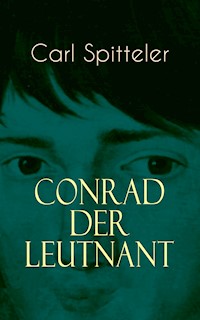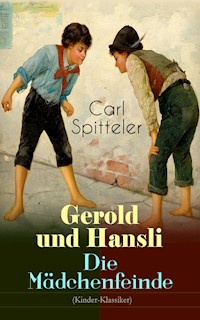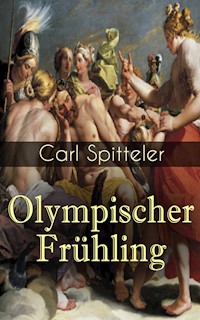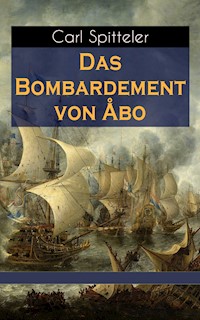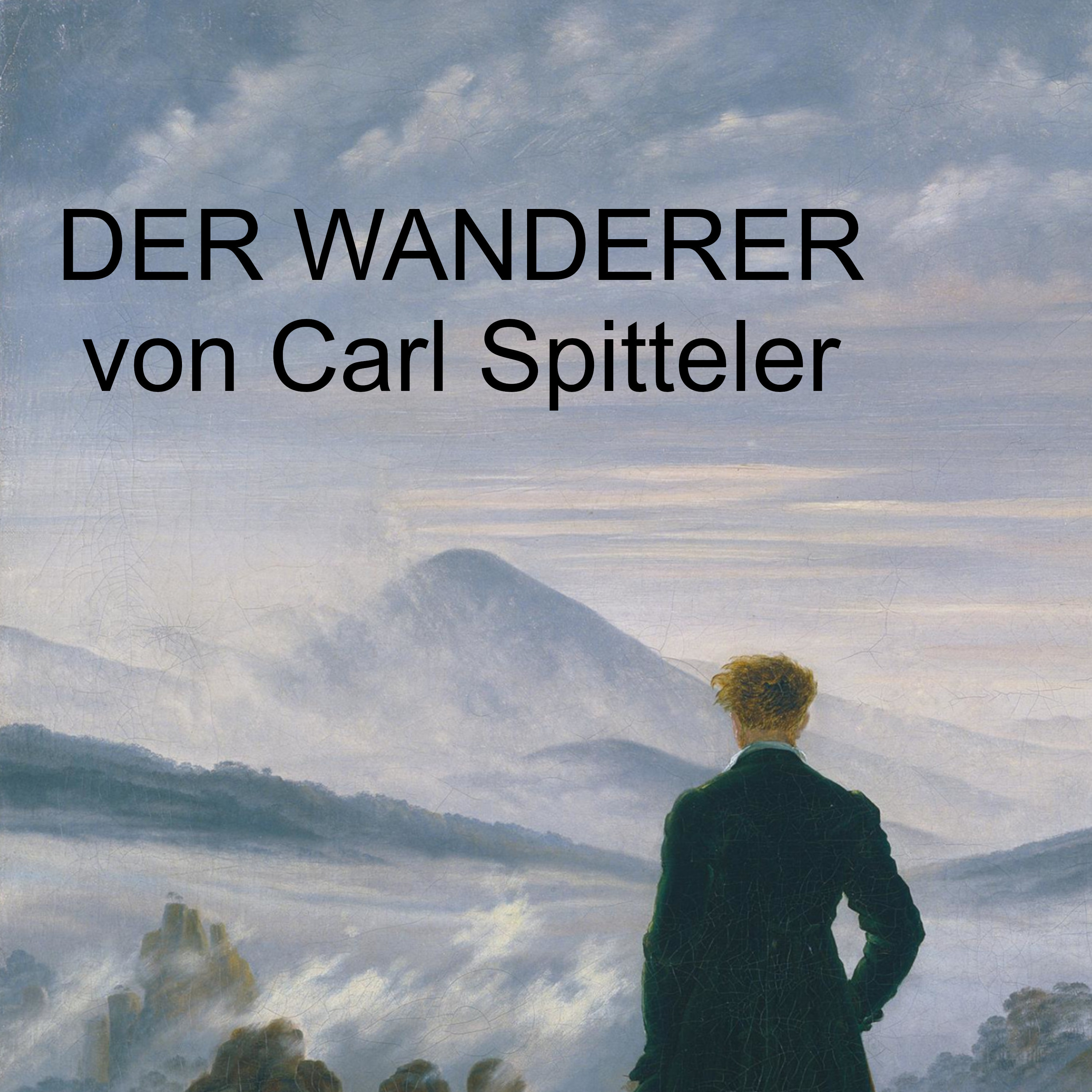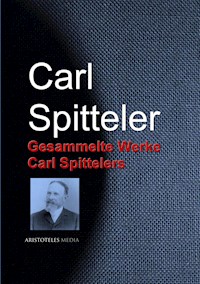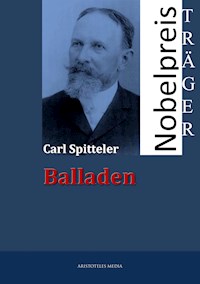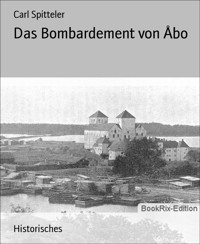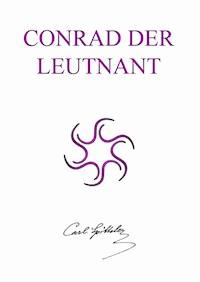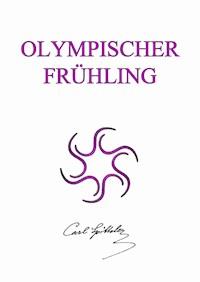Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Spittelers Essayband "Lachende Wahrheiten" bietet umfassenden Einblick in die Gedankenwelt des Literatur-Nobelpreisträgers. Enthalten sind u.a. Essays zu den Themen Literatur, Musik, Sprache, aber auch Allotria.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lachende Wahrheiten
Carl Spitteler
Inhalt:
Carl Friedrich Georg Spitteler - Biografie und Bibliografie
Zum Trutz
Kunstfron und Kunstgenuß
Dichter und Pharisäer
Vom Ruhm
Altersjubiläen
Datumsjubiläen
Copuli, Copula
Von der »männlichen« Poesie
»Alt« und »jung«
Zum Schutz
Literarischer Hader
Vom sittlichen Standpunkt in der Kritik
Von der Entrüstungsliteratur und ihrer Mache
Revolverhumanität
Literatur
Das verbotene Epos
Fleiß und Eingebung
Tempo und Energie des dichterischen Schaffens
Über den Wert zyklischer Sammlungen
Über den Wert der Einzelschönheit
Ein Kriterium der Größe
Über die Ballade
Widmungen
Vexiertitel
Familiaritäten
Die Zimperlichkeit der Druckerschwärze
Auch ein Goethezitat
Allotria
Die »Don Juan-Idee«
Allerlei Bemerkungen zu allerlei Unterricht
Die Balletpantomime
Aus dem Zirkus
Amor
Speck
Musik
Schuberts Klaviersonaten
Zur Ästhetik des Tempos
Unsere Sommermusik
»Fröhlich sei mein Abendessen«
Natur
Nadelholz und Architektur
Das Zederntrio
Jeremias im Garten
Wo ist die Winderlandschaft zu suchen?
Sprache
Von der »singenden« Aussprache
Zur Fremdwörterfrage
Fremdname und Orthographie
Volk und Mensch
Die Persönlichkeit des Dichters
Die Stimmung der Großen
Großstadt und Großstädter
Grundsätzliches
Abrundung
Von der Originalität
Vom Lehrgedicht
Konsequenz und feste Führung
Entmannte Sprichwörter
Maße und Schranken der Phantasie
Naivität
Das Schlimmste
Ein wichtiger Nebenzweck der direkten Rede in der Poesie
Eine ästhetische Unredlichkeit
Von der Glaubhaftigkeit
Poesie und Geist
Vom Realstil
Vom Idealstil
Verkehrte Welt!
Das Kriterium der epischen Veranlagung
Literatursymphonien
Welche Werke sind veraltet?
Die vornehme Zeitschrift
Verstechnisches
Ein Büschel Aphorismen
Von der Charakteristik
Schweizerisches
Professor Glauberecht Goethefest Dünkel von Weisenstein über Weltliteratur
Der degradierte Schiller
Rede des Dr. Michel Genialowitz Modernefritz an der Schillerfeier
Lachende Wahrheiten, C. Spitteler
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849636555
www.jazzybee-verlag.de
Carl Friedrich Georg Spitteler - Biografie und Bibliografie
Schweizer Dichter und Träger des Nobelpreises für Literatur, geboren am 24. April 1845 in Liestal bei Basel, verstorben am 29. Dezember 1924 in Luzern. Nach seiner Schulzeit folgt ein abgebrochenes Jura-Studium in Basel und schließlich ein Theologie-Studium, das Spitteler 1871 besteht. Danach zieht es ihn als Hauslehrer nach Russland und Finnland. Erst 1879 kehrt der Autor in sein Heimatland zurück und wird Lehrer in Bern. 1883 heiratet Spitteler seine frühere Schülerin Maria Op den Hooff und wird 1886 Vater einer Tochter. Ab 1890 schreibt Spitteler für das Feuilleton des Neuen Züricher Zeitung, kann sich aber schließlich drei Jahre später aufgrund der Erbschaft seines verstorbenen Schwiegervaters dazu entschließen, nur noch als freier Autor zu arbeiten. In den nächsten zwanzig Jahren erscheinen seine wichtigsten Werke, für die er 1919 als bisher einziger Schweizer den Literatur-Nobelpreis erhält.
Wichtige Werke:
1881 Prometheus und Epimetheus1883 Extramundana1887 Ei Ole1887 Samojeden1887 Hund und Katze1887 Olaf1889 Das Bombardement von Åbo1889 Schmetterlinge1889 Der Parlamentär1890 Das Wettfasten von Heimligen1891 Friedli der Kolderi1891 Gustav1892 Literarische Gleichnisse1892 Der Ehrgeizige1897 Der Gotthard1898 Conrad, der Leutnant1898 Lachende Wahrheiten1900 Die Auffahrt1901 Hera die Braut1903 Die hohe Zeit1904 Ende und Wende1905 Olympischer Frühling (Epos)1906 Imago1907 Die Mädchenfeinde1920 Meine frühesten Erlebnisse1924 Prometheus der DulderZum Trutz
Kunstfron und Kunstgenuß
Kein empörenderes Schauspiel, als sehen zu müssen, wie unsere leidige Allerweltsschulmeisterei es fertig gebracht hat, die süßesten Früchte mittels pädagogischer Bakterien ungenießbar zu machen und Geschenke, die dazu ersehen waren, uns zu beglücken, in Buß und Strafe umzusetzen. Die Kunst ist großherzig und menschenfreundlich wie die Schönheit, welcher sie entspringt. Sie ist ein Trost der Menschen auf Erden und erhebt keinen andern Anspruch, als innig zu erfreuen und zu beseligen. Sie verlangt weder Studien noch Vorbildung, da sie sich unmittelbar durch die Sinne an das Gemüt und die Phantasie wendet, so daß zu allen Zeiten die einfache jugendliche Empfänglichkeit sich im Gebiete der Kunsturteilsfähiger erwiesen hat, als die eingehendste Gelehrsamkeit. So wenig man Blumen und Sonnenschein verstehen lernen muß, so wenig es Vorstudien braucht, um den Rigi herrlich, ein Fräulein schön zu finden, so wenig ist es nötig, die Kunst zu studieren. Gewiß, die Empfänglichkeit ist beschränkt, die Begabungen sind ungleich zugeteilt, die Sinne, welche die Kunsteindrücke vermitteln, beobachten schärfer oder stumpfer. Indessen habe ich noch keinen Menschen von Gemüt und Phantasie (denn Gemüt und Phantasie sind die Vorbedingungen, aber auch die einzigen Vorbedingungen des Kunstgenusses) gekannt, welcher nicht an irgendeinem Teil der Kunst unmittelbare Freude empfunden hätte. Und darauf kommt es allein an. Jeder suche sich an dem himmlischen Fest diejenige Speise aus, die seine Seele entzückt, und weide sich daran nach Herzenslust, so oft und so viel er mag, im stillen oder, wenn ihm das Herz überläuft, mit gleichgesinnten Freunden. Das ist Kunstgenuß. Das ist aber auch Kunstverständnis. Wer sich aufrichtig und bescheiden an einem Kunstwerke erfreut, der versteht es ebensowohl und wahrscheinlich noch besser, als wer gelehrte Vorträge darüber hält; wie denn auch ewig die Künstler selbst sich unmittelbar an das einfache Publikum wenden und alle Vormundschaft und gelehrte Zwischenträgerei zwischen Kunstwerk und Publikum verabscheuen.
Eine Kunstfron entsteht, sobald der Kunstgenuß als eine Pflicht aufgefaßt wird. Es ist so wenig die Pflicht des Menschen, Schönheit und Kunst zu lieben, als es eine Pflicht ist, den Zucker süß zu finden. Die Kunst ist eine gütige Erlaubnis und eine menschenfreundliche Einladung, mehr nicht; man kann es nehmen oder lassen. Glücklich, wer ihr zu folgen und sie zu schätzen weiß; wer das nicht vermag, den mögen wir bedauern, aber wir haben kein Recht, ihn deshalb zu schelten. – Berechtigt die Tatsache, daß die Kunst erfahrungsgemäß veredelnd wirkt (echte Künstler und naive Kunstliebhaber sind stets gute Menschen), dazu, die Kunst als Erziehungsmittel zu verwenden? Ja, unter der Voraussetzung, daß man Erziehung im Sinne des vorigen Jahrhunderts (Erziehung zu einem rechten Menschen) versteht und daß man nicht mit Pädagogik hineinpfusche. Wenn im Deutschen Wilhelm Tell gelesen wird, verwandelt sich die Schulstube in ein freies grünes Bergland, und aus Lausbuben wird eine liebenswürdige begeisterte Gemeinde der Poesie. Besprich nachher Wilhelm Tell, laß ihn analysieren, vergleichen, in Aufsätzen wiederkäuen, so ist ein guter Teil des Gewinnes wieder dahin. Nein, unter der Voraussetzung, daß Erziehung das Examen zum Ziele hat, daß es gleichbedeutend ist mit lehren und lernen. Zu lehren gibt es in der Kunst überhaupt nichts, außer von Künstlern für Künstler, zu lernen wenig. Die veredelnde und erzieherische Kraft der Kunst beruht eben nicht auf dem Wissen, sondern auf dem Genießen. Ja das Wissen über die Kunst kann unter Umständen sogar die Empfänglichkeit zum Genuß der Kunst beeinträchtigen, dann nämlich, wenn Wissensdünkel entsteht; denn Dünkel ist das Gegenteil jener Seelenverfassung, welche jeder Kunstgenuß voraussetzt: bescheidene, selbstvergessene Hingabe. Vollends den Begriff »Bildung«, das heißt das Wissen in die Breite und im Kreise, in die Kunst herüberziehen zu wollen, ist eine unglückselige Verirrung. Bildungsmäßige Aufnahme der Kunst erzeugt im besten Fall Oberflächlichkeit, im gewöhnlichsten Fall Selbsttäuschung, im schlimmsten Fall Empfindungsheuchelei. Man entschlage sich doch ein für allemal der Hoffnung, das Unmögliche zu erreichen; die Kunst ist viel zu reich, der Einzelne viel zu arm, als daß er die übermächtige Summe von Seligkeiten bewältigen könnte; es gilt, sich entschlossen auf die seelenverwandten Lieblinge zurückzuziehen und mit ihnen in traulichem Umgang zu verkehren. Mit einem solchen Entschluß befreit man sich von der drückendsten Sklaverei der modernen Welt, der Bildungsfron, jener ebenso lästigen, als gemeinschädlichen Kopfsteuer. Der Entschluß kostet übrigens nicht mehr, als die Entsagung auf den allseitigen Genuß sämtlicher Sonnenstrahlen; es bleibt für das Bedürfnis des Einzelnen noch immer im Überfluß da, wenn er sich mit seinem Teil bescheidet. Das Bedürfnis aber ist der richtige Regulator des Kunstgenusses; solange dasselbe schweigt, möge jeder die Kunst in Ruhe lassen.
Viele versehen es nun darin, daß sie den äußeren Anlaß, die Einladung, mit dem inneren Bedürfnis verwechseln. »Wir müssen die Gelegenheit benützen.« Dieser Schluß ist so falsch, wie wenn jemand glaubte, essen zu müssen, sobald ein köstliches Menu in der Zeitung angekündigt wird. Das Kunstbedürfnis hat bei normalen Menschen seine Pausen; es stellt sich periodisch ein; der fortwährende Wolfshunger nach Kunst ist schon ein Zeichen eines ungesunden Zustandes, welcher die Diagnose auf Verbildung stellen läßt. Man muß an Konzertzetteln und Theateranschlägen, an Museen und selbst anCampi santivorübergehen lernen, wie an Schaufenstern; denn damit, daß uns etwas augenfällig angeboten wird, ist noch nicht bewiesen, daß wir dessen bedürfen. Sogar die Seltenheit einer Gelegenheit ist kein Grund für ihre Ausnützung; denn der Mensch ist kein Pelikan; er kann die Eindrücke nicht unverdaut aufstapeln, bis sich das Bedürfnis regt.
Wer statt des jeweiligen Bedürfnisses sein Bildungsgewissen zu Rate zieht, wer jeder Kunstgelegenheit auf jedem Gebiet in jedem Augenblick glaubt Folge leisten zu müssen, der ist kein neidenswerter, wohl aber ein meidenswerter Mensch, vor welchem jeder Erfahrene im weiten Bogen vorüberzieht; denn nicht die Kunst, die freie, edle Göttin ist es, welche ihn inspiriert, sondern die Kunstscholastik. Diese anspruchsvolle und im Grunde doch so fruchtlose Wissenschaft hat die falsche, krampfhafte Kunstbildungswut auf dem Gewissen. Es gibt jedoch ein vortreffliches Heilmittel dagegen, nämlich das schöne Wort: »Ich verstehe nichts davon.« Wie erlösend für den Hörer wie für den Sprechenden wirkt dieses Wort, wo es jemals ertönt! Eigentlich sollte jedermann diesen Satz, dessen Aussprache ein wenig schwierig zu sein scheint, sprechen lernen; denn derselbe sagt die volle Wahrheit, da sich niemand anmaßen darf, in allen Gebieten der Kunst mit dem Herzen zu Hause zu sein. Freilich setzt man sich mit jedem Geständnis der Gefahr einer Unhöflichkeit von seiten schlechterzogener Menschen aus; allein das ist im Grunde ein neuer Gewinn, indem es uns lehrt, nicht mit dem ersten besten in ein Gespräch einzutreten. Eine schlechte Erziehung aber nenne ich es, wenn einer dem andern wegen dessen wirklicher oder vermeintlicher Unempfindlichkeit oder Unwissenheit in Kunstsachen glaubt etwas Unangenehmes bemerken zu dürfen, denn so wie niemand zum Kunstgenuß verpflichtet ist, so darf sich auch niemand unterfangen, seinem Nächsten ein Kunstexamen abzufordern. Es wäre wünschenswert, wenn sich in dieser Beziehung die Begriffe von Höflichkeit etwas verfeinerten, denn bei den meisten stammt das ruhelose und ruhestörende Kunstbildungsbedürfnis einfach aus der Furcht vor der gestrengen Allerweltsinspektion in Gesellschaften, Eisenbahnwagen und Gasthöfen. Sobald wir jedoch die kunstgebildeten Grobheiten den ungebildeten Grobheiten gleichstellen, wird der erschreckend hohe Spiegel der Bildungsflut urplötzlich sinken, wie denn diejenigen Völker, bei welchen ein schärferer Höflichkeitstakt im Gespräch waltet, die Kunstheuchelei kaum kennen.
Wie die Kunst zum Genusse und nicht zur Buße der Menschen da ist, so darf man sich auch den Meister, und wäre er noch so tot, nicht als einen Popanz vorstellen, der geschaffen wurde, um uns zu imponieren oder gar uns zu erdrücken, sondern als einen Freund und Wohltäter. Liebe ist das einzig richtige Gefühl gegenüber einem Meister, und zwar unbefangene Liebe, ohne Scheu und vorsündflutliche Ehrfurcht. Mit diesem Gefühl begnügt sich jeder Schaffende gern, selbst der größte; denn die Huldigung des Herzens bleibt immer die feinste Huldigung. Zur Liebe wird sich von selbst der Dank gesellen, und in ihm findet gewissenhafte Arbeit die schönste Entschädigung für ausgestandene Mühe und Gewissenskämpfe. – Die Bewunderung bedeutet den Tribut ausübender Künstler an den Meister. Der Laie ist von ihr entbunden; sie steht ihm auch schlecht zu Gesicht, da er keine Ahnung von den Schwierigkeiten hat, die in einem Kunstwerk überwältigt, von den Aufgaben, die in demselben gelöst worden sind; er begnüge sich mit Dank und Liebe; das ist natürlicher und zugleich bescheidener. – Eine Vergötterungspflicht, ein ängstliches Tabu vor berühmten Namen, ein Verbot, erlauchte Auswüchse der Unsterblichen ehrlich Kropf zu nennen, anerkennt kein Künstler. Das sind unverschämte Erfindungen anmaßlicher Seelen, welche sich unbefugterweise an einen toten Meister heranschleichen, um ihn als ihr Monopol in Beschlag zu nehmen und sich mit seinem gestohlenen Glanze vor den Menschen unleidlich zu machen. Indem sie sich vor einem einzigen auf dem Bauche wälzen, glauben sie damit das Recht zu erkriechen, allen übrigen die schuldige Ehrerbietung zu verweigern. Jeder schöpferische Geist haßt sie von Herzen.
Dichter und Pharisäer
Man mag es drehen, behandeln und benennen wie man will, es kommt doch schließlich auch in der Kunst und Poesie auf den Glauben oder Unglauben hinaus. Glauben bedeutet auf diesem Gebiete der Überzeugung von einem ewig gegenwärtigen und werkkräftigen Geiste des Schönen; Unglauben die Meinung, jener Geist marschiere getrennt von der jeweiligen Gegenwart, um in der Entfernung von mindestens einem Menschenalter zu biwakieren. Und beiderlei Überzeugung stützt sich auf die Erfahrung. Den einen erfüllt es; wie sollte er's nicht spüren? In dem andern gähnt eine graue Öde; da muß er wohl die Gegenwart für eine Jurakalkperiode ansehen.
Gläubige im höchsten Grade sind natürlich diejenigen, deren ganze Tätigkeit den Glauben als Triebkraft voraussetzt: die schöpferischen Menschen, die Urkünstler, die Meister. Wo ein Meister wohnt, da glänzt die Hoffnung, da winkt die Aufmunterung. Auf das bloße Gerücht seines Vorhandenseins erheben die Mutigen den Kopf; bis in die fernsten Winkel der Mitwelt zündet sein Beispiel; sein Name wirkt auf den Edeln als Herausforderung; sein Ruhm versiegelt den Lügen vom Minderwerte der Gegenwart das Maul. Naht man vollends einem Meister persönlich, so badet man in einem Jungbrunnen. Während in allen Gassen die Klageweiber das Siechtum des Talentes bejammern, während jeder Katheder den Torschluß der Poesie verkündet, jede Dorfzeitung den Bann über den Weinberg verhängt und jede Glocke Vesper läutet, zeigt er auf die Sonne Homers, deutet nach ebenbürtigen Adlern am Horizont, redet von der Unerschöpflichkeit des Schönen, von der Kürze des Lebens, von dem Wenigen, was schon gesammelt, von dem Unabsehbaren, was noch zu ernten übrig bleibt. Unaufhörlich krächzt die Jahrmarktspolizei an den Kreuzwegen sich heiser: »Zurück! Die Hände weg! Ihr kommt zu spät! Es bleibt nichts mehr übrig!« Freundlich grüßt der Meister von seiner gastlichen Pforte: »Alles bisher Geleistete ist nur ein Anfang.«
Doch nicht allein zur Erzeugung des Schönen, sondern ebenfalls zu seiner Annahme bedarf es des Glaubens, wohlverstanden zur unmittelbaren Annahme, zur Wertschätzung vor der Legende; denn nach der Legende können's die Wichte. Auch nach dieser Richtung stehen die Künstler wiederum weit den übrigen voran, denn sie sind nicht bloß Schöpfer und Instrument zusammen, sondern zugleich Resonanzboden. Alles Schöne findet bei ihnen ein volltönendes, durch kein grämliches Mißtrauen, durch keine mäkelnden Vorbehalte gedämpftes Echo. Ein besonderes Seelenorgan befähigt den Meister, im Sande der trostlosesten Sündfluten die Goldkörner zu erkennen, aus den verheerendsten Bücherschwärmen das Bedeutende zu unterscheiden, ich meine jenes Verwandtschaftsgefühl, welches sich unangefragt meldet, sobald etwas Großes in den Gesichtskreis tritt. Außerhalb der Künstlergemeinde gebraucht das Urteil selbst des gescheitesten Mannes Krücken. Vergleichungen mit Vorbildern, Grundsätze, Aussprüche früherer Meister und ähnliches; schätzenswerte Krücken, immerhin Krücken; die überdies den Übelstand haben, gerade dann zu versagen, wenn man ihrer am dringendsten bedarf, nämlich dann, wenn das Originelle nicht den vorhandenen Mustern gleicht, wenn das Große nicht den Kleinen behagt, wenn das Neue kein durch das Alter geheiligtes Ansehen mitbringt. Das Urteil der Künstler ist ferner zugleich ein liebevolles, auf jede wertvolle Eigenart freundlich eingehendes; kein dankbareres Publikum für den Begabten, als große Männer; je größer, desto besser. Auf Grund dieser Eigenschaften bilden zu jeder Zeit die älteren, bereits anerkannten Meister die natürlichen Beschützer der jüngeren, noch um Anerkennung ringenden. Das Bedürfnis, einem Nachfolger die gröbsten Hindernisse aus dem Weg zu räumen, was bloß ein offenes Wort der Empfehlung kostet, ist auch ein zu nahe liegendes, als daß es nicht die Regel bilden sollte; das Gegenteil findet sich daher in der Geschichte der Kunst und Literatur nur als eine seltene Ausnahme. Über das Gegenseitigkeitsverhältnis der ausgereiften Künstler wird mancherlei Unrühmliches gemunkelt. Untersuchen wir jedoch die Akten genauer, so werden wir in jedem besonderen Falle das Zerwürfnis von den Hetzereien der beiderseitigen Anhängsel herrühren sehen. Mit unablässigem Sieden und Schüren, mit Wasserstoff, Chlor und Schwefel kann man bekanntlich sogar das Gold in eine Säure verwandeln.
Jenseits der Künstler sind noch zwei Klassen von Gläubigen zu verzeichnen, oder genauer gesagt: eine Klasse und ein Zustand. Die Klasse besteht aus der Auslese der Frauen. Die berühmte vorurteilslose Empfänglichkeit der Frau für das Schöne jeder Art, jeder Form und jeden Namens ist Natur, gehört zum Wesen; in ausgezeichneten Persönlichkeiten offenbart sie sich sogar als ein sehnsüchtiges Bedürfnis, als ein Durst. Zwar möchte auch die übrige Menschheit das Schöne, behauptet es zu begehren und vermeint es zu suchen; doch einzig die Frau stößt einen unwillkürlichen Freudenruf aus, wenn sie's erblickt. Das weibliche Urteil beruht wie das künstlerische auf dem Instinkt, was von allen Grundlagen stets die köstlichste bleiben wird, weil sich der Instinkt nicht beeinflussen laßt; doch ist der Instinkt des weiblichen Urteils auf das »Schöne« im engeren Sinne beschränkt; zur Unterscheidung des Nachempfundenen vom Ursprünglichen, des Anspruchsvollen vom Großen taugt er wenig. Herrliche Titanien, die sich an einen ungeschlachten Esel oder einen parfümierten Affen anklammern, in der Meinung, einen göttlichen Genius festzuhalten, werden stets von neuem sich unsern erstaunten Augen vorstellen. Wenn indessen die Frau nicht selten einen Frosch für einen Fisch ansieht, so hält sie doch kaum jemals einen Fisch für einen Frosch; noch weniger macht sie dem Fisch zum Vorwurf, daß er kein Frosch sei: es ist dies ein edler Zug und kein gemeiner Vorzug; man darf ihn zur Nachahmung empfehlen. Und dann, gegenüber dem einmal erwähnten Gegenstande des Glaubens, was für eine Treue! Was für eine Selbstlosigkeit! Was für ein unerhörter Mangel an moralischer Feigheit! Die Frau wartet keine Zeichen und Erlaubnisscheine ab, achtet kein Verbot, ja spottet selbst des Hohns. Nach den hoffnungslosesten Niederlagen erlischt dieser Stern nicht, in den schwärzesten Sturmnächten beharrt sein milder, glückverkündender Glanz; später, nach dem Siege, wenn die andern, die sich während der Schlacht in den Gebüschen versteckt, mit zudringlichem Jubel hervorbrechen, zieht sie sich zurück; denn sie stritt nicht um den Lohn. Die Philosophie mag über die Frau urteilen, wie sie will oder muß; die Kunst schuldet ihr Ehrerbietung, Dank und Liebe. Ohne die Frau würde die Menschheit schon längst die Kunstwerke mittels Logarithmen ausrechnen und die Dichterkraft mit dem Koprometer messen.
Der Zustand ist jene wundersame Lazur, welche einige Jahre lang selbst die Seelen von gemeinem Schrot mit einem duftigen Hauch verklärt: die Jugend. Freilich nur die männliche Jugend, da die weibliche mit dem Modellstehen für die Phantasie und mit der Heiratsfähigkeit anderweitig beschäftigt ist; die männliche aber bis ins zarteste Knabenalter. Das Wechselspiel zwischen begeistertem Empfangen und schöpferischem Ahnen, zwischen bescheidener Bewunderung und keckem Selbstgefühl verleiht dem Pubertätsidealismus seinen Reiz und seinen Wert; die gewaltige Zahl der Teilnehmer und der stürmische Charakter der Überzeugungsäußerungen seine Macht. Die Ankunft neuer Jünglingsregimenter bedeutet stets eine Unterstützung des Künstlers, eine Vermehrung der Pietät für das Schöpferische, eine Verstärkung des Ruhmes für unvergängliche Werte. Dem Sauerstoff ähnlich greift die Jugend nur altes Eisen und faules Holz an, die edeln Metalle schützt sie vor dem Staube. Heilsam vor allem aber wirkt die Jugend dadurch, daß sie die babylonischen Türme der Scholastik in die Luft sprengt. Zwar beginnt das Wühlen und Schanzen sogleich von neuem; immerhin war es doch ein hübsches Schauspiel, wie die Pagoden samt den Pfaffen umherflogen.
Damit ist die Liste der Lämmer erschöpft und wir geraten zu den Böcken. Und zwar haben die Böcke eine auffallende Familienähnlichkeit mit den im neuen Testamente geschilderten. Das neue Testament unterscheidet zwei Hauptklassen von Ungläubigen, die eine: das Volk, die andere: die Pharisäer, Sadduzäer und Schriftgelehrten mit ihrem Anhang. Das Volk nennt man in der Kunstsprache »Publikum«. Unter jedem Namen betätigt es seine bekannten Eigenschaften. Einerseits: Wankelmut des Urteils und der Bedürfnisse und geistige Schwerfälligkeit, andererseits Gutartigkeit und brachligende, nutzbare Bereitwilligkeit. Das Publikum in seiner Gesamtheit zu schmähen, ist weder geziemend, noch gerecht, noch vernünftig, denn erstens hilft es nichts, zweitens hat der Mensch noch dringendere Pflichten auf Erden, als den Auftrag, Publikum zu bilden, drittens befinden sich in der buntscheckigen Gesellschaft sehr vornehme Seelen, z. B. die ersten Meister der Nebenkünste, überdies Persönlichkeiten, denen man mindestens Höflichkeit schuldet, z. B. Königinnen, endlich Personen, die kein wohlerzogener Mensch öffentlich schulmeistert, z. B. die eigenen Geschwister. Unheil stiftet das »Volk« oder »Publikum« höchstens durch seine Blindgläubigkeit gegenüber seinen Lehrern; gesellt sich nämlich zu der Blindgläubigkeit der Eifer, dann ergibt sich der »Anhang« der Pharisäer. Je weiter man sich von den Schulen entfernt, desto mehr schwindet diese Gefahr, desto harmloser und bereitwilliger erscheint das Publikum. Darum bekunden heute noch wie vor zweitausend Jahren die Meister eine merkliche Vorliebe für den Umgang mit Zöllnern und Fischern.
Für den Namen »Pharisäer, Sadduzäer und Schriftgelehrte« je einen genauen Paralleltitel in der Kunstwissenschaft zu finden, wäre eine leichte Aufgabe; sie wird mir übrigens gar nicht gestellt, da ich es nicht mit der Trennung, sondern mit der Zusammenfassung zu tun habe. Für die Zusammenfassung nun wähle ich mit Bedacht denjenigen Namen, welcher auf die gemeinsame geistige Heimat hinweist, den Namen Alexandriner. Wer immer von den Alexandrinern handelt, muß, will er nicht zur Ungerechtigkeit hingerissen werden, das natürliche Gesicht dieser Leute von ihren sauertöpfischen Mienen beim Anblick eines Wunders oder Werkes unterscheiden. An sich waren und sind ja die Alexandriner würdige Männer, achtbar und geachtet, verdient um Bildung und Wissenschaft, und darum mit Titeln und Ämtern ausgezeichnet, an antiquarischen Kenntnissen die Ersten ihrer Zeit, und darum »zu oberst in den Schulen« sitzend, voll von Eifer für die Erziehung des Volkes und der Jugend, Hüter des Tempels und des Gesetzes (der Kunst und Literatur), von schrankenloser, fast abgöttischer Pietät vor den heiligen Schriften (den »Klassikern«) erfüllt, an begeisterten Huldigungsbezeugungen für die Verfasser derselben sich niemals genugtuend; »sie bauen den Gerechten Denkmäler und schmücken die Gräber der Heiligen«; jede Kritik der Schriften, jede von den Propheten abweichende Meinung verabscheuen sie als einen Gräuel der Gotteslästerung. Sie haben überhaupt nur den einzigen Fehler, daß sie meinen, der Quell der Offenbarung wäre ausgetrocknet, daß sie lehren, der heilige Geist mache zu ihrer Zeit eine kleine Generalpause von einem Jahrhundert, daß sie die fröhlichen Weissagungen an das Ende der Welt adressieren, daß ihr gesamtes Fühlen und Denken von der Voraussetzung beherrscht wird, die Gegenwart habe keinen vornehmeren Beruf, als der Vergangenheit die Fingernägel zu putzen, und der lebendige Mensch keine wichtigere Aufgabe, als die Toten zu balsamieren. Den einzigen echten Balsam liefert natürlich die Firma Kaiphas & Cie.
Die Frage, aus welchem Seelenwinkel der sonderbare Trieb entspringt, bei abgöttischer Verehrung der Vergangenheit die Gegenwart zu entwerten und die Kinder der nämlichen Propheten, vor welchen man sich auf den Bauch wirft, schlecht zu empfangen, ein Trieb, der sämtlichen Alexandrinern so natürlich ist wie Pulsschlag und Atemzug, ist leicht und bündig zu beantworten: er entspringt aus dem Instinkt der Selbsterhaltung; darum ist er so zäh und störrisch. Das ganze Ansehen und die hohe gesellschaftliche Stellung der Alexandriner beruht eben auf einem Interimszustand, auf einer Sedivakanz, auf der Tatsache oder Annahme, daß zu ihrer Zeit keine großen Männer vorhanden seien. Sonst müßten sie ja von ihrem Thron heruntersteigen und das Lineal, das sie so meisterhaft schwingen, in ein Futteral stecken; sie haben sich aber da oben eingenistet und den Stuhl behaglich gefunden. Daraus erklärt sich ihre unbewußte, darum jedoch nicht minder eifrige Feindseligkeit gegen jede lebendige Kunst und gegen jeden Anspruch auf schöpferischem Gebiete. Ein Gleichnis soll diese Stimmung noch verdeutlichen. Wenn nach dem Tode des Herrn die Dienerschaft sich seines Erbes bemächtigt hat und in seinem Namen schaltet und waltet, wird sie wohl die Nachricht, daß ein Verwandter des Verstorbenen anrücke, mit Freuden begrüßen und dem jungen Herrn demütig mit dem Schlüsselbunde entgegenziehen? Nein, sie wird sich zwar bereit erklären, das Erbe dem Erbberechtigten auszuliefern, aber in jedem besonderen Falle den Ankömmling für unecht ausgeben; mit der Zeit wird sie sogar Aktenstücke vorweisen, welche bezeugen sollen, daß der Herr kinder- und verwandtenlos gestorben sei. Der nämliche Satz in den unbildlichen Gedanken übersetzt, lautet: die Alexandriner müssen allem Ursprünglichen und Großen, wenn es lebendig, wenn es gegenwärtig, wenn es persönlich auftritt, den Krieg ansagen, weil es sie bedroht, weil es sie von ihrer Stellung neben dem heiligen Gral herunternötigt, weil der angekündigte junge Herr voraussichtlich einen Blick und eine Stimme, ein Urteil und einen Befehl und überdies allerhand unheimliche Abneigungen haben wird. Die ganze Sorge der Alexandriner ist daher darauf gerichtet, die Ankunft einer überlegenen Persönlichkeit zu verhüten und für den unglücklichen Fall, daß sie trotzdem herannahe, Wellenbrecher zur Abwendung der schädlichen Folgen anzubringen. Der Instinkt der Selbsterhaltung erfindet zu diesem Zwecke weitläufige Verteidigungssysteme, mit vorgeschobenen Werken, kunstvoller, als der vollendetste Biberbau und Termitenhügel.
Man verfaßt vor allem einen Kalender, welcher auf Grund der Stellung des Mondes zur Erde ausrechnet, daß in den nächsten hundert Jahren überhaupt keine Talente möglich seien; die Kritik übernimmt die Verantwortlichkeit dafür, daß dieses Naturgesetz nicht übertreten werde. Ohnehin hat sich ja die Natur mit der Hervorbringung der Klassiker dermaßen angestrengt, daß man ihr unbedingt eine Erholung gewähren muß. Man schickt sie also in die Ferien, ob sie will oder nicht will. Die Diagnose ist da; die Gefahr der Schwindsucht ist dringend; der Spruch der Ärzte erlaubt keinen Spaß. Zur untrüglichen Erkennung außerordentlicher Begabung, die man so gut zu schätzen weiß wie ein anderer, wird der Mitwelt eingeschärft, daß erfahrungsgemäß jedes echte Talent mit einem Denkmal unter den Füßen einherzuspazieren pflegt; die Anwendung dieses Satzes auf das falsche Talent ergibt sich durch Umkehrung von selbst. Das Gesundheitsamt veröffentlicht ein Gutachten, laut welchem verdiente Anerkennung, oder gar Ehre und Ruhm, in der Jugend oder im rüstigen Mannesalter genossen, giftig wirkt, es wird demnach jedermann ermahnt, denjenigen, der sich etwa unnatürlicher Weise schon in jungen Jahren auszeichnet, vor der Berührung mit den genannten Stoffen ängstlich zu behüten. Den Pfuschern im Gegenteil bekommt jede Auszeichnung in jedem Lebensalter wohl, da es ihnen zur Aufmunterung dient. Junge und auch ältere noch rüstige und zuviel versprechende Meister sollen demgemäß bei ihrer Ankunft sofort isoliert und einer lebenslänglichen Quarantäne unterzogen werden, bis eine Medizinalkommission ihren nahe bevorstehenden Tod, beziehungsweise ihren vollendeten siebzigsten Geburtstag bezeugt. In diesem Falle versammelt sich der Prüfungsausschuß der Alexandriner, um über ihre Aufnahme in den literarischen Senat zu beraten. Es darf immer nur einer auf einmal in den Senat aufgenommen werden, auch ist bei der Aufnahmefeierlichkeit strengstens darauf zu achten, daß die Anerkennung des einen ja den Charakter einer Zurücksetzung der übrigen enthalte; darüber muß in jedem einzelnen Falle der Takt entscheiden. Das Empfangsgeschrei muß so laut angestimmt werden, daß niemand es überbieten kann, so sichert man sich das Vorrecht der Verehrung. Der Verfassungsrat der vereinigten Pharisäer, Sadduzäer und Schriftgelehrten beehrt sich, einer löblichen Gegenwart und Zukunft mitzuteilen, daß Höchstdieselben beschlossen haben, die aristokratische Republik der Künstler und Dichter in eine Wahlmonarchie zu verwandeln. Wählbar sind nur tote Senatoren. Allfällige Bewerber um die Stelle eines Dichterfürsten haben ihre Zeugnisse, ihre nachgelassenen Werke und ungedruckten Briefe nebstCurriculum vitae, Namen, Wohnort und Nummer des Grabsteins bis spätestens zu Ende des Monats bei Endesunterzeichneten einzureichen. Jedes Gesuch, dem nicht ein amtlich beglaubigter Todesschein beigegeben ist, bleibt unberücksichtigt. Künstler, Schriftsteller und Dichter sind von der Abstimmung ausgeschlossen. Insubordinationen gegen den einmal erwählten Dichterfürsten in Form unbefugter Vergleichung desselben mit einem ihm an Rang und Kommando Nachstehenden soll als Hochverrat geahndet werden. Dem verewigten Dichterfürsten ist eine mit unumschränkte Vollmacht ausgerüstete, aus der Zahl der Alexandriner zu ernennende Regentschaft beigegeben, welche in seinem Namen die Regierungsgeschäfte besorgt.
So weit die Alexandriner. Was sagt hierzu der Künstler und Dichter? Nun, der geht seiner Wege und tut seine Wunder und Werke. Treiben es jene gar zu dreist, so wendet er auch wohl einmal das Haupt nach ihnen und macht sich mit einer poetischen Metapher Luft. Heutzutage wählt er hierzu mit Vorliebe Bilder aus der Klasse der höheren Wirbeltiere. Ehemals hieß es: »O, ihr Schlangen, Heuchler und Otterngezüchte!« Im Grunde sind es ja keine Ottern, sondern bloß Blindschleichen. Zum Unglück der Alexandriner unterstreicht jedoch die Nachwelt solche Exklamationen, selbst wenn sie unbillig sein sollten, doppelt und dreifach mit innigem Behagen. Deshalb, weil sie den Dichtern so unendlich viel und ihren Gegnern so unendlich wenig verdankt, weil ferner jene so überaus liebenswürdig, und diese es so ganz und gar nicht sind. Man wird immer von neuem versucht, im Namen der Gerechtigkeit ein gutes Wort für die verwünschten Alexandriner einzulegen. Wer verfolgt indessen ihr Andenken am wütendsten? Die Alexandriner der jedesmaligen Gegenwart. Und das ist der Humor des Unglaubens. Lächelt er auch nicht zwischen Tränen, so beißt er doch in sein eigenes Bein. Mit diesem versöhnenden Bilde will ich schließen.
Vom Ruhm
Eine Nation sollte von Zeit zu Zeit hinter dem Gartenzaun nachschauen, ob es mit dem Ruhm, den sie als höchsten Preis ihren Auserlesenen zu spenden gedenkt, richtig steht. Denn so bequem wie man meint, geht es nicht, als ob der Ruhm ein natürliches, unzerstörbares Eigentum des Menschengeschlechtes wäre.
Im Gegenteil, es gehört sehr, sehr viel dazu, damit einer Nation der Ruhm gedeihe, und die mindeste schlechte Luft erstickt den Lorbeer. Barbarische, despotische, hyperloyale, militärische, scholastische Völker oder Zeitalter entbehren des Ruhmes, sie können ihre Helden bloß ehren, nicht rühmen. Ehre aber ist die feindliche Schwester oder, wenn man lieber will, die Schlingpflanze des Ruhmes. Ehe man sich's versieht, hat sie ihn verdrängt und erwürgt.
Zum Nachschauen aber dünkt mich gegenwärtig Anlaß vorhanden. Denn ich glaube zu bemerken, daß der deutsche literarische Ruhm der Gegenwart an häßlichen Übeln krankt.
Er ist zunächst treulos geworden, indem, wer vorgestern gerühmt wurde, heute in die Rumpelkammer geworfen wird. Sämtliche gepriesene Namen verbrauchen sich mit einer Schnelligkeit, als wäre die Unsterblichkeit ein Konsumartikel. Kaum in den Mund des Volkes genommen, schmilzt auch schon der Herr. Ja, es läßt sich geradezu logisch ausrechnen: Weil heute einer als Genie verkündet wird, wird er in zehn Jahren abgetan sein, mit verächtlichem Achselzucken. Wer ein feines Gehör hat, vermag sogar während des Jubels schon den Nebenton im Falsett zu vernehmen, der später die höhnische Dominante bilden wird.
Der Ruhm ist ferner frech geworden. Man flüstert einander nicht mehr ehrerbietig einen Namen zu, sondern man brüllt ihn den Leuten um die Ohren, den Hut auf dem Kopf, die Hände in den Hosen. Als handelte es sich um einen sozialdemokratischen Genossen. Ich kenne aber nichts Beleidigenderes als einen Ruhm ohne Ehrerbietung. Erst achtet einen Menschen, dann verbeugt euch, hierauf verbeugt euch noch einmal, hernach rühmt ihn.
Freilich, wenn man als Gründer auf Verabredung ergebene Leute gleich Interimsscheinen an den Börsen ausschreit, wenn man seinesgleichen auf sieben Schultern hebt, damit er groß aussehe, dann hält es allerdings schwer, Ehrerbietung für den allzu verwandten Klienten aufzubringen. Und siehe: Das Beispiel wirkt. Andere Gründer unternehmen andere Berühmtheiten. Dann entsteht unlauterer Wettbewerb. Es setzt Papst und Gegenpapst. Und keiner glaubt an seinen eigenen Papst, geschweige denn an den feindlichen.
Da gilt es nun beizeiten vorzubeugen. Sonst könnte es eines Tages widerfahren, daß der oder jener, dem man den Ruhm anbietet antworte: »Aber nicht wahr, ihr wascht ihn doch erst gründlich mit Karbolseife, ehe ich ihn in die Hand nehme, euren Ruhm?«
Altersjubiläen
Ich bin nicht der einzige, der den Jubel nicht nachzufühlen vermag, welcher eine Nation in dem Augenblicke heimsucht, da ein verdienter Mann sechzig oder siebenzig oder achtzig Jahr alt wird. Vielmehr befinde ich mich in vorzüglicher Gesellschaft, nämlich in der Gesellschaft der Gefeierten selber. Denn wer an einem Jubiläum am allerwenigsten zum Jubeln aufgelegt ist, das ist allemal der Jubilar. Dem ist ganz besonders zumute, wehmütig und bitter. Die Geduldigen halten ergeben still, die Trotzigen retten sich vor der zugedachten Operation durch schleunige Flucht ins Gebirge, falls sie nicht gar Feuer und Schwefel herunterknurren wie Grillparzer.
»Es tut ihnen aber im Grunde doch wohl; trotz aller Wehmut.« Gewiß, Wehmut tut wohl, wie jedes erweichte Leid. Und sie zu erweichen, sie zu rühren, vielleicht bis zu Tränen zu rühren, das mag euch mit euren massenhaften Liebes-, Dankes- und Bewunderungsbeteuerungen unschwer gelingen. Da schwindet mancher unbewußte Groll, da lösen sich allerlei böse Spannungen. »Es hat mir doch wohl getan.« Wenn das euch genügt, vortrefflich. Nur erinnert mich dieses »Dochwohltun« fatalerweise an einen Fall, der nicht eben nach Jubel schmeckt, nämlich an einen Trauerfall. Dort tut es den Beteiligten auch doch wohl, wenn man sie durch Teilnahme zu Tränen rührt. Eure Jubiläen sind demnach Kondolenzjubiläen. Kurz, im Munde des Gefeierten – und der Gefeierte an einer Feier zählt doch auch ein wenig mit – schmeckt das Jubiläum wie eine sauersüße Pastete, angefeuchtet mit Bitterwasser.
Glückwünschen kommt ihr dem Herrn? Glückwünschen wozu? wenn es erlaubt ist. Man wünscht einem Menschen Glück, wenn er soeben etwas Erwünschtes erreicht hat. Also wenn er Major geworden ist, oder Regierungsrat, oder wenn er das große Los gewonnen hat oder eine reizende Braut oder einen gesunden kräftigen Buben (Mutter und Kind befinden sich den Umständen angemessen wohl). Aber ein Jubilar, was hat denn der heute Jubelnswertes erreicht? Das siebenzigste Altersjahr. Ein verwünschter Gewinn! Das heißt einen Erlaubnisschein auf Magenkrebs oder Gehirnerweichung.
Gewiß, ein schöner Gedanke, eine Nationalfeier der Bewunderung einem Lebenden geboten! – wenn sie rechtzeitig käme, wenn sie spontan gediehe, aus naiver überquellender Begeisterung. Dagegen eine Bewunderung, die aus dem Kalender stammt, die pedantisch ein Datum abwartet und zwar ein möglichst spätes Datum, um ja nicht zu früh, das heißt rechtzeitig zu kommen, die nach dem Taktstock der Kapellmeister schaut, um den richtigen Einsatz nicht zu verfehlen, eine Bewunderung, die da organisiert wird wie ein Kupfertrust, solch eine gnädige Bewunderung von oben herab, wo das hohe Alter dem Verdienst als mildernder Umstand angerechnet wird, das ist eine ranzige Nationalfeier. Meint ihr denn wirklich, er sähe sie nicht, euer Jubilar, die Schnürchen, welche das Jubiläum ziehen? er mustere und wäge sie nicht, die Impresario, welche die nationale Begeisterung pachteten? die Totengräber, welche ihm die Hand drücken, während ihnen der druckfertige Nekrolog aus der Tasche guckt? Es ist erhebend, König zu sein. Aber ein King aus Gunsten von Kingsmakern! Und von was für Kingsmakern! Sagen wir's doch klipp und klar: eure angeblichen Dichterjubiläen sind Buchhändlerjubiläen. In zweiter Linie Bio- und Monographenjubiläen. Mit siebenzig Jahren wird ein Dichter nachlaßfähig. Da liegt der Honig.
Wissen Sie, für wen ursprünglich die Altersjubiläen erfunden wurden? wen sie erquicken? wem sie wohltun? ganz und gar wohltun, nicht »doch« wohltun? Jenem, der kein anderes Verdienst besitzt als sein hohes Alter, jenem, der zeitlebens keinen anderen Anlaß bot ihn zu feiern, als seinen Geburtstag. Ein kleiner Kassier, ein untergeordneter Beamter, ein dunkler Schullehrer in einem finstern Städtchen, welche fünfundzwanzig oder fünfzig Jahre treu und bescheiden im Dienst standen, wenn man solchen ein Altersjubiläum oder, was auf dasselbe hinausläuft, ein Dienstjubiläum stiftet, denen tut das in der Seele wohl. Deshalb, weil sie sich hiermit zum erstenmal ihres Lebens in den Vordergrund des Interesses gerückt fühlen, weil sie nun wenigstens einmal in ihrem Dasein ihr Ehrgeizchen befriedigt spüren, weil sie hinfort die süße Illusion neben sich aufs Krankenbett legen dürfen, etwas auf Erden gewirkt, etwas gegolten, etwas erreicht zu haben. Wer mithin einen großen Dichter an seinem 70. Geburtstag feiert, erhebt ihn in die schwindelhafte Höhe eines Buchhalters von Brandts Schweizerpillen.
Eines ist sicher: vor dem 70. Geburtstag hatte der Gefeierte einen sechzigsten, vor dem sechzigsten einen fünfzigsten, vor dem fünfzigsten einen fünfundvierzigsten und dreiundvierzigsten Geburtstag. Warum wurde damals nicht gejauchzt, nicht geredet, nicht gedruckt und nicht gebechert? Ich verstehe, der Ruhm hat keine Jubelouverturen, sondern bloß Jubelzapfenstreiche. Immerhin eine dreißigjährige Generalpause vor Beginn des ersten Akkordes ist etwas lang und ein plötzliches Fortissimo mit dem vollen Orchester nach den Sordinen ist etwas plump. So instrumentiert der wahre Ruhm nicht. Der liebt dassempre crescendo. Aber freilich, von einem Jubel, der das Tempo verfehlte, darf man auch keinen Takt erwarten.
Ohne Scherz: der Gegensatz zwischen dem Schweigen während langer Jahrzehnte und dem plötzlichen Tutti mit Pauken am Ende des Lebens ist eine so auffallende Erscheinung, daß sie zum Nachdenken auffordert, daß sie eine Erklärung erheischt. Da habe ich mich nun öfters gefragt, ob nicht am Ende doch der blaßgelbe Neid ein klein klein bißchen mit im Spiele wäre. So habe ich mich gefragt und ich habe mir geantwortet: ja, und antworte mir noch so.
Der Hauptgrund jedoch ist mir zufällig zum Bewußtsein gekommen, damals als Deutschland das Jubiläum Paul Heyses beging. (Ich sage ein Jubiläum »begehen« wie man sagt eine Geschmacklosigkeit begehen.) Dazumal erschien nämlich in einer der ersten Zeitungen Deutschlands ein Breve, das sich feierlich dagegen verwahrte, es möchte etwa Brauch werden, Dichter so unheimlich früh, nämlich in ihrem sechzigsten Jahre schon, zu feiern. Da steht's ausdrücklich, offen und ehrlich. Greifen wir's, halten wir's fest und lassen wir's nicht mehr entschlüpfen. Ein sechzigjähriger Dichter zu jung, um gefeiert zu werden. Mithin ist es eingestandenermaßen die Rüstigkeit, die Vollkraft des Schaffens, was die Generalpause des Ruhmes verschuldete und nicht etwa irgendein anderer Umstand. Ehe der Dichter mit wenigstens einem Fuß im Grabe steht, gebührt ihm keine Feier. Wie gesagt, solch einen goldenen Spruch darf man nicht mehr aus dem Schatze der Menschheit schwinden lassen; er gehört auf ewige Zeiten ins Gedächtnis der Nachwelt, neben den Sprüchen der sieben Weisen.
Indessen das ist nun nicht mehr der Neid, der so spricht. Denn so deutlich drückt sich der Neid nicht aus, der munkelt. Nein, es ist vielmehr die liebliche Voraussetzung, als ob die Bedeutung eines Dichters erst dann anfange, wenn er ein »abgeschlossenes fertiges Ganzes« bildet, wenn man seine »gesamte Tätigkeit« »überschauen«, wenn man ein »Lebensbild« von ihm »entwerfen« kann, mit anderen Worten: wenn man ihn abhandeln, erklären, herausgeben, kommentieren und emendieren, wenn man ihn, kurz gesprochen, in den literarhistorischen Mörser stampfen kann.
Das ist's; das ist das »Sesam, tue dich auf«. Nicht die Werke – Gott bewahre, die sind Nebensache – sondern das »Dichterbild«, der Platz, die Nummer, die dem Manne in der Literaturgeschichte gebühren, das ist das Wichtige. Wenn wir's sonst nicht wüßten, so wüßten wir's jetzt: Das gegenwärtige Deutschland, trotz allem Getue und Gerede über Poesie und Goethe ist mit nichten literarisch, sondern literarhistorisch veranlagt. Nicht um das Genießen der Dichter, sondern um das Dozieren derselben ist es ihm zu tun.
Auf dasjenige Jubiläum aber, auf welches ich mich freue, an welchem ich teilnehmen möchte, werde ich wohl noch lange warten müssen: auf das Jubiläum zu Ehren eines großen Werkes, das soeben frisch erschien.
Datumsjubiläen
Der hundertjährige, der fünfzigjährige, vielleicht auch der fünfundzwanzigste Todestag. Warum nicht der achtundneunzigste oder der neunundvierzigste? Ich begreife, es geht nach dem Dezimalsystem. Wenn die Erde sich so und so vielmal um die Sonne geschwungen hat, dann geschieht plötzlich ein allgemeines Hallo über einen Verschollenen.
Nun ist es ja unstreitig ein erhebendes Schauspiel, diese Popularität der Astronomie und des Dezimalsystems. Nur sage mir doch einer, was hat das Null Komma Null, was hat die Ekliptik mit dem Wert eines toten Schriftstellers oder mit der Freude über seinen Wert zu schaffen?
Wäre das bloß ein harmloses Spiel, wie etwa das Lotto, so hätte ich nichts dagegen einzuwenden. Allein diese Prämienziehung gehört in die Klasse der schlimmen Lose, welche den Abnehmern unfehlbar Schaden bringen. Ich meine Schaden am Wahrheitsgefühl. Denn was da gelogen wird, an den hundertjährigen Weißwaschereien! gelogen! gelogen!
Wenn morgen Wieland, übermorgen Paracelsus, am Dienstag Abälard gefeiert wird, oder wen sonst der Wendekreis des Krebses zufällig aus dem Staub der Geschichte emporwirbelt, so wird das andächtige Europa drei Tage lang staunend vernehmen, wie und was maßen Wieland ein Homer von Gottes Gnaden, Paracelsus der Begründer der Naturwissenschaft, Abälard der geniale Vorläufer der Reformation gewesen. Im Grunde, das andächtige Europa vernimmt es durchaus nicht staunend, denn es glaubt ja kein Wort davon. Und die es sagen, glauben's auch nicht, oder, was noch schlimmer ist, sie wissen nicht einmal, ob sie's glauben oder nicht. Aber jedermann hält es für richtig, daß man's sage. Das nun, sehen Sie, nenne ich lügen. Oder was heißt denn sonst lügen?
Übertreibe ich etwa? Nehmen wir doch den ersten besten der jüngst Jubilierten. Zum Beispiel Bürger. Haben sie ihn uns da in unverantwortliche Klassikerhöhen emporgeschroben, den armen Bürger, dem anderthalb Balladen passierten, von jenen, die keinen Sommer machen!