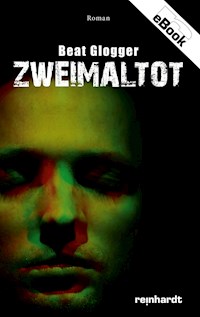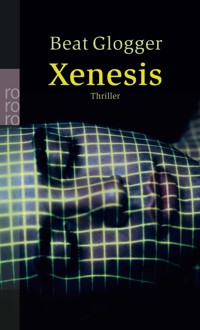8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
DAS BLUT DES SIEGERS Sprint-Superstar Jesse Brown ist unbeirrbar, unbezwingbar – und offenbar auch unfehlbar. Denn während um ihn herum Sportler mit Dopingskandalen von sich reden machen, bleibt er aus Überzeugung sauber. Doch dann sterben kurz vor den Olympischen Spielen mehrere Athleten auf mysteriöse Weise. Todesursache: Gendoping. Jesse kommt ein schrecklicher Verdacht. Könnte sein Trainer Emilio Batista ihn heimlich gedopt haben? Als der Ausnahmeathlet die Zusammenarbeit mit Emilio beenden will, entführt man Jesses Freundin. Wer steckt dahinter? Für Jesse beginnt ein Lauf um Leben und Tod … «Glogger kann ohne weiteres in die Bibliothek zwischen Preston und Crichton eingereiht werden.» (ETH Life) In seinem neuen rasanten Thriller entwirft der Autor ein unheimliches Szenario von einer Welt, in der an der genetischen Verbesserung des Menschen experimentiert wird. Dabei entsprechen die medizinischen Fakten und Zusammenhänge dem aktuellen Stand der Wissenschaft. «Es ist die Kombination von detailreichem Faktenwissen und rasanter Handlung, die an diesem Buch fasziniert.» (Neue Zürcher Zeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Beat Glogger
Lauf um mein Leben
Thriller
Prolog
Das ausgeblichene blaue Sportshirt war ihm ein paar Nummern zu groß, doch Jesse trug es mit offenkundigem Stolz. Schließlich besaß nicht jeder ein Originaltrikot der New York Giants. Auch seine Laufschuhe waren ziemlich abgenutzt, was den dunkelhäutigen Jungen aber nicht daran hinderte, sich selbstbewusst unter all die modisch gekleideten Jogger zu mischen, die im Central Park ihre Runden drehten.
Der warme Sonntagnachmittag hatte unzählige Menschen in den Park gelockt. Mütter mit Kinderwagen, Jugendliche, die auf Kickboards durch die Gegend flitzten oder Fußball spielten, Männer und Frauen, die unter den hohen Bäumen Tai-Chi-Übungen machten oder einfach auf einer Bank im Schatten saßen.
Jesse ließ den großen Weiher hinter sich und nahm den Weg, der langsam anstieg. Vor ihm tauchte eine Gruppe Touristen auf: ältere Damen und Herren in beigefarbener Freizeitbekleidung und Gesundheitsschuhen, alle behängt mit den bunten Taschen ihres Reiseveranstalters. Sie schossen Fotos und hantierten mit ihren Videokameras herum.
Ihnen entgegen rollte ein Skater lässig den Hügel herunter. Seine schwarzen Augen beobachteten die Touristen aufmerksam. Plötzlich beschleunigte der Junge sein Board, fuhr ein paar waghalsige Kurven und ruderte wild mit den Armen.
«Achtung!»
Die Touristen stoben auseinander.
«Aus dem Weg!», brüllte der Skater und hielt direkt auf eine füllige Dame zu, die sich hysterisch kreischend in Sicherheit zu bringen versuchte. Doch die Kollision war nicht mehr zu vermeiden. In hohem Bogen flog ihr Strohhut davon, und die Frau fiel – in die starken Armen des Skaters.
«Entschuldigung», stammelte er. «Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Madam.»
Dann führte er die vor Schreck am ganzen Körper zitternde Frau zur nächsten Parkbank.
«Ihr Hut!», rief er plötzlich und lief los, um die zerbeulte Kopfbedeckung zu holen, die weiter unten auf dem Fußweg lag. Doch er hatte den Hut noch nicht erreicht, da kam schon Jesse herangetrabt und bückte sich im Laufen nach ihm.
«Hier!», rief Jesse und drückte Buzz den Hut in die Hand.
«Danke», grinste Buzz.
Er brachte den Hut der Frau zurück, die inzwischen von der aufgeschreckten Touristenschar umringt war. Ohne sich umzudrehen lief Jesse weiter. Dass vom Hut verdeckt auch ein Gegenstand von Buzz zu Jesse gewechselt hatte, war niemandem aufgefallen.
Jesse verließ den geteerten Weg, durchquerte den menschenleeren Conservatory Garden und lief Richtung Norden. Weiter vorne saß ein Mädchen lesend auf einer Bank. Sie trug ein weißes Kleid, Kniestrümpfe und Lackschuhe. Die große Tasche, die sie neben sich stehen hatte, war weit geöffnet.
Kaum merklich verlangsamte Jesse sein Tempo. Der Gegenstand, den er jetzt aus der Hand gleiten ließ, fiel direkt in die Tasche des Mädchens.
Lizz klappte das Buch zu, hängte sich die Tasche um und verließ den Park. Bis zum Auto war es nicht weit.
Der dunkelblaue Chrysler, den sie in der Park Avenue geparkt hatten, war ein unauffälliges Mittelklassemodell. Dass der Farbton der Motorhaube nicht exakt dem des übrigen Wagens entsprach und eine handtellergroße Stelle am linken, vorderen Kotflügel wenig fachmännisch ausgebessert worden war, fiel nicht weiter auf. Lizz ging langsam am Chrysler entlang, griff in ihre Tasche und warf die Digitalkamera durch das halboffene Seitenfenster in den Wagen.
Kurz darauf saß das Mädchen im weißen Kleid wieder lesend auf der Bank im Central Park. Der Halbwüchsige auf dem Skateboard rollte wieder lässig den Hügel hinunter. Und der Junge mit dem ausgeblichenen, viel zu großen Trikot der New York Giants joggte wieder am Weiher entlang.
«Halt!» Ein Polizist stellte sich Jesse in den Weg.
Doch Jesse reagierte blitzschnell. Er ließ sich zu Boden fallen, rollte zur Seite, sprang wieder auf und rannte in der entgegengesetzten Richtung davon.
«Stehen bleiben!», schrie der Polizist und setzte ihm nach.
Jesse lief aus dem Park und mitten in den Duke Ellington Circle. Mit ein paar riskanten Sprüngen erreichte er die andere Straßenseite. Dann sprintete er auf einen der grauen Wohnblocks zu. Hier hatte er alle möglichen Fluchtwege ausgekundschaftet. Hastig stieß er die gläserne Tür zur Eingangshalle auf, nahm die erste Tür rechts: Kellerräume. Er rannte den Korridor entlang. Dann wieder eine Tür rechts: die Waschküche. Und gelangte zu einem weiteren Korridor. Schwer atmend lief er zur Tür am Ende des Gangs. Er trat ins Freie.
Weit und breit kein Bulle mehr.
Jesse lächelte.
Es blieb ihm jetzt eine halbe Stunde, um sich mit den anderen beim Wagen in der Park Avenue zu treffen. Sie hatten gesehen, dass er in Schwierigkeiten geraten war. Kein Grund zur Panik, doch es bedeutete den Abbruch der Aktion.
Jesse hatte zwei Möglichkeiten, zum Wagen zu gelangen. Entweder er nahm die Madison Avenue nach Süden bis zur 108th Street, oder er lief schon hier oben in die Park Avenue rüber und dann Richtung Süden bis zum Treffpunkt. Für die Madison sprach, dass es zahlreiche Geschäfte und Fußgänger gab, die Schutz boten. In der Park Avenue sah man Gefahren allerdings schon von weitem und konnte im Schatten der Hochbahntrasse laufen.
Jesse entschied sich für die Park Avenue.
Über seinen Kopf hinweg donnerte ein Zug. Sieben Wagen zählte er: die Linie in die Bronx. Mit der hätte er nach Hause fahren können. Doch es war abgemacht, dass alle zusammen im Auto zurückfuhren. Abgesehen davon hatte er auch gar kein Geld für die Fahrt.
Als der Lärm des Zugs verebbte, hörte Jesse die jaulende Sirene. Bullen!
Jesse versuchte cool zu bleiben, so zu tun, als gingen sie ihm am Arsch vorbei. Aber seine Beine rannten einfach los.
Er lief auf die andere Seite der Straße. Doch er konnte die Cops nicht abschütteln; die Bullen schmierten einen U-Turn auf den heißen Asphalt.
Jesse nahm die 108th Street ostwärts. Wohnblocks, Hinterhöfe, Keller. Dort konnte er untertauchen.
Dicht hinter ihm heulte die Sirene.
Er lief, so schnell er konnte. Sein Herz raste, der Kopf dröhnte, die Lungen schmerzten. Er musste sofort weg von dieser Straße.
Plötzlich verstummte die Sirene.
Aber das war noch gefährlicher, als sie dicht hinter sich zu hören: Das bedeutetet, sie wollten mit ihm spielen. Wollten ihn hetzen. Wollten sich nicht mit ihm abmühen. Mit einem kleinen Dieb, einem kleinen schwarzen Jungen aus der Bronx, auf den niemand zu Hause wartete. Der vielleicht nicht mal ein Zuhause hatte. Warum auch sollten sie ihn verhaften, verhören, anzeigen? Nur um ihn dann wieder laufen lassen zu müssen, weil er noch ein Kind war? Und um ihn ein paar Tage später wieder aufzugreifen?
Viel lieber wollten sie etwas Spaß haben. Eine nette, kleine Jagd, dann ein Unfall. Ein bedauerlicher Unfall in einer abgelegenen Straße. Eine Kollision zwischen einem flüchtenden Kind und einem schleudernden Streifenwagen.
Das Kind würde noch am Unfallort sterben.
Panik packte Jesse.
Aber sie lähmte ihn nicht.
Sie trieb ihn an.
Er gab, was er konnte.
Er lief jetzt um sein Leben.
Doch er lief für sein Leben gern.
Rechts! Eine blaue Metalltür! Nur angelehnt! Das Tor zu einem Hinterhof. Jesse stoppte abrupt und schlüpfte hinein.
Der Streifenwagen raste vorbei.
Jesse preschte auf den Eingang eines Backsteinbaus zu.
Er drückte die rostige Türklinke.
Zugesperrt.
Er hörte, wie die Bullenkarre bremste und mit heulendem Motor zurücksetzte.
Die Metalltür schlug auf. Sie waren im Hof.
«Stehen bleiben, Polizei!»
Mit zwei, drei Sprüngen war Jesse bei der nächsten Tür.
Sie ging auf.
Ein Keller.
Jesse hastete durch die Dunkelheit, blind darauf vertrauend, dass in dieser Gegend jeder Keller zwei Türen hatte.
«Stehen bleiben, oder wir schießen!»
Er hetzte weiter, wand sich vorbei an Motorrädern, Bikes und Gartenmöbeln. Als er am Ende des Kellers die Tür aufriss und Licht in den Keller drang, krachte es.
Dicht neben seinem Kopf schlug eine Kugel in die Wand. Glas splitterte. Verputz stob ihm ins Gesicht.
Das nächste Projektil bohrte sich in das Holz der Tür.
Doch Jesse war schon draußen.
Und stand vor einem hohen Gitter.
Shit!
Aus dem Keller drang Lärm: Fahrräder fielen zu Boden. Ein Polizist fluchte laut.
Jesse sah sich im Hof um. Das Gitter war zu hoch, und darunter kein Platz, um hindurchzuschlüpfen. Auf die Straße kam er also nicht. Aber weiter hinten gab es noch ein paar Türen.
Er lief zur nächstgelegenen. Zugesperrt.
Eine zweite: abgeschlossen.
Die dritte ging auf.
Jesse raste durch einen schummrigen Korridor, bog um eine Ecke, drückte eine schwere Stahltür auf. Fehlanzeige: Heizungsraum.
Eine weitere Tür. Er riss sie auf – und stand im gleißenden Sonnenlicht. Vor sich eine Straße, Verkehr, Fußgänger. Jesse tauchte in der Menge unter, ging ein Stück im Zickzack. Dann verschwand er in einem Hauseingang und gönnte sich endlich eine Pause.
Er stand mit dem Rücken gegen die Tür gelehnt und lauschte angestrengt. Sein Kopf wollte explodieren, seine Lungen gierten nach Luft, die Muskeln brannten wie in einem Säurebad. Keinen Meter weiter hätte er jetzt noch rennen können. Er hatte alles aus sich herausgeholt, war ausgequetscht wie ein Schwamm – und fühlte sich trotzdem großartig.
Er hatte sie abgehängt.
Er war wieder einmal seinem Ruf gerecht geworden.
Er war der Schnellste.
Etwas später, an der Stelle, an der zuvor der Chrysler gestanden hatte, starrte Jesse wütend auf das leere Parkfeld. Er wusste, dass es so abgemacht war: Wenn einer es innerhalb der halben Stunde nicht schaffte, setzten sich die anderen mit der Beute ab.
Trotzdem!
Er trat nach einer leeren Cola-Dose, die scheppernd über die Fahrbahn schlitterte. Tränen schossen in seine Augen.
Als Jesse in seine Straße einbog, war es bereits dunkel.
«Brauchst du was?», fragte ihn ein Typ mit schmutziger Rastakappe und blutunterlaufenen Augen.
Jesse ignorierte ihn.
«He, Kleiner. Für dich ganz billig!»
«Leck mich am Arsch!» Jesse verdrückte sich in einen Hauseingang, der vom Boden bis zur Decke mit Graffiti vollgeschmiert war. Im Treppenhaus stank es nach Erbrochenem und Urin – er war zu Hause.
Er stieg die ausgetretenen Stufen hoch. In der ersten Etage drang Musik und Kindergeschrei durch eine Tür. Weiter oben hörte er eine Frau weinen. Und einen Mann fluchen.
Im fünften Stock war es still. Und dunkel.
Die Wohnungstür stand offen.
«Hallo?»
Keine Antwort.
Jesse knipste das Licht an. Vom engen Korridor ging es links in die Küche, geradeaus ins Schlafzimmer, rechts zur Toilette. Jesse ging pinkeln.
Jemand hustete.
Jesse betätigte die Spülung und trat in den Korridor.
Durch die Milchglasscheibe in der Küchentür sah er ein bläulich flackerndes Licht.
Der Fernseher lief ohne Ton.
Am Küchentisch saß eine Frau. Das Haar zerzaust, den hohlen Blick starr auf die Flimmerkiste geheftet, in der eine Gameshow lief.
«Mom!»
Wie in Zeitlupe drehte die Frau ihr Gesicht zu Jesse, ließ die Plastiktüte sinken, die sie sich vor Mund und Nase gehalten hatte, und krächzte etwas. Ihre wässrigen Augen sahen durch Jesse hindurch. Sie war in einer anderen Welt. Einer Welt, die sie sich aus der Plastiktüte ins Gehirn sog.
Es hatte keinen Zweck.
Jesse wandte sich zum Kühlschrank. Er hatte den ganzen Tag nichts gegessen. Er fand vier Eier, die ganz okay aussahen. Er rückte die Bratpfanne auf den Herd, wartete, bis sie heiß war, und schlug die Eier hinein.
Er sah zu, wie das Eiklar sich langsam trübte. In der Pfanne brutzelte es leise. Über das Haus donnerte die Abendwelle vom La-Guardia-Flughafen. Dann waren auf der Treppe schwere Schritte zu hören.
«Hi, Dad», sagte Jesse erfreut, als sich die Tür öffnete.
«Hi, Jesse.» Mit seinem breiten dunklen Gesicht blickte ihn sein Dad freundlich an. Er war groß und stark, so wie Jesse auch einmal werden wollte.
Dad strich ihm übers Haar. Er roch nach Metall und Öl. Manchmal roch er nach frischem Beton oder Teer, wenn er von der Arbeit nach Hause kam. Manchmal auch nach Abfall. Er ging jeden Morgen um fünf zur Arbeitsvermittlung hinter dem alten Schlachthof. Oft auch sonntags. Und oftmals vergebens.
Dad warf einen Blick in die Bratpfanne. «Guter Junge.»
Dann sah er zu seiner Frau hinüber, die beide Ellbogen auf den Tisch gestützt und das Gesicht in den Händen verborgen hatte. Sie rührte sich nicht.
Das waren Momente, in denen Freundlichkeit und Wärme aus Dads Gesicht verschwanden. Momente, in denen Jesse wusste, sein Dad verdiente Besseres.
Jesse nahm die Pfanne vom Herd. «Möchtest du?»
«Gern», sagte Dad und strich ihm abermals über den Kopf.
«Wie viel?», stieß plötzlich die Mutter hervor, ohne die Hände vom Gesicht zu nehmen.
Dad warf einen flüchtigen Blick auf sie und stellte drei verschieden farbige Teller mit abgeschlagenen Rändern auf den Tisch. «Isst du auch?», fragte er seine Frau.
Jesse teilte das Rührei auf.
«Wie viel?», krächzte die Mutter wieder. «Wie viel du bringst, will ich wissen.»
Bevor Dad antwortete, platzierte er sorgfältig die Gabel auf den Tellerrand. «So viel ich an einem Tag verdienen kann: achtzig Dollar.»
«Achtzig!», höhnte sie.
«Immerhin.» Dad blieb beherrscht. «An-der-Tüte-Hängen bringt gar nichts.»
«Scheißkerl.»
«Immerhin ist der Scheißkerl gut genug, um die Kohle ranzuschaufeln», sagte Dad so leise, als rede er zu sich selbst.
Die Mutter spuckte auf den Tisch.
«Okay», sagte Dad ganz ruhig. «Wenn du auf mein Geld spuckst, muss ich dir ja keines mehr geben.»
«Du weißt genau», presste sie hervor, «ich bin krank.»
«Wenn das Geld nicht immer für dein Gift draufginge, hätten wir wenigstens was zu futtern, wenn ich nach Hause komme», sagte Dad. «Jesse hat für mich gekocht.»
«Scheiß-Jesse! Scheiß-Kerl! Scheiß-Geld!» Sie kotzte die Worte förmlich aus sich heraus. «Verreckt doch daran!»
«Du weißt ja nicht, was du redest», sagte Dad und drehte sich zu Jesse um.
«Und? Was hast du heute getrieben?»
Jesse druckste herum. «War im Central Park.»
«Junge!» Dad sah ihn an und schüttelte langsam den Kopf. «Ich habe dir doch gesagt, du sollst das lassen.»
«Du hast gesagt, wir brauchen Geld», erwiderte Jesse trotzig.
«Aber nicht so.»
«Jeden Dollar, hast du gesagt.»
«Ich will nicht, dass du krumme Dinger drehst.»
Jesse murrte.
«Schau mich an.»
Widerwillig wandte Jesse ihm den Kopf zu.
«Junge, ich tue alles, damit wir aus diesem Loch hier rauskommen. Aber ich will nicht, dass du kriminell wirst. Verstanden?»
«Aber…»
«Kein Aber», unterbrach Dad und lächelte Jesse aufmunternd zu. «Ich verspreche es dir: Wir schaffen es.»
Jesse erwiderte sein Lächeln tapfer.
«Fast hätte ich es vergessen», sagte Dad. «Ich habe ein frisches Brot mitgebracht.»
Er ging zu seiner schäbigen Tasche, die er beim Eintreten an den Türgriff gehängt hatte.
Als er seiner Frau den Rücken zudrehte, riss diese die Tischschublade auf. Plötzlich hielt sie eine Pistole in der Hand.
Dad blieb ruhig. «Leg das Ding weg, Jane.»
Mit dem Brot in der Hand trat er an den Tisch. «Magst du eine Scheibe?»
Jesse würgte und starrte auf die Pistole.
«Keine Bange», sagte Dad. «Die ist nicht geladen.» Er schnitt das Brot auf, wie er es immer tat. Aber Jesse sah, dass seine Hand zitterte.
«Jane, möchtest du nicht eine Scheibe Brot mit uns essen?»
Die Mutter erhob sich schwankend und zielte auf Dads Kopf. «Her mit dem Zaster!»
«Nein!» schrie Jesse.
«Die Knarre ist nicht geladen», sagte Dad. «Leg sie weg. Wir kennen das Spiel.»
Die Mutter sagte nichts, sah Dad nur mit ausdruckslosen Junkie-Augen an.
Jesse hatte Angst.
Er wollte seinem Dad helfen.
Er wollte ihm so sehr helfen. Aber er stand nur langsam auf und ging in seine Ecke mit dem alten Sofa. An einer altersblinden Chromstahlstange hing ein vergilbter Vorhang.
Diesen Vorhang zog Jesse jeden Abend zu, wenn er schlafen ging. Er zog ihn auch zu, wenn er die Welt ausschließen wollte. Er zog ihn zu, wenn Dad und Mum sich stritten.
Er zog ihn oft zu.
Eins
«Ich will ganz klar festhalten, dass ich niemals wissentlich illegale Medikamente genommen habe oder sie mir verabreicht worden sind. Ich war immer überzeugt, und bin es noch immer, dass illegale Drogen keinen Platz in unserer Gesellschaft haben.»
Ben Johnson, am 30.September 1988 vor der Kanadischen Doping-Untersuchungskommission
Er hatte zuvor den Olympiasieg über 100Meter errungen und Weltrekord aufgestellt.
Zwei Tage danach wurde ihm Doping-Missbrauch nachgewiesen.
1
Der Schuss zerriss die Stille.
Und es setzte jener präzis koordinierte Bewegungsablauf ein, den er tausendmal trainiert hatte: Die Muskulatur des rechten Oberschenkels gab all ihre Energie frei, das Bein streckte sich, gleichzeitig fuhr der linke Oberschenkel hoch, ebenso der rechte Arm.
Jede einzelne Bewegung war so exakt abgestimmt, als wäre es nicht eine antrainierte Reaktion, sondern ein angeborener Reflex. Reflex war das Einzige, was jetzt zählte. In diesen Sekundenbruchteilen, wo es um alles ging.
Der Körper schoss nach vorne.
Als sich der rechte Fuß vom Startblock stieß, wurden rote Staubkörner aufgewirbelt. Für einen kaum wahrnehmbaren Moment war der ganze Körper in der Schwebe. Aber schon fuhr der linke Oberschenkel nach unten und rammte den Fuß auf den Boden, als wolle er ihn dort für immer verankern. Doch das Bein gab sofort wieder Schub, während gleichzeitig der rechte Oberschenkel hochschnellte. Und wieder nach unten fuhr, um den Fuß auf den Boden zu krallen, noch bevor sich die roten Staubkörner hatten setzen können.
Und wieder gab das rechte Bein Schub.
Das linke ging hoch.
Eine Sekunde war vergangen.
Schub links. Hochziehen rechts.
Schub rechts. Hochziehen links.
Die mächtigen Beine kamen auf Touren wie die Kolben eines hochgezüchteten Motors. Er stampfte alles aus sich heraus, was in ihm drin steckte.
Nichts konnte ihn jetzt stoppen.
Wo die anderen waren, sah er nicht. Doch er spürte sie.
Sie waren ihm auf den Fersen.
Er gab noch mehr Schub.
Genau dafür war er geschaffen: lange Glieder, optimale Proportionen, explosive Muskeln, die so hart gegen die Haut drückten, als wollten sie ihre Energie durch alle Poren pressen. Doch es gab nur ein Ventil dafür: Tempo.
Nach dreißig Metern war er auf Höchstgeschwindigkeit. Sein Lauf war jetzt aufrecht, stolz und leicht. Die Füße schienen den Boden nicht mehr zu berühren, es war, als ob er fliege.
Von dem, was um ihn herum geschah, nahm er nichts mehr wahr. Eine Stille umfing ihn, die so absolut war, als hätte der Schuss alle Geräusche dieser Welt ausgelöscht. Die Gesetze von Raum und Zeit schienen außer Kraft. Sein Geist trieb in einer Flut aus Cortisol und Adrenalin.
Fünf Sekunden waren jetzt vergangen, und fast so viele folgten noch. Sekunden, nach denen er süchtig war. Für die er lebte.
Dann aber würde der Filmriss kommen. Jener Moment, den er so sehr hasste und gleichzeitig so sehr liebte. Das Dahinfliegen würde ein Ende haben, aber es folgte das Schweben des Triumphes.
Noch zehn Meter.
Er blieb locker.
Das war die Kunst des Sprints: jede Faser des Körpers anzupannen und sich trotzdem nicht zu verkrampfen; alle Energie aus sich herauszupumpen und sich trotzdem nicht zu erschöpfen. Alles zu geben, um nichts zu verlieren.
Noch fünf Meter.
Er schob die Brust vor, riss die Arme nach hinten. Und sah unter sich die weiße Linie des Ziels.
Wie Donner schlug der Lärm auf sein Gehör: Gehupe, Pfiffe, Schreie. Wie Blitze zuckten Bilder in seine Augen: Fotografen, Fahnen, Fans.
Doch seine Augen wollten nur eines sehen: die Anzeigetafel. Groß wie ein Haus strahlte über das ganze Stadion ein Gesicht. Darunter sein Name: Jesse Brown.
Und eine Zahl. Sie zeigte, dass er die hundert Meter so schnell gelaufen war wie dieses Jahr noch kein anderer. Es war kein Rekord. Noch nicht. Aber es war ein weiterer präzis ausgeführter Schritt auf dem Weg dorthin.
Jesse hob die Arme, spreizte Zeige- und Mittelfinger: die Siegerpose für die Fotografen und das Siegerlachen für das Fernsehen. Er winkte und warf Kusshände. Die Menschen auf den Rängen klatschten, trampelten mit den Füßen, riefen rhythmisch seinen Namen. Sie verlangten nach dem Ritual.
Und er war bereit, ihnen zu geben, was sie wollten. Wie immer. Denn er wusste, was er ihnen schuldig war.
Mit beiden Händen griff er nach den Trägern seines Einteilers. Dann schälte er aufreizend langsam den glänzenden Stoff über die Schultern herunter, über die Brust, den Bauch, und machte erst knapp über den Lenden halt.
Die Menge tobte vor Begeisterung. Sie wollte mehr.
Jesse nahm die getönte Brille von den Augen, die ihn wie ein außerirdisches Insekt aussehen ließ, und setzte sie auf die Stirn. Er reckte die Arme nach hinten wie zwei gespreizte Flügel, legte den Kopf in den Nacken und schloss die Augen.
Das Stadion kochte.
Er spürte förmlich ihre bewundernden Blicke über seinen perfekten Körper gleiten. Er spürte die Begeisterung, die seine dunkle Haut umschmeichelte, sie streichelte und liebkoste.
Er gab sich der Menge hin. Und gleichzeitig beherrschte er sie.
Das reine Glück durchströmte ihn.
Als er die Augen wieder öffnete, stand ein junger Mann in weißer Hose und weißem Hemd vor ihm und streckte ihm einen Ausweis entgegen.
«Mein Name ist Stefan Bär, Antidoping Schweiz. Sie werden zur Dopingkontrolle erwartet.»
Ein Greifer. Ein Funktionär, der im Stadion nichts anderes zu tun hatte, als den Athleten nachzujagen, die zur Dopingkontrolle mussten.
Jesse unterschrieb ein Formular, dann wandte er den Blick wieder dem Publikum zu.
Und trabte davon.
Sofort heftete sich ein Schatten an seine Fersen: ein Mann, der ihn nun nicht mehr aus den Augen lassen würde, bis er zur Dopingkontrolle gehen würde. Genau eine Stunde Zeit blieb ihm dafür. Eine Stunde, in der er tun durfte, was er wollte – nur nicht pinkeln. Und zwei, drei weitere Dinge waren ebenfalls verboten. Zum Beispiel, Medikamente einzunehmen, welche die Analyse im Dopinglabor verfälschen könnten. Oder sich einen Plastikbeutel unter den Hodensack zu binden, aus dem man mit einem dünnen Schlauch fremden Urin ins Probegläschen füllen konnte. Der Trick war ziemlich riskant, denn dieser Urin hatte nicht Körpertemperatur, und der geübte Kontrolleur merkte das sofort, wenn er das Gläschen in Empfang nahm. Weniger verräterisch war, sich den Beutel samt Ablassschlauch in den Enddarm zu schieben. Aber Jesse fand nur schon die Vorstellung abstoßend, im After nach einem dünnen Schlauch zu fingern. Abgesehen davon hatte er solche Tricks auch gar nicht nötig.
Nach der Ehrenrunde schlüpfte er in die Hose seines Trainingsanzugs, winkte ein letztes Mal und verschwand in den Katakomben des Tribünenbaus.
«Dort drüben», wies ihm der Schatten den Weg.
KEIN ZUTRITT stand auf dem Schild über dem Eingang zur Dopingkontrolle. Ein Wachmann öffnete die Tür.
Dahinter erwartete ihn ein sportlicher Mann um die sechzig mit schlohweißem Haar, das er korrekt gescheitelt trug. «Mein Name ist Hans Berger», sagte er in einem Tonfall, der verriet, dass er die Formulierung nicht zum ersten Mal benutzte. «Ich werde Sie durch die Dopingkontrolle begleiten.»
Jesse schlug ihm die Hand auf die Schulter. «Hallo, Hans, schön, dich zu sehen!»
«Hi, Jesse!» Berger grinste und boxte den Sprinter scherzhaft auf den Oberarm. «Gehen wir zusammen Pipi machen.»
Berger war professioneller Dopingkontrolleur bei Antidoping Schweiz, der nationalen Antidopingagentur. Er trug eine weiße Hose, ein weißes Hemd, eine dunkelblaue Krawatte und ein dunkelblaues Jackett. Genau wie es das Protokoll verlangte. Und genauso begrüßte er auch jeden Athleten mit der vorschriftgemäßen Formulierung. Ansonsten war Berger aber alles andere als ein steifer Verbandsfunktionär.
«Wird ja fast langweilig, wenn immer derselbe gewinnt.»
«Tut mir leid», antwortete Jesse mit gespieltem Schuldbewusstsein. «Das nächste Mal trete ich auf die Bremse.»
«Untersteh dich, Bengel.» Berger puffte ihn in die Seite. Er konnte sich diesen Umgang mit einem der größten Stars in der Leichtathletikwelt erlauben. Bei «Weltklasse Zürich» war er schon für die Dopingkontrolle zuständig gewesen, als Jesse noch in die Windeln machte. Unter seiner strengen Überwachung hatten so ziemlich alle Großen des Sprints die Hosen heruntergelassen: Asafa Powell, Maurice Greene, Justin Gatlin, Frankie Fredericks, Linford Christie, Donovan Bailey, Tim Montgomery– Bergers Gästeliste las sich zweifellos wie ein Who’s who der Sportgeschichte.
Im hinteren Teil des Kontrollbereiches fragte Berger: «Monsieur, welches Gläschen darf’s denn sein?» Er wies auf ein Regal mit Urinbechern.
«Diese Flûte de Champagne.» Jesse griff sich grinsend einen Becher.
Berger begleitete ihn zur Toilette.
«Gemäß Reglement muss ich dich jetzt darauf aufmerksam machen, dass das T-Shirt bis zur Brust hochgerollt werden muss, die Ärmel gehören zurückgekrempelt bis zu den Ellbogen. Die Hose bitte runter bis zum Knie.»
«Danke», sagte Jesse, «dass du mir nicht noch jeden Handgriff vormachst.»
«Na dann, los.» Berger stellte sich so hin, dass ihm nichts entging.
Was hatte er bei diesen Kontrollen nicht schon alles erlebt! Jener rumänische Kugelstoßer, der eine Probe ablieferte, die bakteriell so verunreinigt war, dass der Athlet an einer schweren Blaseninfektion hätte leiden müssen und keinesfalls wettkampffähig gewesen wäre. Der Kerl hatte sich einen künstlichen Penis, gefüllt mit altem Urin, umgebunden und ihn derart geschickt in der Hand gehalten, dass Berger nichts davon bemerkt hatte. Hätte der Rumäne frischen Urin abgefüllt, wäre der Betrug wohl nie aufgeflogen.
Mittlerweile gab es diese Penisprothesen sogar im Internet zu kaufen: für Weiße, Latinos, Schwarze und Asiaten. Inklusive gefriergetrockneten «sauberen» Urins. Doch heutzutage kannten alle Fahnder diesen Trick.
«Fertig», meldete Jesse und zog die Hose hoch.
Als Jesse eine gute Stunde später gebeten wurde, sich für die Siegerehrung bereitzuhalten, war der Steeple-Lauf der Männer im Gange. Dreitausend Meter mit Hindernissen und einem Wassergraben: die härteste Disziplin der Leichtathletik. Jesse stellte sich in der Nähe des Eingangs an die Bande und verfolgte das Rennen.
Von der ersten Sekunde an war klar, wie der Sieger heißen würde: Bikila Asserate zog der Konkurrenz davon, als liefe er in einer anderen Kategorie. Seine drahtigen Beine wirbelten durch die Luft wie zwei Propeller. Er nahm die Hindernisse, als wären sie gar nicht vorhanden. Und während das Feld aus lauter Weltklasseläufern Runde um Runde verbissen kämpfte, schien dem davonstürmenden Äthiopier das Rennen richtig Spaß zu machen. In seinem schwarzen Gesicht strahlte ein frohes Lachen mit Zähnen weiß wie Elfenbein.
«Asserate auf Weltrekordkurs!», schallte die Stimme des Stadionsprechers aus dem Lautsprecher. Das Publikum johlte, klatschte und peitschte den Läufer vorwärts.
Warum tut er das?, fragte sich Jesse. Warum verausgabt er sich derart? So kurz vor den Olympischen Spielen?
Die Glocke schellte.
Letzte Runde.
Noch vierhundert Meter, und das Feld lag weit abgeschlagen zurück. Vier Hürden und ein Wassergraben lagen zwischen dem äthiopischen Wunderläufer und dem Ziel. Und Bikila Asserate würde neuen Weltrekord laufen.
Von einem enormen Energieschub getrieben näherte er sich dem nächsten Hindernis. Das Publikum johlte ein langgezogenes «Hoo», und je näher der fliegende Äthiopier dem schwarzweißen Balken kam, desto höher stieg die Tonlage der Anfeuerungsrufe, bis ein tausendfaches «Hopp» ihn förmlich über die Hürde hob.
Asserate bedankte sich mit dem breitesten Grinsen, das die Welt jemals im Gesicht eines Langstreckenläufers gesehen hatte.
Das rhythmische Stampfen der aufgepeitschten Menge trieb ihn an. «As-se-ra-te!»
«As-se-ra-te!», schrie auch Jesse aus voller Kehle mit. Sollte er den Rekord doch holen. Er würde schon wissen, was er tat.
Der Äthiopier nahm die Gegengerade im Sturmlauf und peilte die nächste Hürde an.
Er sprang.
Ein Aufschrei des Entsetzens ging durch die Menge.
Beim Nachziehen des Sprungbeins hatte Asserate den massiven Balken touchiert. Er strauchelte nach dem Hindernis, fing sich aber wieder und zog in die letzte Kurve.
Zum letzten Mal der Wassergraben. Ein schwieriger Sprung, besonders nach gut sieben Minuten Vollgas, wenn jede Zelle des Körpers nach Sauerstoff schreit, die Arme schwer und die Beine sauer sind. Der Läufer kann nicht einfach über das Hindernis gleiten, sondern muss sich mit einem Fuß auf dem Balken abstoßen, um den nötigen Schub zu gewinnen, der ihn über das Wasser trägt.
Asserate nahm Maß.
Noch vier Schritte.
Plötzlich drehten Asserates Augen nach oben weg, trotzdem fand sein Fuß den Balken.
Noch ahnte das Publikum nichts, doch schon im nächsten Augenblick schien der Herzschlag von zwanzigtausend Menschen gleichzeitig auszusetzen.
Der Lärm erstarb.
Die Zeit stand still.
Wie festgenagelt blieb Asserate auf dem Balken stehen, ruderte mit den Armen, kämpfte um das Gleichgewicht. Sein Blick krallte sich in den Himmel, als böte ihm dort oben jemand Halt.
Zwar hatte er tief im Innern seines Kopfes schon bei der letzten Hürde einen Blitz gespürt. Doch erst der Gerichtsmediziner würde herausfinden, dass dies der Moment gewesen sein musste, in dem ein Klumpen eingedickten Blutes in der Hirnarterie stecken blieb und so einen beträchtlichen Teil des Gehirns von der Blutversorgung abschnitt. Der Sauerstoff hatte gerade noch gereicht, ihn bis zur nächsten Hürde zu tragen. Dann war das Gehirn tot.
Noch immer balancierte der Äthiopier als bizarres Mahnmahl übertriebenen Ehrgeizes auf dem Balken. In seinen Augen war nur noch das Weiße zu sehen. Und seine vollen, purpurn angelaufenen Lippen zogen sich über die Zähne hoch, bis das ganze Glück aus dem Gesicht gewichen war.
Mit irrer Fratze kippte der Läufer seitlich weg.
Als sein hoher Schädel auf dem Balken aufschlug, war das trockene Knacken des Schläfenbeins bis zu den Zuschauerrängen hinauf zu hören.
Und fast gleichzeitig setzten die anderen Läufer keuchend über das Hindernis und landeten laut spritzend im Wasser. Bis alle im Ziel waren, hatten zwei Sanitäter den Gestürzten auf einer Bahre aus der Arena getragen.
Das Rennen gewann Joseph Kiptanui aus Kenia.
Die Show ging weiter.
Asserate nachzutrauern hatte das Publikum keine Zeit. Der Stadionsprecher versicherte, der Unglückliche sei auf dem Weg ins Krankenhaus, und forderte die Menge auf, im Chor «Gute Besserung» zu brüllen. Was diese willig tat.
Kurz darauf stand Jesse völlig benommen auf dem Siegerpodest. Links von ihm Melvin Fagan, Trinidad, rechts T.C.Bullock, USA. Zwei mächtige Brocken – der eine Inhaber des Weltrekords, der andere amtierender Weltmeister. Sie reichten Jesse nur bis zur Brust, denn sie standen auf der Stufe für den Zweit- und Drittklassierten. Ein gewohntes Bild in diesem Jahr. Das Einzige, was sich daran gelegentlich änderte, war, dass die beiden mal die Seite tauschten oder einer durch Irvin Payne vom Podest verdrängt wurde. Zuoberst stand immer derselbe, der neue Star am Leichtathletikhimmel, dessen Aufstieg steil und nicht zu bremsen war: Jesse Brown, Schweiz.
Als aus den Lautsprechern die Nationalhymne für den Sieger ertönte, wandte er sich an Fagan. «Scheiße, das mit Asserate, was?»
Fagan hielt den Blick stur geradeaus gerichtet.
Jesse wandte sich zu Bullock.
«Arschloch», zischte dieser.
Die Hymne war zu Ende. Ohrenbetäubender Jubel brach los.
Die Fans ließen La Ola ums Stadion wandern. Sie forderten eine weitere Ehrenrunde. Jesse ließ sich treiben.
«Jesse!» Über die Bande streckte ihm ein Mann sein Programmheft entgegen. Jesse setzte seinen Namen darauf. Von weiter hinten kam ein T-Shirt geflogen. Jesse unterschrieb und warf es zurück. Ein Mädchen hielt ihm den Unterarm hin.
«Wie heißt du?» fragte Jesse.
Das Mädchen strahlte vor Glück. «Angela.»
«Für Angie», schrieb Jesse auf ihre Haut.
So liebten sie ihn: Jesse, der Star zum Anfassen. Ein Held, der es von ganz unten nach ganz oben geschafft hatte und trotzdem der nette Junge von nebenan geblieben war. Jesse war ein Kumpel und Idol.
Von irgendwoher kam eine Flagge geflogen. Jesse legte sich das rote Tuch mit dem weißen Kreuz um die Schultern wie den Umhang eines Königs. Er war sicher, die Fotografen verstanden die Symbolik. Denn schon bald würde sich Ihre Majestät auch die Krone aufsetzen. Schon bald würde er den Olymp erklimmen. Als neuer Gott des Sprints.
Plötzlich ein grelles Licht. Ein dumpfer Knall und weißer Rauch um ihn herum. Augenblicklich tränten seine Augen. Seine Kehle zog sich zusammen. Er rang nach Luft. Dann rannte er los. Instinktiv, so wie er immer losgerannt war, wenn Rauch und Gas ihm die Luft nahmen.
In welche Richtung er lief, wusste er nicht.
Einfach weg.
Doch er kam nur wenige Schritt weit.
Der Schmerz durchfuhr sein Bein wie ein Schuss.
2
Als Thierry Velan vor die Haustür trat, empfing ihn einer jener Sommermorgen, die er so sehr liebte: Der Himmel war wolkenlos, die Luft rein und klar, sodass man auf den Gipfeln der Savoyer Alpen jedes einzelne Schneefeld gestochen scharf erkennen konnte. Ein leichter Wind strich vom See her den Hang herauf, frisch und angenehm. Der Lac Léman war die beste Klimaanlage, die man sich wünschen konnte.
Thierry fuhr sich mit der Hand über das graue Haar, das er zum Bürstenschnitt gestutzt trug, atmete tief durch und ging dann mit dem elastischen Schritt eines durchtrainierten Fünfzigjährigen über den gepflasterten Hof.
Plötzlich blieb er stehen.
«Bonjour, Minou!», rief er freudig und bückte sich, um die getigerte Katze zu kraulen, die ihm um die Waden strich. «Hast du gut geschlafen?»
Seit der Geburt von Maurice und Maxim, den Zwillingen, gehörte Minou zur Familie: seit fünfzehn Jahren also. Sie war die einzige Frühaufsteherin neben Thierry. Die beiden Jungs hatten noch geschlafen, und Sylvie hatte sich im Bett bloß umgedreht, als Thierry leise aus dem Zimmer geschlichen war.
Minou ließ einen tiefen, gutturalen Laut ertönen. Erst jetzt bemerkte Thierry, dass die Katze etwas zwischen den Zähnen hielt.
«Eine Maus?», staunte er. «Ist dir das Futter nicht mehr gut genug?»
Minou verzog sich mit ihrer Beute unter einen Busch.
«Na dann, guten Appetit.»
Thierry setzte seinen Helm auf und holte das Mountainbike aus der Garage. Es gab nichts Schöneres, als an einem Prachtmorgen wie diesem durch die Weinberge nach Lausanne zu fahren. Viele dieser Rebhänge hatten einmal seinem Urgroßvater gehört. Tété, wie ihn alle nannten, hatte sich mit gutem Wein einen Namen gemacht und es zu stattlichem Reichtum gebracht. Doch weder Thierry noch seine Schwester wollten sich professionell der Winzerei widmen, also wurde der größte Teil des Grundbesitzes verkauft oder verpachtet. Thierry behielt nur einen kleinen, aber exquisiten Hang für sich. Den bewirtschaftete er, um Stress abzubauen und, wie er stets betonte, um die familiären Wurzeln nicht ganz zu verlieren.
«Seltsam», dachte Thierry, als er die erste Kurve unterhalb des Hauses ansteuerte, «fängt Minou wieder Mäuse?» Die Katzendame war doch viel zu alt dafür und leider auch zu fett. Die Tatsache, dass Minou offenbar wieder auf Wildfang umgestiegen war, beschäftigte ihn jedoch nur, bis er in den Feldweg einbog, der ihn hoch über den Weinbergen und fern des Autoverkehrs fast bis nach Lausanne brachte.
«Bonjour, Chef!», rief Catherine Beniston, eine kurzhaarige Brünette, als Thierry frisch geduscht und gut gelaunt die Tür zum Labor aufstieß. «Der Kurier war schon da», fügte sie hinzu, während sie mit einem Messer die Klebstreifen an einem sperrigen Paket aufschnitt.
«Zürich?», fragte Thierry.
«Ja.»
«Die waren aber schnell», sagte er grinsend. «Hast du ‹Weltklasse Zürich› im Fernsehen geschaut?»
Catherine lächelte indigniert. «Bei mir gab’s Krimi.»
«Aber, aber…» Der Tadel in Thierrys Stimme war gespielt. Auch wenn das LAD, das Laboratoire suisse d’Analyse du Dopage, eines der renommiertesten Laboratorien der Welt war, konnte er nicht erwarten, dass sich jeder seiner dreißig Mitarbeitenden so brennend für Sport interessierte wie er. Catherine war eine hervorragende Biologin, eine zuverlässige Laborleiterin – und begeisterte Köchin, wie ihre Körpermaße offenbarten.
«Aber du», sagte Catherine, « warst sicher in Zürich.»
«Ehrensache», erwiderte Thierry grinsend. «Seit ich dort selbst einmal gelaufen bin, habe ich noch kein einziges Mal gefehlt.»
«Als Zuschauer», präzisierte Catherine.
«Natürlich als Zuschauer. Aber einmal bin ich wirklich gelaufen. Als Junior.»
«Ist also schon ein Weilchen her», neckte ihn Catherine.
«Immerhin war ich einmal dabei: über 1500Meter. Früher durfte jeweils der beste Junior seiner Disziplin im B-Lauf starten. Als Motivationsspritze. Ein irres Gefühl! Das Licht, das Publikum; Du meinst, die jubeln alle nur dir zu.»
«Und – hat die ‹Spritze› gewirkt?» fragte Catherine.
«Ich bin kaum jemals schlechter gelaufen», winkte Thierry ab. «Ich war vollkommen überfordert als Neunzehnjähriger. Damals gab es ja noch gar nichts in Sachen psychologischer Betreuung. Die haben mich einfach auf die Bahn gestellt und hopp. Plötzlich waren da überall die Stars, die ich bloß aus dem Fernsehen kannte. Alle einen Kopf größer als ich, mit doppelt so langen Beinen. Da rutscht jedem das Herz in die Hose. Heute ist das ganz anders: Die Athleten werden psychologisch regelrecht präpariert. Heute weiß man, dass die Hälfte der Leistung aus dem Kopf kommt.»
«Und die andere Hälfte aus dem Giftschrank, meinst du?»
Thierry verzog das Gesicht. «Wie du einen wieder in die harte Realität zurückholst», knurrte er, klatschte dann aber energisch in die Hände. «Also: an die Arbeit!»
«Eigentlich wollte ich diese Proben einfrieren», sagte Catherine. «Es sind noch nicht genügend für eine ganze Serie. Selbst mit denen nicht, die schon auf Lager sind.»
«Catherine», seufzte Thierry. «Zürich ist ein guter Kunde. Und alles, was wir jetzt noch abarbeiten, kommt uns in den nächsten Wochen nicht in die Quere.»
Catherine verdrehte die Augen. Das war Thierry Velan: immer antreiben, immer fordern. Typischer Sportler, wie sie meinte. Sie klemmte sich das Paket mit den Proben unter den Arm. «Okay, ich bin schon dabei.»
«Danke», rief Thierry ihr nach und verließ das Labor.
Wie froh er doch um Catherine war, die bei ihm arbeitete, seit er vor fünfzehn Jahren das Labor gegründet hatte. Sie war eine Pedantin, also die Idealbesetzung für eine Laborleiterin. Er war der kreative Kopf, der gängige Tests verfeinerte und neue entwickelte. Zusammen hatten sie das LAD zu dem gemacht, was es heute war. Ihre Auftragbücher waren immer voll. Doch was diesen Sommer anstand, übertraf alles bisher Dagewesene. Das Internationale Olympische Komitee hatte ihnen exklusiv alle Dopinganalysen für die Olympischen Sommerspiele zugesprochen. Wobei sie sich gegen so große Konkurrenten wie die staatlich unterstützten Labors von Köln und Paris durchgesetzt hatten. Diesen Job wollte Thierry zur höchsten Zufriedenheit des Kunden erledigen. Das würde ihnen weitere fette Aufträge und somit die Zukunft des Labors sichern.
Sein Büro bestand aus einem kleinen Raum, der bis unter die Decke mit Büchern vollgestopft war. In der einzigen freien Ecke war die Wand behängt mit bunten Wimpeln und Plakaten großer Sportevents, für die das Labor die Proben analysiert hatte.
Er schaltete den Computer ein und vertiefte sich in die Arbeit – bis die Bürotür aufging und er hochfuhr.
«Hast du keinen Hunger?»
«Hunger?»
«Ja, Hunger», sagte Catherine. «Medizinisch gesehen entspricht dies einer Kombination aus geringer Magenfüllung und tiefem Blutzuckerspiegel. Umgangssprachlich nennt man so was auch Loch im Bauch.»
Thierry warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Tatsächlich: Mittag war schon vorbei. Und als sie die Rue du Bugnon überquerten und auf den langgestreckten Glas-Alu-Bau der Poliklinik zusteuerten, merkte Thierry, dass er tatsächlich ein Loch im Bauch hatte.
Sie holten sich in der Kantine Sandwiches und setzten sich an einen Tisch am Fenster.
Während sie ihre Brote aßen, erkundigte sich Catherine nach Thierrys Familie. Er erzählte, dass heute alle ausschliefen, die Kinder dann wohl, wie schon die ganze Woche, den Tag am Pool verbrächten und Sylvie den Urlaub im Garten genieße. «Nur ich bin am Arbeiten.»
«Du Armer.»
«Na ja. Den ganzen Tag am Pool wäre mir sowieso zu langweilig.»
«Eben.»
«Aber dich als Katzenliebhaberin dürfte etwas anderes mehr interessieren», fuhr Thierry fort. «Minou fängt wieder Mäuse.»
Catherine stieß einen spitzen Schrei aus. «Die alte Dame! Was für Mäuse kriegt die denn noch?»
«Genau genommen, war es nur eine», gab Thierry zu. «Eine weiße.»
«Eine weiße!» Catherine lachte. «Du warst aber nüchtern?»
«Morgens um sechs bin ich in der Regel stocknüchtern», erwiderte Thierry trocken.
Catherine nahm einen Bissen von ihrem Brot. «Eine weiße Maus also? So eine Art Labormaus, könnte man sagen?»
«Könnte man sagen», bestätigte Thierry.
«Eine Labormaus vor deinem Haus, weitab von jedem Labor.»
«Ja, ja», sagte Thierry kauend. «Ich werde mal meine Jungs fragen, ob jemand in der Nachbarschaft weiße Mäuse hat. Wir werden das Tier wohl ersetzen müssen.»
Er stand auf. «Espresso?»
Als er mit zwei kleinen Tassen zurückkam, saß Catherine kerzengerade auf ihrem Stuhl. «Da stimmt doch was nicht.»
«Mit dem Kaffee?»
«Nein, mit der Maus. Ausgerechnet der Chef eines Dopinganalyselabors findet vor seiner Haustür eine Labormaus.»
«Catherine» seufzte Thierry. Seine Laborleiterin war wie immer gnadenlos, wenn es um Katzen ging. Sie lebte ohne Mann und Kinder mit drei Lieblingen zusammen. Exklusive Exemplare, die viel Geld gekostet hatten und nie nach draußen durften. «Ehrlich gesagt, steht diese Mäusegeschichte momentan nicht zuoberst auf meiner Prioriätenliste. Olympia steht an. Und wir haben noch nicht einmal alle angeheuerten Teilzeitkräfte instruiert, wir haben für diverse Maschinen noch keinen Testlauf gemacht, und wir…»
«Das ist es ja gerade», unterbrach ihn Catherine. «Olympia. Diese Maus taucht nicht irgendwann auf, sondern ausgerechnet vor den Olympischen Spielen. Das ist kein Zufall.»
Thierry seufzte erneut. Jetzt kam wieder die Sache mit Zufall und Vorbestimmung. In solchen Dingen bewies seine Laborleiterin einen Hang zur Esoterik.
Auch Catherine seufzte. Ihr Chef mochte zwar ein kreativer Wissenschaftler sein, der schon manchen neuen Test zum Nachweis der immer ausgeklügelteren Dopingmethoden und -mittel entwickelt hatte, aber manchmal war er wirklich ganz schön realitätsfremd.
Sie holte tief Luft. «Da lag doch einmal vor dem Hotelzimmer eines Dopingfahnders eine gebrauchte Spritze. Darin: Spuren eines Dopingmittels. Bei der Tour de France war das, und es hat die Aufdeckung eines der größten Dopingskandale der Geschichte ausgelöst.»
Thierry starrte sie stumm an.
«Nehmen wir an», sagte Catherine charmant und gleichzeitig unbeirrbar, wie immer, wenn sie eine ganz bestimmte Absicht hatte, «nehmen wir an, die Maus sei so etwas wie jene Spritze. Wäre doch schade, wenn einer der besten Dopingfahnder einfach so daran vorbeiginge.»
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren zückte Thierry sein Mobiltelefon und wählte. «Salut, Sylvie», sagte er. «Hast du auch gesehen, dass Minou eine Maus gefangen hat?»
Er lauschte.
«Heute Morgen, als ich losging.»
Er schüttelte den Kopf.
«Chérie, tu mir den Gefallen: Schau dich mal im Garten um. Und ruf mich zurück, falls du eine weiße Maus findest.»
3
In Jesses Kopf kreisten die ewig gleichen Gedanken:
Hatte er sich vor dem Start zu wenig aufgewärmt, zu wenig gedehnt? War es unvernünftig gewesen, so nah ans Publikum heranzugehen?
Doch die Fragen waren müßig, die Antwort eindeutig.
«Adduktorenzerrung», sagte Emilio Batista, während er den Muskel mit dem Daumen abtastete. Seine buschigen Augenbrauen hatten sich über den dunklen, fast schwarzen Augen zusammengezogen. «Du bist nicht von einem Knallkörper getroffen worden. Du bist zu ruppig losgelaufen. So wie du den Schmerz beschreibst, und so wie es sich anfühlt, kann es nichts anderes sein. Eine Zerrung. Keine allzu schlimme, würde ich meinen. Aber trotzdem: Du bist verletzt.»
Obwohl Jesse es längst wusste, traf ihn der Befund wie ein Dolchstoß. Und obwohl Emilio kein Arzt war, gab es keinen Grund, an seiner Diagnose zu zweifeln. Emilio hatte Sportwissenschaften studiert, ließ sich gelegentlich auch Dottore nennen und war Jesses Trainer, Betreuer und Manager in Personalunion. Das war in der Leichtathletik eher außergewöhnlich – die meisten Top-Athleten hielten das Sportliche, Psychologische und Wirtschaftliche voneinander getrennt. Doch Jesse war mit Emilio immer gut gefahren.
Wieder traf Emilios Daumen zielsicher in das Epizentrum des Schmerzes, und Jesse verzog gequält das Gesicht.
Emilio seufzte. «Was machst du nur für ’n Scheiß, Junge.»
«Gar nichts habe ich gemacht», protestierte Jesse, während er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht aufsetzte. «So ein Idiot hat mich bombardiert.»
Emilio seufzte wieder und holte ein Frottiertuch. Er wischte sich den Schweiß von den fleischigen Nackenwülsten. Von hinten sah es aus, als würde sich seine gewaltige Körpermasse am Genick stauen, weil sie nicht auch noch vom vollkommen kahlen Schädel Besitz ergreifen konnte.
«Eines, Junge, ist ganz wichtig», sagte er bestimmt. «Es hat dich niemand bombardiert.»
«Das Ding kam direkt auf mich zugeflogen.»
«Natürlich tat es das», sagte Emilio. «Aber es hat niemand damit auf dich gezielt. Da ist einer beim Abfeuern ausgerutscht, oder es hat ihn jemand gestoßen, oder weiß der Teufel was.»
«Überhaupt sind die Dinger im Stadion doch verboten.»
«Es gibt halt immer wieder Typen, die diesen Mist mit hineinschmuggeln.»
«Arschlöcher!»
Jesse glitt von der Massageliege herunter, die sie in Emilios Hotelsuite aufgestellt hatten, und schlüpfte in die Trainingshose. Dann wich mit einem Mal die Spannung aus seinem Körper, und er starrte auf seine nackten Füße.
«Es war wie damals.» Er tat einen schweren Atemzug. «Ich sah plötzlich wieder alles vor mir, ich…»
«Ist schon gut, Junge», sagte Emilio väterlich und legte Jesse die Hand auf die Schulter. «Ich weiß, es verfolgt dich. Wird es vielleicht immer tun. Aber daran arbeiten wir ja.» Er ließ die schwere Hand und seine Worte wirken.
Jesse seufzte.
Kennengelernt hatte er Emilio damals auf dem großen Sportfest. Er hatte gerade den Hundert-Meter-Lauf gewonnen, als Emilio ihn angesprochen und gefragt hatte, ob er mit ihm laufen wolle.
Natürlich hatte Jesse Lust zu laufen. Denn Laufen war so ziemlich das Einzige, was er gerne tat, das Einzige, was er tun konnte, um zwischendurch aus dieser verdammten Hillborough School rauszukommen. Fünf Jahre hatte er damals schon in diesem Loch verbracht. Fünf lange Jahre hatte sich sein ganzes Leben hinter diesen hohen Backsteinmauern abgespielt: Schlafen, Essen, Schule, Sport, alles. Selbst wenn man krank war – oder so tat, als ob–, kam man nicht raus. Es hatte da drinnen sogar eine Krankenstation gegeben.
Hellborough nannten die Jungen das Heim.
Raus kam nur, wer sich für «das Fest» qualifiziert hatte. Das Fest, wie die Heimleitung es nannte, war ein Wettkampf, zu dem die Kinderheime im Staat New York jedes Jahr ihre besten Kids schickten.
Beim Fest war alles wie im Fernsehen, wie in der richtigen Welt eben. Es gab im Stadion Musik und Cheerleader, Popcorn und Publikum. Richtiges Publikum. Und Reporter kamen. Sie waren für die Heime das Wichtigste. sie sollten darüber berichten, wie man die schweren Jungs, die man sonst hinter den hohen Mauern verwahrte, wieder auf den rechten Weg brachte.
Dass «mit mir laufen» nicht bedeuten konnte, zusammen mit Emilio zu laufen, war Jesse damals sofort klar gewesen. Denn vor ihm hatte sich der dickste Mensch aufgebaut, den er jemals gesehen hatte. «Mit mir laufen» hatte nur bedeuten können, dass Emilio ihn trainieren wollte. Vor allem aber hatte es für Jesse bedeutet, aus dem Heim wegzukommen, aus der Bronx wegzukommen und die Chance auf ein neues Leben zu erhalten.
«Ist gut, Junge», sagte Emilio wieder. Dann richtete er sich auf und markierte Tatendrang. «Aber nun ist Schluss mit Grübeln.»
Er ging zur Tür, und drehte sich noch einmal um. «Bin gleich wieder da.»
Als Emilio zurückkam, trug er einen Verbandskasten in der einen und einen schwarzen Behälter in der anderen Hand. Mit dem Absatz stieß er die Tür zu und stellte beide Behältnisse auf den Tisch neben der Massageliege. Der schwarze Behälter sah aus wie ein abgewetzter Geigenkasten, aber kleiner. Oder ein Köfferchen für eine Querflöte, nur bauchiger.
«Was ist da drin?», fragte Jesse.
Emilio lächelte verschwörerisch und holte, ohne etwas zu sagen, diverse medizinische Utensilien aus dem Verbandskasten: ein braunes Fläschchen, einen Packen Wattebäusche und einen Spannriemen, wie er bei Blutentnahmen um den Oberarm gelegt wird.
Dann zog er sich feine Latexhandschuhe über, rückte den schwarzen Behälter zurecht und ließ mit gespreizten Fingern die verchromten Schlösser aufschnappen.
Jesse reckte den Hals.
Passgenau in eine Schaumstoffform eingebettet lag ein Gerät. Mit seinem anatomisch geformten, länglichen Griff und dem glockenförmigen Aufsatz erinnerte es Jesse entfernt an das altmodische Massagegerät, mit dem sich sein Pflegevater immer selbst den Rücken massiert hatte.
«Was ist das?», wiederholte Jesse.
«Meine Wunderwaffe», erwiderte Emilio seelenruhig.
Dann hielt er unversehens eine kleine Ampulle in der Hand.
«Keine Medikamente», stieß Jesse hervor.
Emilio begann das metallene Siegel an der Ampulle zu entfernen.
«Überlass das dem Arzt», sagte Jesse. «Der weiß genau, was ich mir jetzt erlauben kann.»
Emilio lächelte gönnerhaft. «Der Arzt hat dir gestern Nacht die schmerzstillende Spritze verpasst und dann Ruhe und Physiotherapie verordnet. Viel mehr hat die Medizin in solchen Fällen nicht zu bieten.» Er hielt die Ampulle mit der farblosen Flüssigkeit gegen das Licht. «Dass es das hier gibt – davon hat der noch nicht mal was gehört.»
«Emilio, die Kontrollen werden kurz vor Olympia immer strenger.»
Emilio trat auf Jesse zu. «Dein Muskel braucht gut und gerne einen Monat, um zu verheilen. Diesen Monat haben wir aber nicht.»
«Du hast immer gesagt, ich bleibe sauber.»
«Natürlich bleiben wir sauber.»
Jesse fixierte die Ampulle. Kein Gift, hatte er sich geschworen. Er war unter Junkies aufgewachsen, hatte sie reihenweise abkratzen sehen und «verdankte» die schlimmsten Jahre seines Lebens so einem menschlichen Wrack: seiner Mutter.
Und das Wichtigste: Er hatte es seinem Dad versprochen.
«Junge. Du und ich: wir sind ein Team – ein erfolgreiches Team.» Emilio sprach betont langsam und eindringlich. «Ich will nur dein Bestes. Und ich tue genau das, was das Beste für dich ist. Und nun sag: Wollen wir die Golden-League-Million?»
«Du weißt…»
«Wollen wir die Million?»
Jesse zögerte.
«Junge. Du und ich: wir wollen zusammen diese Million holen.»
Eine Million Dollar in bar. Die absolut höchste Prämie in der Leichtathletik. Wer die Million wollte, musste in seiner Disziplin bei den sechs größten europäischen Veranstaltungen gewinnen. Das Perfide an der sogenannten Golden League war, dass man auch gegen Athleten aus anderen Disziplinen kämpfte. Man konnte also nicht taktieren und auf einen strategischen Sieg setzen. Es gab immer nur eines: Alles geben.
Vier Golden-League-Rennen hatte Jesse bereits gewonnen: Paris, Rom, Oslo – und Zürich. Fehlten noch Brüssel und Berlin. Neben ihm hatten nur noch vier Athleten Chancen auf den Jackpot: Mikki Hämäläinen, der finnische Speerwerfer, den alle nur «Koloss» nannten; die kenianische Langstreckenläuferin Airimu Ngugi, die alles gewann, was es zu gewinnen gab; Henri Wanjiku, ebenfalls aus Kenia, ebenfalls Langstreckler, und auch er ein junges Talent und praktisch nicht zu schlagen. Der Vierte war…
«Asserate ist tot», sagte Jesse.
Emilio verdrehte die Augen. «Ja, ist er. Aber das ist nicht deine Sache.»
«Er ist vor meinen Augen gestorben.»
«Er hatte zu viel Epo geladen. Der Idiot!» Emilio schnaubte verächtlich. «Junge. Mach es, wie du es schon immer getan hast. Vergiss alles um dich herum.»
Jesse schluckte trocken.
«Wer ist der schnellste Mann der Welt?»
Jesse presste die Lippen aufeinander.
«Wer war der schnellste? Wer war es schon bei den Panthern?»
Jesse ließ den Blick in die Ferne schweifen.
«Und wer ist es heute? Wer?»
Entschlossen schob Jesse den Unterkiefer vor und sah Emilio direkt in die Augen. «Ich.»
«Na, also!» Mit der flachen Hand klopfte Emilio auf die Liege. «Komm.»
Jesse zog die Hose seines Trainingsanzugs aus und legte sich bäuchlings auf die gepolsterte Unterlage.
Emilio setzte sich an den Rand der Liege, nahm einen Wattebausch und tränkte ihn mit Desinfektionsmittel. Dann reinigte er sorgfältig die Rückseite von Jesses Oberschenkel.
«Nein!», schrie Jesse, als er die mörderisch lange Injektionsnadel sah, die Emilio aus ihrem sterilen Umschlag schälte, und wollte von der Liege springen. Doch blitzschnell zog Emilio den Medizinalriemen über Jesses Beinen straff, den er zuvor unbemerkt angelegt hatte.
Dann beugte sich Emilio zu ihm herunter. «Nie würde ich etwas tun, das dir schadet. Das weißt du, Junge.»
Er krempelte einen Ärmel seines T-Shirts hoch. Früher hatte sich hier der starke Bizeps eines durchtrainierten Athleten präsentiert, der Emilio einmal gewesen war. Als Student hatte er es im Diskuswerfen immerhin zum italienischen Meister gebracht. Doch jetzt kam eine schwabbelige Keule zum Vorschein. Er setzte sich die dünne, biegsame Nadel auf die bleiche Haut und drückte sie hinein. Langsam bohrte sich die Nadel in sein Fleisch.
«Vier Zentimeter», sagte Emilio. «Und keinerlei Schmerz. Die Nadel ist so fein – und ich bin so geschickt. Jede Tussi muss mehr ertragen, wenn sie sich den Arsch tätowieren lässt.»
Mit weitaufgerissenen Augen starrte Jesse auf die Nadel, die in Emilios Arm steckte. Schwitzend und mit bebender Stimme sagte er: «Erklär mir wenigstens, was es ist.»
«Ein natürlicher Stoff, der deinem Muskel hilft, die gerissenen Fasern zu ersetzen. Nennen wir es das Unsichtbare. Nichts davon wird in deinem Blut zu finden sein. Ich injiziere es direkt in die Muskelzellen.»
Jesse ließ den Kopf ergeben sinken und schloss die Augen.
Dann hörte er, wie Emilio eine neue Injektionsnadel aus dem Papier schälte. Jesse biss die Zähne zusammen und wartete auf den Einstich.
Doch Emilio hatte recht gehabt: Es tat nicht weh.
Jesse hörte nur ein feines Surren, das er nicht deuten konnte.
Was er nicht sehen konnte: Die ultradünne Injektionsnadel durchstieß seine Haut und drang langsam in den Muskel ein. Gleichzeitig wurde um die Nadel herum ein Kranz aus ultrafeinen Nadeln ausgefahren, die wie Akupunkturnadeln etwa einen Millimeter tief in die Haut gestochen wurden.
Völlig schmerzlos.
Dann spürte Jesse tief im Muskel ein Vibrieren.
Er verkrampfte sich.
«Schön locker bleiben», sagte Emilio leise. «Das ist nur ein bisschen Strom. Der macht, dass die Muskelzellen den Stoff gut aufnehmen. Bleib einfach ganz ruhig, dann ist das absolut kein Problem. Wenn du dich bewegst, gehen die Muskelzellen kaputt – unwiderruflich. Und du hast ein Loch im Bein. Das wollen wir doch nicht. Oder?»
4
Wo war Minou?
Normalerweise galt Thierry Velans erster Blick dem Himmel, wenn er am Morgen aus dem Haus trat. Heute nicht. Er suchte den gepflasterten Hof ab, lief zur Scheune hinüber, in der Sylvies Atelier und der Musikkeller der Zwillinge untergebracht waren, und inspizierte den Platz vor der Garage. Er ging zur Ausfahrt, die auf die Landstraße führte, und dann zur alles überragenden Trauerweide.
Von der Katze keine Spur.
Thierry atmete tief ein, hob die Arme, bog die Wirbelsäule durch und ließ die Luft dann wieder geräuschvoll ausströmen. Eigentlich war es höchste Zeit, dass er ins Labor kam, doch er konnte sich nicht losreißen. Hier, auf seinem Hof, hatte gestern eine weiße Maus gelegen. Vor der blühenden violetten Glyzinie, die sich an der Fassade des Hauses hochrankte, begann er mit einer Serie von Gymnastikübungen, um seine Muskeln zu dehnen – und um Minou eine Chance zu geben, doch noch aufzutauchen.
Was sie aber nicht tat.
Als Thierry endlich im Labor eintraf, war Catherine bereits an der Arbeit. Sie prüfte die Digitalanzeige eines der vielen Gas-Chromatographen im Analyseraum.
«Letzte Probe», sagte sie, als Thierry hinzutrat.
An den Massenspektrometern standen die Statuslämpchen auf Grün: Die Analysen waren abgeschlossen. Die Geräte hatten die ganze Nacht über gearbeitet, die Proben in ihre Bestandteile getrennt und mit reinen Referenzsubstanzen verglichen. Das Resultat waren farbige Kurven auf Endlospapier.
«Schon etwas entdeckt?», fragte Thierry.
«Auf den ersten Blick nicht. Nur in den Narkotikaproben der Radfahrer die übliche Sauce.»
«Aber alles legal, nehme ich an.»
«Natürlich. Aber ich frage mich manchmal, ob da ausschließlich Migränepatienten mitfahren.»
«So sind die Radrennfahrer. Die hatten noch nie Berührungsängste mit Chemie.»
Er griff sich einen der Papierstapel und blätterte ihn durch. Normalerweise zeichnete sich in den Kurven jede getestete Substanz als klarer Ausschlag ab. Nicht so bei diesen Proben. Wie ein Nebel waren hier alle Kurven von irgendwelchen Signalen überlagert; sie ließen sich den diversen Schmerzmitteln zuordnen, die die Fahrer praktisch permanent intus hatten. Ohne diese Substanzen hätten sie die Strapazen eines professionellen Etappenrennens gar nicht durchgestanden. Viele gebrauchten diese Mittel inzwischen auch im Training, weil sie immer ans Limit gingen, oft auch darüber. Aber auch mit härterem Stoff waren die Radrennfahrer die experimentierfreudigsten unter den Sportlern. Nicht von ungefähr hatten sie den ersten Dopingtoten der Geschichte geliefert. Thierry musste an Arthur Linton denken, der 1886 beim Rennen Bordeaux– Paris tot vom Rad gefallen war. Sein Betreuer, notabene der Besitzer einer Fahrradfabrik, hatte ihm eine Überdosis Trimethyl verabreicht. Und auch das erste olympische Dopingopfer war ein Radfahrer gewesen. Wie Thierry wusste, war Knut Enemark Jensen 1960 nach der Einnahme von Amphetaminen tot in einen Straßengraben gekippt.
«Dabei stammen diese Proben nicht mal von einer großen Tour», unterbrach Catherine kopfschüttelnd Thierrys Gedanken. «Die sind von irgendeinem Amateurrennen, und wenigstens die sollten doch eigentlich noch sauber sein.»