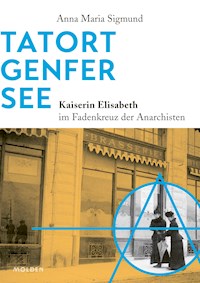7,99 €
Mehr erfahren.
Spannend, witzig, kultverdächtig!
Eigentlich ist Hermine eine ganz normale Bankangestellte. Niemand würde glauben, dass sie in ihrer Freizeit heimlich mordet. Doch jetzt, mit über fünfzig, ist sie fest entschlossen, sich keine Gemeinheit mehr gefallen zu lassen — eher geht sie über Leichen. Und so muss zuerst Herr Wegner, ein Freund ihres Mannes, dran glauben, wenig später ihr Gatte selbst und schließlich der Investmentbanker Florian. Jedes Mal sieht es nach einem tragischen Unfall aus, denn als passionierte Krimileserin weiß Hermine, wie man seine Spuren verwischt. Und besser, man verscherzt es sich nicht mit ihr — denn ihre Mordlust ist gerade erst geweckt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 284
Ähnliche
Anna Sigmund| Leichenroulette
Anna Sigmund im Gespräch
Frau Sigmund, bislang haben Sie ausschließlich Sachbücher geschrieben. Was hat Sie dazu bewogen, einen Roman zu verfassen?
Die Frage muss eher umgekehrt lauten: Warum habe ich bislang ausschließlich Sachbücher geschrieben? Es war eine interessante Arbeit, aber natürlich eine, bei der ich meine Phantasie zugunsten harter Fakten und penibler Recherchen zügeln musste. Bis ich schließlich dazu überging, abends zur Entspannung kurze Geschichten und heitere Alltagsepisoden niederzuschreiben.
Wie und wann kam Ihnen die Idee zu Hermine, ihrer mordenden Heldin?
Es war mein betagter Schwiegervater, der den Anstoß gegeben hat. Nach der Lektüre eines Buches über historische Kriminalfälle meinte er nämlich: »Soll ich dir sagen, wie man einen perfekten Mord begeht? Du musst mir aber versprechen, dass du unsere Familie nicht ausrottest.« Gleich danach ging ich ans Werk. Meine Familie ist übrigens noch am Leben.
War es am Ende schwer, sich von den Figuren zu verabschieden?
Der Abschied von Hermine war tatsächlich sehr schwer. Für seine Schöpfung trägt man schließlich eine gewisse Verantwortung. »Wie geht es jetzt mit ihr weiter?«, habe ich mich bange gefragt. »Wird sie auf den Pfad der Tugend zurückfinden und in Zukunft ein anständiges Leben führen?« Ich wage dies zu bezweifeln und fürchte sehr, dass sie ihren unheilvollen Weg fortsetzt. Wohin? Wir wissen es nicht!
Über die Autorin
Anna Sigmund studierte Geschichte und Kunstgeschichte an der Wiener Universität. Sie arbeitete als freie Wissenschaftsjournalistin sowie Historikerin und feierte als Sachbuchautorin mit ihrer Reihe Die Frauen der Nazis internationale Erfolge. Leichenroulette ist ihr erster Roman. Anna Sigmund lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Wien.
Leichenroulette
Anna Sigmund
Leichenroulette
Kriminalroman
Impressum
Originalausgabe 09/2011
Copyright © 2011 by Diana Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion | Uta Rupprecht
Herstellung | Helga Schörnig
Satz | Leingärtner, Nabburg
ePub-ISBN 978-3-641-05652-0
www.diana-verlag.de
Kapitel 1
1
Dick, dick, zu dick – das waren die Worte, die sich wie ein roter Faden durch meine Kindheit zogen. »Frau Meier, Ihre Hermine wird immer runder. Diese vielen Süßigkeiten! Man sieht sie aber auch dauernd naschen.« Gerne machten freundliche Nachbarinnen aus der Schlossergasse meine Mutter beim morgendlichen Einkaufstratsch darauf aufmerksam, dass ihre einzige Tochter fast einer kleinen Tonne glich.
Schon im Kindergarten habe ich gern gegessen. Selbst die in der Nachkriegszeit bei der sogenannten »Ausspeisung« verabreichte dicke Erbsensuppe mundete mir vortrefflich. Voll Gier musste ich jedes Mal schlucken, wenn man unser Mittagsmahl in einer großen Milchkanne aus Aluminium herbeitrug, der Deckel sich klappernd öffnete, mir ein köstlicher – von anderen Kindern als ekelhaft empfundener – Geruch in die Nase stieg, der gusseiserne Schöpflöffel in den zähen Brei tauchte.
Zu Hause hingegen war für mich immer Ostern, da meine selbst schlanke und ranke Mutter dazu überging, ihre Lebensmittel vor meinen gierigen Händen zu verstecken. Doch ich suchte beharrlich und fand – Rosinen, die Kochschokolade, die Eierbiskotten. Die Strafe folgte auf dem Fuß. Sehr anpassungsfähig, änderte ich blitzschnell meine Taktik und half emsig in der Küche, wobei immer das eine oder andere Häppchen für mich abfiel. Ganz nebenbei lernte ich ausgezeichnet kochen.
Abgesehen von meinen Figurproblemen, die mich getreulich weiterbegleiten sollten, gestaltete sich meine Kindheit gar nicht so schlecht. Ob ich allerdings, wie die Schauspielerin Lilli Palmer in ihrer Autobiografie »Dicke Lilli, gutes Kind« über sich selbst schrieb, auch ein gutes Kind war, könnte man bezweifeln.
Ich stamme aus einer kleinen Stadt in einer wildromantischen, aber ärmlichen Region im Norden Österreichs an der böhmisch-mährischen Grenze. Mit Eltern und Großmutter lebte ich in einer etwas düsteren, zur Gasse hin gelegenen Wohnung eines Mietshauses, im Schatten der imposanten barocken Stadtpfarrkirche. Das ehemalige bäuerliche Anwesen war sehr alt; es bestand aus einem kleinen Haupthaus, einer durch ein schweres Tor geschützten Einfahrt, einem für wilde Spiele bestens geeigneten Innenhof und einem winzigen »Ausnahmstüberl«. Auf engstem Raum vereinte sich ein wahrer Mikrokosmos menschlicher Existenzen. Das Zusammenleben der sogenannten »Parteien« verlief zu keinem Zeitpunkt konfliktfrei und bot den Kindern der Mieter – meiner besten Freundin Mizzi und mir sowie den zwei Buben Raini und Günther – stets Unterhaltung.
Es war eine schöne, spannende und abwechslungsreiche Zeit voll Geborgenheit und Sicherheit, aber mit festen Regeln und Normen. Bereits in der Volksschule scharte ich eine kleine Gruppe von gleichaltrigen Buben und Mizzi als einzigem Mädchen um mich. Sie waren meine »Vasallen« – das Wort hatte ich bei Erwachsenen gehört und übernommen –, denen unter meiner Leitung auch ganz ohne Gameboys und Computerspiele nie langweilig war. Mit Raini, Günther, Otti, Waldi, Seppi und Mizzi erforschte ich die tiefen und geheimnisvollen Keller, die sich wie ein Spinnennetz unter der Stadt hinzogen. Nach dem Vorbild von Abenteuerromanen, die wir aus der städtischen Leihbücherei bezogen, klopften wir die Wände auf der Suche nach eingemauerten Schätzen ab.
Der Unterricht endete um 12 Uhr, und einer eisernen Regel zufolge erledigten wir die Hausaufgaben sofort nach dem Mittagessen. Kaum war eine hübsche, kunstvolle »Zierleiste« säuberlich unter die Rechnungen und Übungssätze gemalt und die Schultasche für den nächsten Tag gepackt, veranstalteten wir auch schon auf dem Katzenkopfpflaster vor dem Haus polternd Rennen mit jenen kleinen Leiterwagen, die man damals allgemein zum Transport sperriger Sachen benutzte – sehr zum Missvergnügen der älteren Anrainer, die meist gerade dann ihr kleines Schläfchen hielten. Zum Gaudium meiner Vasallen setzte ich meine schönste Puppe – ein sinnreiches Geschenk einer Tante zur Förderung meiner weiblichen Eigenschaften – in das klapprige Gefährt. Flugs ging es die steile Gasse hinunter. Bald versanken die großen, tiefblauen, von dichten schwarzen Wimpern gesäumten Augen der zarten Porzellanfigur in ihrem lieblichen Blondkopf, was ihr ein sinister-dämonisches Aussehen verlieh. Wir bogen uns vor Lachen.
Einige Mütter sahen uns kopfschüttelnd zu. Naserümpfend stellten sie meine Mutter zur Rede: »Frau Meier, warum lassn’s denn die Hermi mit solchen Gassenbuben herumrennen?« Ihren behüteten Töchtern untersagten sie den Umgang mit mir und meiner Bande. Das kam mir gelegen, denn ich verabscheute das kindische Getue der niedlichen Mädchen, wenn sie artig im Garten saßen, Kleidchen für ihre Püppchen nähten, mit ihnen sogar sprachen, sie badeten, spazieren führten und schlafen legten.
Ich als »Old Shatterhand« zog Buben und »Räuber-und-Gendarm«-Spiele bei einfallender Dunkelheit vor. Noch Jahre später vermeinte ich jenen prickelnden Schauer zu verspüren, der mir, versteckt hinter einem Hausvorsprung, über den Rücken jagte, wenn sich der »Gendarm«, nachdem er bis dreißig gezählt hatte, mit dem Ruf »Ich komme!« auf die Suche nach uns »Räubern« machte.
Häufige, kostenlose »Reality-Shows« ersetzten in der Schlossergasse 14 das Fernsehen, denn es wurde fast täglich gestritten. Zu verschieden waren die unter einem Dach vereinten Charaktere. Die Schwestern Fröhlich im ersten Stock distanzierten sich gerne von ihren als vulgär empfundenen Nachbarn. Altjüngferlich und pedantisch, litten die stets in Weiß gekleideten zwei Damen vor allem darunter, dass sie ihre Toilette mit dem in ihren Augen rohen und derben Ehepaar Prosch, dessen frechen Söhnen Raini und Günther, aber auch deren wechselnden »Bettgehern« teilen mussten.
In besonderer Erinnerung blieben zwei Monteure eines Wiener Elektrokonzerns, die bei uns in der tiefen Provinz Wartungs- und Reparaturarbeiten durchführten. Herr Prosch, ein bei den städtischen Wasserwerken beschäftigter und daher von allen nur »Wassermann« genannter hagerer und griesgrämiger Mann, gewährte ihnen Unterkunft. Er war froh über den kleinen Zusatzverdienst. Und da die jungen Männer im Schichtdienst arbeiteten, schien es ihm ganz logisch, ihnen die Bettbank in der Küche zur gemeinsamen, abwechslungsweisen Nutzung zu vermieten. Besuchte ich meine Spielgefährten, fand ich immer einen der Burschen tief schlafend vor. Er ließ sich weder durch die Kochgeräusche der Frau Prosch noch durch den Lärm, den wir verursachten, stören. Im Wachzustand prahlten die feschen Monteure mit ihrer Männlichkeit. Stolz erzählten sie, dass sie, wenn sich die Gelegenheit bot, bei der Arbeit hübsche und willige Ehefrauen, die sie allein antrafen, »vernaschten«. Wir spitzten unsere Ohren. Auch Herr Prosch amüsierte sich königlich, während er von einer der Einfachheit halber an einem Nagel im Türrahmen aufgehängten Speckseite, einem Geschenk seiner bäuerlichen Verwandten, kleine Stücke abschnitt und verzehrte.
Das Lachen verging ihm, als er wegen der mangelnden Hygiene der flotten »Bettgeher« vor dem Bezirksgericht landete. Dieser betrübliche Fall trat ein, nachdem der biedere »Wassermann« in höchster Erregung einem der Fräulein Fröhlich, das sich mit näselnder Stimme über die verschmutzte Toilette beschwerte, einen heftigen Schlag versetzte. Das vom Bezirksrichter verhängte Schmerzensgeld händigte er seinen triumphierenden Gegnerinnen in monatlichen Raten aus.
Seine privaten Querelen minderten den Status des »Wassermanns« nicht. Im Gegenteil, er galt als Held. Mit Argusaugen wachte er auch weiterhin über die »Bassena«, die einzige Wasserstelle zur Versorgung der Schlossergasse 14 mit dem unentbehrlichen Nass. Als ehrenamtlicher Experte entschied er Fragen, welche die Parteien des Hauses zutiefst bewegten: »Wer verbraucht viel, wer wenig Wasser? Wie sollen die Kosten gerecht verteilt werden?« Die Hausgemeinschaft, die sich – im besten Fall – einmal wöchentlich in das städtische »Tröpferlbad« begab und sich ansonsten mit oberflächlicher Säuberung in einer Waschschüssel, dem »Lavur«, begnügte, beobachtete missbilligend, welche Verschwendung meine auf höchste Sauberkeit bedachte Mutter betrieb. Nicht nur, dass sie unnötig oft die Holzfußböden unserer Wohnung schrubbte, auf ihr Geheiß hin zogen wir auch – damals eher unüblich – täglich frische Kleidungsstücke an.
Daraus resultierte, dass meine Großmutter einmal wöchentlich die Gemeinschaftswaschküche in Beschlag nahm. Ein beeindruckendes Schauspiel nahm seinen Lauf. Es dampfte und brodelte in den Kesseln über der Feuerstelle, die voll waren mit zuvor eingeweichten und dann mit Schichtseife auf der »Rumpel« geschrubbten Textilien aus Baumwolle oder Leinen. Es grenzte an Zauberei, wie die geschäftig hantierende Wäscherin zeitweise in den dichten Nebelschwaden vollkommen verschwand. Ich traute mich nie zu fragen, bei welcher Gelegenheit wir uns, nämlich mein Vater als Beamter in seinem Amt, meine Mutter zu Hause und ich in der Schule, jemals derart beschmutzten, um diese komplizierte Prozedur zu rechtfertigen. »Nur gekochte Wäsche ist wirklich hygienisch sauber«, belehrte uns meine Mutter, die nur mit Mühe davon abgehalten werden konnte, auch unsere Schuhe zu waschen. Auf jeden Fall verrechnete man meiner Familie das Doppelte der pro Person anfallenden Wassergebühren.
Im Hintertrakt unseres Hauses, neben der Waschküche, logierte eine meist stark geschminkte, nicht mehr ganz junge Dame, bei der »Mauner«, nämlich Männer – alt und jung –, nächtens verkehrten. Den Mitbewohnern blieb das unmoralische Treiben selbstverständlich nicht verborgen. Sie ergötzten sich daran im Geheimen, sparten jedoch nicht mit verächtlichen Blicken und zynischen Anspielungen. Vermutlich aus Rache rief mich die von allen gemiedene Frau manchmal zu sich in ihr mit allerlei Kitsch gefülltes Heim. Ich saß dann unter Heiligenbildern zwischen bunten Kissen auf ihrem Schlafsofa, sie erzählte mir aus ihrem Leben, und ich erntete gleichsam die Früchte ihrer Unzucht, indem ich köstliche Pralinen aus den von nächtlichen Besuchern hinterlassenen billigen Bonbonnieren verzehrte.
Für uns Kinder war das alte, verwinkelte, heruntergekommene Gebäude ein wahres Eldorado. So benutzten wir die aufgrund der Hanglage der Liegenschaft teilweise ebenerdige Wohnung des – wie es uns vorkam – uralten Ehepaars Smutny, das im hinteren Trakt, gleich neben Mizzis Eltern, Küche und Zimmer bewohnte, als praktische Abkürzung zum Kirchplatz. Ungeniert liefen wir die Treppenstiege im Hof hinauf und kletterten durch ein Fenster hinaus, wenn wir auf dem Weg zu verwegenen Bandenspielen beim Pfarrhof neben der Kirche waren.
Herr Smutny trank exzessiv. Die ordinären Flüche, die er im Zustand der Volltrunkenheit ausstieß, bereicherten unseren geheimen Wortschatz ganz ungemein. Im Sommer barg die Sucht des Herrn Smutny keinerlei Gefahren. Im Winter jedoch kam er auf dem Heimweg von seinem Wirtshaus manchmal von der Straße ab und landete in einem Rinnsal, wo ihn von seiner Frau alarmierte männliche Mitbewohner der Schlossergasse 14 dann aufspürten. Ihr Mitleid bewahrte ihn in eisigen Nächten vor dem Erfrieren. Sie trugen ihn nach Hause, wo er seinen Rausch ausschlief.
Der kleine Innenhof des Hauses mit einem verkrüppelten Fliederbaum und der »Bassena« als Wasserstelle war Allgemeingut. Dort lebte eine von allen geduldete, von mir jedoch geliebte und gefütterte Katzenfamilie. Dort hielten manche in kleinen Ställchen Kaninchen, so wie ich meinen »Hansi«, dort legte Frau Zottl, eine im »Ausnahmstüberl« einquartierte über 90-jährige, stets keifende alte Frau, ein kleines Gärtchen an, das sie gegen uns ballspielende Kinder vehement verteidigte, genauso wie den räudigen Fliederbusch neben dem Plumpsklo.
In der von sämtlichen Bewohnern – mit Ausnahme der Schwestern Fröhlich und der Familie des »Wassermanns« – benutzten und sommers wie winters nur über den Hof zu erreichenden Toilette hörten Mizzi und ich, auf einem Holzbrett sitzend, tief unten oft die Ratten kratzen. Das verschwiegene Örtchen bildete einen Zankapfel. War es, wie es manchmal geschah, verstopft, verbreitete sich bald ein penetranter Gestank. Zuallererst appellierte man an die Hausbesitzerin, eine liebenswerte alte Dame, die, wie sie deutlich zu verstehen gab, mit den Bewohnern ihrer Liegenschaft und auch mit ihrem Besitz selbst nichts zu tun haben wollte. Das lag, wie uns die Erwachsenen erklärten, an den in der Inflationszeit nach dem Ersten Weltkrieg eingefrorenen und seitdem nicht mehr erhöhten Mieten. Man zahlte den sogenannten »Friedenszins«.
Nachdem es keine finanziellen Rücklagen gab, Appelle an die Hausbesitzerin ungehört verhallten und die Suche nach den Übeltätern stets im Sand verlief, traten die von den Frauen verköstigten, gelobten und angefeuerten Männer der Wohngemeinschaft mit Hacken und Spaten in Aktion. Unter derben Flüchen gruben sie den Hof bis auf die Gasse hinaus auf, legten den Kanal frei und säuberten ihn. Wir Kinder liebten die große Aufregung und erschauderten vor den Ratten, die manchmal unverhofft ans Tageslicht kamen.
Nur ein Wehrmutstropfen trübte mein junges Leben, und zwar in Gestalt eines großen, dicken, hartgesottenen Buben mit bösartigem Gesicht. Der Hahn Peter, wie er genannt wurde, war in unserer Kleinstadt berüchtigt. Er schlug kleinere Kinder und nahm ihnen, wenn er sie im Sommer genüsslich schleckend auf der Straße antraf, die Eistüten weg. Er entwendete Spielzeug, verscherbelte es und hatte so immer Geld. Ich hasste den Sohn einer alleinstehenden Gemüsehändlerin, die ihn maßlos verwöhnte, nicht nur deshalb, weil er sich ein Vergnügen daraus machte, Tiere zu quälen. Ich fürchtete ihn vor allem als Chef einer rivalisierenden Bande, mit der er den Kirchenplatz beherrschte und mich mitsamt meinen »Vasallen« oftmals vertrieb und terrorisierte.
Im Schutze meiner Anhänger drohte mir keine Gefahr, ja, da ließ ich mich sogar zu Schmährufen hinreißen. »Hei, blöder Schwabbler!«, schrie ich forsch, wenn ich Peter von Weitem kommen sah. »Trau di her, feiger Fettwanst!« Als ich jedoch eines Tages mit Mizzi allein unterwegs war, verstellte er mir den Weg. Wortlos gab er mir, bevor er weiterschlenderte, ein paar Ohrfeigen, die mir auf den Wangen brannten. Und dies vor den Augen meiner ungläubig starrenden Freundin! Welche Schande! Welcher Gesichtsverlust! Ich merkte sofort, wie ich in ihrer Achtung sank. Und sollte bald auch merken, dass sie den Vorfall weitererzählte.
Am Ende dieses beschämenden Tages weinte ich mich voll ohnmächtigem Zorn in den Schlaf, und auch an den folgenden Abenden fand ich vor Gram keine Ruhe. In der irrigen Annahme, dass man mich, wie es oft geschah, wegen meiner Molligkeit gehänselt hatte, las mir meine besorgte Mutter Hans Christian Andersens Märchen »Das hässliche Entlein« vor. »Es war einmal«, begann sie ihre Gutenachtgeschichte mit sanfter, beruhigender Stimme. Ich kuschelte mich unter die weiche Bettdecke und hörte zu. Es gefiel mir, wie das von allen verspottete hässliche Küken zum wunderschönen Schwan heranwuchs. Eine Lösung meiner eigenen Probleme fand ich in der sentimentalen Erzählung nicht.
Wenige Tage später bedachte mich meine Mutter, als ich aus der Schule kam, nicht mit dem üblichen forschenden Blick, sondern schaute mich mitleidig an. Was hatte das zu bedeuten? Leicht verunsichert verstaute ich meine Sachen, wusch mir die Hände und setzte mich an den Küchentisch. Als ich, was sonst nur an Sonn- und Feiertagen geschah, ein Wiener Schnitzel vorgesetzt bekam, befiel mich eine düstere Ahnung. Ich stopfte mir einen großen Löffel mit Kartoffelsalat in den Mund und blieb gegen jede Gewohnheit ungerügt. Im Gegenteil, meine Mutter lächelte mild, strich ihre weiße Schürze glatt und setzte sich zu mir. »Sei nicht traurig«, meinte sie. »Aber dein Hansi ist verschwunden. Heute früh war sein Ställchen leer. Und das Türl offen.« Mir wurde vor Schreck ganz kalt. Hansi, mein geliebtes schwarz-weißes Kaninchen mit den langen Ohren, dessen weiches Fell ich so gern streichelte, den ich mit Karotten und Löwenzahn verwöhnte, ja förmlich mästete! »Wo, glaubst du, kann er denn sein?«, fragte ich weinerlich. »Werd ich ihn wiederkriegen?«
Bis in die Abendstunden suchte ich die Nachbarschaft nach meinem Lieblingstier ab. Ich fragte alle, die mir begegneten, erhielt jedoch nur negative Auskünfte. Schließlich verfasste ich noch eine Suchanzeige, ging zum Rathaus und klebte sie neben den Schaukasten mit den Verlautbarungen der Gemeinde. Tags darauf schaute ich nach, begleitet von meiner Runde, die ich sofort eingeweiht hatte. Schon von Weitem leuchtete uns die auf einen Zettel geschmierte, trotz Rechtschreibfehlern eindeutige Botschaft in roten Großbuchstaben entgegen: KRIGST NIMER!!!!! Wir erstarrten vor Entsetzen.
Der infame Schreiber sollte Recht behalten – Hansi tauchte nie wieder auf. Noch lange rätselte ich, welch trauriges Schicksal ihn ereilt haben könnte. Zwei Wochen verstrichen. Dann verbreitete sich das Gerücht, dass der Fleischer eines kleinen Dorfes unweit der Stadt Kaninchenfleisch – es soll sehr fett gewesen sein – zum Verkauf angeboten hätte. »Ob vielleicht der Hahn Peter?«, formulierte Mizzi ungeschickt ihren dunklen Verdacht. Ich teilte diesen voll und ganz, schwieg jedoch. In meinem Innersten hatte ich schon längst einen Entschluss gefasst. Es fehlte nur noch die passende Gelegenheit. Und die kam.
Schon ab Mitte Juni gingen die Kinder unserer Stadt, wenn das Wetter es nur halbwegs erlaubte, jeden Nachmittag die kurze Strecke aus der Stadt hinaus und durch ein kleines Wäldchen hinunter bis zum Ufer des träge, braun und mit Laub bedeckt dahinströmenden Flusses. Dort, in der Nähe eines rauschenden Wehrs, hatten fürsorgliche Stadtväter vergangener Epochen, als Turnen und Sport groß in Mode kamen, ein Strandbad errichtet. Wir lösten im Kiosk am Eingang Badekarten, bekamen kleine Schlüssel ausgehändigt und verstauten unsere Kleider in einem der Kästchen des weitläufigen grünen Umkleidepavillons, dem kunstvolles Schnitzwerk ein luftiges Aussehen verlieh. In dessen offenen Gängen konnten wir, obwohl dies die Badeordnung ausdrücklich untersagte, hervorragend Fangen spielen. Sie boten auch Schutz, wenn Unwetter aufzog. Wir saßen dann auf den Balustraden und schauten in den strömenden Regen hinaus, während die von der Sonne aufgeheizte Holzkonstruktion behagliche Wärme abgab. Bis zum Einbruch der Dunkelheit verbrachten wir unbeschwerte Stunden. Erwachsene begleiteten uns nur zum Wochenende, ansonsten genossen wir unsere Freiheit. Meiner Erinnerung nach ist auch – abgesehen von einer einzigen tragischen Ausnahme – niemals etwas passiert.
Die Kleinen planschten in einem umzäunten, von der Fließstrecke abgetrennten Becken, auf dem Drei-Meter-Brett wippten mutige Jugendliche, bevor sie ihre Sprungkünste vorführten, auf den Holzpritschen in der Liegewiese strickten und plauderten Frauen in bunten Badeanzügen aus dünner Wolle. Ein strenger »Badewaschl« mit Trillerpfeife wachte über Zucht und Ordnung: »Schwimm net so weit hinaus! Fredl, gib a Ruh! Kum aussa, du bist ja schon ganz blau!«, lauteten seine Befehle, denen wir sofort gehorchten. Während sich meine Freunde noch mit ihren voluminösen Schwimmreifen abquälten – zweckentfremdeten Schläuchen alter Autoreifen, die ihnen der freundliche Herr Waiss, seines Zeichens Händler von Kraftfahrzeugen, kostenlos überlassen hatte –, konnte ich bereits schwimmen. Mit kräftigen Stößen durchquerte ich hocherhobenen Hauptes, im Nacken die neidischen Blicke der Gleichaltrigen, mühelos den Fluss. Am gegenüberliegenden Ufer zog ich mich an Land, schüttelte mich und drehte mich selbstbewusst um. Von Hahn Peter und seinem widerlichen rotznäsigen Gefolge, die mir feixend zuschauten, war natürlich kein Beifall zu erwarten. Allerdings auch keine Aggressionen, denn auf dem neutralen Territorium des Strandbades ruhte der Kampf. Abgesehen von gezischten Schimpfwörtern, Anspucken oder »Haxlstellen« im Vorbeigehen, wenn der muskulöse »Badewaschl« wegsah, blieb es friedlich. So konnte auch Hahn Peter ungestört seinen schwarzen Reifen zu Wasser bringen, sich mit seinem massigen Körper darauf niederlassen und sich in dem kühlen Nass – der Fluss wurde niemals richtig warm – hinaustreiben lassen, wobei ihm die Hände als Paddel dienten. Lange betrachtete ich ihn mit gesenkten Augen, dann wurde mir blitzschnell klar: »Das ist die Gelegenheit, auf die du gewartet hast! Die darfst du nicht verpassen.«
Nichts ist, wie sich bald herausstellte, süßer als Rache! Als er, ganz allein, langsam auf die Mitte des Flusses zutrieb, glitt ich in die Fluten und folgte ihm. Die Sonne schien, die Wellen kräuselten sich, die Bäume am Ufer zeichneten auf der Wasseroberfläche flüchtige, sich rasch wandelnde Schattengebilde. Als ich näher kam, hob Peter den Kopf: »Bleib weg, du blöde Kuh. Weißt ja, dass ich no net schwimmen kann! Tu mir ja nix, sonst erlebst was!« – »Was machst dann da heraußen? G’hörst ins Planschbecken«, lautete meine prompte Antwort. »Fürchtst di gar? Wasserschluckn ist g’sund!« Unter lautem Lachen rüttelte ich spielerisch an seinem Reifen, in dem er hingegossen wie eine feiste Qualle lag. In seiner Angst sah er die grüne Glasscherbe in meiner linken Hand nicht, mit der ich hurtig die Flicken auf dem oftmals geklebten Schwimmbehelf löste. Und da niemand aus dem Bad unseren Kindereien Beachtung schenkte, machte ich noch rasch ein paar kleine Schnitte unter der Wasseroberfläche. Dann ließ ich von meinem Opfer ab. Als kleine Bläschen, Vorboten kommenden Unheils, aus dem durchlöcherten Gummi aufstiegen, entfernte ich mich schnell, zufrieden über die kleine Lektion, die ich dem bösen Buben erteilt hatte. Aus sicherer Entfernung beobachtete ich, wie er sich an den Rettungsanker klammerte, aus dem langsam die Luft entwich, zuerst seinen Freunden winkte, dann um Hilfe schrie, wie wild um sich schlug, unterging, auftauchte, unterging und schließlich versank. Schließlich stürzte sich der alarmierte »Badewaschl«, der anfangs an ein dummes Bravourstück des als Angeber bekannten Wildlings gedacht hatte, in die Fluten, um den offensichtlich Ertrinkenden zu retten. Mehrmals tauchte er unter, bis es ihm gelang, den Buben, dessen Bein sich, wie wir später erfuhren, in Schlingpflanzen verfangen hatte, an die Oberfläche zu ziehen. Im Kreis neugieriger Badegäste erkämpfte ich mir einen Platz in der ersten Reihe und erlebte aus nächster Nähe, wie der rasch herbeigerufene Gemeindearzt an dem regungslos auf der Wiese liegenden Buben energische Wiederbelebungsversuche durchführte. »Er war lang unter Wasser. Wenn es nur nicht zu spät ist«, meinte er pessimistisch. Zuerst legte er ihn auf die rechte Seite, dann drückte er mit festen, rhythmischen Bewegungen gegen seinen Brustkorb, bis Wasser aus seinem Mund quoll. Mir wurde fast übel. Peter war doch nicht etwa tot? Ich hatte ihn doch nur schrecken wollen. Obwohl mir allmählich dämmerte, dass er furchtbare Rache nehmen würde, war ich doch froh, dass er nach ein paar Minuten erste Lebenszeichen von sich gab, zuckte und zu atmen begann. Er blieb jedoch ohne Bewusstsein und hielt die Augen geschlossen, bis ihn ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht in rasender Fahrt ins Krankenhaus fuhr. Die Ärzte dort würden ihm schon helfen! Ich schob die momentanen Skrupel und aufkeimende Gewissensbisse zur Seite. Bald gewannen andere Gefühle die Oberhand: Was für ein aufregender Tag! Und welch interessantes Erlebnis! Spannend wie ein Abenteuerfilm.
Die Weise, in der die Bewohner unserer kleinen Stadt Anteil am Schicksal des Scheusals nahmen, überraschte mich. Sie schien mir stark übertrieben, grenzte fast an Hysterie. Man überbot sich in Mitleidsbekundungen, als die Folgen des – vermeintlichen – Unfalls feststanden und man erfuhr, dass der »Sonnenschein«, wie Frau Hahn ihren missratenen Sprössling zu rufen pflegte, zwar mit dem Leben davonkommen würde, aufgrund des erlittenen Sauerstoffmangels aber schwere körperliche und geistige Schäden davongetragen hatte. Angesteckt von der allgemeinen Stimmung, suchte ich mich vor mir selbst zu rechtfertigen: Warum ist der Blöde auch ins tiefe Wasser, wenn er net schwimmen kann? Hab ich g’wusst, dass es so ausgeht?
Beinahe hätte ich meinen Eltern alles gestanden, doch eingedenk ihrer häufigen Ermahnung: »Reden ist Silber, Schweigen ist Gold!« hielt ich den Mund. Wenn Frau Hahn meinen Ex-Rivalen voll resignierter Traurigkeit im Rollstuhl durch die Straßen schob und sein Kopf mit leerem Blick lallend zur Seite sank, grüßte ich besonders freundlich und höflich. Nicht der Schatten eines Verdachts fiel auf mich, und so wurde mein wiederholtes Angebot, den armen Peter spazieren zu fahren, gerne angenommen. Für diese gute Tat erntete ich viel Lob. Manchmal suchten wir den abschüssigen und einsamen Teil der Stadtpromenade auf. Mit »Und jetzt ein kleines Spiel« löste ich, wenn wir allein waren, die Bremsen seines Wägelchens. Langsam rollte es an, beschleunigte rasch, gewann an Fahrt und schoss auf den Stadtgraben zu. Knapp vor dem Abgrund brachte ich das Gefährt zum Stehen. Trotz seiner Behinderung spürte Peter die Gefahr, er wurde unruhig, wimmerte und gab Schreckenslaute von sich. Es war zum Lachen!
Die meisten Eltern zogen aus dem schrecklichen Vorfall Konsequenzen. Sie vernichteten die gefährlichen porösen Autoschläuche, in denen sie die Ursache des Unglücks wähnten. Bald sah man im Strandbad viele stolze Besitzer neuer, bunter Schwimmreifen. Das hatten sie nur mir zu verdanken!
Immer wenn sich das Schuljahr dem Ende näherte, wurden alle Mädchen und Buben der Volksschule – in unserer Stadt lebten nur Katholiken – in gebührender Weise auf die Beichte eingestimmt. Sollten wir doch, gereinigt von allen lässlichen und schweren Sünden, beim feierlichen Schlussgottesdienst in Anwesenheit der gesamten Gemeinde die heilige Kommunion empfangen. Meist fiel uns bei der Vorbereitung dieses großen Ereignisses nichts ein außer »Ich habe gelogen« und »Ich habe Vater und Mutter nicht geehrt«, wobei wir unter Letzterem »Ich bin frech gewesen« verstanden. Dankbar nahmen wir daher die Instruktionen des Herrn Religionslehrers entgegen. Mit seiner Hilfe setzten wir vor dem Gang in die Pfarrkirche auch das uns vollkommen mysteriöse »Ich habe unkeusch gedacht« auf unsere Merkzettel.
Mir selbst war in diesem Jahr nur allzu bewusst, dass ich die Sache mit Hahn Peter erwähnen oder zumindest hätte andeuten müssen. Mir standen jedoch die in unserer Klasse hängenden farbigen Schautafeln biblischer Szenen aus dem Alten Testament als Warnung vor Augen. Wie grausam wurden damals Sünder bestraft! Wie war das mit Sodom und Gomorrha? Lots Weib erstarrte zur Salzsäule, nur weil sie sich verbotenerweise umdrehte und zurückschaute. Und Kain? Trug der nicht ein Mal? Besser, sich nicht der unberechenbaren Gnade der katholischen Kirche auszuliefern. Außerdem, welches der Zehn Gebote hatte ich denn überhaupt verletzt? Ich glaubte an Einen Gott, begehrte nicht des Nächsten Frau, legte nicht Zeugnis ab gegen meinen Nächsten und heiligte mit Freude den Tag des Herrn, an dem es keine Hausaufgaben zu erledigen gab!
Wenig später wurden wir geschlossen in das Gotteshaus geführt. Als die Reihe an mich kam, kniete ich im halbdunklen Beichtstuhl vor dem Priester nieder. Nach der eingelernten Formel: »Ich bekenne vor Gott, dass ich folgende Sünden begangen habe«, gestand ich alle meine kleinen Verfehlungen. Der vom Ansturm beichtender Schüler und ihren stereotyp heruntergeleierten Bekenntnissen schon etwas ermüdete alte Pfarrer hörte mir zerstreut zu, dann erteilte er mir diskret murmelnd die Absolution. Als Buße hat er mir drei Vaterunser und fünf Ave Maria auferlegt. Ich betete inbrünstig vor dem Altar, während Christus vom Kreuz auf mich herabblickte. Nichts geschah! Anscheinend hatte mir der Allmächtige verziehen. Zeit, auch mir selbst zu verzeihen. Erleichtert verließ ich mit gemessenen Schritten die heilige Stätte.
Der dramatische Abgang des gefürchteten Hahn Peter brachte mancherlei Vorteile mit sich. Ungehindert streunten wir nun über den großen Hauptplatz, um die wenigen dort geparkten Autos zu bestaunen. Vor allem ein zweifarbiger »Borgward Isabella« in Rosa und Hellblau hatte es uns angetan. Wir besichtigten ihn von allen Seiten, gingen um ihn herum, bewunderten jedes Detail. Ich weiß nicht, was mich überkam, aber ich zückte mein kleines Messerchen und kratzte damit ein paar Mal durch den glänzenden Lack. Meine Freundesrunde johlte, Mizzi kicherte vor sich hin.
Den Wunsch, vielleicht selbst einmal ein derartiges Luxusgefährt zu besitzen, äußerten wir nicht. Er kam gar nicht auf, denn er schien uns zu vermessen.
Weihnachten erlebte ich als eine geradezu magische Zeit. Am Nachmittag des Heiligabend, der sich in Erwartung des Christkinds endlos lang hinzog, nisteten Mizzi und ich uns immer bei der Familie Prosch ein, wo wir ohne Anmeldung oder Einladung stets willkommen waren. Man klopfte einfach an die Wohnungstür, fragte ob Raini oder Günther zu Hause seien, wurde eingelassen und gehörte dazu. Im einzigen größeren Zimmer zeichneten wir auf dem Ess- und Arbeitstisch mit Aquarellfarben hingebungsvoll goldene Engel auf Schablonen, widmeten uns aber auch, wenn man uns allein ließ, ganz anderen und viel spannenderen Dingen. Herr Prosch besaß aus Militärbeständen ungeklärter Herkunft noch mehrere Revolver samt Munition aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die er uns schon öfter mit Stolz vorgeführt hatte. Die holten wir in seiner Abwesenheit aus dem unversperrten Kasten hervor, gingen damit in den Keller, luden sie, wie Herr Prosch es uns gezeigt hatte, mit scharfer Munition und schossen zum Zeitvertreib an wenig einsichtigen Stellen auf Ziele in den meterdicken Hauswänden. Ich entpuppte mich als gute Schützin.
Etwa um fünf Uhr, wenn die Spannung bereits unerträglich geworden war, hörten wir ein Glöcklein läuten. »Das Christkind war da!« Ich verabschiedete mich schnell von meinen Freunden, stürzte die Stiege hinunter und hinein in das Schlafzimmer meiner Eltern, wo mich die Pracht eines Lichterbaums überwältigte. Und erst die darunter ausgebreiteten Geschenke! Und der überirdische Duft von Kerzen. Alles war wunderbar.
Den Rest des Abends probierte ich die neue praktische Kleidung und ärgerte mich ein wenig, dass ich anstelle der gewünschten roten Schuhe wieder nur braune bekommen hatte. Dann packten wir das DKT – Das kaufmännische Talent – aus und spielten, gewannen und verloren Häuser, Hotels, Straßen, ja, ganze Städte. Viel später als üblich, umweht von dem köstlichen Duft der gelöschten Kerzen des Christbaums, kroch ich unter die warme Daunendecke meines Betts und schlief zufrieden ein. Gab es noch Schöneres?
Kapitel 2
2
Mit dem Eintritt in das Realgymnasium, wohin mein bildungsgläubiger Vater mich als gute Schülerin nach eingehender Beratung mit meiner Lehrerin schickte, erfuhr mein Leben eine dramatische Wende. Und zwar zum Schlechteren. Eine harte Zeit brach für mich an. Zuerst verließ mich Mizzi, die heitere Gefährtin vieler lustiger Stunden. Ihre Eltern hatten noch den Abschluss der Volksschule abgewartet, dann übersiedelten sie samt Tochter nach Wien, wo sie sich bessere Verdienstmöglichkeiten erhofften. Der Rest der Bande war aufgrund mangelnden Bildungshungers und dementsprechend schlechter schulischer Leistungen für die Hauptschule und anschließend für eine handwerkliche Lehre vorgesehen. Raini und Günther sollten nach dem Vorbild ihres Vaters den Installateursberuf erlernen, Otti einmal die elterliche Bäckerei übernehmen, Waldi in die Fleischerei seines Onkels eintreten, und der etwas begriffsstutzige Seppi sah einer Zukunft als Maurer entgegen. Erstaunlich rasch entglitten sie meiner strengen Führung, schlossen Freundschaft mit anderen Buben – wir entfremdeten uns zusehends. Bald wurde klar: Die schönen Tage wilder Streiche gehörten für immer der Vergangenheit an, die Kindheit näherte sich rapide ihrem Ende. Der Ernst des Lebens begann. Oft sah ich meine einstigen »Vasallen« vor ihren Häusern beim fachkundigen Zerlegen und Reparieren ihrer Fahrräder, hörte, wie sie über ordinäre Witze lachten. Unter meinem Regime wäre dies nicht möglich gewesen! Traf ich sie zufällig auf der Straße, mieden sie mich. In ihren Augen war ich als Gymnasiastin »etwas Besseres«.
Damit saß ich zwischen zwei Stühlen, gleichsam im Niemandsland. Zwischen mir und meinen alten Freunden hatte sich eine tiefe Kluft aufgetan. Eine ebensolche trennte mich von meinen neuen Klassenkameradinnen, die meisten von ihnen Fahrschülerinnen aus der näheren und weiteren Umgebung unserer Bezirkshauptstadt. Im Unterschied zu mir stammten sie aus »besseren« Kreisen, hatten Ärzte, Rechtsanwälte oder gut situierte Geschäftsleute als Eltern. Die »höheren Töchter« trugen modisch schwingende, teure Kleider samt steifer Unterröcke. Unter toupierten Frisuren blickten sie voll Hochmut auf mich herab – ich war für mein Alter eher klein. Einige waren, was eine zunehmend wichtige Rolle spielen sollte und von mir nicht geleugnet wurde, hübsch, viel hübscher als ich selbst. Auf jeden Fall schlanker.
Zum ersten Mal kamen mir auch Standesunterschiede zu Bewusstsein. Geld, bis dahin eine Nebensächlichkeit, gewann plötzlich an Bedeutung. Über das Gehalt, das mein Vater pünktlich jeden Ersten vom Staat erhielt, wurde nie mit mir gesprochen. Sein Beamtenstatus mit Pensionsberechtigung entsprach dem Wunsch meiner Eltern nach finanzieller Sicherheit. Beide hatten vor und nach dem Zweiten Weltkrieg schwere, entbehrungsreiche Zeiten erlebt, nun waren sie mit ihrer Existenz vollkommen zufrieden. Der Tradition entsprechend, verfuhren sie mit der väterlichen »Besoldung«, wie es damals noch hieß, nach einer einfachen Regel – zwei Drittel gaben sie für das tägliche Leben aus, ein Drittel legten sie als Notgroschen auf ein Sparbuch.
Ich selbst verwaltete mein Taschengeld, wie mir schien, meisterlich, sparte einen Teil und verprasste den Rest beim Konditor. Es war eine große Freude, in das kleine Geschäft von Herrn Maxer einzutreten und mich beraten zu lassen. »Bitte, was krieg ich für einen Schilling?« Der Zuckerbäcker liebte Kinder. Geduldig und wohlwollend machte er Vorschläge. »Zehn Stollwerck oder eine kleine Tafel Bensdorp-Schokolade, fünf Deka Seidenzuckerl – oder möchtest du lieber ein Eis?« Mir fehlte nichts, bis mir die neue Umgebung die Ärmlichkeit unseres Lebens vor Augen führte. Ich schämte mich.
Mit den reichen Mädchen aus meiner Klasse konnte ich nicht konkurrieren. Sie zu beeindrucken, ja, sie zu dominieren war ein Ding der Unmöglichkeit.
Einsam, unglücklich und ausgeschlossen, tröstete ich mich an langen, eintönigen Nachmittagen mit Essen und noch mehr Essen. Meine plumpe Erscheinung trug nichts zur Verbesserung meiner Situation bei. In »Leibesübungen« wurde ich zum allgemeinen Gespött, da es mir einfach unmöglich war, das Reck zu erklimmen. Bei Wettläufen keuchte ich stets als Letzte ins Ziel. Zu Partys, von denen sich die anderen Mädchen in einem Winkel des Klassenzimmers geheimnisvoll wispernd erzählten, lud man mich nicht ein.
Mein freches Selbstbewusstsein schwand dahin, ich wurde verklemmt und schüchtern. Schweißgebadet schreckte ich des Nachts aus fürchterlichen Albträumen hoch, in denen ich zitternd vor Angst bei Mathematik-Schularbeiten saß und keine einzige Aufgabe lösen konnte. Vom Lateinlehrer zur Tafel gerufen, wusste ich keine Vokabeln. Manchmal stand ich auch an einem offenen Fenster, kletterte auf das Gesims, breitete die Arme wie Flügel weit aus und flog mit raschen Schlägen davon. Kühle Luft umfächelte meinen durchgestreckten Körper, mein Nachthemd bauschte sich im Abendwind. Ich zog Kreise, schwebte hoch am Himmel und blickte in das weite, mit bizarren, in ein fahles Licht getauchten grünlichen Felsen überzogene Land. Mühelos schraubte ich mich hoch und höher, in einem atemberaubenden Spiralflug drehte ich mich lustvoll um die eigene Achse. Schwungvoll zog ich meine Kreise, bis ich voll Entsetzen merkte, dass meine Arme erlahmten, ich mich nicht mehr in der Luft halten konnte. Alle verzweifelten Anstrengungen, mit zusammengebissenen Zähnen und in höchster Konzentration, erwiesen sich als vergeblich. Unter mir tauchte ein riesiger See auf, der näher und näher kam. Beim Eintauchen in das eisige Wasser merkte ich, dass ich nicht schwimmen konnte. Verzweifelt ruderte ich mit den Armen. Den schwarzen Schwimmreifen vor mir konnte ich nicht fassen, obwohl er zum Greifen nah war. Namenloser Schrecken erfüllte mich, es wurde dunkel. Langsam sank ich auf den Grund hinab, tief, immer tiefer. Die Angstvisionen blieben oft bis zum Mittag des folgenden Tages präsent.