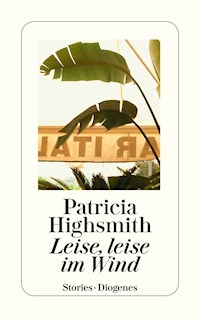
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwölf psychologische Erzählungen aus den 70er Jahren über den Traum von Liebe und Glück und wie weit moderne Menschen – junge Eltern, Liebespaare, einsame Großstadtmenschen – zu gehen bereit sind, um ihn zu realisieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Patricia Highsmith
Leise, leise im Wind
Stories
Aus dem Amerikanischen von Werner Richter
Mit einem Nachwort von Paul Ingendaay
Herausgegeben von Paul Ingendaay und Anna von Planta
Diogenes
Leise, leise im Wind
Zur Erinnerung an meine
amerikanische Freundin
Natica Waterbury
24. April 1921–13. März 1978
Der Mann, der seine Bücher im Kopf schrieb
Everett Taylor Cheever schrieb Bücher im Kopf, nie auf Papier. Als er mit zweiundsechzig starb, hatte er vierzehn Romane verfaßt und einhundertsiebenundzwanzig Figuren geschaffen, die ihm alle, zumindest ihm, genau im Gedächtnis geblieben waren.
Gekommen war das so: Mit dreiundzwanzig hatte Cheever einen Roman mit dem Titel Die ewige Herausforderung geschrieben, der von vier Londoner Verlagen abgelehnt wurde. Cheever, damals stellvertretender Redakteur bei einer Zeitung in Brighton, zeigte sein Manuskript drei oder vier befreundeten Journalisten und Kritikern, die sich unisono fast ebenso abfällig dazu äußerten wie die Londoner Verleger: »Figuren konturlos … geschraubte Dialoge … Thema bleibt verschwommen … du willst meine ehrliche Meinung, und darum sage ich dir offen: Ich glaube nicht, daß das eine Chance hat, veröffentlicht zu werden, selbst wenn du noch einmal drübergehst … Vergiß es doch einfach und schreib was Neues.« Cheever hatte zwei Jahre lang seine gesamte Freizeit auf diesen Roman verwendet und darüber seine Freundin Louise Welldon, die er heiraten wollte, so sehr vernachlässigt, daß er sie beinahe verlor. Sie heirateten dann aber doch, wenige Wochen nach der Flut von negativen Reaktionen auf sein Buch. Allerdings vermißte er nun das Element des Triumphs, mit dem er seine Braut zu erobern und in den Hafen der Ehe zu führen geplant hatte.
Cheever besaß ein kleines Einkommen aus Wertpapieren und Louise ein etwas größeres. Cheever brauchte nicht zu arbeiten. Er hatte sich vorgenommen, die Stelle bei der Zeitung nach Erscheinen seines ersten Romans zu kündigen, um weitere Bücher zu schreiben wie auch Rezensionen, vielleicht auch eine eigene Literaturkolumne, zunächst für die Zeitung in Brighton, von wo er zur Times und zum Guardian aufsteigen könnte. Er versuchte sich als Literaturkritiker beim Brightoner Beacon zu bewerben, aber sie wollten ihm keine ständige Kolumne geben. Außerdem wollte Louise in London leben.
Sie kauften also ein Stadthaus am Cheyne Walk und richteten es mit den Möbeln und Teppichen ein, die sie von ihren Familien geschenkt bekommen hatten. Inzwischen dachte sich Cheever einen neuen Roman aus, der aber absolut perfekt geraten sollte, ehe er ein Wort davon zu Papier brachte. Er hielt damit so sehr hinter dem Berg, daß er Louise weder Titel noch Thema verriet und auch die Figuren nicht mit ihr besprach, obwohl er diese deutlich vor sich sah – ihre Herkunft, Beweggründe, Vorlieben und ihr Aussehen bis hin zur Farbe ihrer Augen. Sein nächstes Buch würde ein genau umrissenes Thema haben, Figuren mit messerscharfen Konturen und knappe, aussagekräftige Dialoge.
Stundenlang saß er in seinem Arbeitszimmer in dem Haus am Cheyne Walk, gleich nach dem Frühstück ging er hinauf und blieb bis zum Mittagessen, danach noch einmal bis zum Tee oder zum Abendessen, wie jeder andere Schriftsteller, nur daß er an seinem Schreibtisch kaum je etwas aufschrieb, außer gelegentlichen Notizen wie »1877 + 53« oder »1939 – 83«, um Alter oder Geburtsjahr einzelner Figuren zu bestimmen. Während er nachdachte, summte er gern leise vor sich hin. Um sich sein Buch, das er Der Spielverderber nannte (den Titel kannte niemand sonst auf der Welt), auszudenken und im Kopf zu schreiben, brauchte er vierzehn Monate. Inzwischen war Everett junior geboren worden. Cheever hatte seinen Roman so deutlich vor sich, daß die ganze erste Seite in seiner Vorstellung eingeprägt war, als sähe er sie gedruckt. Er wußte, daß es zwölf Kapitel geben würde, und kannte auch genau deren Inhalt. Ganze Dialogpassagen lernte er auswendig, um sie nach Belieben aus dem Gedächtnis abzurufen. Cheever war der Meinung, den Roman in weniger als einem Monat tippen zu können. Er besaß eine nagelneue Schreibmaschine, die ihm Louise zu seinem letzten Geburtstag geschenkt hatte.
»Jetzt bin ich fertig – endlich«, sagte Cheever eines Morgens mit ungewohnter Fröhlichkeit.
»Ach, wie herrlich, Schatz!« sagte Louise. Taktvollerweise fragte sie ihn nie danach, wie er mit der Arbeit vorankam, da sie spürte, daß ihm das nicht gefallen würde.
Während Cheever in der Times blätterte und sich seine erste Pfeife stopfte, bevor er wieder zur Arbeit nach oben ging, schnitt Louise draußen im Garten drei gelbe Rosen ab, stellte sie in eine Vase und brachte sie in sein Zimmer. Dann zog sie sich sachte zurück.
Cheevers Arbeitszimmer, das zum Garten hinausging, war nett und gemütlich, mit einem großzügigen Schreibtisch, gutem Licht, griffbereiten Wörterbüchern und Nachschlagewerken, einem grünen Ledersofa, auf dem er ein kurzes Nickerchen halten konnte, wenn er wollte, und einem Blick auf den Garten. Cheever bemerkte die Rosen auf dem kleineren Rolltischchen neben dem Schreibtisch und lächelte dankbar. Seite eins, Kapitel eins, dachte Cheever. Das Buch wollte er Louise widmen. Für meine Frau Louise. Schlicht und klar. Es war ein grauer Vormittag im Dezember, als Leonard …
Er hielt inne und zündete sich eine neue Pfeife an. Er hatte ein Blatt Papier in die Schreibmaschine eingespannt, aber dies war die Titelseite, und bisher hatte er noch nichts getippt. Plötzlich, um Viertel nach zehn, wurde er sich des Gefühls von Langeweile bewußt – einer bedrückenden, ja lähmenden Langeweile. Er kannte das Buch doch, hatte es vollständig im Kopf, wozu sollte er es da noch schreiben?
Der Gedanke, nun wochenlang auf die Tasten einzuhämmern, um auf schätzungsweise zweihundertzweiundneunzig Seiten Wörter zu Papier zu bringen, die er bereits auswendig wußte, ließ ihn verzagen. Er warf sich auf das grüne Sofa und schlief bis elf Uhr. Er erwachte erfrischt und mit einer neuen Perspektive: das Buch war schließlich schon fertig, und nicht nur das, es war auch überarbeitet und endredigiert. Warum nicht etwas Neues beginnen?
Schon seit fast vier Monaten trug Cheever die Idee für ein Buch über ein Waisenkind auf der Suche nach seinen Eltern mit sich herum. Er begann, sich um diese Idee herum einen Roman auszudenken. Den ganzen Tag saß er am Schreibtisch, summte vor sich hin, starrte auf die Papierblätter, die fast alle leer waren, und klopfte mit dem Radiergummiende eines gelben Bleistifts einen Takt. Er war mitten im Schöpfungsprozeß.
Als er sich den Roman über das Waisenkind zu Ende ausgedacht hatte, war sein Sohn fünf Jahre alt.
»Schreiben kann ich meine Bücher später immer noch«, sagte Cheever zu Louise. »Die Hauptsache besteht ja in der Gedankenarbeit.«
Louise war enttäuscht, aber sie zeigte es nicht. »Dein Vater ist Schriftsteller«, sagte sie zu Everett junior. »Romancier. Romanciers müssen nicht zur Arbeit gehen wie andere Menschen. Sie können zu Hause arbeiten.«
Klein Everett ging in den Kindergarten, und die Kinder hatten ihn gefragt, was sein Vater von Beruf sei. Als Everett zwölf war, begriff er die Situation und empfand sie als höchst lächerlich, besonders als ihm seine Mutter mitteilte, sein Vater habe sechs Bücher geschrieben. Unsichtbare Bücher. Daraufhin änderte Louise ihre Haltung gegenüber Cheever: ihre nachsichtige Toleranz wich Respekt und Bewunderung. Sie tat es ganz bewußt und vor allem, um Everett mit gutem Beispiel voranzugehen. Sie vertrat die höchst konventionelle Meinung, wenn ein Sohn die Achtung vor seinem Vater verliere, könne nicht nur sein eigener Charakter, sondern die gesamte Familie zu Schaden kommen.
Als Everett fünfzehn war, fand er das Tun des Vaters nicht mehr zum Lachen, sondern peinlich, und er schämte sich, wenn ihn seine Freunde besuchten.
»Romane? … Sind sie gut? … Zeigst du mir mal einen?« fragte etwa Ronnie Phelps, ebenfalls fünfzehn und Everetts bewundertes Vorbild. Daß Everett Ronnie über die Weihnachtsferien zu sich nach Hause gelotst hatte, war ein phänomenaler Coup, und nun sorgte sich Everett, daß auch alles glattging.
»Er macht nicht viel Aufhebens davon«, antwortete Everett. »Bewahrt sie alle in seinem Zimmer auf, weißt du?«
»Sieben Bücher. Komisch, daß ich noch nie von ihm gehört habe. Bei welchem Verlag denn?«
Everett stand deshalb unter einer derartigen Anspannung, daß sich auch Ronnie nicht mehr recht wohl fühlte, schon nach drei Tagen abreiste und zu seiner Familie nach Kent fuhr. Everett verweigerte daraufhin das Essen, fast völlig jedenfalls, und schloß sich in seinem Zimmer ein, wo ihn die Mutter zweimal weinend antraf.
Cheever bemerkte von all dem nichts. Louise schirmte ihn gegen jede häusliche Unruhe und Störung ab. Doch da die Ferien noch fast einen Monat dauern würden und Everett in so schlechter Verfassung war, machte sie Cheever behutsam den Vorschlag, eine Kreuzfahrt zu unternehmen, und warum nicht zu den Kanarischen Inseln.
Zunächst bestürzte Cheever der Gedanke. Er mochte keine Ferien, brauchte keine und sagte es immer wieder. Doch nach vierundzwanzig Stunden gelangte er zu der Ansicht, eine Kreuzfahrt sei keine schlechte Idee. »Arbeiten kann ich ja trotzdem«, sagte er.
Auf dem Schiff saß Cheever stundenlang in seinem Liegestuhl, manchmal mit Bleistift, manchmal ohne, und arbeitete an seinem achten Roman. Er notierte sich während der zwölf Tage allerdings keine Zeile. Wenn er seufzte und die Augen schloß, wußte Louise, die neben ihm saß, daß er eine Pause einlegte. Gegen Ende des Tages schien er oft ein Buch in den Händen zu halten und darin zu blättern, und daran sah sie, daß er in früheren Werken schwelgte, die er ja auswendig kannte.
»Haha«, lachte Cheever still vor sich hin, wenn ihn eine Passage amüsierte. Dann wieder wandte er sich einer anderen Stelle zu, schien eine Weile zu lesen und murmelte: »Hm-mm. Nicht übel, nicht übel.«
Everett, dessen Stuhl auf der anderen Seite seiner Mutter stand, rappelte sich dann meist grummelnd auf und stakste davon, wenn sein Vater diese zufriedenen Grunzlaute ausstieß. Die Kreuzfahrt war kein durchschlagender Erfolg für Everett, da es keine anderen Passagiere seines Alters gab bis auf ein Mädchen, und Everett hatte seinen Eltern und dem freundlichen Steward bereits deutlich gesagt, er verspüre keinerlei Verlangen, die junge Dame kennenzulernen.
Als Everett nach Oxford kam, besserte sich die Lage insofern, als er gegenüber seinem Vater wieder eine amüsierte Haltung einnahm. Der habe ihn nämlich richtig populär gemacht an der Universität, erklärte Everett. »Nicht jeder hat einen lebenden Limerick zum Vater«, sagte er einmal zu seiner Mutter. »Soll ich mal einen aufsagen, den ich …«
»Bitte, Everett!« unterbrach ihn seine Mutter eisig, so daß Everett schlagartig das Grinsen verging.
Mit Ende Fünfzig zeigten sich bei Cheever die ersten Anzeichen der Herzkrankheit, an der er sterben sollte. Er schrieb weiterhin im Geiste, so regelmäßig wie gewohnt, aber sein Arzt riet ihm dazu, das Pensum etwas einzuschränken und zweimal täglich ein Nickerchen einzuschieben. Es war ein neuer Arzt, ein Herzspezialist, und Louise hatte ihm erklärt, worin Cheevers Arbeit bestand.
»Er denkt sich einen Roman aus«, sagte Louise. »Das ist natürlich genauso anstrengend, wie einen zu schreiben.«
»Natürlich«, pflichtete der Doktor bei.
Als für Cheever das Ende kam, war Everett achtunddreißig und selbst Vater zweier Teenager. Everett war Zoologe geworden. Er und seine Mutter standen mit fünf oder sechs anderen Verwandten in dem Krankenzimmer versammelt, in dem Cheever unter einem Sauerstoffzelt lag. Cheever murmelte vor sich hin, und Louise beugte sich zu ihm herab, um ihn zu verstehen.
»… Asche zu Asche«, sagte Cheever. »Bitte zurücktreten! … Das Fotografieren ist nicht erlaubt … ›Gleich neben Tennyson?‹« Dieser letzte Satz kam leise und mit hoher Stimme. »… ein Denkmal der menschlichen Vorstellungskraft …«
Auch Everett hörte zu. Sein Vater schien irgendeine vorbereitete Rede zu halten. Eine Laudatio, dachte Everett.
»… einer kleinen Ecke, wo ein dankbares Volk seiner gedenken … Achtung! … Vorsicht!«
Plötzlich neigte sich Everett mit lautem Gelächter vor. »Er bestattet sich doch tatsächlich in der Westminster Abbey!«
»Everett!« tadelte ihn seine Mutter. »Ruhe!«
»Hahaha!« Everetts innere Spannung entlud sich in einem Lachanfall, und er wankte aus dem Zimmer, um sich im Korridor auf eine Bank zu werfen, wo er in einem hoffnungslosen Versuch, sich zu beherrschen, die Lippen aufeinanderpreßte. Noch komischer war das Ganze ja, weil mit Ausnahme seiner Mutter keiner der Anwesenden die Situation kapierte. Sie wußten zwar, daß sein Vater Bücher im Kopf schrieb, aber die Sache mit der Poets’ Corner in der Westminster Abbey ging völlig an ihnen vorbei.
Nach einer Weile beruhigte sich Everett wieder und kehrte in das Zimmer zurück. Sein Vater summte vor sich hin, wie er es oft beim Arbeiten getan hatte. Arbeitete er immer noch? Everett sah seine Mutter sich dicht zu ihrem Mann vorbeugen, um ihn zu verstehen. Täuschte er sich, oder waren das tatsächlich einige Takte von Elgars Pomp and Circumstance, die da aus dem Sauerstoffzelt drangen?
Es war vorbei. Als sie aus dem Krankenzimmer hinausdefilierten, hatte Everett das Gefühl, sie könnten ebensogut gleich zum Leichenschmaus ins Haus seiner Eltern weitermarschieren, aber nein – das Begräbnis hatte ja noch gar nicht stattgefunden. Sein Vater besaß wirklich eine außergewöhnliche Suggestionskraft.
Ungefähr acht Jahre später war Louise nach einem Grippeinfekt an Lungenentzündung erkrankt und lag im Sterben. Everett war bei ihr, in ihrem Schlafzimmer am Cheyne Walk. Sie sprach von seinem Vater und daß ihm nie der verdiente Ruhm und Respekt zuteil geworden sei.
»… erst ganz zum Schluß«, sagte Louise. »Immerhin liegt er im Poets’ Corner begraben, Everett – das dürfen wir nicht vergessen.«
»Ja«, sagte Everett und war irgendwie beeindruckt, beinahe glaubte er es.
»Für die Ehefrauen ist dort ja leider nie Platz – sonst könnte ich bei ihm sein«, flüsterte sie.
Und Everett nahm davon Abstand, ihr zu sagen, daß sie sehr wohl bei ihm sein würde, im Familiengrab am Stadtrand von Brighton. Aber stimmte das wirklich? Konnten sie nicht doch ein Plätzchen im Poets’ Corner für sie finden? Brighton, sagte Everett zu sich, während die Wirklichkeit zu bröckeln begann. Brighton, fing sich Everett wieder ein. »Da bin ich nicht so sicher«, sagte er. »Wir wollen sehen, ob es sich einrichten läßt, Mummy.«
Sie schloß die Augen, und ein sanftes Lächeln lag auf ihren Lippen, dasselbe zufriedene Lächeln wie bei seinem Vater, als er unter dem Sauerstoffzelt lag.
Das Netz
Das Telefon – eigentlich waren es zwei schicke Telefone, eines beige und eines malvenfarben – klingelte in Frans kleiner Wohnung ungefähr alle halbe Stunde. Es klingelte so oft, weil Fran derzeit und tatsächlich schon seit etwa einem Jahr die inoffizielle Mutter Oberin des Netzes war.
Das Netz bestand aus einer Gruppe von Freunden in New York, die sich gegenseitig moralische Unterstützung gaben, indem sie einander anriefen und sich beständig ihrer Freundschaft und Solidarität versicherten inmitten des Ozeans von Feinden, von Nichtfreunden, von potentiellen Dieben, Vergewaltigern und Schwindlern. Natürlich traf man sich auch häufig und tauschte untereinander die Hausschlüssel aus, um sich gegenseitig Gefälligkeiten zu erweisen, wie mit dem Hund auszugehen, die Katze zu füttern oder Blumen zu gießen. Das wichtigste dabei war, daß man einander vertrauen konnte. Einmal hatte das Netz eine Lebensversicherung für eins der Mitglieder durchgeboxt, das alle Gesellschaften abgelehnt hatten. Einer aus der Gruppe konnte Hi-Fi-Anlagen und Fernseher reparieren. Ein anderer war Arzt.
Fran war nichts Besonderes, nur Buchhaltungssekretärin, aber sie war geduldig, und man durfte sich nach Herzenslust bei ihr ausweinen, und da sie momentan nicht arbeitete, hatte sie noch mehr Zeit als sonst. Zehn Monate zuvor war sie an der Gallenblase operiert worden, kurz darauf hatte man eine Verwachsung im Magen-Darm-Trakt diagnostiziert, was eine weitere Operation nach sich zog, und danach hatte sich ihr altes Rückenleiden (ein Bandscheibenvorfall) zurückgemeldet und das Tragen eines Stützkorsetts nötig gemacht, das Fran aber nicht ständig anlegte. Fran war achtundfünfzig, also ohnedies nicht mehr die Beweglichste. Sie war unverheiratet und arbeitete seit siebzehn Jahren bei der Stromgesellschaft Consolidated Edison in der Kundenabteilung (im Grunde war das der Rechnungsdienst). Con Ed bezahlten großzügig Krankengeld, hatten sie auch in eine gute Krankenzusatzversicherung aufgenommen und hielten ihr ihre Stelle offen. Fran hätte auch eigentlich schon seit gut zwei Monaten wieder arbeiten gehen können, doch sie hatte sich an die Ungebundenheit gewöhnt und genoß es auch, jederzeit ans Telefon gehen zu können, wenn es klingelte.
»Hallo? Ah, Freddie! Wie geht’s dir denn?« Fran saß beim Telefonieren immer etwas geduckt da und raunte in den Apparat, als fürchtete sie, daß jemand mithörte, und hielt dabei den leichten Hörer so sanft in beiden Händen, als wäre er ein kleines Pelztier oder gar die Hand des Freundes, mit dem sie gerade sprach. »Ja, geht gut. Ist bei dir ganz bestimmt alles in Ordnung?«
»Och, ja. Und bei dir auch?« Irgendwie hatten alle Mitglieder des Netzes Frans Angewohnheit übernommen, sich gleich doppelt zu vergewissern, daß es dem anderen auch wirklich gutging. Freddie war Werbezeichner und hatte ein eigenes Atelier und eine Wohnung auf der West Thirtyfourth Street.
»Ja, alles bestens. Sag mal, hast du letzte Nacht auch die Polizeisirenen gehört? Nein, nicht die Feuerwehr, das war die Polizei«, sagte Fran.
»Wann war das?«
»So gegen zwei Uhr morgens. Meine Güte, die waren dem vielleicht hinterher! Das müssen sechs Wagen gewesen sein, die da die Seventh entlanggerast sind, und du hast gar nichts gehört?« Nein, Freddie hatte nichts gehört, und das Thema wurde fallengelassen. Fran raunte weiter: »Oje, sieht nach Regen aus, und ich muß noch kurz einkaufen …«
Als sie auflegten, murmelte Fran weiter vor sich hin. »Also, wo war ich gerade? Der Pullover. Einmal ausgespült, muß noch einmal ins Wasser … der Müll in den Müllschlucker …« Sie spülte den Pullover im Badezimmerwaschbecken, drückte ihn aus und hatte ihn gerade auf einem aufblasbaren Kleiderbügel an die Duschstange gehängt, als das Telefon erneut klingelte. Fran hob im Ankleideraum ab, zwischen Bad und Eßbereich, erkannte die Stimme von Marj (fünfundvierzig, gutbezahlte Einkäuferin für das Warenhaus Macy’s) und raunte: »Oh, Marj, hallo. Hör mal, bleibst du kurz dran, dann kann ich rüber zu dem Apparat im Wohnzimmer, ja?«
Fran legte den Hörer auf die Kommode und ging in ihr Wohnzimmer hinüber. Sie hinkte und ging leicht gebückt, das hatte sie sich seit ihrer Bandscheibengeschichte angewöhnt – sogar wenn sie allein war, wie ihr soeben klar wurde, doch um so besser, denn zweimal im Monat schickten ihr Con Ed ihren Versicherungsbeauftragten vorbei, um ein wenig zu schnüffeln und nachzufragen, wann sie wieder zur Arbeit käme. »Hallo Marj, wie geht’s?«
Der nächste Anruf kam von einem Versandhaus für Sportartikel auf der East Forty-second Street, dessen Name Fran vage vertraut klang und das ihr eine Stelle in der Buchhaltung anbot, Arbeitsbeginn am nächsten Montag zu zweihundertzehn netto pro Woche plus Kranken- und Pensionsversicherung.
Fran erschrak kurz. Woher hatten die bloß ihren Namen? Sie war doch gar nicht auf Stellensuche. »Vielen Dank. Sehr liebenswürdig«, sagte Fran höflich, »aber sobald ich gesund bin, fange ich wieder bei Con Ed an.«
»Ich glaube, bei uns bekommen Sie ein besseres Gehalt. Wollen Sie sich das Angebot überlegen?« Die Frau mit der angenehmen Stimme blieb hartnäckig. »Unsere diversen Quoten haben wir erfüllt, und jetzt hätten wir gern jemanden wie Sie.«
Die Schmeichelei verfing nicht lange. Hielt man bei Con Ed ihre Stelle etwa nicht länger für sie offen? Hieß das etwa, bei Con Ed hatte man sie abgeschrieben und an diese Firma weitervermittelt, um ihr das Krankengeld nicht mehr zahlen zu müssen, das fast so hoch war wie ihr Gehalt? »Danke, ich bleibe doch lieber bei Con Ed«, sagte Fran. »Die waren immer so nett zu mir.«
»Tja, wie Sie meinen …«
Nach dem Auflegen beschlich Fran ein unangenehmes Gefühl. Bei Con Ed anzurufen und direkt nachzufragen, was dahintersteckte, das wagte sie nicht. Angestrengt überlegte sie, wie der letzte Besuch dieses Versicherungsmenschen verlaufen war. Dummerweise hatte sie damals vergessen, daß er sich für halb fünf bei ihr angesagt hatte, und so mußte der Arme fast eine Stunde lang unten in der Lobby auf sie warten, und dann war sie quietschfidel mit Connie hereinspaziert, einer Freundin, die abends als Kellnerin arbeitete und tagsüber oft frei hatte. Sie waren im Kino gewesen. Als sie plötzlich den Versicherungskontrolleur in der leeren Halle stehen sah (es gab keine Möbel im Eingangsbereich ihres Hauses, alles gestohlen, obwohl es an die Wände angekettet gewesen war), hatte Fran sofort einen Buckel gemacht und war auf ihn zugehinkt. Es gehe zwar eindeutig bergauf mit ihr, sagte sie, aber einem täglichen Achtstundenjob fühle sie sich noch nicht gewachsen. Sie mußte in einem Büchlein unterschreiben, als Bestätigung für seinen Besuch bei ihr. Ein Schwarzer war es gewesen, aber durchaus ein freundlicher Bursche. Er hätte viel fieser sein können, mit gemeinen Bemerkungen und so, aber der hier war höflich gewesen.
Fran erinnerte sich auch, daß sie am selben Tag Harvey Cohen begegnet war, der bei ihr im Haus wohnte, und Harvey hatte ihr berichtet, der Kontrolleur habe ihn unten im Eingang angesprochen und sich nach Miss Covaks Gesundheitszustand erkundigt. Harvey hatte gemeint, er habe »dick aufgetragen« und dem Mann erzählt, daß Miss Covak immer noch hinkte und es zwar dann und wann in den Lebensmittelladen an der Ecke schaffte, weil ihr als alleinstehender Frau nichts anderes übrigblieb, aber daß sie noch nicht den Eindruck machte, als könnte sie schon wieder regelmäßig arbeiten. Der gute alte Harvey, dachte Fran. Juden wußten eben, wie man so etwas deichselte, die waren Schlauberger. Fran hatte Harvey herzlich gedankt und es auch so gemeint.
Aber jetzt? Was um Himmels willen war geschehen? Sie würde Jane Brixton deswegen anrufen. Jane hatte einen klugen Kopf, sie war mehr als zehn Jahre älter als Fran (Lehrerin im Ruhestand), und nach einem Gespräch mit Jane fühlte Fran sich immer beruhigt. Jane bewohnte eine wunderschöne Etagenwohnung voll antiker Möbel in der West Eleventh Street.
»Ha-ha«, lachte Jane leise, nachdem sie Frans Geschichte gehört hatte. Fran hatte sie in allen Einzelheiten erzählt und sogar die Bemerkung der Frau erwähnt, das Sportartikelgeschäft habe seine Quoten erfüllt, und Jane sagte: »Das bedeutet, sie haben bereits so viele Schwarze eingestellt, wie es das Gesetz verlangt, und nun würden sie ganz gern mal wieder eine Weiße dazwischenmischen, solange es noch geht.« Jane hatte einen leichten Südstaatenakzent, obwohl sie aus Pennsylvania stammte.
So ungefähr hatte Fran die Bemerkung der Frau auch verstanden.
»Wenn du noch nicht arbeiten gehen möchtest, dann tu’s nicht«, sagte Jane. »Das Leben ist …«
»Eben, wir haben doch neulich mal alle darüber gesprochen, schließlich hole ich mir ja nur das Geld zurück, das ich über die Jahre eingezahlt habe. Wie die Krankenhausbeiträge. Sag mal, Jane, könntest du mir nicht eine Bescheinigung oder so was ausstellen, daß du mir ein paar Rückenmassagen gegeben hast?«
»Na ja – ich bin doch gar nicht ausgebildet. Deshalb wird dir eine solche Bescheinigung wohl wenig nützen.«
»Da hast du auch wieder recht.« Fran hatte sich gedacht, ein weiteres Papier könnte ihre Arbeitsunfähigkeit zusätzlich unterstreichen. »Du kommst doch hoffentlich auch zu Marjs Party am Samstag?«
»Natürlich. Übrigens ist gerade mein Neffe in der Stadt und wohnt bei mir. Eigentlich ist es der Sohn meines Neffen, aber ich sage immer ›mein Neffe‹. Den bringe ich auch mit.«
»Deinen Neffen! Wie alt ist er? Und wie heißt er?«
»Greg Kaspars. Er ist zweiundzwanzig. Aus Allentown. Er hat vor, als Möbeldesigner in New York zu arbeiten. Jedenfalls möchte er es gern versuchen.«
»Wie aufregend! Ist er nett?«
Jane lachte wie eine ältliche Tante. »Ich denke schon. Sieh ihn dir an.«
Sie legten auf, und Fran seufzte bei der Vorstellung, noch einmal zweiundzwanzig zu sein und in der Weltstadt New York ihr Glück zu versuchen. Sie sah ein wenig fern, ihr Apparat war alt, mit einem kleineren Bildschirm als heutzutage üblich, aber Fran hatte keine Lust, Geld für einen neuen auszugeben. Der einzige Sender mit scharfem Bild brachte ein grauenhaftes Programm, irgendeine Quizshow. Alles abgekartet, natürlich. Wie konnten erwachsene Menschen so aus dem Häuschen geraten, nur weil es fünfzig Mäuse oder einen Kühlschrank zu gewinnnen gab? Fran schaltete ab und ging zu Bett, nachdem sie Kissen und Tagesdecke vom Sofa genommen und das schwere Metallgestell auseinandergeklappt hatte, auf dem das fertige Bett lag, bereit zum Hineinschlüpfen. Die Kissen steckten in einer halbrunden Vertiefung mit gepolstertem Oberteil, die einen dekorativen Vorsprung, ja einen Extrasitz am Ende des Sofas ergab, wenn es als solches verwendet wurde. Sie blätterte im Liegen das neuste National Geographic durch, betrachtete allerdings nur die Bilder, da immer noch ab und zu das Telefon klingelte und jedesmal, wenn sie einen Artikel zu lesen versuchte, ihren Gedankengang unterbrach. Frans älterer Bruder, der Tierarzt in San Francisco war, schickte ihr zu jedem Geburtstag ein Abonnement für das National Geographic.
Fran schaltete das Licht aus und war eben eingeschlafen, als das Telefon nochmals klingelte. Sie angelte in der Dunkelheit nach dem Hörer, nicht im geringsten darüber verärgert, geweckt zu werden.
Es war Verie (eigentlich Vera), auch eine aus dem Netz, die verkündete, sie sei mit den Nerven völlig fertig und regelrecht deprimiert. »Ich habe heute mein Portemonnaie verloren.«
»Was? Wie denn?«
»Ich stand gerade an der Supermarktkasse und habe es da kurz hingelegt, nachdem ich bezahlt und das Wechselgeld hineingetan hatte – weil ich alles in Papiertüten packen mußte, weißt du? –, und als ich wieder hinsah, war es weg. Ich glaube, der Mann hinter mir … Ach, ich weiß nicht.«
Fran stellte rasch hintereinander ein paar Fragen. Nein, Verie hatte niemanden davonlaufen sehen, auf dem Fußboden lag es auch nicht, und hinter die Theke konnte es unmöglich gerutscht sein (es sei denn, die Kassiererin hatte es genommen), aber es war schon möglich, daß es ihr der Mann direkt hinter ihr geklaut hatte, ein Weißer, den Verie vom Typ her partout nicht beschreiben konnte, weil er weder besonders ehrlich noch unehrlich aussah, jedenfalls hatte sie mindestens siebzig Dollar dabei verloren. Fran floß über vor Mitgefühl.
»Es tut wenigstens gut, darüber zu reden, stimmt’s?« raunte Fran im Dunkeln in den Hörer. »Das ist das wichtigste im Leben, mit jemandem reden zu können … ja … ja … Das ist doch alles, was zählt, reden können. Ist doch wahr?«
»Und daß man Freunde hat«, schniefte Verie.
Fran war davon noch gerührter als ohnehin schon, und sie raunte: »Verie, ich weiß, es ist schon spät, aber möchtest du herüberkommen? Du könntest auch hier übernachten, das Bett ist breit genug. Wenn es dir hilft …«
»Danke, lieber nicht. Muß morgen arbeiten, Geld verdienen.«
»Du kommst doch hoffentlich zu Marjs Party.«
»Ja, sicher. Am Samstag.«
»Du, ich habe vorhin mit Jane telefoniert. Sie bringt ihren Neffen mit. Also, den Sohn ihres Neffen.« Fran erzählte Verie alles, was sie über ihn wußte.
Es war herrlich, am Samstag abend bei Marj all die vertrauten Gesichter wiederzusehen. Freddie, Richard, Verie, Helen, Mackie (dick, fröhlich, Geschäftsführer eines Schallplattenladens auf der Madison Avenue, konnte jedes elektronische Gerät reparieren) und seine Frau Elaine, leicht schielend und genauso herzlich wie er. Es war einfach großartig, einander zu umarmen und Begrüßungen auszutauschen. Aber zu etwas Besonderem wurde die Party für Fran, weil jemand Neues, Junges da war: Janes Neffe. Fran bahnte sich etwas steif und leicht hinkend ihren Weg an die kleine Bar, wo Jane sich mit einem jungen Mann in Cordhosen und Rollkragenpulli unterhielt. Er hatte dunkles, welliges Haar und ein leise amüsiertes Lächeln – ein Schutzmechanismus, wie Fran vermutete.
»Hallo, Fran. Das ist Greg«, sagte Jane. »Fran Covak, Greg – auch eine aus unserer Bande.«
»Wie geht’s so, Fran?« Greg streckte eine Hand aus.
»Danke, und selbst, Greg? Wie nett, einen Verwandten von Jane zu treffen! Und, wie gefällt Ihnen New York?« fragte Fran.
»Ich war schon öfter hier.«
»Gewiß! Aber jetzt wollen Sie hier arbeiten, habe ich gehört.« Blitzschnell ging Fran im Geiste ihre Bekannten durch, die Greg vielleicht behilflich sein konnten. Richard – er war Designer, machte aber eher Bühnenbilder. Marj – eventuell kannte sie jemanden in der Möbelabteilung bei Macy’s, der Greg mit jemanden zusammenbringen konnte, der wiederum …
»Fran! Wie geht’s dir, Mädchen?« Jeremys Arm umschlang Frans Hüfte, und er gab ihr einen freundschaftlichen Klaps auf das Hinterteil ihres Hosenanzugs. Jeremy war um die Fünfundfünfzig und hatte einen weißen Haarschopf.
»Jeremy! Du siehst großartig aus!« sagte Fran. »Wahnsinn, dieses lila Hemd!«
»Was macht der Rücken?« erkundigte sich Jeremy.
»Besser, danke. Das dauert eben. Hast du schon Greg kennengelernt? Janes Neffe.«
Das hatte Jeremy nicht, also stellte Fran sie einander vor. »An welche Art von Tätigkeit haben Sie denn gedacht, Greg?« fragte sie dann.
»Über die Arbeit möchte ich heute eigentlich nicht reden«, erwiderte Greg mit ausweichendem Lächeln.
»Ich überlege mir nur gerade«, sagte Fran, zu Jane gewandt, klar und deutlich, wenn auch genauso sanft wie sonst am Telefon, »unter all unseren Bekannten ist doch bestimmt einer, der Greg weiterhelfen kann. Um ihm das richtige Entree zu verschaffen, weißt du? Jane erzählte, Sie seien Möbeldesigner, Greg?«
»Also gut. Wenn Sie meine Lebensgeschichte unbedingt hören wollen: Ich habe über ein Jahr lang für einen Kunsttischler gearbeitet. Alles Handarbeit, da habe ich natürlich das eine oder andere selbst entworfen. Schränke und Kommoden nach genauen Vorgaben.«
Fran warf einen Blick auf seine Hände und sagte: »Sie sind sicher kräftig. Ist er nicht ein netter Junge, Jeremy?«
Jeremy nickte und leerte seinen Scotch on the rocks.
Jane sagte: »Macht euch keine Sorgen wegen Greg. Ich rede im Laufe des Abends mal mit Marj.«
Fran strahlte. »Genau daran habe ich auch gedacht. Irgend jemand bei Macy’s …«
»Zu Macy’s will ich nicht«, unterbrach sie Greg freundlich, aber bestimmt. »Ich dachte eher an etwas Selbständiges.«
Fran schenkte ihm ein mütterliches Lächeln. »Wir wollen doch nicht, daß Sie bei Macy’s arbeiten. Überlassen Sie das nur uns.«
Gegen elf Uhr gab es ein bißchen Musik und Tanz, aber nicht so laut, daß es die Nachbarn stören konnte. Marj wohnte im vierzehnten (eigentlich im dreizehnten) Stock eines ziemlich pompösen Apartmenthauses in den East Forties mit einem Doorman rund um die Uhr. In Frans Haus saß nur von sechzehn Uhr bis Mitternacht jemand unten im Foyer, was bedeutete, daß es nicht ganz ungefährlich war, nach Mitternacht heimzukommen, denn dann mußte sie die Eingangstür selbst aufschließen, um in das Gebäude hineinzugelangen. Der Gedanke erinnerte sie an Susie, die sie seit deren schrecklichem Erlebnis im East Village vor etwa drei Wochen noch gar nicht gesprochen hatte.
Fran fand die großgewachsene, gutaussehende Frau im Nebenzimmer, wo sie auf dem Doppelbett saß und sich mit Richard und Verie unterhielt. Als erstes mußte Fran natürlich ein paar Worte an Verie richten, wegen ihres Portemonnaies.
»Ich denke lieber nicht mehr daran«, sagte Verie. »So was gehört eben zum Leben. Und das Leben ist erbarmungslos. Wir sind nun mal von Gesindel umgeben.«
»Hört, hört!« sagte Richard. »Aber nicht alle sind Gesindel. Es gibt schließlich immer noch uns.«
»Genau!« stimmte ihm Fran zu, die sich gelöst fühlte, weil sie nur selten Alkohol trank, und der von dem, was sie intus hatte, langsam warm ums Herz wurde. »Wie ich schon neulich abend zu Verie am Telefon sagte: Das wichtigste im Leben ist, mit jemandem reden zu können, den man mag – stimmt doch, nicht?«
»Stimmt«, sagte Richard.
»Wißt ihr, als mich Verie wegen ihres Portemonnaies angerufen hat …« Als Fran merkte, daß ihr niemand zuhörte, wandte sie sich direkt an Susie. »Susie, meine Liebe, hast du dich denn schon erholt? Ich hab dich doch noch gar nicht gesehen seit dieser schrecklichen Sache im East Village, aber gehört hab ich natürlich davon.« Von allen aus dem Netz telefonierte Susie wohl am wenigsten, und Fran hatte noch nicht einmal einen Bericht aus erster Hand erhalten, sondern sich alles von Verie und Jeremy erzählen lassen müssen.
»Ach, es geht schon wieder«, sagte Susie. »Erst dachten sie, meine Nase wäre gebrochen, war sie aber nicht. Nur diese kahle Stelle am Kopf, und die sieht man kaum noch, weil sie schon wieder zuwächst.« Susie neigte den adrett frisierten Kopf zu Fran hin, damit diese die abrasierte Stelle sehen konnte, die tatsächlich durch das wallende rotbraune Haar beinahe verborgen wurde.
Fran überlief es kalt. »Mit wie vielen Stichen haben sie das denn nähen müssen?«
»Acht, glaube ich«, antwortete Susie lächelnd.
Susie hatte damals eine Freundin im Wagen nach Hause gefahren. In dem Augenblick, als Susies Freundin die Hausschlüssel herausholte, war ein großer Schwarzer aufgetaucht, um die beiden zu überfallen. Sie hatten zwischen der Haus- und der Windfangtür in der Falle gesessen und sich von dem Schwarzen ihr ganzes Bargeld, die Armbanduhren und die Ringe abnehmen lassen müssen (»Zum Glück sind die Ringe heruntergegangen«, so Susies erster Kommentar laut Jeremy, »denn die schneiden einem sonst glatt die Finger ab, und ein Messer hatte der Kerl dabei«), und dann befahl er ihnen auch noch, sich auf den Boden zu legen, wohl weil er sie beide vergewaltigen wollte, aber inzwischen hatte sich Susie, die recht groß war, heftig zu wehren begonnen und machte keinerlei Anstalten, sich hinzulegen. Die Freundin schrie wie am Spieß, bis jemand aus dem Haus sie hörte und lauthals verkündete, er werde die Polizei rufen, woraufhin der Schwarze (»vielleicht, weil er merkte, daß das Spiel aus war«, hatte Jeremy gemeint) irgendeinen schweren Gegenstand hervorgeholt und Susie damit eins übergezogen hatte. Blut war gespritzt, ringsum auf Decke und Wände, und später hatte Susie genäht werden müssen. Fran war ganz aus dem Häuschen darüber, daß eine von ihnen sich richtig gegen die Barbaren gewehrt hatte, und das ohne Waffe.
»Na, ich möchte das Ganze am liebsten vergessen«, sagte Susie der erstaunten Fran. »Aber seither mache ich einen Judokurs. Wir müssen schließlich hier leben.«
»Aber niemand muß im East Village leben«, entgegnete Fran. »Du weißt doch, da gibt’s nichts, was es nicht gibt: Schwarze, Puertoricaner, Latinos, die ganze Blase. Ist jedenfalls kein Ort, an den man noch jemanden spätabends nach Hause bringt!«
Inzwischen waren der große Backschinken, das Roastbeef und der Kartoffelsalat auf dem Buffettisch schon gebührend verkostet worden. Fran saß, noch ein Stück benebelter, in einem der zwei Schlafzimmer (welcher Luxus!) mit einigen aus dem Netz auf dem Bett. Sie sprachen über New York und was sie, abgesehen vom Geld, eigentlich hier hielt. Richard kam aus Omaha, Jeremy aus Boston. Fran war in der Seventh Avenue Ecke Fifty-third Street geboren. »Bevor all die vielen Hochhäuser hochgezogen wurden«, sagte Fran. Sie betrachtete den Ort ihrer Geburt (wo jetzt ein Bürogebäude stand) als das Herz der Stadt, obwohl es natürlich auch andere Herzen der Stadt gab, wenn man so wollte: West One hundred and eleventh Street, Gramercy Park, sogar Yorkville. New York war aufregend und gefährlich, in stetem Wandel – zum Guten wie zum Bösen. Selbst in Europa mußten sie inzwischen zugeben, daß New York nun das Weltzentrum der Kunst war. Ein Jammer nur, daß die hohen Sozialhilfesätze den Abschaum der gesamten USA anzogen, natürlich keineswegs immer nur Schwarze oder Puertoricaner, sondern eben Abzocker aller Art. Amerika hatte löbliche Zielsetzungen, man denke nur an die großartige Verfassung, die noch allem standgehalten hatte, sogar Nixon. Kein Zweifel, daß die USAim Grunde richtig lagen …
Als Fran am nächsten Morgen aufwachte, erinnerte sie sich nicht allzu genau an ihr Nachhausekommen, nur daß die gute alte Susie sie in ihrem Cadillac mitgenommen hatte (Susie war Model und verdiente ziemlich gut), und vermutlich war auch Verie mit im Wagen gewesen. In einer Tasche ihrer Jacke, die sie in der Nacht nicht mehr aufgehängt, sondern nur über eine Sessellehne gelegt hatte, fand sie einen Zettel: »Liebe Fran, wegen Greg rufe ich heute gleich Carl bei Tricolor an, also keine Sorge. Habe es auch Jane gesagt. Gruß, Richard.«
Wie nett von Richard! »Wußte ich doch, daß ihm etwas einfallen würde«, sagte Fran leise vor sich hin und lächelte.
Das Telefon klingelte. Noch im Pyjama ging Fran an den Apparat und sah, daß die Uhr auf dem Beistelltisch zwanzig nach neun zeigte. »Hm, hallo?« murmelte sie.
»Hallo, meine Liebe, hier ist Jane. Greg könnte dir gegen elf den Schmorbraten vorbeibringen, wenn’s dir recht ist.«
»Ja, sicher, ich bin zu Hause. Vielen Dank, Jane.« Fran erinnerte sich verschwommen an den versprochenen Schmorbraten. Immer noch brachte man ihr Essen vorbei, wie in ihren schlimmsten Tagen, als sie sogar zum Einkaufengehen zu hinfällig gewesen war. »Greg fand ich übrigens schrecklich nett. Er hat wirklich Format.«
»Er trifft sich heute vormittag mit einem Bekannten von Richard.«
»Tricolor. Ich weiß. Ich drücke ihm die Daumen.«
»Marj möchte ihm auch einen Termin verschaffen. Hat soviel ich weiß aber nichts mit dem Kaufhaus selbst zu tun«, sagte Jane.
Sie unterhielten sich noch eine Weile über die Party, und als sie auflegten, machte sich Fran einen Instantkaffee und Orangensaft aus tiefgekühltem Konzentrat. Sie klappte das Bett zusammen, zog sich an und murmelte dabei vor sich hin. »Habe ich meine Arthritis-Tabletten jetzt schon genommen? Nein, muß ich noch … Und ein bißchen aufräumen. Ach was, sieht doch noch ganz ordentlich aus …« Und natürlich klingelte mehrmals das Telefon, was alles ein wenig verzögerte, und als sie das nächste Mal auf die Uhr sah, war es schon fünf nach elf, und jemand betätigte unten an der Eingangstür den Summer.
Sicher Greg, dachte Fran und drückte den Öffner. Sie hatte keine Gegensprechanlage. Als es an ihrer Wohnungstür klingelte, sah sie durch den Spion. Greg, tatsächlich.
»Greg?«
»Ja, ich bin’s«, sagte Greg.
Fran öffnete die Tür.
Greg trug einen schweren roten Topf mit Deckel herein. »Jane wollte es gleich im Topf lassen, damit Sie den ganzen Bratensaft dazu bekommen.«
»Wunderbar, Greg. Vielen Dank!« Fran nahm ihm den Topf ab. »Ihre Tante Jane macht den allerbesten Schmorbraten, weil sie ihn nämlich die ganze Nacht über mariniert, wissen Sie?« Fran stellte das Essen in ihrer schmalen kleinen Küche ab. »Setzen Sie sich doch, Greg. Möchten Sie einen Kaffee?«
»Nein, danke. Ich habe gleich einen Termin.« Greg wanderte mit verschränkten Händen im Wohnzimmer auf und ab und sah sich alles an.
»Toi, toi, toi für heute, Greg. Ich habe übrigens angeboten, Sie hier unterzubringen. Jane weiß davon. Es klingt albern, weil sie ja eine viel größere Wohnung hat. Aber falls Sie je abends in dieser Gegend sind – eine Freundin von mir wohnt gleich um die Ecke, bei der kann ich jederzeit unterschlüpfen. Und Sie könnten hier übernachten. Gar kein Problem.«
»Wenn Sie mich nur nicht alle wie ein kleines Kind behandeln würden«, sagte Greg. »Ich nehme mir ein möbliertes Zimmer. Ich bin lieber unabhängig.«
»Verstehe. Ist ganz normal.« Aber im Grunde verstand Fran ihn nicht. Sich einfach so von seinen Freunden abzusetzen? »Ich betrachte Sie nicht als kleines Kind, wirklich nicht.«
»Mit Verlaub: ihr erstickt einen ja geradezu mit eurer Fürsorglichkeit. Aber dieses Geklüngel – ich meine, bei der Party gestern.«
Frans höfliches Selbstschutzlächeln wurde breiter. Beinahe hätte sie gesagt: Na schön, dann versuchen Sie’s eben auf eigene Faust, hielt sich aber im Zaum, wofür sie sich höchst wohlerzogen und überlegen vorkam. »Ich weiß schon. Sie sind ein großer Junge, Greg.«
»Auch kein Junge. Ich bin erwachsen.« Greg nickte ebenso zur Bestätigung wie zum Abschied und ging zur Tür. »Wiedersehen, Fran, und hoffentlich schmeckt Ihnen der Schmorbraten!«
»Toi, toi, toi, Greg«, rief sie ihm hinterher und hörte ihn die Stufen hinunterrennen, immerhin sechs Stockwerke.
Es vergingen zwei Tage. Dann rief Fran bei Jane an, um nachzufragen, wie Greg zurechtkam.
Jane kicherte. »Nicht so gut. Er ist ausgezogen …«
»Ja, das hatte er offenbar vor.« Fran hatte Jane natürlich bereits angerufen, um zu sagen, wie gut der Schmorbraten gewesen war, aber Gregs Bemerkung über seine Umzugspläne hatte sie nicht weitergegeben.
»Nun ja, und noch am selben Abend ist er überfallen worden, vorgestern war das.«
»Überfallen?« Fran war entsetzt. »Ist er verletzt?«
»Nein, zum Glück nicht. Es war …«
»Wo ist es denn passiert?«
»Etwa Twenty-third Street Ecke Third Avenue, gegen ein Uhr früh, sagte Greg. Er kam gerade aus einer dieser Bars, wo man um diese Zeit schon Frühstück bekommt. Ich weiß, daß er nicht beschwipst war, weil er kaum je auch nur Bier trinkt. Aber auf dem Weg zu seiner Unterkunft …«
»Wo hat er denn sein Zimmer?«
»Irgendwo auf der East Nineteenth. Jedenfalls haben ihn zwei Kerle angefallen und ihm die Jacke über den Kopf gezogen, weißt du, ihn so zu Boden gestoßen, wie sie es oft mit älteren Leuten auf der Straße machen, und ihm alles Geld abgenommen, das er dabeihatte. Zum Glück waren das nur zwölf Dollar, sagt er.« Wieder lachte Jane leise.
Fran jedoch schmerzte es tief im Innern, als wäre dieser demütigende, widerliche Vorfall einem Mitglied der eigenen Familie widerfahren. »Hoffentlich ist es ihm wenigstens eine Lehre! So spät zieht man nicht allein durch die Straßen, auch nicht als kräftiger junger Mann.«
»Er sagt, er hat sich gewehrt. Dafür haben sie ihm dann noch ein paar geprellte Rippen verpaßt. Aber zu allem Übel weigert er sich auch noch, den Mann zu treffen, mit dem ihn Marj bekannt machen wollte – ein anderer Einkäufer, der jede Menge Kunsttischler kennt. Greg hätte dadurch ein paar gutbezahlte … na, zumindest Firnis- und Lackierarbeiten bekommen können.«
Fran fand das unglaublich. »So kann nie etwas aus ihm werden«, prophezeite sie im Brustton der Überzeugung.
Fran rief gleich bei Jeremy an, um ihm von Greg zu berichten. Jeremy war ebenso überrascht wie Fran, daß Greg Marjs Kontakte nicht nutzen wollte.
»Der Junge hat noch viel zu lernen«, sagte Jeremy. »Zum Glück hatte er nur ein paar Mäuse in der Tasche. Passiert ihm hoffentlich nicht wieder, wenn er ab jetzt aufpaßt.«
Fran beteuerte, genau das habe sie auch zu Jane gesagt. Seit Janes Anruf litt Frans Herz, durch keine Mutterfreuden gestillt, Folterqualen.
»Ich kenne ein paar Maler in SoHo«, sagte Jeremy. »Die will ich mal fragen, ob sie irgendwelche Kunsttischlerarbeiten brauchen. Weißt du, wo ich Greg erreichen kann, falls sich etwas ergibt?«
»Nein, ich nicht, aber Jane bestimmt. Er wohnt irgendwo auf der East Nineteenth.«
Kurz nachdem sie aufgelegt hatten, verließ Fran die Wohnung. Sie hatte nur ein paar Blocks weit zu gehen, um den Krankengeldscheck bei der Bank einzureichen und ein paar Sachen im Supermarkt an der Ecke einzukaufen, und als sie zurückkam, klingelte das Telefon schon wieder, und sie erreichte es, kurz bevor es für sie logischerweise hätte aufhören sollen zu klingeln. Es war Richard.
»Die Leute von Tricolor hatten nichts für Greg«, sagte Richard. »Tut mir leid, aber mir wird schon noch was anderes einfallen. Wie geht’s ihm? Hast du was gehört?«
Fran brachte ihn auf den neuesten Stand. Sie setzte sich aufs Sofa, zündete sich eine Zigarette an und sprach lange und ausführlich in den beigefarbenen Hörer, erläuterte ihre Philosophie, wonach man nichts unversucht lassen sollte, aber auch keine Luftschlösser bauen durfte. »Nicht daß ich damit sagen will, daß Greg Flausen im Kopf hat. Er ist bloß noch recht unreif …« Eigentlich meinte sie, daß er unbedingt unter die kollektiven Fittiche des Netzes kommen sollte, daß sie ihn nicht entfleuchen beziehungsweise in sein sicheres Verderben rennen lassen durften. »Vielleicht solltest du einmal mit ihm reden, Richard, so von Mann zu Mann, was meinst du? Vielleicht würde er auf dich hören, mehr als auf Jane jedenfalls.«





























