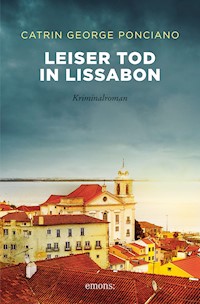
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sehnsuchtsorte
- Sprache: Deutsch
Ein psychologisch fein gesponnener Kriminalroman mit politischem Zündstoff. Der Hitzesommer hat Portugals Hauptstadt fest im Griff, als ein Toter in der Kirche São Miguel im malerischen Altstadtviertel Alfama gefunden wird. Inspetora-Chefe Dora Monteiro erkennt auf den ersten Blick, dass der Mord nicht zufällig genau an dieser Stelle geschah. Ein vergilbtes Foto führt sie auf die Fährte eines mächtigen, aber seit Jahrzehnten tot geglaubten Mannes. Ist er der Mörder? Je weiter Dora ermittelt, desto tiefer gerät sie in ein gefährliches Netz aus alten Seilschaften, die weit in die Geschichte Lissabons zurückreichen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Catrin George Ponciano, geboren 1967 in Bielefeld, lebt seit zwanzig Jahren in Portugal. Die Autorin veröffentlicht Reportagen und Reiseführer über ihre Wahlheimat, unter anderem »111 Orte an der Algarve, die man gesehen haben muss« aus der Emons-Verlagsreihe »111 Orte«. »Leiser Tod in Lissabon« ist ihr Kriminalroman-Debüt. Die Landesvertreterin der Deutsch-Portugiesischen Gesellschaft Berlin führt an der Algarve einen Salon über lusophone Literatur und fungiert als Kultur-Vermittlerin. www.catringeorge.com
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2020 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Montage aus Cristina Macia/Pixabay.com, shutterstock.com/Captblack76
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Gestaltung Innenteil: César Satz & Grafik GmbH, Köln
Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-594-7
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Wer das Kap bezwingen will,muss erst den Schmerz besiegen.Gott gab dem Meer Abgründe und Gefahrenund ließ es doch den Himmel spiegeln.
25. November 1975, Dragoner Hauptquartier, Lissabon
Es geschah an einem klirrend kalten Sonntagmorgen Ende November. Auf den Wiesen im Park am Torre de Belém knirschte Raureif in der steifen Nordwestbrise. Die einlaufende Flut presste von Sturm und Brandung aufgewühltes Meerwasser schlammbraun in den Tejo. Unruhig klatschte der Fluss gegen den Kai in Alcântara. Die Bars am Cais do Sodré hatten längst die Schotten dicht gemacht. Die leichten Mädchen lagen in ihren eigenen Betten. Lissabon suchte erschöpft Schlaf und blieb dennoch aufmerksam wach.
Ein Streifen Morgendämmerung zuckte silbrig am östlichen Horizont. Er begrüßte den Tag, den kein Portugiese über fünfzig jemals vergessen würde. Es war der Tag, an dem Portugiesen auf Portugiesen geschossen hatten.
Kommandant Romeu drehte den schweren Eisenschlüssel im Schloss der Tür zum Waffenarsenal um. Dann folge er seinen Kameraden hinter die Mauerbrüstung auf die Dachterrasse über dem Exerzierhof und forderte absolutes Redeverbot. In der Stille des Morgens hörte er die zwei herannahenden Militärjeeps bereits, noch bevor sie am Kutschenmuseum rechts in die Calçada da Ajuda abbogen und über das spiegelglatte Kopfsteinpflaster die steile Gasse zur Kaserne hinaufschlingerten.
Romeu gab das verabredete Zeichen. Seine Gefährten duckten sich, das geladene Gewehr bei Fuß. Kein einziger Laut verriet sie.
Im Hauptquartier der Dragoner Militärpolizei blieb alles ruhig. Nebelperlen, in denen sich das Morgenlicht spiegelte, verwandelten kunstvoll gewebte Spinnennetze in schimmernde Ketten in den Arkadenbogen im Patio der Kaserne. Sperlinge mit aufgeplustertem Gefieder hockten dicht gedrängt im Jacaranda-Baum. Die Turmglocke der Kapelle schlug. Es war sieben Uhr morgens. Nichts deutete auf die drohende Gefahr hin.
Zwei Militärpolizeistreifen kehrten von ihrer Patrouillenfahrt zurück. Beim Aussteigen klopften die Soldaten ihrem Sergeanten für die erfolgreiche Razzia in Alcântara kumpelhaft auf die Schulter, verstauten ihre Schlagstöcke und Revolver in ihrem Gürtel und schlugen den Weg zur Messe ein. Ihre Hände steckten in Wollhandschuhen, um den Hals hatten sie einen Schal gebunden. Ihre Wangen und Ohren glänzten rot von der bitterkalten Nachtluft. Atemwölkchen begleiteten ihren Wortwechsel. Sie freuten sich auf heiß gebrühten Kaffee mit süßer Milch, Salzsardinen und frisch gebackenes Brot. Und liefen den Soldaten des Kommandanten Romeu direkt in die Falle.
Als der erste Schuss in der morgendlichen Stille barst, ließ der Koch in der Kasernenküche fluchend eine Pfanne mit Spiegeleiern fallen. Die Sperlinge flatterten erschreckt auf und tschilpten ohrenbetäubend durcheinander.
Der Sergeant schubste seine Kameraden hinter die Säulen im Bogengang. »Kopf einziehen«, befahl er und zog seinen Revolver.
Der Militärputsch am 25. November 1975 begann.
1
Donnerstag, 8. August
Lissabon ächzte. Agonie lag in der Luft. Die seit Wochen andauernde Hitzewelle machte die Stadt apathisch. Tag und Nacht blies warmer Wind durch die Straßen, pustete schwüle Luft durch das Gassenlabyrinth im Burgviertel, durch jede Ritze an Fenster und Türen in die Häuser. Die aufgeheizte Luft brannte in den Augen, kratzte auf der Haut und klebte auf den Lippen. Einen solch erbarmungslos heißen Sommer hatte es seit 1975 nicht mehr gegeben, sagten die Alten und trotzten den Temperaturen jenseits der vierzig Grad Celsius mit stoischer Gelassenheit.
Lissabon bewegte sich bloß mehr im Schneckentempo. Der sonst chaotische Verkehr schleppte sich dahin. Der Alltag passierte untertourig. Nur der Fremdenverkehr hielt die Stadt und ihre Menschen auf Trab. Melancholische Fado-Melodien dudelten aus den Radios in den Café-Bars. Leiser als sonst, als sei es sogar den Musikapparaten zu heiß. Die kunterbunten Basthocker vor den Lokalen blieben unbesetzt, die Gäste flüchteten ins schattige Innere.
Über den auf die Straße vor den Kneipen aufgebauten Grillstationen säuselten Qualmfähnchen. Die Grillroste waren leer. Die andauernde Hitze verdarb jeglichen Appetit auf frische Sardinen oder würzig scharfes Hähnchen vom Holzkohlegrill. Kellner standen vor leeren Terrassen, lustlos mit dem Rücken gegen eine Hauswand gelehnt. Die Hemden bis zum Bauchnabel aufgeknöpft, fächerten sie sich mit einer Zeitung Luft zu. Über Fußball oder Politik mochte heute keiner von ihnen streiten.
In den Küchen standen Köchinnen und Abwäscherinnen barfuß auf den Fliesen, umringt von einer Kompanie Ventilatoren, und rührten lustlos in dampfenden Töpfen. Überall in dem Häuserlabyrinth in der Altstadt Alfama, das sich vom Burgfried Castelo de São Jorge bis zum Ufer des Tejo den Hügel hinab ausbreitete und dessen Ursprung bis in die einst maurische Besetzung der Stadt zurückreichte, brummten die Klimaanlagen an den Fassaden der schmalen, Wand an Wand gebauten alten Häuser auf Hochtouren, bis in dem altersschwachen Kabelsalat entlang der Häuserfassaden ein Kabel durchschmorte und der Kurzschluss mit einem zischenden Geräusch sämtliche Aggregate zum Stillstand brachte.
Die Haustüren in der Nachbarschaft standen offen. Wer nicht arbeitete, hockte spärlich bekleidet, lethargisch tatenlos auf der Türschwelle. Einzig den Kindern des Viertels war die Hitze egal. Sie planschten und tobten in dem von der Gemeinde gestifteten mobil aufgestellten Schwimmbecken im Schatten eines Feigenbaumes hinter der Igreja de São Miguel und glucksten vor Vergnügen.
Vom letzten Straßenfest übrig gebliebene Krepppapierblumen zitterten an gespannten Leinen in den Weinranken über dem vermoderten Brunnen auf dem Platz. Auf der Treppe neben dem Brunnen saß ein buckliger Junge und sang.
Die schlanken Glockentürme der Kirche überragten die rostrot schraffierte Dachlandschaft in der unteren Alfama. Die Igreja de São Miguel stand in dem Teil der Alfama, wo früher die Frauen der Fischer fangfrischen Fisch am offenen Stubenfenster anpriesen. Zwar verkaufte nun keine Hausfrau mehr Fisch am Fenster, dafür gab es Ginja. Ein Gläschen Kirschlikör im Vorbeigehen, ein Euro. Und es gab den Fado. Lissabons Schicksalsgesang zum Mitweinen. Die Igreja de São Miguel markierte das Herz des Fado-Viertels für Touristen. Ihre barocken Kuppeln reckten sich in den postkartenblauen Himmel.
Durch das zweiflügelige Portal fand bloß wenig Sonnenlicht Einlass in das Innere des Gebetshauses. Im Lichtkegel der Sonnenstrahlen tanzten Staubpartikel durch den Mittelgang bis zum Altar. Die sonst von Lissabon-Besuchern stets gut besuchte Kirche war an diesem unerträglich heißen Augustnachmittag bis auf einen einzigen Besucher leer.
Die Kirchenwächterin Dona Rosário saß an einem niedrigen Tischchen auf einem Hocker und sortierte Rosenkranzketten. Ihre von Gichtattacken gekrümmten Finger entwirrten flink die feinen Schnüre der religiösen Heilsbringer, die sich in den Händen hereinströmender Touristen täglich wieder neu verhedderten.
Ihr Blick wanderte aufmerksam umher. Den letzten Besucher beobachtete sie bereits seit geraumer Zeit und schielte auf ihre Armbanduhr. Siebzehn Uhr zehn. Die Besuchszeit war vorbei. Sie wollte die Kirche schließen.
Zehn Minuten wollte sie dem Besucher noch geben. Schließlich kannte sie ihn. Er kam jeden Tag zum Beten, begrüßte sie und verabschiedete sich bei ihr und erkundigte sich nach ihrem Befinden. Ein Senhor mit guten Manieren. Sonst verließ er die Kirche stets pünktlich um kurz vor fünf. Dass er heute später kam und länger blieb, musste einen Grund haben. Deswegen wollte Dona Rosário ihn nicht stören.
Sie seufzte, stand auf und tippelte den Mittelgang entlang durch das Kirchenschiff am Altar vorbei zur Kapelle der heiligen Mutter Maria.
»Senhor«, wisperte sie und berührte den Mann sanft an seiner Schulter. »Wir schließen.«
Der Mann sackte zur Seite und blieb regungslos auf der Bank liegen. Seine Augen standen weit offen. In einer Wunde in seiner Stirn steckte ein langer metallener Gegenstand.
Dona Rosário schrie laut »Jesus« und noch lauter um Hilfe.
***
Aus den geöffneten Dachgaubenfenstern einer Patriziervilla hallten Gitarrenakkorde, rhythmisches Händeklatschen und das Echo klappernder Absätze auf Parkett. Sechs Frauen übten in dem Tanzsaal auf einem ehemaligen Dachboden Flamenco, bis die Holzdielen unter ihren Schuhsohlen vibrierten.
»Meninas! Bitte!«, forderte ihre spanische Tanzlehrerin Carmenzita trotz flirrender Hitze und klatschte laut den Takt der Musik. »In jedem Schritt will ich euren Puls spüren. Stuten seid ihr. Stolze Stuten. Zeigt euren Stolz. Kinn hoch, Brust raus, Schultern aufrecht, Rücken durchdrücken. Dora, deine linke Ferse tritt nicht fest genug auf, du kannst das besser. Un, dos, trés, quatro.«
Inspetora-Chefe Dora Monteiro aus dem Morddezernat der Kriminalpolizei Lissabon, Secção de Homicídios da Polícia Judiciária de Lisboa, trat absichtlich heftig mit der linken Ferse auf. Spitze, Ferse, Spitze, rechts, links, immer im Wechsel. Ihre Arme, ihre Hände, ihre Finger, alles an ihr zuckte im Takt des Gitarrenspiels, das aus den Lautsprechern dröhnte, begleitet von dem für Flamenco eigentümlichen Jammergesang und dem ureigenen rhythmischen Klatschen der Hände. Dora kombinierte Schrittfolgen mit Drehungen, je nach Dramaturgie der Melodie mal langsamer, mal schneller.
»Ferse, Spitze, Ferse, Ferse«, zählte Carmenzita, verbesserte Haltungsfehler ihrer Schülerinnen, rückte hier eine Taille in Position, hob dort ein Kinn an, drückte behutsam Schultern zurück. »Einatmen, ausatmen, Becken spannen und wieder von vorn.«
Gleich beim ersten Akkord ließ sich Dora vom eindringlichen Takt des Flamencos einfangen und durch den Saal treiben.
»Dora«, mahnte Carmenzita in ihrem unnachahmlichen spanisch-portugiesischen Singsang-Tonfall. »Dein Telefon vibriert.«
Dora ließ die Arme sinken. Chatice! Ausgerechnet jetzt. Seit Jahren wollte sie tanzen lernen, ihr im Dauerlauf denkendes Gehirn abbremsen, hach, einfach einmal alldem Druck ihrer Arbeit entfliehen und hatte endlich eine Tanzschule in der Nähe ihrer Wohnung gefunden, aber fast jede Tanzstunde kam ihr etwas dazwischen. Meistens eine Leiche.
»Cardoso, fassen Sie sich kurz.«
»Boa tarde, Senhora Inspetora-Chefe, wir haben einen Mord in der Alfama. Der Boss will Sie. Sensibles Terrain, sagt er.«
Sensibles Terrain? Womöglich ein Minenfeld mitten in Lissabon, von dem sie nichts ahnte?
Cardosos Antwort »Kirche« erreichte ihr Ohr.
Dora machte: »Oh.«
Sehr viel mehr fiel ihr dazu momentan nicht ein. Schließlich standen in der Altstadt ihrer Heimatstadt über einhundert Gotteshäuser, da war ein Mord in einer Kirche statistisch betrachtet nichts Außergewöhnliches. Jedenfalls heutzutage nicht. Im Mittelalter war im Namen der Kirchen ja ständig hingerichtet worden. Die Inquisition tagte mitten in Lissabon noch im späten 18. Jahrhundert ein allerletztes Mal, und die Richter des Heiligen Stuhls ließen die Verurteilten auf dem Rossio-Platz vor der Igreja de São Domingos auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Ein Olivenbaum, ein schlichter Marmorobelisk mit dem christlichen Fischsymbol und ein Davidstern mahnten in Gedenken an die Opfer, die auf grausame Weise während der Epoche der Katholischen Könige in Portugal zu Tode gekommen waren.
Heutzutage gehörten Kirchen zu den Rückzugsorten derjenigen Lissabonner, die einen Augenblick des Innehaltens fern vom Lärm im Hexenkessel ihrer Stadt suchten, und zu den Wirkungsstätten für Taschendiebe, die den Lissabon-Urlaubern während ihrer Besichtigungstouren in den Kirchen und Klöstern mit großer Geschicklichkeit die Geldbörsen mopsten.
»Igreja de São Miguel? Natürlich weiß ich, wo die steht. Im Fado-Viertel für Touristen. Carlos soll mich abholen.«
Dora drückte den Anruf nachdenklich weg. Ein Mord in einer Kirche. Das klang spannend.
Der Tatort war definitiv kein Zufall. Für die Nachbarschaft in der Alfama sorgte ein Toter am helllichten Tag jedenfalls für reichlich Kanonenfutter bei den täglich mehrfach wiederkehrenden Treffen zum Cafezinho in der Konditorei um die Ecke und bedeutete für Schaulustige und Anwohner eine morbid-schaurige Abwechslung bei dieser sengenden Hitze. Wie ein Lauffeuer würde sich die Kunde ausbreiten und schneller, als von der Kriminalpolizei gewünscht, die Nachrichtenredaktionen erreichen, unkte Dora.
Geschmeidigen Schrittes kam Carmenzita zu ihr. »Du hast großes Talent für den Tanz meiner Heimat, Dora, aber kein Herz für dich selbst«, kommentierte sie, als sich Dora mit den Worten »Ein neuer Fall« für den Anruf entschuldigte und sich zum Umziehen zurückzog.
Die Worte ihrer Tanzlehrerin trafen Dora scharf in die feine Naht zwischen ihrer Sehnsucht nach einer Welt ohne Bösewichte und ihrem professionellen Ich als Inspetora-Chefe. Seit sie ihren Vater und ihre Kindheit verloren hatte, lebte, arbeitete und atmete sie für den Wunsch, Mörder zu jagen. Ihr Ehrgeiz trieb sie nach der Tragödie rund um den bis heute ungeklärten Mordfall an ihrem Vater unerbittlich dazu an, die Beste zu sein und die jüngste Inspetora-Chefe der Lissabonner Mordkommission zu werden. Ihre Karriere war steinig, schmerzvoll und oftmals bis unter die Gürtellinie demütigend gewesen, denn sie musste sich stets gegen die männlichen Anwärterkollegen durchsetzen. Mit besseren Noten. Mit schnellerer Kombinationsgabe. Mit durchschlagenden Ergebnissen. Nun, sie hatte es geschafft. Ihr Ehrgeiz trug Früchte. In Polizeikreisen war Dora hoch angesehen.
Doch ihr Erfolg schürte auch Neid. Bei ihren Kollegen galt Dora als unnahbar schwierig, weil sie, seit sie befördert worden war, niemandem mehr nach dem Mund redete und Hierarchiestrukturen altmodisch fand. Ihre Mitarbeiter hofften auf Nähe, auf einen gelegentlichen Drink nach Feierabend und auf den Austausch von Vertraulichkeiten, was Dora schlichtweg ablehnte. Ihre Vorgesetzten hofften auf Gehorsam, verlangten ihn manchmal auch sehr nachdrücklich, den sie, falls für die Aufklärung ihres Falls nötig, verweigerte, um stattdessen eigene Wege zu gehen.
Privat gab es in Doras Leben im Gegensatz zu ihrem aufregenden Berufsleben überraschend wenig Abwechslung. Von den täglichen Telefonaten mit ihrem Großvater und gelegentlichen amourösen Ausschweifungen einmal abgesehen, zählten die Tanzstunden bei Carmenzita zu ihrem derzeit einzigen Privatvergnügen.
Dass ihr Leben zwischen zwei Mordfällen, an Tatorten, in den Räumen der Gerichtsmedizin, auf Friedhöfen und bei Zeugenvernehmungen passierte, hatte sie in den vergangenen fünfzehn Jahren voll und ganz ausgefüllt, aber seit einiger Zeit reichte ihr das nicht mehr. Andauernde Unruhe trieb sie durch schlaflose Nächte, im Morgengrauen oft hinaus auf die Straße, wenn sie außer streunenden Katzen, die um Fischabfälle neben Mülltonnen rauften, niemandem begegnete und endlich ohne Bauchziehen tief ein- und ausatmen konnte. Länger am Stück sitzen zu bleiben bereitete ihr immense Schwierigkeiten. Irgendetwas bewegte sie immer. Ein Finger zuckte oder alle. Manchmal bemerkte Dora es und zwang sich dazu, ihre Hände still zu halten, meistens merkte sie es nicht. Zappelig wie ein Rennpferd in der Startbox wartete sie auf den Startschuss, wusste aber nicht, wohin sie rennen wollte. Appetitlosigkeit machte ihr außerdem zu schaffen. Dafür verspürte sie ständig Heißhunger auf Süßes, vertilgte zum Frühstück Pralinen, mittags süße Cremedesserts und nachmittags Schokoladenkuchen.
Vermutlich war es die weibliche biologische Uhr, doch Dora weigerte sich, ihr Befinden einzig auf ihren kommenden vierzigsten Geburtstag zu reduzieren. Zum Familienleben mit Mann und Kind taugte ihre Lebensart ganz und gar nicht. Das Wort Routine existierte in ihrem Beruf nicht. Wie sollte sie da jemals ein Kind versorgen können? Jeder Tag verlief anders, einen geregelten Feierabend kannte sie nicht, und ein Baby konnte sie schließlich nicht an einen Tatort mitnehmen.
Was sich da in ihr aufstaute, hatte mit einem diffusen Verlangen zu tun, wofür sie keine Worte fand. Nicht einmal eine klare Vorstellung von dem, wonach sie sich sehnte, hatte sie. Sich wirklich mit diesem vagen Gefühl auseinanderzusetzen, scheute sie, denn sie ahnte, dass sie mit ihrem Leben doch nicht ganz so zufrieden war, wie sie es nach außen darstellte, sondern dass sie es insgeheim satthatte, immer besser, immer schneller, immer effizienter als ihre Kollegen zu sein. Trotzdem versuchte sie, diesem Etwas mit Worten eine emotionale Gestalt zu geben.
Saudade nannte ihr Großvater ihre durcheinandergeratene Gefühlswelt und fügte meist lapidar hinzu, dass sie sich daran gewöhnen sollte, denn in Portugal trugen alle Menschen dieses Gefühl in sich, eben weil saudade in diesem Land wohnte. »Jeder Portugiese hofft auf ein anderes, leichteres Leben weit fort an einem Ort, wo Ruhe, Frieden und Eintracht herrschten, und gleichzeitig war des Portugiesen archaisches Herz vom Heimweh nach seiner Familie erfüllt«, hatte ihr Großvater ihr erklärt und diesen emotionalen Aggregatzustand eine Sehnsuchtszwickmühle genannt.
Familie. Was für ein großes Wort. Es begann mit Beziehung, baute auf Vertrauen und endete mit Kinderkriegen. Dazu musste man allerdings den passenden Partner finden. Und dem war Dora bisher auch noch nicht begegnet. Zwar mochte sie Männer, und Männer mochten sie, aber keiner blieb bei ihr. Spätestens bei der nächsten Leiche nahm jeder Mann Reißaus, und eine längere Beziehung hatte Dora bislang nicht erfahren.
Anwärter hatte es einige gegeben. Nette, amüsante, liebevolle Kandidaten. Einen tatsächlich bis in ihr Leben und in ihre Wohnung zu lassen, hatte Dora jedoch abgelehnt. Allein die Vorstellung einer fremden Zahnbürste in ihrem Badezimmer bereitete ihr Unbehagen. Die einzige Person, mit der sie jemals Badezimmer, Tisch und Bett geteilt hatte, war Marta, ihre einst beste Freundin.
Dora vermisste Marta. Sie kannten sich seit dem Kindergarten, waren gemeinsam eingeschult worden und bis zum Abschluss auf dem Lyzeum immer in derselben Klasse geblieben. Marta und sie hatten gleichzeitig zum ersten Mal »die Tage« bekommen, sich gegenseitig gezeigt, wie ein Tampon funktionierte, und nach dem Sportunterricht unter der Dusche die sprießenden Schamhaare gezählt. Den ersten Kuss, das erste Fummelabenteuer hatten sie sich anvertraut und Präservative auf Zucchini ausrollen geübt, während sie von Teenagern zu Frauen heranwuchsen und Marta rund geworden war, wo Dora eckig geblieben war. Sie blieb klein, schmalhüftig und flachbrüstig. Marta wuchs groß, vollschlank, vollbusig.
Nach der Schule ging Dora auf die Polizeiakademie, und Marta begann eine Ausbildung zur Diätassistentin. Sie wohnten weiterhin zusammen, bis Dora ihre beste Freundin eines Tages mit ihrem damaligen Geliebten in flagranti im Bett erwischt hatte. Seitdem gab es keine Marta, keine andere beste Freundin mehr und keine feste Beziehung mehr zu einem Mann.
Trotzig zog Dora das Gummiband aus dem straff zum Zopf zusammengebundenen schwarzen, taillenlangen Haar und schüttelte ihre Lockenpracht auf. Sei es drum. Wozu eine Freundin? Wozu mit einem Mann zusammenziehen? Sie fand ja noch nicht einmal genügend Privatleben, um einmal pro Woche einen Tanzkurs zu besuchen oder sich um einen Kanarienvogel zu kümmern. Kein Wunder, dass einer nach dem anderen dem Hungertod in ihrer Wohnung erlegen war.
Lieblos stopfte sie ihr zusammengeknülltes Tanzkostüm in eine Sporttasche. Irgendetwas in ihr lief unrund.
Als sie sich aufrichtete und ihre Tasche schulterte, stand Carmenzita vor ihr. Sie hob die Hand und tätschelte Dora zärtlich die Wange, drehte sich um und stellte die Musik lauter.
Dora schluckte. Carmenzitas zärtliche Geste fraß sich durch ihren Hals abwärts mitten hinein in ihren Bauch und ihr Herz und berührte die andere, sensible, schöngeistige, zurückgezogene Dora in ihr. Die sich in eine rosarote Welt hinfortträumte, in der Betrachtung von Skulpturen verlor und bei Carl Orffs Kantate »Carmina Burana« Rotz und Wasser heulte. Aber diese Dora kam selten und nur in wirklich sicherer Umgebung zum Vorschein. Nämlich nur dann, wenn sie ganz allein war.
Sie setzte ihr Chefe-Gesicht auf, nahm mit einem tiefen Atemzug Anlauf für ihre neue Aufgabe und lief eilig aus dem Tanzsaal über den Flur zum Fahrstuhl. Sie drückte auf den Knopf, doch der Aufzug bewegte sich kein einziges Stockwerk. Ungeduldig trat Dora gegen die Metalltür und nahm dann kurzerhand die Treppe.
Drei Stockwerke tiefer blieb sie stehen und schnappte nach Luft. Das flache Dreieck zwischen ihren Brüsten flatterte wie ein Spatz, der aus dem Nest gefallen war. So fest sie konnte, kniff sie sich in den Bauch. Ein Schmerz vertrieb den anderen.
***
Ihr Dienstwagen, ein in die Jahre gekommener klappriger Toyota Corolla, stand mit laufendem Motor vor der Haustür. An die Motorhaube gelehnt stand jedoch nicht ihr Fahrer Carlos, sondern ein fremder junger Mann.
»Boa tarde, Senhora Inspetora-Chefe Monteiro«, begrüßte er sie und öffnete die Tür an der Beifahrerseite.
Dora ging grußlos an ihm vorbei und setzte sich hinter den Fahrersitz in den Fond.
Der junge Mann schickte einen Blick gen Himmel, schlug die Beifahrertür wieder zu und setzte sich hinter das Steuer.
»Wo ist Carlos?«
»Carlos ist in Urlaub. Ich vertrete ihn. Eigentlich bin ich Student. Mein Onkel ist verheiratet mit der Schwester von Carlos, und als die erfuhr, dass ich nach einem Job in den Semesterferien suchte, bat sie ihren Bruder, sich umzuhören. Sie wissen ja, wie das geht. Familienbande.« Er grinste.
»Und hier bin ich.«
Dora holte ihr Smartphone hervor. »Haben Sie einen Namen?«
»Luís.«
Kaum losgefahren, schaltete Luís das Blaulicht an und drängelte an der Ampel an der Alameda Edgar Cardoso am Parque Eduardo VII durch den alltäglich zum Stehen kommenden Berufsverkehr in die Rotunde Praça Marquês de Pombal über alle vier Fahrspuren rund um die vierzig Meter hohe Gedenksäule, auf dessen Spitze die imposante Bronzestatue des ersten Ministers Portugals und Herzogs von Lissabon thronte, eine Hand auf einem Löwenkopf ruhend, mit Blick über die Baixa Richtung Tejo.
Vom Blaulicht genervt, kniff Dora beide Augen zu und öffnete sie erst wieder, als sie den Kreisverkehr hinter sich gelassen hatten und die Avenida da Liberdade stadteinwärts fuhren.
»Stellen Sie das Ding aus«, bat sie mit Nachdruck. »Wir müssen niemanden retten. Das Opfer ist mausetot.«
Ihre Blicke trafen sich im Rückspiegel. Als sie den verwunderten Ausdruck in Luís’ Augen wahrnahm, tat es ihr beinahe leid, so barsch gewesen zu sein. Er konnte schließlich nichts für ihren versauten Feierabend. Er wollte einfach dienstbeflissen sein, vielleicht ein bisschen Eindruck bei ihr schinden. Dabei war das gar nicht notwendig. Entweder er fuhr gut und zügig und redete nur, wenn sie ihn fragte, oder er blieb morgen gleich wieder zu Hause und fragte bei Carlos’ Schwester wegen eines anderen Jobs nach.
Unwirsch wischte Dora mit dem Zeigefinger durch das virtuelle Newsfeed auf dem Display ihres Smartphones. In den sozialen Medien hatte sich die Neuigkeit vom Mord in der Igreja de São Miguel längst verbreitet. Bizarr formulierte Kommentare, gespickt mit haarsträubenden Spekulationen, verbrämt mit Unmengen an Fotos vom Tatort, geisterten bereits zu Hunderten durch das Netz.
»Brutaler Mord am helllichten Tag im Herzen von Lissabon.«
»Ermordeter betet mit Eisennagel im Kopf weiter.«
»Teufelswerk im Herzen der Millionenmetropole Lissabon.«
»Kirchenkiller schlägt wieder zu.«
»Leiser Tod in Lissabon.«
Solche und andere reißerische Meldungen hatten sogenannte Augenzeugen gepostet, da sollte es nicht lange dauern, bis die aktuellen Nachrichten ebenso spekulativ über den Mord berichteten. Eine Pressemeldung sollte es aber so bald noch nicht geben.
Dora wurde unruhig. Die Fahrt zum Tatort kam ihr endlos lang vor. Auf der Avenida da Liberdade erwischte Luís eine rote Ampel nach der anderen. Ein Phänomen auf der Prachtallee Lissabons, das Dora täglich wieder verwirrte. Wieso installierten die Verkehrsplaner die Ampeln nicht auf grüne Welle, solange alle Autofahrer sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielten? Zum Verrücktwerden. Stop and go and stop and go.
An der Praça dos Restauradores kam der Verkehr wegen einer Baustelle völlig zum Erliegen. Einige besonders ungeduldige Autofahrer übten sich im Dauerhupen. Aber deswegen ging es trotzdem nicht schneller voran. Im Gegenteil. Rund um die Säule, die an den über achtundzwanzig Jahre andauernden Krieg der Portugiesen gegen die Spanier zur Wiedereinsetzung der königlich portugiesischen Souveränität erinnerte, herrschte Blechchaos. Ein Auffahrunfall mit einem Taxi, einem Leihwagen, einem Lieferwagen und einem streitsüchtigen Dreiradfahrer machte das Chaos komplett.
Ihr Wagen stand genau neben dem Kiosk vor der Kirschlikör-Bar »Ginjinha«, und Dora hatte freien Ausblick auf die Haltestelle des Ascensor da Glória. Von dort bis zum Eingang zur Metrostation Restauradores tummelte sich eine Menschenschlange. Alle warteten auf einen freien Platz in der Kabine, um während ihres Lissabon-Aufenthaltes wenigstens einmal mit der für Lissabon typisch gelb lackierten Kettenbahn von der Baixa die steile Glória-Stiege bis zum Aussichtspunkt São Pedro de Alcântara im Bairro Alto hinaufzufahren.
Typisch Touristen. Verschwenden überall ihre wertvolle Ferienzeit mit Warten, dachte Dora. Am Einstieg des dem Pariser Eiffelturm nachempfundenen Elevador Santa Justa, an der Praça Martim Moniz, der Endhaltestelle der Linie 28, um eine Fahrt in der urigen Lissabonner Straßenbahn zu unternehmen, oder zu Tausenden täglich am Eingang zu der mächtigen, von den Mauren errichteten Bastion Castelo de São Jorge auf der Hügelkuppe. Dabei hatte Doras Stadt so viel mehr zu bieten.
Straßenarbeiter hämmerten den Asphalt mit Pressluft auf. Der Corolla stand so dicht daneben, dass sogar das Sitzpolster unter Doras Allerwertestem vibrierte. Es kostete sie enorm viel Überwindung, nicht auszusteigen und in die Metrostation Restauradores zu verschwinden. Am liebsten wollte sie laut loskreischen, das Sitzpolster mit ihren Fäusten malträtieren und zu genau der exaltierten Zicke mutieren, als die sie im Dezernat betitelt wurde und vor der ihre Kollegen Luís bestimmt bei einem wohlgemeinten Gespräch unter Männern gewarnt hatten.
Als hätte Luís ihre Anspannung bemerkt, manövrierte er den Wagen an der roten Ampel und der Baustelle vorbei über den Bürgersteig und erreichte auf diese Weise den Bahnhofsvorplatz Rossio am »Grand Hotel Avenida Plaza«. Sie passierten das Theater Dona Maria II westlich des Rossio mit seinen zwei prächtigen, italienisch inspirierten Springbrunnen und fuhren in Richtung Tejo zum Handelsplatz Praça do Comércio.
In der Rua Áurea wartete das nächste Hindernis. Am Elevador de Santa Justa stockte der Verkehr erneut. Drei Reisebusse versperrten die gesamte rechte Fahrspur und entließen eine Heerschar Touristen, die zur Shoppingtour in die Fußgängerzone Armazéns do Chiado und in die Luxuseinkaufsmeile Rua Almeida Garrett ausschwärmten. Die Polizei regelte den Verkehr. Taxifahrer fluchten wüst aus offenen Fenstern. Autofahrer drückten auf die Hupe. Der Tourismus in Lissabon kostete die Stadt hin und wieder den allerletzten Nerv.
Dora steckte das Smartphone weg, lehnte den Kopf auf die Nackenstütze und bereitete sich auf ihre neue Aufgabe vor.
Sie mochte den Tod. Ihrer Meinung nach war Sterben das einzig Gültige im Leben. Nicht umsonst lautete ein portugiesisches Sprichwort: »Wir werden geboren, um zu sterben.« Eine Weisheit zum Festhalten. Alles andere im Leben war variabel. Vielleicht suchte die Menschheit deswegen immerzu nach dem Sinn des Lebens, anstatt es zu genießen, überlegte Dora. Die Angst vor dem Tod machte alle Menschen gleich – und gleich anfällig für Lehren, die etwas Schönes, etwas Tröstliches für nach dem Ableben versprachen.
Dora jedenfalls stellte sich den Tod als Frau vor, als eine aparte schlanke Frau in einem am Kragen hochgeschlossenen Kleid und barfuß. Frau Todin. Senhora Morte. Schließlich war in der portugiesischen Sprache der Tod mit weiblichem Artikel ausgestattet, a morte. Senhora Morte brachte also das irdische Dasein zu Ende. Elegant, unausweichlich, mit einem allerletzten Atemzug.
In der Kirchenkunst war der Übertritt vom Leben zum Tod als Schiffspassage ausgedrückt, als sogenannter passo. Die Heilige Jungfrau Maria glitt in einem Boot liegend über einen See einem unsichtbaren Ufer entgegen. Vielleicht eine etwas naive Vorstellung vom spirituellen Übertritt vom hiesigen Dasein ins Ungewisse, aber auf jeden Fall tröstlich. Falls Senhora Morte ein Leben zeitlich vorgezogen beendete, agierte sie brutal, als Bösewicht verkleidet. Dann trug sie eine Maske, trat als Mann auf und streute als gewieftes Luder falsche Fährten aus. Doras Aufgabe war es, das Luder zu enttarnen und die Fährte zu entschlüsseln.
Am Ende der Rua Áurea bog Luís links ab. Im Schritttempo fuhren sie vorbei an den Arkaden rund um den einstigen Terreiro do Paço, die heutige Praça do Comércio, die seit bald fünfhundert Jahren die am Pier ankommenden Schiffspassagiere in der portugiesischen Metropole willkommen hieß. Flankiert von den beiden früheren königlichen Audienzsälen rechts und links vom Anlegesteg, schmiegten sich diverse Ministerialgebäude und ihre Arkaden rund um die quadratisch angelegte königliche Terrasse, gepflastert mit glänzendem Kopfstein und geschmückt mit der Reiterstatue des Königs D. José I.
Am Triumphbogen Augusta blieben Dora und Luís erneut im Verkehr stecken, bis der Zebrastreifen endlich lange genug frei blieb, sodass sie weiterfahren konnten. Am ehemaligen Zollamt löste sich der Verkehr auf. Luís gab Gas und erreichte gleich hinter der früheren Synagoge Lissabons, der heutigen Igreja da Nossa Senhora da Conceição, den Platz Campo das Cebolas.
Nach einem Umweg bis zum Militärmuseum am neuen Überseehafen ging es ohne weitere Verzögerung weiter zum Chafariz-d’El-Rei-Brunnen. Der einstige Hauptbrunnen der unteren Alfama war überwuchert mit leuchtend pink blühender Bougainvillea und lag unmittelbar neben einem der ehemals sechzehn Stadttore, die vom Ufer des Tejo durch die mittelalterliche Feste hinein in das arabisch geprägte Häuserlabyrinth führten. Mit einem kurzen Hupsignal scheuchte Luís eine Gruppe Touristen vom Parkstreifen und hielt direkt vor dem Brunnen. Er deutete auf ein Café an der Promenade.
»Da warte ich auf Sie.«
Dora stieg aus und lief zu Fuß weiter. Gleich hinter der Porta do Mar führte rechts eine steile Treppe in das Quartier São Miguel. Im Torbogen versperrte eine Gruppe asiatischer Touristen mit ihrem Guide den Durchgang. Mit aufgestellten Ellenbogen schob sich Dora durch die Menschenwand und wich einem Trupp Segway-Fahrern aus, die aus der arabischen Bogengasse zu ihrer Linken gerollt kamen. Sie nahm die Treppe rechts.
Auf der steilen Pflastersteinstiege kam ihr ein älterer Portugiese entgegen. Sein Hemd war ihm aus der Hose gerutscht. Das Gesicht glänzte schweißnass. Die Anstrengung, die Treppenstufen abwärts mit einem steifen Bein zu nehmen, stand ihm ins Antlitz geschrieben. Mit einer Hand stützte er sich auf einen Gangstock, mit der anderen umklammerte er das Geländer.
Dora presste den Rücken gegen die Wand, damit der Herr an ihr vorbeikam. Er bedankte sich mit einem Kopfnicken.
Am Ende der Treppe angekommen, überquerte Dora einen ehemaligen Waschplatz und erreichte wenige Schritte später ihr Ziel. Die Igreja de São Miguel.
Wie immer vor ihrer ersten Begegnung mit »ihrem« Opfer begannen ihre Finger zu kribbeln.
Am Fuße der Freitreppe blieb Dora kurz stehen und ließ ihren Blick an der überraschend schnörkellosen Fassade der Barockkirche hinaufwandern bis zum Kreuz auf dem Giebel. Ein Tatort in einer Kirche. Premiere!
Eine auffrischende Bö bauschte ihre gelockten Haare auf. Dora eilte die Stufen über die Freitreppe vor dem Portal hinauf, drängte sich vorbei an der Menge Schaulustiger und beugte sich unter dem Absperrband hindurch. Kinder tuschelten, Erwachsene tippten eifrig in ihre Mobiltelefone oder fotografierten, um die Bilder sogleich in die virtuelle Welt zu verschicken.
Irgendwo hörte Dora ein Kind singen. Wieder blieb sie stehen und entdeckte hinter den Schaulustigen auf dem Kirchplatz einen buckligen Jungen. Er saß auf einem Hocker, schraubte an einem Bonanza-Rad herum und sang dazu.
»Im Garten von Celeste, da ist es passiert, falalalala, ich weiß wo, ich weiß was, ich weiß wer, falalalala.«
Dora kannte dieses Lied gut. Sie und Marta hatten es als Kinder beim Seilspringen oder beim Kästchenhüpfen gesungen.
Die neben dem Eingangsportal postierten Beamten der Guarda Nacional Republicana salutierten zackig, als die Inspetora-Chefe ihnen grüßend zunickte.
Das Quietschen der Scharniere der schweren Holzflügeltür kündigte Dora den Kollegen der Polícia Judiciária an. Kaum hatte sie die Schwelle übertreten, umfing sie eine völlig andere, von der Hektik Lissabons ausgesperrte Atmosphäre der Stille.
Im Foyer des Kirchenschiffs verharrte Dora einen Augenblick lang und ließ ihren Augen Zeit, um sich an das Halbdunkel zu gewöhnen. Gedankenverloren strich sie mit den Fingerkuppen über das glatt geschliffene Holz am Türrahmen, tauchte ihre Finger in das Weihwasserbecken und witterte den herben Myrrheduft.
Es war angenehm kühl in dem Gebetshaus. Und still. Dora spürte die Stille eher, als dass sie das Gewicht der Ruhe akustisch wahrnahm. Eine Wohltat nach dem erlebten Straßenlärm in der Innenstadt auf dem Weg bis hierher. Tanzende Lichtkegel fielen durch das Buntglas der oval geformten Fenster in das Kirchenschiff und erhellten die dunklen Ebenholzdielen im Mittelgang.
São Miguel war eine einschiffige Saalkirche mit Tonnengewölbedecke ohne Säulen und Kreuzgewölbe. Links und rechts entlang des Kirchenschiffs befanden sich je drei Kapellen mit Altarretabeln, in üppiger Barockkunst mit Putten und Blattgold verziert. An der Rückwand der Kirche unter der Apsis im hohen Altar stand eine lebensgroße Holzfigur, der Erzengel Michael. Seine Hand ruhte auf seinem Schwert, sein Fuß thronte auf dem Kopf des besiegten Drachen. Rechts neben dem Altar befand sich ein Reliquienaltar. Links davon die Kapelle der heiligen Mutter Maria.
Der Tatort.
Schritt für Schritt näherte sich Dora durch den Mittelgang dem Altar. Sie ließ die Aura der Kirche auf sich wirken. Die Gewölbedecke war in Kassetten unterteilt und mit biblischen Szenen der Kreuzigungsgeschichte bemalt. Der Boden war mit Ebenholz belegt. Im Gang glänzten helle Flecken auf dem Holzboden.
Getrocknete Wassertropfen aus den Badeanzügen der Kinder aus dem Planschbecken, die neugierig in die Kirche gerannt waren, als die Küsterin um Hilfe geschrien hatte, kombinierte Dora.
Am vorderen Ende des Ganges wandte sie sich nach links. Die in einen samten schwarzen Umhang gehüllte Figur der heiligen Mutter Maria schaute traurig auf sie herab. Den Kopf hielt die Ikone gesenkt, ihre Tränen waren blutrot stilisiert. Die Marienfigur trug ein Kopftuch und darüber den Strahlenkranz. In Lissabon nannte man sie Nossa Senhora das Dores, die Mutter aller Schmerzen.
»Boa tarde, Senhora Inspetora-Chefe«, begrüßten sie die Kollegen aus der Abteilung für Spurensicherung.
Dora erwiderte den Gruß und nahm sogleich den Toten und die Stelle, an der er aufgefunden worden war, in Augenschein.
Der Mann lag seitlich umgekippt auf der vorderen Kirchenbank vor dem Marienaltar. In seiner linken Stirnseite steckte ein langer Gegenstand aus Stahl. Bei flüchtiger Betrachtung hätte man es für einen Zimmermannsnagel halten können. Doch Dora wusste es besser. Es handelte sich um ein Bildhauerwerkzeug. Sie fragte sich, woher der Täter sich dieses spezielle Werkzeug zum Bearbeiten von Marmor und Speckstein beschafft haben mochte.
Die talha dourada auf dem Altarretabel glänzte und schuf mit ihrem Goldglanz einen deprimierenden Gegensatz zur schwarz gekleideten weinenden Maria im Zentrum der Kapelle. Der Platz davor bis zur dritten Bankreihe lag im Halbdunkel. Das durch die oberen Fenster hereinfallende Sonnenlicht erreichte diese Ecke des Gebetshauses nicht.
Im ersten Seitenaltar links am Seitengang zeigte ein deckenhohes Ölgemälde qualvoll verzerrte Visagen von Sterbenden im Purgatorium. Dora wusste, dass alle Kirchengebäude Geschichten erzählten. Deswegen war sie sich sicher, dass auch dieses Höllenbild neben dem Marienaltar eine Bedeutung hatte. Ob der Tote dieses Rätsel gelöst hatte und deswegen zum Beten hierhergekommen war?
Von der Liebe zur Hölle brauchte es tatsächlich oft bloß einen Schritt, sinnierte Dora weiter und scannte die Szenerie, den Toten vor dem Altar und das Bild des Infernos. Vielleicht war das Opfer unglücklich verliebt gewesen und hatte gegen das sechste Gebot, »Du sollst nicht ehebrechen«, verstoßen. Der Ehering verriet ja seinen gesetzlichen Familienstatus eindeutig. Eine tragische Dreiecksgeschichte mit fatalem Ausgang konnte sich Dora durchaus vorstellen. Hatte sich seine Ehefrau oder der Ehemann seiner Geliebten gerächt?
Neben dem Ermordeten lag eine Bibel, darin waren zwei Lesezeichen eingeschoben. Ein silberner Rosenkranz war um den Umschlag geschlungen.
Über Doras Kopf flatterte eine Taube durch eine winzige Luke herein. Sie beobachtete ihren Flug aus der schattigen Ecke in den Lichtkegel im Mittelschiff. In dem Moment nahm sie im rechten Augenwinkel eine Bewegung wahr. Ihr Assistent, Inspetor Cardoso, trat zu ihr. Er maß beinahe zwei Meter, machte stets überdurchschnittlich große Schritte und ließ seine langen Arme beim Gehen mitschwingen, worüber sich Kollegen im Dezernat insgeheim lustig machten, wusste Dora. Ihr persönlich war das egal. Cardoso war ein exzellenter Mitarbeiter und durch und durch loyal.
»Gut, dass Sie da sind, Senhora Inspetora-Chefe –«
Dora schnitt seinen Redefluss mit einer Handbewegung ab. Von den bisherigen Erkenntnissen wollte sie noch nichts hören, sondern erst die Stimmung am Tatort einfangen – und das funktionierte am besten, wenn Cardoso den Mund hielt.
Was mag hier passiert sein?, fragte sie sich und ließ ihrer Wahrnehmung freien Lauf. Routiniert zog sie ein Paar Latexhandschuhe an, hob die Bibel von der Bank auf und schlug die mit Lesezeichen versehenen Seiten auf. Mit gedämpfter Stimme las sie eine markierte Stelle aus dem Buch der Offenbarung vor.
»›Das Tier ward gegriffen und mit ihm der falsche Prophet, durch den er verführt das Tier anbetete. Schuldig wurden sie in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte.‹«
Sofern sie diese Bibelstelle richtig interpretierte, ließ sich der Getötete von einem sogenannten falschen Propheten verführen, betete das Tier an und schmorte bis zu seinem Tod im Saft der eigenen Reue. So wie die Sterbenden im Purgatorium auf dem Wandgemälde. Das war vielleicht ein Hinweis, der ihr im Laufe ihrer Ermittlungen helfen konnte, das Motiv für den Mord zu entschlüsseln.
Sie schauderte. Die Geschichten in der Bibel fand sie grauenhaft. Bereits als Kind hatte ihr die Heilige Schrift im Religionsunterricht in der Schule große Angst eingeflößt, und sie weigerte sich seither, das Strafe-Sühne-Prinzip, wie es die katholische Kirche proklamierte, zu akzeptieren. Damals hatte sie sich auch gar nicht vorstellen können, dass Menschen derart böse waren und jemanden lebendig an ein Kreuz nageln würden. Als Erwachsene wusste sie es jetzt besser. Menschen konnten noch viel böser sein.
Cardoso stand immer noch halb hinter ihr. Sein Körper warf einen Schatten auf den Boden vor dem Tatort, ihrer hingegen nicht, bemerkte Dora. Interessant. Somit hatte sich der Täter seinem Opfer mit ziemlicher Sicherheit von links durch den im Halbdunkel befindlichen Seitengang genähert und nicht durch den Mittelgang, so wie Cardoso. Sonst hätte sein Körper vermutlich einen Schatten vorausgeworfen, und das Opfer wäre gewarnt gewesen. Der Mord musste hinterrücks geschehen sein. Schnell, sauber, geräuschlos. Ein gezielt ausgeführter Hieb. Ein leiser Tod.
Dora stutzte. Unter der Fußbank in der zweiten Bankreihe blinkte etwas. Sie bückte sich. Eine filigrane Goldkette kam zum Vorschein. Die Kette trug einen Anhänger. Ein Medaillon. Dora öffnete es. Eine vergilbte Schwarz-Weiß-Fotografie zeigte das Gesicht einer attraktiven jungen Frau mit streng zum Zopf zurückgekämmtem Haar. Dora klappte den Deckel des Schmuckstücks wieder zu und reichte die Kette ihrem Assistenten.
»Ich will wissen, wer diese Frau ist, Cardoso.«
Als Nächstes nahm Dora neben dem Opfer auf der Bank Platz. Sie bettete die Bibel auf ihren Schoß und betrachtete die Marienfigur. So wie der Ermordete es vermutlich getan hatte.
Sein Platz musste in der vordersten Reihe gewesen sein. Nicht in der Mitte, nicht hinten, nein, ganz vorn. Das ließ darauf schließen, dass er bereits öfter in dieser Kirche gewesen war. Beim ersten Besuch in einem Gotteshaus setzte sich niemand gleich in die erste Bankreihe, sondern blieb meistens zunächst einmal im hinteren Drittel mit sich und seinen Gebeten.
Wonach hatte ihr Opfer gesucht. Nach Liebe? Nach Vergebung? Oder nach Barmherzigkeit? Oder war sie auf dem Holzweg?
Mutmaßlich hatte der Täter die Gewohnheiten seines Opfers über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet, das Gebäude und die Umgebung studiert und einen Fluchtweg vorbereitet. Einen Mord aus Affekt schloss Dora schon jetzt aus. Ein Plan nahm Zeit in Anspruch. Das bedeutete, der Täter hatte das Terrain gründlich sondiert. Vielleicht hatte ihn dabei sogar jemand aus dem Viertel beobachtet und konnte brauchbare Hinweise liefern.
Seit Cardosos Anruf beschäftigte Dora die Frage nach dem Tatort Kirche. Der Mörder musste den Ort bewusst ausgewählt haben. Niemand ging zufällig in eine Kirche und hieb jemandem ein Stück Stahl in die Schläfe. Vielleicht war er ein Agnostiker gewesen, der bloß nach einer effektheischenden Kulisse gesucht hatte. Ein devot Gläubiger, den die Kirche einmal abgrundtief enttäuscht hatte, kam ebenso in Frage.
Dora rückte dem Toten näher und beäugte ihn von Kopf bis Fuß.
»Das Opfer trägt einen Maßanzug, Lederschuhe aus einer Schuhmanufaktur, eine goldene Schweizer Markenuhr. Am linken Ringfinger steckt ein Ehering. Um den Hals trägt er eine Goldkette mit Kreuzanhänger.« Sie drehte sich zu Cardoso um. »Wissen Sie schon mehr?«
»Ja. Seine Brieftasche war ihm aus der Hose gerutscht, vielleicht, als er umgefallen war. Laut seinem Personalausweis heißt er Elías Inácio. Geboren 1949.«
Für stramme siebzig hätte Dora den Mann nicht gehalten. Eher zehn Jahre jünger. Genauso überraschte sie der Vorname Elías, dem man eher selten begegnete. »Ungewöhnlicher Vorname.«
»Das Opfer war verheiratet und hatte zwei erwachsene Kinder. Das hat die Meldestelle bereits bestätigt. Von den Kollegen weiß ich, dass er einen Bruder hat.«
Dora zog ihr Mobiltelefon aus der Tasche und nahm das Gesicht des Toten von allen Seiten auf. Elías Inácio war ein eleganter Mann gewesen, stellte sie fest. Alles passte an ihm zusammen. Understatement, kein Protz. Edle Kleidung, noble Schmuckstücke. Dezentes Rasierwasser, manikürte Fingernägel. Akkurater Haarschnitt. Vom Barbier gepflegter Backenbart. Er musste wohlhabend gewesen sein.
»Hatte er etwas mit der Privatbank Inácio zu tun?«
Cardoso bejahte. »Er ist der Vorstandschef gewesen.«
Dora fand sich in ihrer Einschätzung bestätigt und hielt die Szenerie in Bildern fest. Die Kirchenbank. Die Kapelle. Das Opfer. Die Bibel. Die Kette. Die Tatwaffe.
»Ein Bankier, der zum Beten geht …«, sagte sie schließlich nachdenklich. »Eine Marotte? Oder aus einem bestimmten Anlass?«
»Vielleicht hat er einen Angehörigen verloren.«
»Vielleicht ist zu wenig, Cardoso.« Dora schlug die Bibel auf und las die zweite markierte Stelle aus dem Sonnengesang des heiligen Franziskus laut vor. »›Wehe jenen, die in schwerer Sünde sterben. Selig jene, die sich in deinem heiligsten Willen finden, denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun.‹ Hm. Das klingt ganz anders als die andere Bibelstelle.«
Cardoso schnalzte mit der Zunge. »Das hört sich nach lebenslänglicher Qual an, erst im Tod fände man Erlösung. Ich lebe lieber fröhlich und sterbe traurig.«
Dora überging seinen Kommentar, obwohl sie ihm voll und ganz zustimmte. Viel interessanter schien ihr die Tatwaffe zu sein. Der schmale, etwa zwanzig Zentimeter lange, achteckig geformte Stahlschaft mit flach geklopftem Kopf war etwa bis zur Hälfte in die Schläfe des Opfers versenkt. Es handelte sich um ein Werkzeug für Bildhauer. Ein Stecheisen. Doras Großvater war Skulpteur und hämmerte mit ebensolchen Eisen größere Stücke aus Marmor, Sandstein oder Granit.
Ein Bildhauermeißel hatte ein ordentliches Gewicht und eine geschliffen scharfe Spitze aus Stahl. Das schwere Werkzeug in eine menschliche Schädeldecke zu stoßen benötigte weniger Kraft, als einen Nagel in die Wand zu treiben. Mit etwas Schwung brauchte es nicht einmal einen Hammer dazu. Der Täter konnte demnach ein Mann oder eine Frau gewesen sein.
»Eine Kunst für sich«, murmelte Dora.
Zufrieden zog sie die Latexhandschuhe aus und verkündete ihr Fazit aus ihren bisherigen Beobachtungen: »Wir suchen einen Linkshänder.«
***
Dona Rosário wurde in der Teeküche der Kirche notärztlich versorgt. Der Schock steckte ihr noch in den Knochen.
»Ist sie ansprechbar?«
Der Arzt bejahte und zog sich zurück.
Dora rückte einen Stuhl näher und setzte sich.
Die Küsterin war klein, hager, ihre kurz geschnittenen Locken standen ihr wirr vom Kopf ab. »Wer tut bloß so etwas?«
Dora tätschelte ihr die Hand. »Dona Rosário, Sie kümmern sich um den Verkauf der sakralen Andenken und schließen morgens und abends die Kirche auf und zu?«
Dona Rosário nickte. »Sie glauben ja gar nicht, wie froh ich bin, meinen vier Wänden zu entkommen. Ich lebe allein. Meine Tochter arbeitet in Porto. Meine Nachbarinnen sind jünger als ich und leben ihr eigenes Leben, oder sie sind älter und können nicht mehr alles selbst machen. Brauchen Hilfe beim Anziehen, können nicht mehr einkaufen gehen, sich waschen oder selbst kochen. Ich bin fit, habe aber niemanden zum Reden. Seit meine Tochter ausgezogen ist, weine ich und rufe sie ständig an, bloß um meine eigene Stimme laut zu hören. Schrecklich. Eines Tages fragte mich nach der Sonntagsmesse unser Gemeindepfarrer Padre Nuno, ob ich in der Kirche aufpassen will. Dem Herrn sei Dank. Endlich bin ich wieder unter Menschen.«
»Kannten Sie Senhor Elías?«
»So hieß das Opfer? Ein jüdischer Vorname aus dem Alten Testament. Aber ja, ich kenne, Pardon, kannte ihn. Er kam jeden Tag hierher. Jedenfalls seit geraumer Zeit. Aus der Nachbarschaft stammte er aber nicht. Das habe ich gleich erkannt. Wissen Sie, Kindchen, Maßanzüge trägt hier in der Alfama niemand. Wir sind alle Fischer, Hausangestellte oder Arbeiter und tragen unsere Kleidung auf, bis man sie nicht mehr flicken kann. Unsere Nachbarn kennen wir manchmal besser als die eigene Familie, wohnen ein Leben lang Wand an Wand.« Dona Rosário hielt inne und betrachtete ihre krummen Finger. »Sonst kam der Senhor immer so gegen vier und ging um fünf. Heute kam er später.« Sie seufzte laut. »Unterhalten haben wir uns nie wirklich. Hin und wieder ein paar Worte gewechselt. Ach Gottchen, der Arme.«
»Worüber haben Sie und Senhor Elías zuletzt gesprochen?«
Dona Rosário richtete sich abrupt auf. »Wenn ich daran denke, friert es mich.« Sie faltete ihre Hände im Schoß. »Es war ein regnerischer Nachmittag. Der Himmel hing tief, die Wolken waren schmutzig grau und rasten Richtung Meer. Es donnerte und blitzte, der Strom fiel aus. Es war duster in der Kirche. Kein Mensch da. Unheimlich. Deswegen zündete ich Kerzen an. Gerade als der Sturm besonders laut heulte, flog die Tür auf. Senhor Elías. Pitschnass war er. Außer Atem, völlig gehetzt, als sei der Teufel hinter ihm her. Ich fragte ihn, ob alles in Ordnung sei, aber er antwortete nicht. Im Kerzenschein sah er anders aus als sonst. Sein Mund, die Augen, alles verschoben. ›Verdammt bin ich!‹, zischte er. Schauen Sie, Kindchen, ich brauche nur daran zu denken, schon bekomme ich Entenhaut.« Zum Beweis streckte sie ihren Unterarm aus.
Dora betrachtete die aufgerichteten Härchen an Dona Rosários Arm und wechselte einen Blick mit ihrem Inspetor, der im Türrahmen lehnte und zuhörte. »Senhor Elías hat die Mutter Maria angebetet?«
»Jeden Tag.«
»Cardoso, finden Sie heraus, ob es eine lokale Legende über diese Kirche oder ihren Standort in der Alfama gibt. Ich habe das Gefühl, unser Opfer hat aus einem ganz bestimmten Grund genau hier gebetet.«
Dora wusste, Cardoso würde bis zum Nimmerleinstag recherchieren und ihr einen vollständigen Bericht über die Mutter Maria und ihre Bedeutung für dieses Stadtviertel liefern. Deswegen wollte sie ihn auf keinen Fall gegen einen anderen Inspetor tauschen. Er war als Praktikant zu ihr in die Abteilung gekommen, und er war geblieben.
»Hielten Sie Senhor Elías für verwirrt, Dona Rosário?«
»Das kann ich doch gar nicht wissen, Kindchen, ich bin ja kein Kopfdoktor. Er kam mir vielmehr so vor, als hätte ihn etwas gequält.« Die Küsterin bedeutete Dora mit dem Zeigefinger, näher zu kommen, und senkte geheimnisvoll die Stimme. »Vielleicht hat ein Dämon in ihm dringesessen. Verstehen Sie? Etwas Böses. Ein Exorzist hätte ihm helfen können.«
Dora stellte sich den Arbeitsplatz eines Exorzisten in der heutigen Zeit vor. Mit Smartphone und Facebook-Seite. Mit Büro im ehemaligen Weltausstellungsgelände, organischem Dachgarten und Blick auf die Ponte Vasco da Gama.
Was das Fegefeuer, den Teufel und seine Austreiber betraf, wähnte sich Dora ohnehin froh, dass ihr Großvater Maurice väterlicherseits einen eher puristisch-weltlichen Einfluss auf ihre kindliche Entwicklung genommen hatte und im Gegensatz zu ihrer Oma mütterlicherseits und ihrer Mutter ganz anders über Religion und Glauben dachte. Wenngleich auch er an gute und an böse Geister glaubte. Jedenfalls hatte er ihr von Kindesbeinen an beigebracht, Dinge, die sie nicht verstand, zu hinterfragen. Die Bibel mit all diesen unheilvollen Prophezeiungen darin zum Beispiel. Sonst würde Dora vielleicht auch jedes Mal einen Teufelsaustreiber zu Hilfe rufen, sobald etwas »nicht stimmte«, wie es ihre Mutter ausdrückte, beziehungsweise etwas passierte, das mit Bibelsprüchen unerklärbar blieb, weswegen ihre Mutter das Haus mit kokelnden Rosmarinzweigen vor bösen Flüchen beschützte. Dora hasste Rosmarin. In der Seife, im Essen, im Waschmittel. Sie war aufgewachsen mit Reiskörnern und Knoblauchknollen als Schutz gegen den Teufel hinter der Tür, mit getöpfertem Frosch als Schutz gegen diebisches Volk vor der Haustür und mit Geschirrtuch als Schutz vor bösen Geistern an der Türklinke. »Vorsichtshalber«, wie ihre Mutter stets betonte. Sobald eine Eule schrie oder eine weiße Katze auftauchte, bekreuzigte sich aber selbst heute noch jede ältere Frau in Lissabon. Der Aberglaube schwelte überall.
»Dona Rosário. Haben Sie in den vergangenen Tagen oder Wochen jemanden beobachtet, der Ihnen verdächtig vorkam?«
Die Küsterin hob beide Arme. »Ach Kindchen. Ich sehe jeden Tag Leute, die ich nicht kenne und nicht verstehe, weil sie mit anderer Zunge sprechen. Die Fremden kommen und gehen. Die einen verhalten sich höflich, andere unangemessen. Aber ob das verdächtig ist? Manche kommen hier herein, schlecken Eiscreme, tragen Hotpants oder Muskelshirts, reden laut, lachen laut und glotzen den Altar unseres lieben Erzengels Michael an, als hätten sie noch nie einen Engel und einen Drachen gesehen. Dann reißen sie Witze und fotografieren wild mit ihren Telefonen an Stöcken herum. Als wäre dies ein Theater und keine Kirche.«
»Ich dachte, Fotografieren sei verboten.«
»Ach, seien Sie nicht naiv, Kindchen. Die Leute knipsen doch alles, was ihnen vor die Linse kommt. Mich und den ermordeten Senhor Elías haben sie fotografiert. Unerhört! Ganz dicht vor dem Gesicht herumgefuchtelt haben sie mir, aber wie es mir geht, hat mich niemand gefragt. Dieser Sittenverfall endet am Tag des Jüngsten Gerichts.«
Eher nach einem längeren Stromausfall, dachte Dora. »Gibt es Überwachungskameras?«
»Eine. Im Hauptaltar. Für den Erzengel. Sonst würden manche Leute da womöglich auch noch hinaufklettern.« Dona Rosário schnaufte verächtlich.
»Im Eingang hängt keine?«
»In die Kirche gehen die Leute zum Beten. Das muss niemand überwachen.«
Im Geiste stimmte Dora ihr zu. An ihre kauzige Art konnte sie sich gewöhnen.





























