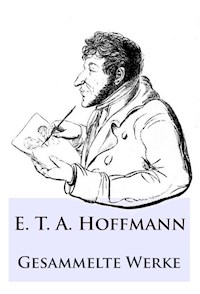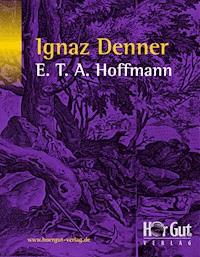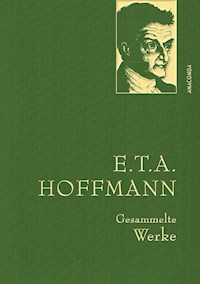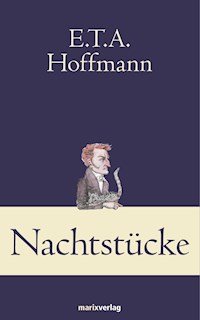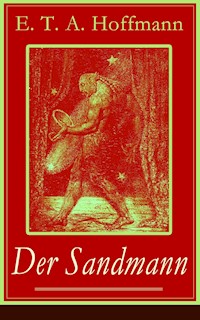Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Weitere Erzählungen des Autors: Haimatochare Die Marquise de la Pivardiere Die Irrungen Die Geheimnisse Der Elementargeist Die Räuber Die Doppeltgänger Datura fastuosa (Der schöne Stechapfel) Des Vetters Eckfenster Naivetät Die Genesung Neueste Schicksale eines abenteuerlichen Mannes Meister Johannes Wacht Der Feind
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 793
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Letzte Erzählungen
E. T. A. Hoffmann
Inhalt:
Ernst Theodor Amadeus (E.T.A.) Hoffmann – Biografie und Bibliografie
Haimatochare
Die Marquise de la Pivardiere
Die Irrungen
Die Geheimnisse
Der Elementargeist
Die Räuber
Die Doppeltgänger
Datura fastuosa
Der schöne Stechapfel
Des Vetters Eckfenster
Naivetät
Die Genesung
Neueste Schicksale eines abenteuerlichen Mannes
Meister Johannes Wacht
Der Feind
Letzte Erzählungen, E.T.A. Hoffmann
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849616144
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Ernst Theodor Amadeus (E.T.A.) Hoffmann – Biografie und Bibliografie
Einer der originellsten und phantasiereichsten deutschen Erzähler, zugleich auch Musiker und Maler, geb. 24. Jan. 1776 zu Königsberg i. Pr., gest. 24. Juli 1822 in Berlin. Er studierte in seiner Vaterstadt die Rechte, arbeitete seit 1796 bei der Oberamtsregierung in Großglogau und seit 1798 bei dem Kammergericht in Berlin, wurde 1800 Assessor bei der Regierung in Posen, aber wegen einiger anzüglichen Karikaturen, die er gefertigt, 1802 als Rat nach Plozk und 1803 in gleicher Eigenschaft nach Warschau versetzt, wo damals auch J. E. Hitzig und Zacharias Werner als preußische Beamte tätig waren. Der Einmarsch der Franzosen 1806 machte hier seiner amtlichen Laufbahn ein Ende. Ohne Vermögen und ohne Aussichten im Vaterland, benutzte er seine musikalischen Talente zum Broterwerb und ging 1808 auf Einladung des Grafen Julius v. Soden als Musikdirektor bei dem neuerrichteten Theater nach Bamberg. Als dieses bald nachher geschlossen wurde, geriet er in die größte Not. Nachdem er sich einige Zeit durch Musikunterricht und Arbeiten für die Leipziger »Allgemeine musikalische Zeitung« die nötigsten Unterhaltsmittel erworben, erhielt er 1813 die Stellung als Musikdirektor bei der Secondaschen Schauspielergesellschaft und leitete bis 1815 das Orchester dieser abwechselnd in Dresden und in Leipzig spielenden Truppe. 1816 wurde er wieder als Rat bei dem königlichen Kammergericht in Berlin angestellt; er starb daselbst an der Rückenmarksschwindsucht nach qualvollen Leiden. H. hatte sich von Jugend auf mit Vorliebe dem Studium der Musik gewidmet. In Posen brachte er das Goethesche Singspiel »Scherz, List und Rache« aufs Thea ter, in Warschau »Die lustigen Musikanten« von Brentano, dazu die Opern: »Der Kanonikus von Mailand« und »Liebe und Eifersucht«, deren Text er nach ausländischen Mustern selbst bearbeitete. Auch setzte er die Musik zu Werners »Kreuz an der Ostsee« und komponierte für das Berliner Theater Fouqués zur Oper umgestaltete »Undine«, deren Partitur samt den prächtigen, nach Hoffmanns Entwürfen gefertigten Dekorationen bei dem Brande des Opernhauses zugrunde ging. Die Aufforderung, seine in der »Musikalischen Zeitung« zerstreuten Aufsätze zu sammeln, veranlaßte ihn zur Herausgabe der »Phantasiestücke in Callots Manier« (Bamberg 1814, 4 Bde.; 4. Aufl., Leipz. 1864, 2 Bde.), die großes Aufsehen machten und ihm die unterscheidende Bezeichnung »H.-Callot« verschafften. Weiter folgten: »Vision auf dem Schlachtfeld von Dresden« (Leipz. 1814); »Elixiere des Teufels« (Berl. 1816); »Nachtstücke« (das. 1817, 2 Bde.); »Seltsame Leiden eines Theaterdirektors« (das. 1818); »Die Serapionsbrüder« (das. 1819–21, 4 Bde.; nebst einem Supplementband, der Hoffmanns letzte Erzählungen enthält, das. 1825); »Klein Zaches, genannt Zinnober« (das. 1819, 2. Aufl. 1824); »Prinzessin Brambilla, ein Capriccio nach Jakob Callot« (das. 1821); »Meister Floh, ein Märchen in sieben Abenteuern zweier Freunde« (Frankf. 1822); »Lebensansichten des Katers Murr, nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler, in zufälligen Makulaturblättern« (Berl. 1821–22, 2 Bde.); »Der Doppelgänger« (Brünn 1822) und einige kleinere Erzählungen, von denen »Meister Martin und seine Gesellen«, »Das Majorat«, »Das Fräulein von Scudéry«, »Der Artushof«, »Doge und Dogaresse« etc. wahre Meisterstücke der Novellistik genannt zu werden verdienen. H. war ein durchaus origineller Mensch, mit den seltensten Talenten ausgerüstet, wild, ungebunden, nächtlichem Schwelgen leidenschaftlich ergeben (wobei er in Berlin besonders an Ludwig Devrient einen geistesverwandten Genossen hatte) und doch ein trefflicher Geschäftsmann und Jurist. Voll scharfen und gesunden Menschenverstandes, der den Erscheinungen und Dingen sehr bald die schwachen und lächerlichen Seiten ablauschte, gab er sich doch allerlei phantastischen Anschauungen und abenteuerlichem Dämonenglauben hin. Exzentrisch in seiner Begeisterung, Epikureer pis zur Weichlichkeit und Stoiker bis zur Starrheit, Phantast bis zum fratzenhaftesten Wahnsinn und witziger Spötter bis zur phantasielosen Nüchternheit, vereinigte er die seltsamsten Gegensätze in sich, Gegensätze, in denen sich auch seine meisten Novellen bewegen. In allen seinen Dichtungen fällt der Mangel an Ruhe zuerst auf, seine Phantasie und sein Humor reißen ihn unaufhaltsam mit sich fort. Finstere Gestalten umkreisen und durchkreuzen stets die Handlung, und das Wilddämonische spielt selbst in die Welt der philisterhaften und modernen Alltäglichkeit hinein. In der Virtuosität, gespenstiges Grauen zu erwecken, werden wenige Erzähler H. erreicht haben; es ist glaubhaft, daß er sich, wie man erzählt, vor seinen eignen gespenstigen Gestalten gefürchtet habe. Die Sprache handhabte er mit großer Gewandtheit, wenn auch nicht ohne Manier. Als Musikkritiker hielt er zu Spontini und den Italienern gegen K. M. v. Weber und die aufblühende deutsche Oper, wirkte aber für das Verständnis Mozarts und Beethovens. Eine Sammlung seiner »Ausgewählten Schriften« erschien Berlin 1827–28, 10 Bde., denen seine Witwe Micheline, geborne Rorer, 5 Bände Supplemente (Stuttg. 1839) beifügte, welche die Erzählungen aus seinen letzten Lebensjahren und die 3. Auflage von Hitzigs Biographie (»Hoffmanns Leben und Nachlaß«, zuerst Berl. 1823) enthalten. Eine neue Ausgabe erschien u. d. T. »Gesammelte Schriften« (Berl. 1871–73. 12 Bde.), in der Hempelschen Sammlung (das. 1879–83, 15 Tle.) und, besorgt von E. Griesebach, in M. Hesses Klassikerausgaben (»Sämtliche Werke«, Leipz. 1899, 15 Bde.); eine gut kommentierte Auswahl der »Werke« bot Schweizer (das. 1896, 3 Bde.), eine andre mit Einleitung von Lautenbacher erschien im Cottaschen Verlag (Stuttg. 1894, 4 Bde.). Vgl. auch »Das Kreislerbuch, Texte, Kompositionen und Bilder.« Zusammengestellt von Hans v. Müller (Leipz. 1903). H. war auch ein geschickter Karikaturenzeichner, von dem mehrere Karikaturen auf Napoleon I. herrühren. Interessante Erinnerungen an H. gab Funck (K. F. Kunz) in seiner Schrift »Aus dem Leben zweier Dichter, Ernst Theod. Wilh. H. und Fr. G. Wetzel« (Leipz. 1836). Im Ausland, besonders in Frankreich, ist H. vielfach übersetzt und nachgeahmt worden. Vgl. Ellinger, E. T. A. Hoffmann, sein Leben und seine Werke (Hamb. 1894); O. Klinke, E. T. A. Hoffmanns Leben und Werke. Vom Standpunkte des Irrenarztes (Braunschw. 1903).
Haimatochare
Vorwort
Nachfolgende Briefe, welche über das unglückliche Schicksal zweier Naturforscher Auskunft geben, wurden mir von meinem Freunde Adalbert von Chamisso mitgeteilt, als er eben von der merkwürdigen Reise zurückgekommen, in der er den Erdball anderthalbmal umkreist hatte. Sie scheinen wohl öffentlicher Bekanntmachung würdig. – Mit Trauer, ja mit Entsetzen gewahrt man, wie oft ein harmlos scheinendes Ereignis die engsten Bande der innigsten Freundschaft gewaltsam zu zerreißen und da verderbliches Unheil zu bereiten vermag, wo man das Beste, das Ersprießlichste zu erwarten sich berechtigt glaubte.
E. T. A. Hoffmann.
1. An Se. Exzellenz den Generalkapitän und Gouverneur von Neusüdwales
Port Jackson, den 21. Juni 18..
Ew. Exzellenz haben zu befehlen geruhet, daß mein Freund, Herr Brougthon, mit der Expedition, die nach O-Wahu ausgerüstet wird, als Naturforscher mitgehe. Längst war es mein innigster Wunsch, O-Wahu noch einmal zu besuchen, da die Kürze meines letzten Aufenthalts mir nicht mehr gestattete, manche höchst merkwürdige naturhistorische Beobachtungen bis zu bestimmten Resultaten zu steigern. Doppelt lebhaft erneuert sich jetzt dieser Wunsch, da wir, ich und Herr Brougthon, durch die Wissenschaft, durch gleiches Forschen auf das engste verkettet, schon seit langer Zeit gewohnt sind, unsere Beobachtungen gemeinschaftlich anzustellen und durch augenblickliches Mitteilen derselben uns einander an die Hand zu gehen. Ew. Exzellenz bitte ich daher, es genehmigen zu wollen, daß ich meinen Freund Brougthon auf der Expedition nach O-Wahu begleite.
Mit tiefem Respekt etc. etc.
J. Menzies.
N. S. Mit den Bitten und Wünschen meines Freundes Menzies vereinigen sich die meinigen, daß Ew. Exzellenz geruhen möchten, ihm zu erlauben, mit mir nach O-Wahu zu gehen. Nur mit ihm, nur wenn er mit gewohnter Liebe meine Bestrebungen teilt, vermag ich das zu leisten, was man von mir erwartet.
A. Brougthon.
2. Antwort des Gouverneurs
Mit innigem Vergnügen bemerke ich, wie Sie, meine Herren, die Wissenschaft so innig miteinander befreundet hat, daß aus diesem schönen Bunde, aus diesem vereinten Streben sich nur die reichsten, herrlichsten Resultate erwarten lassen. Aus diesem Grunde will ich auch unerachtet die Bemannung der Diskovery vollständig ist und das Schiff wenig Raum hat, dennoch erlauben, daß Herr Menzies der Expedition nach O-Wahu folge, und erteile in diesem Augenblick deshalb dem Kapitän Bligh die nötigen Befehle.
(gez.) Der Gouverneur.
3. J. Menzies an E. Johnstone in London
Am Bord der Diskovery, den 2. Juli 18..
Du hast recht, mein lieber Freund, als ich Dir das letztemal schrieb, war ich wirklich heimgesucht von einigen spleenischen Anfällen. Das Leben auf Port Jackson machte mir die höchste Langeweile, mit schmerzlicher Sehnsucht dachte ich an mein herrliches Paradies, an das reizende O-Wahu, das ich erst vor kurzem verlassen. Mein Freund Brougthon, ein gelehrter und dabei gemütlicher Mensch, war der einzige, der mich aufzuheitern und empfänglich für die Wissenschaft zu erhalten vermochte, aber auch er sehnte sich, wie ich, hinweg von Port Jackson, das unserm Forschungstrieb wenig Nahrung darbieten konnte. Irre ich nicht, so schrieb ich Dir schon, daß dem Könige von O-Wahu, namens Teimotu, ein schönes Schiff versprochen worden, das zu Port Jackson gebaut und ausgerüstet werden sollte. Dies war geschehen, Kapitän Bligh erhielt den Befehl, das Schiff hinzuführen nach O-Wahu und sich dort einige Zeit aufzuhalten, um das Freundschaftsbündnis mit Teimotu fester zu knüpfen. Wie klopfte mein Herz vor Freude, da ich glaubte, daß ich unfehlbar mitgehen würde; wie ein Blitz aus heitrer Luft traf mich aber der Ausspruch des Gouverneurs, daß Brougthon sich einschiffen solle. Die Diskovery, zur Expedition nach O-Wahu bestimmt, ist ein mittelmäßiges Schiff, nicht geeignet, mehr Personen aufzunehmen, als die nötige Bemannung; um so weniger hoffte ich mit dem Wunsch, Brougthon begleiten zu dürfen, durchzudringen. Der edle Mensch, mir mit Herz und Gemüt auf das innigste zugetan, unterstützte indessen jenen Wunsch so kräftig, daß der Gouverneur ihn bewilligte. Aus der Überschrift des Briefes siehst Du, daß wir, Brougthon und ich, bereits die Reise angetreten.
O des herrlichen Lebens, das mir bevorsteht! – Mir schwillt die Brust vor Hoffnung und sehnsüchtigem Verlangen, wenn ich daran denke, wie täglich, ja stündlich die Natur mir ihre reiche Schatzkammer aufschließen wird, damit ich dieses, jenes nie erforschte Kleinod mir zueignen, mein nennen kann, das nie gesehene Wunder!
Ich sehe Dich ironisch lächeln über meinen Enthusiasmus, ich höre Dich sprechen: »Nun ja, einen ganzen neuen Swammerdamm in der Tasche, wird er zurückkehren; frage ich ihn aber nach Neigungen, Sitten, Gebräuchen, nach der Lebensweise jener fremden Völker, die er gesehen, will ich recht einzelne Details wissen, wie sie in keiner Reisebeschreibung stehen, wie sie nur von Mund zu Mund nacherzählt werden können, so zeigt er mir ein paar Mäntel und ein paar Korallenschnüre und vermag sonst nicht viel zu sagen. Er vergißt über seine Milben, seine Käfer, seine Schmetterlinge die Menschen!« –
Ich weiß, Du findest es sonderbar, daß mein Forschungstrieb gerade zu dem Reiche der Insekten sich hingeneigt, und ich kann Dir in der Tat nichts anderes darauf antworten, als daß die ewige Macht nun gerade diese Neigung so in mein Innerstes hineingewebt hat, daß mein ganzes Ich sich nur in dieser Neigung zu gestalten vermag. Nicht vorwerfen darfst Du mir aber, daß ich über diesen Trieb, der Dir seltsam erscheint, die Menschen oder gar Verwandte, Freunde vernachlässige, vergesse. – Niemals werde ich es dahin bringen, es jenem alten holländischen Obristleutnant gleichzutun, der – doch um Dich durch den Vergleich, den Du dann zwischen diesem Alten und mir anstellen mußt, zu entwaffnen, erzähle ich Dir die merkwürdige Historie, die mir eben in den Sinn kam, ausführlich. – Der alte Obristleutnant (ich machte in Königsberg seine Bekanntschaft) war, was Insekten betrifft, der eifrigste, unermüdetste Naturforscher, den es jemals gegeben haben mag. Die ganze übrige Welt war für ihn tot, und wodurch er sich der menschlichen Gesellschaft allein nur kundtat, das war der unausstehlichste, lächerlichste Geiz und die fixe Idee, daß er einmal mittelst eines Weißbrots vergiftet werden würde. – Irre ich nicht, so heißt dies Weißbrot im Deutschen Semmel. – Ein solches Brot buk er sich jeden Morgen selbst, nahm es, war er zu Tische gebeten, mit und war nicht dahin zu bringen, ein anderes Brot zu genießen. Als Beweis seines tollen Geizes mag Dir der Umstand genügen, daß er, seines Alters unerachtet ein rüstiger Mann, Schritt vor Schritt mit weit von dem Leibe weggestreckten Armen auf den Straßen einherging, damit – die alte Uniform sich nicht abscheure, sondern fein konserviere! – Doch zur Sache! – Der Alte hatte keinen Verwandten auf der ganzen Erde, als einen jüngeren Bruder, der in Amsterdam lebte. Dreißig Jahre hatten die Brüder sich nicht gesehen; da machte der Amsterdamer, von dem Verlangen getrieben, den Bruder noch einmal wiederzusehen, sich auf den Weg nach Königsberg. – Er tritt ein in das Zimmer des Alten. – Der Alte sitzt an dem Tische und betrachtet, das Haupt hinübergebeugt, durch eine Lupe einen kleinen, schwarzen Punkt auf einem weißen Blatt Papier. Der Bruder erhebt ein lautes Freudengeschrei, er will dem Alten in die Arme stürzen, der aber, ohne das Auge von dem Punkt zu verwenden, winkt ihn mit der Hand zurück, gebietet ihm mit einem wiederholten: »St-St-St-« Stillschweigen. »Bruder,« ruft der Amsterdamer, »Bruder, was hast du vor! – Georg ist da, dein Bruder ist da, aus Amsterdam hergereiset, um dich, den er seit dreißig Jahren nicht sah, noch wiederzusehen in diesem Leben!« – Aber unbeweglich bleibt der Alte und lispelt: »St-St-St-Tierchen stirbt!« – Nun bemerkt der Amsterdamer erst, daß der schwarze Punkt ein kleines Würmchen ist, das sich in den Konvulsionen des Todes krümmt und windet. Der Amsterdamer ehrt die Leidenschaft des Bruders, setzt sich still neben ihm hin. Als nun aber eine Stunde vergeht, während der Alte auch nicht mit einem Blicke sich um den Bruder kümmert, springt dieser ungeduldig auf, verläßt mit einem derben holländischen Fluch das Zimmer, setzt sich auf zur Stelle und kehrt zurück nach Amsterdam, ohne daß der Alte von allem auch nur die mindeste Notiz nimmt! – Frage Dich selbst, Eduard, ob ich, trätest Du plötzlich hinein in meine Kajüte und fändest mich vertieft in die Betrachtung irgendeines merkwürdigen Insekts, ob ich dann das Insekt unbeweglich anschauen oder Dir in die Arme stürzen würde?
Du magst, mein lieber Freund, denn auch daran denken, daß das Reich der Insekten gerade das wunderbarste, geheimnisvollste in der Natur ist. Hat es mein Freund Brougthon mit der Pflanzen – und mit der vollkommen ausgebildeten Tierwelt zu tun, so bin ich angesiedelt in der Heimat der seltsamen, oft unerforschlichen Wesen, die den Übergang, die Verknüpfung zwischen beiden bilden. – Doch! – ich höre auf, um Dich nicht zu ermüden, und setze nur noch, um Dich, um Dein poetisches Gemüt ganz zu beschwichtigen, ganz mit mir auszusöhnen, hinzu, daß ein deutscher geistreicher Dichter die in den schönsten Farbenschmelz geputzten Insekten freigewordene Blumen nennt. Erlabe Dich an diesem schönen Bilde! –
Und eigentlich – warum sagt' ich so viel, um meine Neigung zu rechtfertigen? Geschah es nicht, um mich selbst zu überreden, daß mich bloß der allgemeine Drang des Forschens unwiderstehlich nach O-Wahu treibt, daß es nicht vielmehr eine sonderbare Ahnung irgendeines unerhörten Ereignisses ist, dem ich entgegengehe? – Ja, Eduard, eben in diesem Augenblick erfaßt mich diese Ahnung mit solcher Gewalt, daß ich nicht vermögend bin, weiterzuschreiben! – Du wirst mich für einen närrischen Träumer halten, aber es ist nicht anders; deutlich steht es in meiner Seele, daß mich in O-Wahu das größte Glück oder unvermeidliches Verderben erwartet! –
Dein treuster etc.
4. Derselbe an denselben
Hana-ruru auf O-Wahu, den 12. Dezember 18..
Nein! ich bin kein Träumer, aber es gibt Ahnungen – Ahnungen, die nicht trügen! – Eduard, ich bin der glücklichste Mensch unter der Sonne, auf den höchsten Punkt des Lebens gestellt. Aber wie soll ich Dir denn alles erzählen, damit Du meine Wonne, mein unaussprechliches Entzücken ganz fühlst? – ich will mich fassen, ich will versuchen, ob ich imstande bin, Dir das alles, wie es sich zutrug, ruhig zu beschreiben.
Unfern Hana-ruru, König Teimotus Residenz, wo er uns freundlich aufgenommen, liegt eine anmutige Waldung. Dorthin begab ich mich gestern, als schon die Sonne zu sinken begann. Ich hatte vor, womöglich einen sehr seltenen Schmetterling (der Name wird Dich nicht interessieren) einzufangen, der nach Sonnenuntergang seinen irren Kreislauf beginnt. Die Luft war schwül, von wollüstigem Aroma duftender Kräuter erfüllt. Als ich in den Wald trat, fühlt' ich ein seltsam süßes Bangen, mich durchbebten geheimnisvolle Schauer, die sich auflösten in sehnsüchtige Seufzer. Der Nachtvogel, nach dem ich ausgegangen, erhob sich dicht vor mir, aber kraftlos hingen die Arme herab, wie starrsüchtig vermochte ich nicht von der Stelle zu gehen, nicht den Nachtvogel zu verfolgen, der sich fortschwang in den Wald. – Da wurde ich hineingezogen wie von unsichtbaren Händen in ein Gebüsch, das mich im Säuseln und Rauschen wie mit zärtlichen Liebesworten ansprach. Kaum hineingetreten, erblicke ich – O Himmel! – auf dem bunten Teppiche glänzender Taubenflügel liegt die niedlichste, schönste, lieblichste Insulanerin, die ich jemals gesehen! – Nein! – nur die äußeren Konture zeigten, daß das holde Wesen zu dem Geschlechte der hiesigen Insulanerinnen gehörte. – Farbe, Haltung, Aussehen, alles war sonst anders. – Der Atem stockte mir vor wonnevollem Schreck. – Behutsam näherte ich mich der Kleinen. – Sie schien zu schlafen – ich faßte sie, ich trug sie mit mir fort – das herrlichste Kleinod der Insel war mein! – Ich nannte sie Haimatochare, klebte ihr ganzes kleines Zimmer mit schönem Goldpapiere aus, bereitete ihr ein Lager von eben den bunten, glänzenden Taubenfedern, auf denen ich sie gefunden! – Sie scheint mich zu verstehen, zu ahnen, was sie mir ist! – Verzeih mir, Eduard – ich nehme Abschied von Dir – ich muß sehen, was mein liebliches Wesen, meine Haimatochare macht, – ich öffne ihr kleines Zimmer. – Sie liegt auf ihrem Lager, sie spielt mit den bunten Federchen. – O Haimatochare! – Lebe wohl, Eduard!
Dein treuester etc.
5. Brougthon an den Gouverneur von Neusüdwales
Hana-ruru, den 20. Dezember 18..
Kapitän Bligh hat Ew. Exzellenz über unsere glückliche Fahrt bereits ausführlichen Bericht erstattet und auch gewiß nicht unterlassen, die freundliche Art zu rühmen, mit der unser Freund Teimotu uns aufgenommen. Teimotu ist entzückt über Ew. Exzellenz reiches Geschenk und wiederholt ein Mal über das andere, daß wir alles, was O-Wahu nur für uns Nützliches und Wertes erzeugt, als unser Eigentum betrachten sollen. Auf die Königin Kahumanu hat der goldgestickte rote Mantel, den Ew. Exzellenz mir als für sie bestimmtes Geschenk mitzugeben die Gnade hatten, einen tiefen Eindruck gemacht, so daß sie ihre vorige unbefangene Heiterkeit verloren und in allerlei fantastische Schwärmereien geraten ist. Sie geht am frühen Morgen in das tiefste, einsamste Dickicht des Waldes und übt sich, indem sie den Mantel bald auf diese, bald auf jene Art über die Schultern wirft, in mimischen Darstellungen, die sie abends dem versammelten Hofe zum besten gibt. Dabei wird sie oft von einer seltsamen Trostlosigkeit befallen, die dem guten Teimotu nicht wenigen Kummer verursacht! – Mir ist es indessen doch schon oft gelungen, die jammervolle Königin aufzuheitern durch ein Frühstück von gerösteten Fischen, die sie sehr gern ißt und dann ein tüchtiges Glas Gin oder Rum daraufsetzt, welches ihren sehnsüchtigen Schmerz merklich lindert. Sonderbar ist es, daß Kahumanu unserm Menzies nachläuft auf Steg und Weg, ihn, glaubt sie sich unbemerkt, in ihre Arme schließt und mit den süßesten Namen nennt. Ich möchte beinahe glauben, daß sie ihn heimlich liebt.
Sehr leid tut es mir übrigens, Ew. Exzellenz melden zu müssen, daß Menzies, von dem ich alles Gute hoffte, in meinen Forschungen mich mehr hindert als fördert. Kahumanus Liebe scheint er nicht erwidern zu wollen, dagegen ist er von einer andern törichten, ja frevelhaften Leidenschaft ergriffen, die ihn verleitet hat, mir einen, sehr argen Streich zu spielen, der, kommt Menzies nicht von seinem Wahn zurück, uns auf immer entzweien kann. Ich bereue selbst, Ew. Exzellenz gebeten zu haben, ihm zu gestatten, daß er der Expedition nach O-Wahu folge. Doch wie konnte ich glauben, daß ein Mann, den ich so viele Jahre hindurch bewährt gefunden, sich plötzlich in seltsamer Verblendung auf solche Weise ändern sollte. Ich werde mir erlauben, Ew. Exzellenz von den näheren Umständen des mich tief kränkenden Vorfalls ausführlichen Bericht zu erstatten, und sollte Menzies nicht, was er tat, wieder gutmachen, Ew. Exzellenz Schutz gegen einen Mann zu erbitten, der sich erlaubt, feindselig zu handeln, da, wo er mit unbefangener Freundschaft aufgenommen wurde. Mit tiefem Respekt etc.
6. Menzies an Brougthon
Nein, nicht länger kann ich es ertragen! – Du weichst mir aus, Du wirfst mir Blicke zu, in denen ich Zorn und Verachtung lese, Du sprichst von Treulosigkeit, von Verrat, so daß ich es auf mich beziehen muß! – Und doch suche ich im ganzen Reiche der Möglichkeit vergebens eine Ursache aufzufinden, die Dein Benehmen gegen Deinen treusten Freund auf irgendeine Weise rechtfertigen könnte. Was tat ich Dir, was unternahm ich, das Dich kränkte? Gewiß ist es nur ein Mißverständnis, das Dich an meiner Liebe, an meiner Treue einen Augenblick zweifeln läßt. Ich bitte Dich, Brougthon, kläre das unglückliche Geheimnis auf, werde wieder mein, wie Du es warst.
Davis, der Dir dies Blatt überreicht, hat Befehl, Dich zu bitten, daß Du auf der Stelle antwortest. Meine Ungeduld wird mir zur qualvollsten Pein.
7. Brougthon an Menzies
Du frägst noch, wodurch Du mich beleidigt? In der Tat, diese Unbefangenheit steht dem wohl an, der gegen Freundschaft, nein, gegen die allgemeinen Rechte, wie sie in der bürgerlichen Verfassung bestehen, frevelte auf empörende Art! – Du willst mich nicht verstehen? Nun, so rufe ich Dir denn, daß es die Welt höre und sich entsetze über Deine Untat – ja, so rufe ich Dir denn den Namen ins Ohr, der Deinen Frevel ausspricht! – Haimatochare! – Ja, Haimatochare hast Du die genannt, die Du mir geraubt, die Du verborgen hältst vor aller Welt, die mein war, ja, die ich mit süßem Stolz mein nennen wollte in ewig fortdauernden Annalen! – Aber nein! – noch will ich nicht verzweifeln an Deiner Tugend, noch will ich glauben, daß Dein treues Herz die unglückliche Leidenschaft besiegen wird, die Dich fortriß im jähen. Taumel! – Menzies! – Gib mir Haimatochare heraus, und ich drücke Dich als meinen treusten Freund, als meinen Herzensbruder an meine Brust! Vergessen ist dann aller Schmerz der Wunde, die Du mir schlugst durch Deine – unbesonnene Tat. Ja – nur unbesonnen, nicht treulos, nicht frevelhaft will ich Haimatochares Raub nennen. – Gib mir Haimatochare heraus! –
8. Menzies an Brougthon
Freund! welch ein seltsamer Wahnsinn hat Dich ergriffen? – Dir – Dir sollte ich Haimatochare geraubt haben? Haimatochare, die, so wie ihr ganzes Geschlecht, Dir auch nicht im mindesten etwas angeht – Haimatochare, die ich frei, in der freien Natur auf dem schönsten Teppiche schlafend fand, der erste, der sie betrachtete mit liebenden Augen, der erste, der ihr Namen gab und Stand! – In Wahrheit, nennst Du mich treulos, so muß ich Dich verrückt schelten, daß Du, von einer schnöden Eifersucht verblendet, in Anspruch nimmst, was mein eigen geworden und bleiben wird immerdar. Mein ist Haimatochare, und mein werde ich sie nennen in jenen Annalen, wo du prahlerisch zu prunken gedenkest mit dem Eigentum des andern. – Nie werd' ich meine geliebte Haimatochare von mir lassen, alles, ja mein Leben, das nur durch sie sich zu gestalten vermag, geb' ich freudig hin für Haimatochare! –
9. Brougthon an Menzies
Schamloser Räuber! – Haimatochare soll mir nichts angehen? In der Freiheit hast Du sie gefunden? – Lügner! war der Teppich, auf dem Haimatochare schlief, nicht mein Eigentum; mußtest Du nicht daran erkennen, daß Haimatochare mir – mir allein angehörte? Gib mir Haimatochare heraus, oder kund mache ich der Welt Deinen Frevel. Nicht ich, Du – Du allein bist von der schnödesten Eifersucht verblendet, Du willst prunken mit fremdem Eigentume, aber das soll Dir nicht gelingen. Gib mir Haimatochare heraus, oder ich erkläre Dich für den niedrigsten Schurken! –
10. Menzies an Brougthon
Dreifacher Schurke Du selbst! Nur mit meinem Leben lasse ich Haimatochare!
11. Brougthon an Menzies
Nur mit Deinem Leben läßt Du Schurke Haimatochare? – Gut, so mögen denn morgen abends um sechs Uhr auf dem öden Platze vor Hana-ruru unfern des Vulkans die Waffen über Haimatochares Besitz entscheiden. Ich hoffe, daß Deine Pistolen im Stande sind.
12. Menzies an Brougthon
Ich werde mich zur bestimmten Stunde am bestimmten Platz einfinden. Haimatochare soll Zeugin des Kampfes sein um ihren Besitz.
13. Kapitän Bligh an den Gouverneur von Neusüdwales
Hana-ruru auf O-Wahu, den 26. Dezember 18..
Ew. Exzellenz den entsetzlichen Vorfall, der uns zwei der schätzbarsten Männer geraubt hat, zu berichten, ist mir traurige Pflicht. Längst hatte ich bemerkt, daß die Herren Menzies und Brougthon, welche sonst, in innigster Freundschaft verbunden, ein Herz, eine Seele schienen, die sonst sich nicht zu trennen vermochten, miteinander entzweit waren, ohne daß ich auch nur im mindesten erraten konnte, was wohl die Ursache davon sein könne. Zuletzt vermieden sie mit Sorgfalt, sich zu nähern, und wechselten Briefe, die unser Steuermann Davis hin und her tragen mußte. Davis erzählte mir, daß beide bei dem Empfang der Briefe immer in die höchste Bewegung geraten wären, und daß vorzüglich Brougthon zuletzt ganz Feuer und Flamme gewesen. Gestern abend hatte Davis bemerkt, daß Brougthon seine Pistolen lud und hinauseilte aus Hana-ruru. Er konnte mich nicht gleich auffinden. Auf der Stelle, als er mir endlich den Verdacht mitteilte, daß Menzies mit Brougthon wohl ein Duell vorhaben könnte, begab ich mich mit dem Leutnant Collnet und dem Schiffschirurgus Herrn Whidby hinaus nach dem öden Platz unfern des vor Hana-ruru liegenden Vulkans. Denn dort, schien mir, war wirklich von einem Duell die Rede, die schicklichste Gegend dazu zu sein. Ich hatte mich nicht getäuscht. Noch ehe wir den Platz erreicht, hörten wir einen Schuß und unmittelbar darauf den zweiten. Wir beschleunigten unsere Schritte, so gut wir es vermochten, und doch kamen wir zu spät. Wir fanden Menzies und Brougthon in ihrem Blute auf der Erde liegen, dieser durch den Kopf, jener durch die Brust tödlich getroffen, beide ohne die mindeste Spur des Lebens. – Kaum zehn Schritte hatten sie auseinander gestanden, und zwischen ihnen lag der unglückliche Gegenstand, den mir Menzies' Papiere als die Ursache, die Brougthons Haß und Eifersucht entzündete, bezeichnen. In einer kleinen, mit schönem Goldpapier ausgeklebten Schachtel fand ich unter glänzenden Federn ein sehr seltsam geformtes, schön gefärbtes kleines Insekt, das der naturkundige Davis für ein Läuslein erklären wollte, welches jedoch, was vorzüglich Farbe und die ganz sonderbare Form des Hinterleibes und der Füßchen anlange, von allen bis jetzt aufgefundenen Tierchen der Art merklich abweiche. Auf dem Deckel stand der Name: Haimatochare.
Menzies hatte dieses seltsame, bis jetzt unbekannte Tierchen auf dem Rücken einer schönen Taube, die Brougthon herabgeschossen, gefunden und wollte dasselbe, als dessen erster Finder, unter dem eignen Namen: Haimatochare in der naturkundigen Welt einführen, Brougthon behauptete dagegen, daß er der erste Finder sei, da das Insekt auf dem Körper der Taube gesessen, die er herabgeschossen, und wollte die Haimatochare sich aneignen. Darüber entstand der verhängnisvolle Streit zwischen den beiden edlen Männern, der ihnen den Tod gab.
Vorläufig bemerke ich, daß Herr Menzies das Tierchen für eine ganz neue Gattung erklärt und es in die Mitte stellt zwischen: pediculus pubescens, thorace trapezoideo, abdomine ovali posterius emarginato ab latere undulato etc. habitans in homine, Hottentottis, Groenlandisque escam dilectam praebens, und zwischen: nirmus crassicornis, capite ovato oblongo, scutello thorace majore, abdomine lineari lanceolato, habitans in anate, ansere et boschade.
Aus diesen Andeutungen des Herrn Menzies werden Ew. Exzellenz schon zu ermessen geruhen, wie einzig in seiner Art das Tierchen ist, und ich darf, unerachtet ich kein eigentlicher Naturforscher bin, wohl hinzusetzen, daß das Insekt, aufmerksam durch die Lupe betrachtet, etwas ganz ungemein Anziehendes hat, das vorzüglich den blanken Augen, dem schön gefärbten Rücken und einer gewissen anmutigen, solchen Tierchen sonst gar nicht eignen Leichtigkeit der Bewegung zuzuschreiben ist.
Ich erwarte Ew. Exzellenz Befehl, ob ich das unglückselige Tierchen wohlverpackt für das Museum einsenden oder als die Ursache des Todes zweier vortrefflichen Menschen in die Tiefe des Meeres versenken soll.
Bis zu Ew. Exzellenz hohen Entscheidung bewahrt Davis die Haimatochare in seiner baumwollnen Mütze. Ich habe ihn für ihr Leben, für ihre Gesundheit verantwortlich gemacht. Genehmigen Ew. Exzellenz die Versicherung etc.
14. Antwort des Gouverneurs
Port Jackson, den 1. Mai 18..
Mit dem tiefsten Schmerz hat mich, Kapitän, Ihr Bericht von dem unglückseligen Tode unserer beiden wackern Naturforscher erfüllt. Ist es möglich, daß der Eifer für die Wissenschaft den Menschen so weit treiben kann, daß er vergißt, was er der Freundschaft, ja dem Leben in der bürgerlichen Gesellschaft überhaupt schuldig ist? – Ich hoffe, daß die Herren Menzies und Brougthon auf die anständigste Weise begraben worden sind.
Was die Haimatochare betrifft, so haben Sie, Kapitän, dieselbe den unglücklichen Naturforschern zur Ehre mit den gewöhnlichen Honneurs in die Tiefe des Meeres zu versenken. Verbleibend etc.
15. Kapitän Bligh an den Gouverneur von Neusüdwales
Am Bord der Diskovery, den 5. Oktober 18..
Ew. Exzellenz Befehle in Ansehung der Haimatochare sind befolgt. In Gegenwart der festlich gekleideten Mannschaft, sowie des Königes Teimotu und der Königin Kahumanu, die mit mehreren Großen des Reichs an Bord gekommen waren, wurde gestern abend Punkt sechs Uhr von dem Leutnant Collnet Haimatochare aus der baumwollnen Mütze des Davis genommen und in die mit Goldpapier ausgeklebte Schachtel getan, die sonst ihre Wohnung gewesen und nun ihr Sarg sein sollte, diese Schachtel aber dann an einen großen Stein befestigt und von mir selbst unter dreimaliger Abfeuerung des Geschützes in das Meer geworfen. Hierauf stimmte die Königin Kahumanu einen Gesang an, in den sämtliche O-Wahuer einstimmten und der so abscheulich klang, als es die erhabene Würde des Augenblicks erforderte. Hierauf wurde das Geschütz noch dreimal abgefeuert und Fleisch und Rum unter die Mannschaft verteilt. Teimotu, Kahumanu, sowie die übrigen O-Wahuer wurden mit Grog und andern Erfrischungen bedient. Die gute Königin kann sich noch gar nicht zufrieden geben über den Tod ihres lieben Menzies. Sie hat sich, um das Andenken des geliebten Mannes zu ehren, einen großen Haifischzahn in den Hintern gebohrt und leidet von der Wunde noch große Schmerzen.
Noch muß ich erwähnen, daß Davis, der treue Pfleger der Haimatochare, eine sehr rührende Rede hielt, worin er, nachdem er Haimatochares Lebenslauf in der Kürze beschrieben, von der Vergänglichkeit alles Irdischen handelte. Die härtesten Matrosen konnten sich der Tränen nicht enthalten, und dadurch, daß er in abgesetzten Pausen ein zweckmäßiges Geheul ausstieß, brachte Davis es auch dahin, daß die O-Wahuer entsetzlich heulten, welches die Würde und Feierlichkeit der Handlung nicht wenig erhöhte.
Die Marquise de la Pivardiere
(Nach Richers Causes célèbres)
Ein Mensch gemeinen Standes, namens Barré, hatte seine Braut zu später Abendzeit in das Boulogner Holz gelockt und sie dort, da er, ihrer überdrüssig, um eine andere buhlte, mit vielen Messerstichen ermordet.
Das Mädchen, die Gartenfrüchte feilhielt, war ihrer ausnehmenden Schönheit, ihres sittlichen Betragens halber allgemein bekannt unter dem Namen der schönen Antoinette. So kam es, daß ganz Paris erfüllt war von Barrés Untat, und daß auch in der Abendgesellschaft, die sich bei der Duchesse d'Aiguillon zu versammeln pflegte, von nichts anderm gesprochen wurde als von der entsetzlichen Ermordung der armen Antoinette.
Die Duchesse verlor sich gern in moralische Betrachtungen, und so entwickelte sie auch jetzt mit vieler Beredsamkeit, daß nur heillose Vernachlässigung des Unterrichts und der Religiosität bei dem gemeinen Volk Verbrechen erzeuge, die den höhern, in Geist und Gemüt gebildeten Ständen fremd bleiben müßten.
Der Graf von St. Hermine, sonst das rege Leben jeder Gesellschaft, war an dem Abend tief in sich gekehrt, und die Blässe seines Gesichts verriet, daß irgendein feindliches Ereignis ihn verstört haben mußte. Er hatte noch kein Wort gesprochen; jetzt, da die Duchesse ihre moralische Abhandlung geschlossen, begann er: »Verzeiht, gnädigste Frau! Barré liest vortrefflich, schreibt eine schöne Hand, kann sogar rechnen, spielt überdies nicht übel die Geige; und was seine Religion betrifft, so hat er Freitags in seinem Leben niemals auch nur eine Unze Fleisch genossen, regelmäßig seine Messe gehört und noch an dem Morgen, als er abends darauf den Mord beging, gebeichtet. Was könnt Ihr gegen seine Bildung, gegen seine Religiosität einwenden?«
Die Duchesse meinte, daß der Graf durch seine bittre Bemerkung ihr und der Gesellschaft den unausstehlichen Unmut entgelten lassen wolle, der ihm heute seine ganze Liebenswürdigkeit raube. Man setzte das vorige Gespräch fort, und ein junger Mann stand im Begriff, noch einmal alle Umstände der Tat Barrés auf das genaueste zu beschreiben, als der Graf von Saint Hermine sich ungeduldig von seinem Sitze erhob und auf das heftigste erklärte, man würde ihn augenblicklich verjagen, wenn man nicht ein Gespräch ende, das mit scharfen Krallen in seine Brust greife und eine Wunde aufreiße, deren Schmerz er wenigstens auf Augenblicke in der Gesellschaft zu verwinden gehofft.
Alle drangen in ihn, nun nicht länger mit der Ursache seines Unmuts zurückzuhalten. Da sprach er: »Man wird es nicht mehr Unmut nennen, was mich heute langweilig, unausstehlich erscheinen läßt; man wird es mir, meinem gerechten Schmerz verzeihen, daß ich das Gespräch über Barrés Untat nicht zu ertragen vermag, wenn ich offenbare, was mein ganzes Inneres tief erschüttert. Ein Mann, den ich hochschätzte, der sich in meinem Regiment stets brav, tapfer, mir innig ergeben bewies, der Marquis de la Pivardiere, ist vor drei Nächten auf die grausamste Weise in seinem Bette ermordet worden.«
»Himmel,« rief die Duchesse, »welch' neue entsetzliche Untat! Wie konnte das geschehen! Die arme unglückliche Marquise!«
Auf dies Wort der Duchesse vergaß man den ermordeten Marquis, bedauerte nur die Marquise und erschöpfte sich in Lobeserhebungen der anmutigen geistreichen Frau, deren strenge Tugend, deren edler Sinn als Muster gegolten und die schon als Demoiselle du Chauvelin die Zierde der ersten Zirkel in Paris gewesen sei.
»Und,« sprach der Graf mit dem ins Innere dringenden Ton der tiefsten Erbitterung, »und diese geistreiche tugendhafte Frau, die Zierde der ersten Zirkel in Paris, diese war es, die ihren Gemahl erschlug mit Hilfe ihres Beichtvaters, des verruchten Charost!« –
Stumm, von Entsetzen erfaßt, starrte alles den Grafen an, der sich vor der Duchesse, die der Ohnmacht nahe, tief verbeugte und dann den Saal verließ. –
Franziska Margarete Chauvelin hatte in früher Kindheit ihre Mutter verloren, und so war ihre Erziehung ganz das Werk ihres Vaters geblieben, eines geistreichen, aber strengen, ernsten Mannes. Der Ritter Chauvelin glaubte daran, daß es möglich sei, das weibliche Gemüt zur Erkenntnis seiner eignen Schwächen zu bringen, und daß diese eben dadurch weggetilgt werden könnten. Sein starrer Sinn verschmähte jene hohe Liebenswürdigkeit der Weiber, die sich aus der subjektiven Ansicht des Lebens von dem Standpunkt aus, auf den sie die Natur gestellt hat, erzeugt; und eben in dieser Ansicht liegt ja der Ursprung aller der Äußerungen einer innern Gemütsstimmung, die in demselben Augenblick, da sie uns launisch, beschränkt, kleinartig bedünken will, uns unwiderstehlich hinreißt. Der Ritter meinte ferner, daß, um zu jenem Zweck zu gelangen, es vorzüglich nötig sei, jeden weiblichen Einfluß auf das junge Gemüt zu verhindern; auf das sorglichste entfernte er daher von seiner Tochter alles, was nur Gouvernante heißen mag, und wußte es auch geschickt anzufangen, daß keine Gespielin es dahin brachte, sich mit Franziska in gleiche Farbe zu kleiden und ihr die kleinen Geheimnisse eines durchtanzten Balls o.s. zu vertrauen. Nebenher sorgte er dafür, daß Franziskas notwendigste weibliche Bedienung aus geckenhaften Dingern bestand, die er dann als Scheubilder des verkehrten weiblichen Sinns aufstellte. Vorzüglich richtete er auch, als Franziska in die Jahre gekommen, daß davon die Rede sein konnte, die vernichtenden Pfeile seiner Ironie gegen die süße Schwärmerei der Liebe, die den weiblichen Sinn erst recht nach seiner innersten Bedeutung gestaltet, und die wohl nur bei einem Jünglinge oft ins Fratzenhafte abarten mag.
Glück für Franziska, daß des Ritters Glaube ein arger Irrtum war. So sehr er sich mühte, dem tief weiblichen Gemüt Franziskas die Rauhigkeit eines männlichen Geistes, der das Spiel des Lebens verachtet, weil er es zu verstehen, es durchzuschauen vermeint, anzuerziehen; es gelang ihm nicht, die hohe Anmut und Liebenswürdigkeit, der Mutter Erbteil, zu zerstören, die immer mehr herausstrahlte aus Franziskas Innern, und die er in seltsamer Selbsttäuschung für die Frucht seiner weisen Erziehung hielt, ohne daran zu denken, daß er ja eben dagegen seine gefährlichsten Waffen gerichtet.
Franziska konnte nicht schön genannt werden, dazu waren die Züge ihres Antlitzes nicht regelmäßig genug; der geistreiche Feuerblick der schönsten Augen, das holde Lächeln, das um Mund und Wangen spielte, eine edle Gestalt im reinsten Ebenmaß der Glieder, die hohe Anmut jeder Bewegung, alles dieses gab indessen Franziskas äußerer Erscheinung einen unnennbaren Reiz. Kam nun noch hinzu, daß die viel zu gelehrte Bildung, die ihr der Vater gegeben, und die sonst nur zu leicht das innerste, eigentliche Wesen des Weibes zerstört, ohne daß ein Ersatz möglich, ihr nur diente, richtig zu verstehen, aber nicht abzusprechen, daß die Ironie, die ihr vielleicht von des Vaters Geist zugekommen, sich in ihrem Sinn und Wesen zum gemütlichen lebensvollen Scherz umgestaltete: so konnt' es nicht fehlen, daß sie, als der Vater, den Ansprüchen des Lebens nachgebend, sie einführte, in die sogenannte große Welt, bald der Abgott aller Zirkel wurde.
Man kann denken, mit welchem Eifer sich Jünglinge und Männer um die holde, geistreiche Franziska bemühten. Diesen Bemühungen stellten sich nun aber die Grundsätze entgegen, die der Ritter du Chauvelin seiner Tochter eingeflößt. Hatte sich auch irgendein Mann, dem die Natur alles verliehen, um den Weibern zu gefallen, Franziskan mehr und mehr genähert, wollte ihr Herz sich ihm hinneigen, dann trat ihr plötzlich der fratzenhafte Popanz eines verliebten Weibes vor Augen, den der Vater herbeigezaubert, und der Schreck, die Furcht vor dem Scheubilde tötete jedes Gefühl der Liebe im ersten Aufkeimen. Da es unmöglich war, Franziska stolz, spröde, kalt zu nennen, so geriet man auf den Gedanken eines geheimen Liebesverständnisses, auf dessen Entwickelung man begierig wartete, wiewohl vergebens. Franziska blieb unverheiratet bis in ihr fünfundzwanzigstes Jahr. Da starb der Ritter, und Franziska, seine einzige Erbin, kam in den Besitz des Ritterguts Nerbonne.
Die Duchesse d'Aiguillon (wir haben sie in dem Eingange der Geschichte kennen gelernt) fand es nun nötig, sich um Franziskas Wohl und Weh, um ihre Verhältnisse zu kümmern, da sie es nicht für möglich hielt, daß ein Mädchen, sei sie auch fünfundzwanzig Jahre alt geworden, sich selbst beraten könne. Gewohnt, alles auf gewisse feierliche Weise zu betreiben, versammelte sie eine Anzahl Frauen, die über Franziskas Tun und Lassen Rat hielten und endlich darin übereinkamen, daß ihre jetzige Lage es durchaus erfordere, sich zu vermählen.
Die Duchesse übernahm selbst die schwierige Aufgabe, das ehescheue Mädchen zur Befolgung dieses Beschlusses zu bewegen, und freute sich im voraus über den Triumph ihrer Überredungskunst. Sie begab sich zu der Chauvelin und bewies ihr in einer wohlgesetzten Rede, die ihr nicht wenig Kopfbrechens gekostet, daß sie endlich den Bedingnissen des Lebens nachgeben, ihren Starrsinn, ihre Sprödigkeit ablegen, rücksichtslos dem Gefühl der Liebe Raum lassen und einen Mann, der ihrer wert, mit ihrer Hand beglücken müsse.
Franziska hatte die Duchesse mit ruhigem Lächeln angehört, ohne sie ein einziges Mal zu unterbrechen. Nicht wenig erstaunte die Duchesse aber jetzt, als Franziska erklärte, daß sie ganz ihrer Meinung sei, daß ihre Lage, der Besitz der weitläuftigen Güter, die Verwaltung des Vermögens durchaus erfordere, sich durch die Vermählung mit einem ehrenwerten Manne ihres Standes im Leben fest zu stellen. Sie sprach dann von dieser Vermählung wie von einem Geschäft, das, von ihrem Verhältnis herbeigeführt, notwendig abgeschlossen werden müsse, und meinte, daß sie vielleicht bald imstande sein werde, unter ihren Bewerbern den zu wählen, der sich als den vernünftigsten, ruhigsten bewährt.
»Fräulein,« rief die Duchesse, »Fräulein, sollte Euer reiches Gemüt, Euer empfänglicher Sinn denn ganz verschlossen sein dem schönsten Gefühl, das die Sterblichen beglückt? – Habt Ihr denn niemals, niemals geliebt?«.
Franziska versicherte, daß dies niemals der Fall gewesen sei, und entwickelte dann die Theorie ihres Vaters über ein Gefühl, das ein böses Prinzip in der Natur mit heilloser Ironie in die menschliche Brust gelegt, da es die Urkraft des menschlichen Geistes breche und nichts herbeiführe als ein durch Demütigungen, durch lächerliche Narrheiten aller Art verstörtes Leben.
Die Duchesse geriet ganz außer sich über die abscheulichen Grundsätze und begann Franziska tüchtig auszuschelten, daß sie einer Lehre gefolgt, die sie geradezu ruchlos und teuflisch nannte, da sie der innersten Natur des Weibes zuwider sei und eben das bewirken müsse, was sie dem höchsten Gefühle schuld gebe, nämlich ein armseliges verstörtes Leben. Zuletzt faßte sie des Fräuleins Hand und sprach, indem ihr die Tränen in die Augen traten: »Nein, mein gutes teures Kind, nein, es ist nicht möglich; du täuschest dich selbst, du gibst dich uns schlechter, als du wirklich bist; fremd sind dir jene Grundsätze eines strengen, starren Mannes, der dem Leben feindlich entgegentrat! – Du hast geliebt und widerstrebtest nur im ungekünstelten Eigensinn deiner innern Regung! – Sei aufrichtig, erwäge jeden Augenblick deines Lebens! – Es ist nicht möglich, daß es keinen geben sollte, in dem nicht das Gefühl der Liebe plötzlich eindrang in dein eisumpanzertes Herz!«
Franziska stand im Begriff, der Duchesse zu antworten, als plötzlich ein Gedanke wie ein Blitz sie zu durchzucken schien. Über und über errötend, dann zum Tode erbleichend, starrte sie zur Erde nieder; ein tiefer Seufzer stieg aus der Brust empor, dann begann sie: »Ja, ich will aufrichtig sein – Ja, es gab in meinem Leben einen Moment, in dem mich mit zerstörender Gewalt ein Gefühl überraschte, das ich verabscheuen lernte und noch verabscheue!« –
»Weh dir!« rief die Duchesse, »weh dir, aber sprich!«
»Ich hatte«, erzählte Franziska, »eben mein sechzehntes Jahr zurückgelegt, als mein Vater mich in Eure Zirkel, gnädigste Frau, einführte. Ihr verstandet meine Befangenheit zu besiegen, mich dahin zu bringen, meiner Laune mich ganz hinzugeben. Man fand das, was ich jetzt als ausgelassen verwerfen würde, damals über die Maßen liebenswürdig, und ich hätte eitel genug sein können, mich für die gefeierte Königin der Gesellschaft zu halten.«
»Das wart Ihr, das wart Ihr!« unterbrach die Duchesse das Fräulein.
»Ich weiß nicht mehr,« fuhr das Fräulein fort, »was ich eben sprach, aber es erregte die Teilnahme der ganzen Gesellschaft so sehr, daß in dem tiefsten Stillschweigen aller Blicke starr auf mich gerichtet waren und ich beschämt die Augen niederschlug.
Es war mir, als vernähme ich ganz in meiner Nähe den Namen Franziska! wie einen leisen Seufzer. – Unwillkürlich schaue ich auf – mein Blick fällt auf einen Jüngling, den ich so lange noch gar nicht bemerkt; – aber ein unbekanntes Feuer strahlt aus seinen dunklen Augen und durchdringt mein Innerstes wie ein glühender Dolch, – mich erfaßt ein namenloser Schmerz, – es ist mir, als müsse ich sterbend niedersinken, aber der Tod sei das höchste seligste Entzücken des Himmels. – Keines Wortes mächtig, vermag ich nur, von süßer Qual gepeinigt, tief aufzuseufzen – Tränen strömen mir aus den Augen – Man hält mich für plötzlich erkrankt, man bringt mich in ein Nebenzimmer, man schnürt mich auf, man braucht alle Mittel, die zur Hand sind, mich aus dem entsetzlichen Zustande zu reißen. – In tötender Angst, ja in Verzweiflung versichere ich endlich, daß alles vorüber, daß mir wieder wohl sei. – Ich verlange zurück in die Gesellschaft. – Meine Augen suchen, finden ihn – ich sehe nichts als ihn – ihn! – Ich erbebe vor dem Gedanken, daß er sich mir nähern könne, und doch ist es eben dieser Gedanke, der mich mit dem süßesten, nie gefühlten, nie geahneten Entzücken durchströmt! – – Mein Vater mußte meinen überreizten Zustand bemerken, konnte er auch vielleicht dessen Ursache nicht erforschen; er führte mich schnell fort aus der Gesellschaft. –
So jung ich war, mußte ich doch wohl erkennen, daß das böse verstörende Prinzip auf mich eingedrungen, vor dem mich der Vater so sehr gewarnt, und eben die Gewalt, der ich beinahe erlegen, ließ mich die Wahrheit alles dessen, was er darüber gesagt, vollkommen einsehen. Ich kämpfte einen schweren Kampf; aber ich siegte; das Bild des Jünglings verschwand, ich fühlte mich froh und frei, ich wagte mich wieder in Eure Gesellschaft, gnädigste Frau; aber ich fand den Gefürchteten nicht wieder. Dem Schicksal oder vielmehr jenem bösen Prinzip des Lebens genügte aber nicht mein Sieg; ein schwererer Kampf stand mir bevor. – Mehrere Wochen waren vergangen, als ich, da eben die Abenddämmerung einzubrechen beginnt, im Fenster liege und hinaussehe auf die Straße. Da erblicke ich jenen Jüngling, der zu mir hinaufschaut, mich grüßt und dann geradezu losschreitet auf die Tür des Hauses. – Weh mir! – mit verdoppelter Kraft ergreift mich jene entsetzliche Macht! – Er kommt, er sucht dich auf! – Dieser Gedanke, – Entzücken, – Verzweiflung – raubt mir die Sinne! – Als ich aus tiefer Ohnmacht erwachte, lag ich ausgekleidet auf dem Sofa; mein Vater stand bei mir, ein Naphthafläschchen in der Hand. Er fragte, ob mir etwas Besonderes begegnet. Er habe die Tür meines Zimmers öffnen, wieder verschließen und dann Tritte die Treppe herab gehört, die ihm männliche hätten bedünken wollen, mich aber zu seinem nicht geringen Schreck ohnmächtig auf der Erde liegend gefunden. Ich konnte, ich durfte ihm nichts sagen; doch schien er das Geheimnis zu ahnen, denn des Nervenfiebers, das mich an den Rand des Grabes brachte, unerachtet, traf mich seine bittre Ironie, die er gegen verfängliche Ohnmachten eines verdrießlichen Liebesfiebers richtete. Ich danke ihm das; denn er verhalf mir zum zweiten Siege, der mir glorreicher schien als der erste.«
Die Duchesse umarmte, küßte und herzte voller Freude das Fräulein. Sie versicherte, daß nun alles sich gar herrlich fügen werde; auf den erfochtenen Sieg gebe sie ganz und gar nichts; vielmehr werde sie, da sie ein Tagebuch führe, in dem jede Person, die ihre Abendgesellschaft besucht, und was dabei vorgefallen, genau aufgezeichnet stehe, sehr leicht den Jüngling ausfindig machen, der Franziskas Liebe errungen, und so ein Liebespaar vereinen, das abscheuliche Grundsätze eines starrsinnigen Vaters getrennt.
Franziska versicherte dagegen, daß, wenn der Jüngling, der nun nach beinahe zehn Jahren wohl ein Mann worden, wirklich noch unverheiratet sei und sich um ihre Hand bewerben wolle, sie sich doch nimmermehr mit ihm vermählen werde, da die Erinnerung an jene verhängnisvollen Augenblicke ihr Leben durchaus verstören müsse.
Die Duchesse schalt sie ein eigensinniges Ding und meinte sogar, daß die Stunde der Erkenntnis vielleicht zu spät und dann unwiederbringliches Verderben über Franziska kommen könne.
Das Fräulein meinte, daß, da sie sich zehn Jahre hindurch bewährt, wohl eine Änderung ihres Sinns unmöglich gedacht werden könne. Auch übereilte sie sich eben nicht mit der ihr selbst so notwendig dünkenden Wahl eines Gatten, denn beinahe drei Jahre vergingen, und noch war sie unverheiratet.
»Seltsam wie sie ist, wird sie das Seltsame unerwartet tun«, sprach die Duchesse d'Aiguillon und hatte recht; denn niemand hatte geahnet, daß Franziska dem Marquis de la Pivardiere ihre Hand reichen würde, wie es wirklich geschah.
Der Marquis de la Pivardiere war unter Franziskas Bewerbern derjenige, dessen Ansprüche auf ihre Hand gerade die geringsten schienen. Von mittelmäßiger Gestalt, trocknem Wesen, etwas unbehilflichem Geiste, stellte er sich in der Gesellschaft eben nicht glänzend dar. Er war gleichgültig gegen das Leben, weil er es in früherer Zeit vergeudet, und diese Gleichgültigkeit, die bisweilen überging in Verachtung, ließ sich oft aus in beißenden Spott. Dabei gehörte er zu den unentschiedenen Charakteren, die niemals Böses tun ohne dringenden Anlaß, und Gutes, wenn es sich gerade so fügen will und sie nicht besonders daran denken dürfen.
Franziska glaubte in der Art, wie sich der Marquis gab, in seinen Meinungen und Grundsätzen viel Ähnliches mit ihrem Vater zu finden, und dies veranlaßte sie, sich ihm mehr anzunähern. Der Marquis, schlau genug, einzusehen, worauf es ankomme, um sie für sich zu gewinnen, hatte nichts Angelegentlicheres zu tun, als auf das sorglichste alles zu studieren und sich einzuprägen, was Franziska aus dem Innersten heraus vorzüglich über das Verhältnis der Ehe äußerte, und es dann als seine eigne Überzeugung vorzutragen.
Diese scheinbare Einigkeit der Gesinnung, der Gedanke, daß der Marquis unter allen denen, die um sie warben, der einzige sei, der das Leben aus dem richtigen Standpunkt betrachte und niemals Ansprüche machen werde, die sie nicht erfüllen könne, ja selbst der Umstand, daß es ihm nie eingekommen, den feurigen Liebhaber zu machen, daß er stets kalt und trocken geblieben, bestimmte Franziskas Wahl und machte den von Gläubigern verfolgten Marquis zum Herrn des Ritterguts Nerbonne.
So sehr man Ursache hatte, zu glauben, daß ein böses Mißverhältnis sich gleich in dieser Ehe offenbaren werde, so mußte man sich doch vom Gegenteil überzeugen.
Der Marquis, umstrahlt von dem Glanze der Liebenswürdigkeit seiner Gattin, schien ganz ein anderer. Das Eis, zu dem sein Inneres erstarrt, schien aufgetaut, und trotz alles Sträubens mußte man zuletzt gestehen, der Marquis de la Pivardiere sei ein ganz angenehmer Mann, mit dem die Marquise, bleibe sie ihren Grundsätzen treu, wohl glücklich sein könne.
Der Marquis begab sich mit seiner Gattin, nachdem er einige Monate in Paris gelebt, nach dem Rittergute Nerbonne, und beide führten in der Tat ein ruhiges, glückliches Leben, will man eine völlige Gleichgültigkeit gegeneinander, die gar keine Ansprüche zuläßt, dafür annehmen. Diese Stimmung änderte sich auch nicht im mindesten, als die Marquise dem Gatten eine Tochter gebar.
Mehrere Jahre waren vergangen, als der ausbrechende Krieg (1688) den Aufruf des sogenannten Arrièrebans veranlaßte, so daß der Marquis im Dienste dieses Arrièrebans von Zeit zu Zeit vom Schlosse Nerbonne sich zu entfernen genötigt ward.
Mag es sein, daß dieser Dienst ihm zu lästig war, mag es sein, daß er sich hinwegsehnte aus dem einförmigen Leben, und daß selbst das Verhältnis mit der Marquise ihm langweilig, verdrießlich geworden; genug, er suchte Dienste in der Armee, es gelang ihm, eine Eskadron in dem Dragonerregiment des Grafen Saint Hermine zu erhalten, und er blieb so vom Hause ganz entfernt. –
Eine Viertelstunde von dem Schlosse Nerbonne war die Abtei zu Miseray gelegen, welche regulierte Augustiner im Besitz hatten. Einer dieser Geistlichen verwaltete zugleich die Kapelle im Schlosse Nerbonne, welcher Dienst ihn verpflichtete, jeden Sonnabend in der Kapelle Messe zu lesen. Dieser Geistliche war denn auch altem Herkommen nach der Beichtvater der Herrschaft zu Nerbonne. So geschah es denn, daß die Marquise, statt in der Kirche zu Jeu, der eigentlichen Parochialkirche von Nerbonne, in der Kirche der Abtei Messe zu hören und zu beichten pflegte.
Da die Abtei nur eine Viertelstunde von dem Schlosse entfernt lag, so machte die Marquise den Weg dahin gewöhnlich zu Fuß.
Eines Morgens an einem Heiligentage, als die Marquise sich gerade in dem Garten des Schlosses befand, tönten die Glocken der Abtei dumpf und feierlich herüber. Die Marquise fühlte sich von einer Wehmut durchdrungen, die ihr lange fremd geblieben. Es war, als stiege die Vergangenheit vor ihr auf wie ein Traumbild, und manche liebe Gestalt, mancher schnell entflohene Moment mahne sie daran, daß sie das Leben nicht zu erfassen vermocht, als es noch grün und blühend sie umgab. Ein seltsamer Schmerz, den sie selbst nicht verstand, beengte ihre Brust, und unwillkürlich rannen ihre Tränen. In der Andacht glaubte sie Erleichterung der Qual zu finden, die ihr Inneres zerriß. Sie begab sich nach der Abtei, und während des Hochamts, das soeben begann, näherte sie sich, von unbekannter, unwiderstehlicher Gewalt getrieben, dem Beichtstuhl, den der Kapellan des Schlosses Nerbonne einzunehmen pflegte.
Als nun aber der Priester die Absolution sprach, bebte sie zusammen vor seiner Stimme, und der Ohnmacht nahe, wankte sie fort, als sie durch das Gitter das totenbleiche Antlitz des Geistlichen erblickte, aus dessen düstern Augen ein Feuerstrahl sie durchfuhr.
»Nein, es war kein Mensch, es war ein Geist, aus grauenvoller Tiefe heraufgebannt, mich, mein Leben zu zerstören!« – So sprach die Marquise, als sie ganz erschöpft auf ihr Schloß zurückgekommen. Aber von tiefem Entsetzen wurde sie erfaßt, als sie sich deutlich erinnerte, dem gespenstischen Priester gebeichtet zu haben, daß sie einst in früher Jugend, wiewohl schuldlos, einen Jüngling ermordet, dann aber Untreue an ihrem Gemahl verübt; Verbrechen, von denen auch nie die Ahnung in ihre Seele gekommen. Ebenso erinnerte sie sich, daß, als sie den Mord gebeichtet, der Geistliche einen seltsamen, herzzerschneidenden Laut des Jammers von sich gegeben, bei der Absolution aber gesagt habe, daß der Himmel ihr den Mord längst verziehen, daß aber, was die an ihrem Gemahl verübte Untreue betreffe, aufrichtige Reue und strenge Buße zwar die Tat sühnen könne, daß sie aber dafür die weltliche Rache des Gesetzes treffen werde. – Das ganze geheimnisvolle Ereignis erschien ihr wie der fürchterliche angstvolle Traum einer Wahnsinnigen; sie schickte nach der Abtei, sie wollte wissen, wer an jenem Morgen statt des Kapellans Beichte gehört.
Man benachrichtigte sie, daß der Kapellan nach einem Krankenlager von zwei Tagen soeben verschieden sei; daß aber derselbe Geistliche, der am Morgen Beichte gehört, indessen den Dienst der Kapelle im Schloß Nerbonne verwalten und den nächsten Sonnabend Messe lesen werde. »Ist es möglich,« sprach die Marquise zu sich selbst, »daß eine aufgeregte Stimmung, ich möchte sagen, der Anfall eines die Nerven erschütternden Krampfs solche Torheiten erzeugen kann? Mein Gespenst verkörpert sich; ich werde es schauen und – mich meiner Albernheit schämen.« – Als am Sonnabend in der Frühe der Geistliche, der den Dienst des Kapellans verwalten sollte, in das Zimmer der Marquise trat, als er sie, sich sanft neigend, mit einem »Gelobt sei Jesus Christus!« begrüßte, da starrte sie ihn an, sank dann nieder zu seinen Füßen und schrie ganz außer sich: »Weh mir! – ja, du bist es, du bist der Jüngling, den ich in früher Jugend ermordet.«
»Faßt Euch, Frau Marquise,« sprach der Geistliche ruhig, indem er die Marquise aufhob und zum Lehnstuhl führte, »ich bitte Euch, überwindet den Schmerz, der – ach, vielleicht nur zu tötend Eure Brust zerreißt, da keine Reue das ersetzt, was unwiederbringlich verloren!« –
»Haltet,« begann die Marquise mit bebender Stimme, »haltet mich nicht für wahnsinnig, ehrwürdiger Herr! – Euer bleiches Antlitz, Euer ergrautes Haar – und doch seid Ihr es, ja, Ihr seid der Jüngling, den ich einst bei der Duchesse d'Aiguillon erblickte, der in meiner Brust alles tötende Entzücken, alle brünstige Qual eines Gefühls erweckte, das mir ewig fremd bleiben sollte! – Weh mir! – was ist es, das noch jetzt, da ich Euch wiedersehe, mein Inneres zerreißt? – Doch nein! – alles ist Einbildung – Torheit – Ihr könnt nicht jener Jüngling sein – es ist nicht möglich!« –
»Wohl,« unterbrach der Geistliche die Marquise, »wohl bin ich jener Jüngling, jener unglückliche Charost, den Ihr in Verzweiflung stürztet! – Ich erkannte Euch, als Ihr an den Beichtstuhl tratet; ich verstand das, wozu Ihr Euch in seltsamer Verstörtheit bekanntet, und die Seufzer, die unwillkürlich meiner Brust entflohen, die heißen Tränen, die meinen Augen entströmten, waren der letzte Tribut, den ich dem Andenken an irdisches Weh zollen mußte. Bis dahin hatte ich den Brief aufbewahrt, den Ihr mir schriebt, der mein Herz durchschnitt, mich in trostloses Elend stürzte; ich vernichtete ihn, als ich Euch wiedergesehen, als ich die Überzeugung gewonnen hatte, daß nun die letzte Prüfung vorüber sei.«
»Wie,« begann die Marquise, »wie? Ihr sprecht von einem Briefe, den Ihr empfingt? – Nie habe ich Euch geschrieben. Ich hatte Euch bei der Duchesse d'Aiguillon gesehen, und es unterblieb ja jede weitere Annäherung – was für Geheimnisse!« –
»Vielleicht,« erwiderte der Geistliche mit ruhigem Lächeln, »vielleicht verlöschte ein Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren mit dem Andenken an die tiefe Kränkung, die mich zur Verzweiflung brachte, auch die Erinnerung der Art, wie sie mir widerfuhr. – Ich hatte noch nicht geliebt; erst als ich das Fräulein von Chauvelin sah, erfaßte mich dies Gefühl mit aller, das ganze Gemüt erschütternden Stärke, die es über einen reizbaren Jüngling zu üben vermag. – Von Wonne und Lust durchbebt, bemerkte ich die Unruhe des Fräuleins, sah, wie ihre Blicke mich in scheuer Liebe suchten und mieden. Ja! – es war kein Zweifel – ich konnte glauben an das höchste Glück meines Lebens! – Die Abreise meines Vaters, des Präsidenten Charost, nach seinem Wohnsitz Chatillon sur Indre, entfernte mich von Paris. Aber wie konnte ich fernbleiben von meiner Liebe? – Mit Mühe erhielt ich von meinem Vater die Erlaubnis, zurückzukehren nach der Hauptstadt. Ich hatte die Wohnung des Fräuleins erforscht; mein erster Gang, da ich angekommen, war dahin, ich hoffte die Geliebte wenigstens am Fenster zu schauen. Welch Entzücken, welche Himmelswonne, als ich sie erblickte, als sie wie im jähen Schreck zurückfuhr. – Hinauf – hinauf zu ihr – zu ihren Füßen mein ganzes Selbst aushauchen in der höchsten Inbrunst der Liebe! – der Gedanke ließ keine Rücksicht aufkommen. Niemand auf der Hausflur; ich fand mich zurecht, ich trat in des Fräuleins Zimmer. Da rief die, von der ich geliebt zu sein glaubte, mit einer Stimme, die tötend mein Innerstes durchfuhr: ›Fort – fort – Unseliger!‹ – streckte mir die Hände abwehrend entgegen mit allen Zeichen des tiefsten Abscheus! – Ich hörte Tritte sich nahen; aber erst in meiner Wohnung, in die ich mechanisch zurückgekehrt, fand ich mich wieder. Zur Stunde weiß ich nicht, wie ich aus dem Hause des Ritters du Chauvelin gekommen, ob ich jemanden begegnet, ob jemand mit mir gesprochen, oder was sich sonst begeben. – Ruhiger geworden, konnte ich nicht anders glauben, als daß irgendein unseliges Mißverständnis über mich walten müsse. Ich schrieb an Franziska, schilderte ihr mit aller Glut der heftigsten Leidenschaft meine Liebe, meinen trostlosen Zustand, beschwor sie in den rührendsten Ausdrücken, mir zu sagen, welches böse Verhängnis den Haß, ja den tiefen Abscheu verursacht, den sie mir bewiesen. Gleich andern Tages erhielt ich die Antwort, jenen Brief, der mir alle Hoffnung des Lebens raubte. Franziska verwarf mich mit dem bittersten Hohn. Sie versicherte, daß sie weit entfernt sei, irgendeinen Haß oder gar Abscheu gegen mich, den zu kennen sie kaum das Vergnügen habe, in sich zu tragen; vor Wahnsinnigen habe sie aber große Furcht, weshalb sie mich bitte, ihr meinen Anblick zu ersparen. An einem seltsamen Wahnsinn müsse ich nämlich wohl leiden, und der Ausbruch jener Furcht sei es vielleicht gewesen, was ich für Haß oder Abscheu gehalten. Jedes Wort des unseligen Briefes spaltete mein Herz. – Ich verließ Paris und schweifte umher, ohne nach Chatillon zurückzukehren. Wo ich Ruhe suchte und fand, zeigt Euch das Kleid, das ich trage!«
Die Marquise beteuerte bei allem, was ihr heilig, daß sie niemals einen Brief von Charost erhalten, also auch keinen habe beantworten können. Nur zu gewiß war es, daß jener Brief dem Ritter in die Hände gefallen, der ihn statt seiner Tochter beantwortet.
Die Marquise wurde von einem Gedanken ergriffen, dessen Ahnung sonst nicht in ihrer Seele gelegen. Es ging ihr auf, daß der Vater, dessen ganzes Sein und Wesen ihr stets die tiefste Ehrfurcht eingeflößt, dessen Lebensweisheit ihr die einzige Norm ihres Denkens, ihres Handelns gegeben, daß eben dieser Vater das böse Prinzip gewesen sei, das sie um ihr schönstes Glück betrogen. Ihr ganzes mißverstandenes Leben schien ihr eine finstre, freudenleere Gruft, in die sie rettungslos begraben; ein vernichtender Schmerz durchbohrte ihre Brust.
Charost begriff die Marquise ganz und gar und mühte sich, sie aufzurichten durch den Trost der Kirche, den er aussprach in salbungsvollen Worten. Er versicherte, daß er nun erst den ewigen Ratschluß des Himmels erkenne und preise, nachdem sein irdisches Glück zertrümmert worden, um seinen Sinn ganz zu reinigen, zu heiligen, empfänglich zu machen für ein Verhältnis, das auf Erden schon die Seligkeit des Himmels erschließe. Ihn habe die ewige Macht ausersehen, sie, die er einst mit der höchsten Inbrunst geliebt, auf den wahren, einzigen Himmelsweg zu leiten. –
»Wie,« unterbrach ihn die Marquise heftig, »wie, Ihr wolltet« –
»Euer,« sprach Charost mit ruhiger Würde, »Euer Beichtvater sein, und ich glaube, Frau Marquise – oder laßt mich Euch Franziska nennen – daß es mir gelingen wird, allen irdischen Schmerz zu besiegen, der Euer Leben hienieden stört. Euer Gemahl wird mir gern die Kapellanstelle in Eurem Schlosse anvertrauen; er wird sich des Silvain François Charost wohl erinnern, dessen Jugendfreund er war.« –
Charost hatte recht; sein trostreicher Zuspruch erleichterte das Gemüt der Marquise, und es kam bald eine Heiterkeit in ihr Leben, die sie sonst nicht gekannt. Öfter, als es gerade der Kapellansdienst erforderte, kam Charost nach dem Schlosse Nerbonne und war, da sein lebhafter Geist sich gern einer Fröhlichkeit überließ, die die engsten Schranken der Würde nicht überschreitet, die Seele des kleinen Zirkels, der sich auf dem Schlosse zu versammeln pflegte. Diesen Zirkel bildeten vorzüglich der Ritter Preville mit seiner Gemahlin, ein Herr de Cangé, die Dame Dumée mit ihrem Sohn und ein Herr Dupin, alle Nachbarn der Marquise. –
Die Marquise unterließ nicht, ihrem Gemahl zu schreiben, daß der Kapellan des Schlosses gestorben, daß der Augustiner Charost indessen den Dienst verwalte, und daß er nun bestimmen möge, ob Charost, der, wie er behaupte, sein Jugendfreund sei, den Dienst behalten sollte.