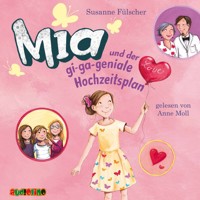8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sommer, Freundschaft und Limonenduft Seit ein Ereignis ihre Freundschaft vor über zwanzig Jahren zerbrechen ließ, haben Judith, Lene und Katharina nicht mehr miteinander gesprochen. Doch die fünfundvierzigjährige Schauspielerin Judith hofft, in diesem Sommer die Verbundenheit von damals wieder aufleben lassen zu können, und reist zu ihren ehemaligen Schulfreundinnen in die Schweiz und nach Ligurien. Endlich kommen Dinge zur Sprache, über die viele Jahre geschwiegen wurde, und alte Wunden heilen langsam. Während Judith, Lene und Katharina nach und nach die Frage ergründen, was aus den Träumen ihrer Jugend geworden ist, erkennen sie bald, was im Leben wirklich zählt: Die Freiheit, das eigene Glück selbst zu bestimmen, wahre Freundschaft und die Zuversicht, aus den Limonen, die das Leben einem manchmal reicht, Limoncello machen zu können. Der neue Roman von Erfolgsautorin Susanne Fülscher ist die perfekte Urlaubslektüre – lebensnah, warmherzig und voller Gefühl.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2020Redaktion: Lisa WolfCovergestaltung: zero-media.net, MünchenCovermotiv: FinePic®, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Prolog
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Epilog
Dank
Prolog
Bordighera, 1989
Sie waren vierzehn und liebten alles, was süß und verführerisch war. Gummitiere, Lakritze, Schaumküsse, Zitronenbonbons, Schleckmuscheln, Eiskonfekt, Zuckerstangen, Jungs mit dunkel gelocktem Haar und vor allem sich selbst.
»Schwört ihr?«, fragte Judith und ließ den grobkörnigen Sand durch die Finger rieseln.
»Was?«, entgegnete Katharina. Sie hatte sich so großzügig mit Sonnenöl eingerieben, dass ihre bronzefarbene Haut glänzte. Hinreißend sah sie immer noch aus. Ein bisschen wie Brooke Shields.
Lene lag bäuchlings auf der Badematte – wegen ihrer krabbenroten Schultern hatte sie sich ein T-Shirt umgelegt und grunzte schlaftrunken.
»Dass wir immer beste Freundinnen bleiben«, fuhr Judith fort.
»Immer im Sinne von … bis an unser Lebensende, und wer den Schwur bricht, muss getötet werden?« Typisch Katharina mit ihren makabren Witzen.
»Genau so«, bestätigte Judith.
Lene rappelte sich hoch, und kichernd schlugen sie ein.
Es klang zwar wie ein Spaß, aber Judith meinte es ernst. Ein Leben ohne Katharina und Lena – unvorstellbar! Eine ferne Himmelsmacht – vielleicht hieß sie Gott – hatte sich etwas dabei gedacht, als sie die drei Mädchen in die Welt katapultiert hatte. Geboren Mitte der Siebzigerjahre in Hamburg-Eppendorf, waren sie in unmittelbarer Nachbarschaft aufgewachsen und vom ersten Schultag an unzertrennlich. Sie spielten Volleyball im Verein, ließen sich in derselben Gemeinde konfirmieren und saßen im Unterricht in der zweiten Reihe nebeneinander. Links Lene, in der Mitte Judith, rechts Katharina.
In den Sommerferien fuhren sie, sooft es nur ging, gemeinsam nach Italien. Bordighera hieß der zauberhafte Ort an der Blumenriviera unweit der französischen Grenze. Dort hatten sich Katharinas gut situierte Eltern Anfang der Achtzigerjahre zusammen mit der Oma eine Wohnung gekauft. Für drei Familien war sie zu klein, doch Judith und Lene durften mit in Katharinas Zimmer übernachten. Sie liebten die Nächte fern von den Eltern, die sich in einer Pension oder einem der Hotels im Ort einquartiert hatten. Oft plauderten sie bis spät in die Nacht und schliefen erst ein, nachdem Katharinas Mutter zum zweiten oder dritten Mal hereingeplatzt war und sie ermahnt hatte, endlich still zu sein.
1989, im Jahr des Mauerfalls, reisten Judiths Eltern zu Verwandten in die DDR. Lenes Eltern blieben zu Hause, um die Wohnung zu renovieren, und die Mädchen bettelten so lange, bis man ihnen erlaubte, mit Katharinas Familie nach Italien zu fahren. Sechs Wochen nicht enden wollender Sommerferien. Hitze, Meer und braun gebrannte Jungs. Es war wie das Paradies auf Erden, wie ein Versprechen von allem, was noch kommen würde. Keine von ihnen hatte bisher einen Freund gehabt, und sie waren sich auch nicht sicher, ob sie das schon wollten. Und überhaupt, es war doch viel prickelnder, zu gucken und zu schwärmen und sich kringelig zu lachen, wenn einer der Jungs zu ihnen herübersah.
Die meisten Italiener schauten Lene an, die zarte, rotblonde Schönheit, die den Sonnenbrand ohne zu klagen ertrug. Katharina stand ebenfalls hoch im Kurs, und manchmal lachte Judith extralaut, damit auch ihr mal jemand ein Lächeln schenkte. So wie Enzo, den sie am dritten Tag an der Eisdiele kennenlernten. Sie genoss es, wie er sie mit Blicken verschlang, als wäre sie ein Eis. Doch als er einen Tag später seine schwitzige Hand mit den abgekauten Fingernägeln auf ihren Oberschenkel legte und ihr einen nassen Kuss auf den Hals schmatzte, ließ sie ihn ohne ein weiteres Wort stehen. Seine übergriffige Art behagte ihr nicht, da mochte er noch so säuseln und auf charmant tun.
Zum Glück gab es Lene und Katharina. Bei ihnen fühlte sie sich geliebt und geborgen, einfach sicher. Und es ging weiter mit den Schwüren an diesem heißen Sommertag. Sie versprachen einander, immer offen und ehrlich zu sein. Nichts zu verschweigen, weil heimlich tun irgendwie auch lügen war. Alles schwesterlich zu teilen, die Gummibärchen, den Tintenkiller, die Tampons. Nur nicht die Jungs, das stellten sie von Anfang an klar. Und der Freundin schon gar nicht den Freund auszuspannen, denn das war nun wirklich das Allerletzte. Sie wollten fair bleiben, von heute bis in alle Ewigkeit.
Bei einer eisgekühlten Cola in der Strandbar besiegelten sie den mündlichen Vertrag. Noch viele Jahre danach war sich Judith sicher, dass ihre Abmachung nicht nur einer Ferienlaune geschuldet, sondern wirklich ernst gemeint war.
Und doch kam alles anders.
Eins
Judith
Hamburg, Mai 2019
In der Nacht hatte Judith von ihrer Mutter geträumt. Wie sie in ihrem Lieblingssessel saß, dem sattgelben mit der hohen Rückenlehne, und an einem Strauß Flieder roch. Ohne tiefe Schatten unter den Augen. Ohne den Luftröhrenschnitt. Ihre Haare waren braun gelockt und störrisch wie früher, ihre Arme weich und rund, und sie lachte. Mit blitzweißen Zähnen, die sie nie gehabt hatte.
Mama. Mutti. Omi. Irmchen. Gestorben an ihrem Geburtstag vor einem Jahr. Wie immer am 30. April hatten die Büsche und Bäume in lichtem Grün gestanden. Die Straßenränder waren mit Löwenzahn und Gänseblümchen betupft, die Vögel hatten gesungen und die Luft nach unbändiger Lust aufs Leben gerochen. Nur in Judith war alles tot gewesen. Die Tage danach hatte sie sich in Aktionismus geflüchtet. Die Beerdigung musste organisiert werden; ihre Schwester Anna, die in Rotterdam ein Café betrieb, reiste aus den Niederlanden an. Welcher Sarg? Welches Blumengesteck? Welche Musik? Ihre Mutter hatte Bach und Ranunkeln geliebt, und beim Sarg, das hatte sie in ihrer pragmatischen Art oft genug betont, sollte es das einfachste Modell sein. Keine Kinkerlitzchen, kein Schnickschnack. Die Kiste würde ohnehin verbrannt werden, also bitte. Ein Totenhemd hatte sie auch nicht gewollt. Sauber und praktisch gedachte sie sich in den Sarg zu legen. In ihren Wohlfühljeans, dazu ein flottes Karo-Flanellhemd.
Auch in den Wochen nach der Beerdigung gab es viel zu organisieren. Die Wohnung, in der ihre Mutter seit dem Tod des Vaters vor zehn Jahren allein gelebt hatte, musste aufgelöst werden. Ein Schritt, der Judith an ihre Grenzen brachte. In ihren Sachen schnüffeln. Jeden Zettel umdrehen, jede Vase in die Hand nehmen, jeden Teller, jedes Buch und dann entscheiden, ob der Gegenstand es wert war, ihn aufzubewahren. Durfte sie das überhaupt? Nein, sie musste. Mit der Zeit gingen sie und ihre Schwester resoluter vor. Die Pfanne und der angebrannte Topf konnten weg, die Kristallgläser sowieso. Letztere wollte nicht mal ihre Tochter Lisbeth haben, die in Bielefeld Germanistik und Soziologie studierte und in einer spärlich bestückten WG lebte. Viel zu unmodern, Gläser gab es im schwedischen Möbelhaus zum Schleuderpreis. Was war mit der Brotmaschine? Nur ein Staubfänger und benutzte heutzutage niemand mehr. Brot kaufte man geschnitten, oder man nahm das gute alte Messer in die Hand. Irgendwann hatten Anna und sie es geschafft. Alles durchgesehen. Jeden Winkel der Wohnung abgegrast. Am Ende hatten sie bloß wenige Andenken behalten. Die Fotoalben, den Schmuck der Mutter, Vaters Uhren, das Tafelsilber und die gerahmten Fotos der Ahnen und Urahnen, alles sicher in zweieinhalb Umzugskartons verstaut.
Dann waren die Entrümpler angerückt. Gerade mal drei Stunden hatten die Jungs gebraucht. Drei Stunden, um ein gesamtes Leben wie einen falsch geschriebenen Buchstaben im Schulheft mit dem Tintenkiller auszulöschen. Judith stand mit Anna auf dem Balkon und rauchte eine mit, obwohl ihr von Zigaretten übel wurde. Es tat weh, mit anhören zu müssen, wie das Mobiliar ihrer Eltern zertrümmert, das Porzellan zerschlagen und der Rest, der sich vielleicht noch verhökern ließ, in Kisten geworfen wurde. Ohne Rücksicht darauf, dass diese Dinge viele Jahre nicht nur Dinge gewesen waren. Sie hatten ihrer Mutter etwas bedeutet, sie hatte sie gehegt und gepflegt, als müssten sie Jahrzehnte überdauern.
Drei Stunden darauf war der Spuk vorüber und die Wohnung besenrein. Das Leben ihrer Mutter ausgekehrt. Judith unterschrieb den Auftrag und fing an zu weinen. Anna hatte ihre Tränen nur weggedrückt, sie weinte erst später, als sie im Reichshof am Hauptbahnhof ein Glas Champagner tranken. Auf Mutti, die ihnen hoffentlich dabei zusah.
Das war etliche Monate her. Monate, in denen Judith täglich an ihre Mutter gedacht und sich nach ihr gesehnt hatte. Die Lücke, die sie hinterlassen hatte, klaffte so viel größer, als sie es sich noch zu ihren Lebzeiten hätte vorstellen können.
Am meisten vermisste sie, dass ihre Mutter sie nicht mehr anrief. Weil Tote das für gewöhnlich nicht taten. Dennoch ging Judiths Blick als Erstes zum Anrufbeantworter, sobald sie in die Wohnung kam, und flackerte das rote Lämpchen, tat ihr Herz einen Hüpfer. Einen Sekundenbruchteil lang dachte sie dann, dass es ja vielleicht doch ihre Mutter war, um gleich darauf über sich selbst den Kopf zu schütteln. Und empört über den Lauf der Dinge, streifte sie die Schuhe von den Füßen und pfefferte sie in die Ecke.
Eine harte Zeit lag hinter ihr. Erst bei Drehbeginn vor wenigen Wochen – Judith spielte im Polizeiruf 110 die psychisch labile Mutter des Mordopfers – hatte sich die Dunkelheit in ihrem Kopf gelichtet. Die Rolle war ihr wie auf den Leib geschneidert, und nach einer Flaute an Rollenangeboten im letzten Jahr fühlte sich die Bestätigung, die sie am Set erfuhr, wie ein warmer Frühlingsregen an. Sie war Mitte vierzig und immer noch gefragt. Und es würde weitergehen. Ihre Agentin Corinna hatte ihr bereits Castinganfragen für Nebenrollen in drei Fernsehfilmen sowie für die Hauptrolle in einer täglichen Serie zukommen lassen. Das klang vielversprechend, und wenn nur eins der Angebote klappte, wäre sie überglücklich. Sie wusste, dass ihre Mutter sehr stolz auf sie gewesen wäre. Wie bei jedem Theaterengagement und bei jedem Film, in dem sie in den letzten zwanzig Jahren mitgespielt hatte.
Vor einer Woche wäre sie neunundsiebzig geworden. Judith hatte den Todes- und Geburtstag zum Anlass genommen, mit ihrem Mann, ihrer Schwester und deren Freund Hannes zu feiern. So, wie sie Muttis Ehrentag all die Jahre gefeiert hatten. Mit Würstchen und Kartoffelsalat, dem besten Sekt aus dem Feinkostladen und einem bodenständigen Zitronenkuchen. Backen gehörte nicht zu Judiths Lieblingsbeschäftigungen, aber der Geburtstagskuchen ihrer Mutter gelang ihr, ohne auch nur einmal ins Rezept zu schauen. Der Clou war die Zuckerglasur mit Zitruszesten. Dazu gab es wie früher starken Bohnenkaffee. Und statt Dosenmilch echte Sahne.
Die kleine Familienfeier war Balsam für Judiths Seele. Sie hatten Puccini-Opern gehört, gelacht, geweint, gescherzt und eine Flasche Sekt auf Eis geleert. Anna und Hannes reisten nach zwei Nächten, die sie mehr schlecht als recht in Lisbeths altem Kinderbett geschlafen hatten, wieder ab. Es war in Ordnung so. Auch wenn Tom den ganzen Tag im Möbelgeschäft verbrachte, fühlte sich Judith weniger allein. Sie hatte ja auch allerhand zu tun. Aufräumen, Wäsche waschen, putzen. Und endlich knöpfte sie sich die Familienalben vor, die sie im letzten Jahr – aus purer Bequemlichkeit, vielleicht aus Feigheit – nicht mal aus dem Umzugskarton genommen hatte. Ihre Schwester hatte sich bereits ein paar Lieblingsfotos herausgerissen, mehr wollte sie nicht. Sie und Hannes lebten in Amsterdam auf engstem Raum; da war kein Platz für Ballast.
Auch Judith nahm sich vor, nicht jede verwackelte Aufnahme, die ihre Mutter beim Tomatenernten auf dem Balkon oder mit ihrer Freundin Hilde auf Kreta beim Sonnenbaden zeigte, aufzubewahren. Ein paar wenige, dafür besondere Fotos – das musste reichen. Hatte sie früher jeden Strampler von Lisbeth, jedes noch so abgewetzte Plüschtier gehortet, war sie mit den Jahren rigoroser geworden. Wozu den ganzen Plunder aufbewahren? Dafür brauchte sie mehr Schränke, und die hatte sie nicht.
Doch gleich auf den ersten Seiten des Albums blieb sie hängen. Sie hatte es befürchtet. Sie, Anna und ihre Eltern in Timmendorfer Strand an der Ostsee. Während Judith in den auslaufenden Wellen planschte, baute Anna eine Sandburg. Ihre Mutter trug einen rot-weiß gepunkteten Bikini und tat nichts. Außer Aufsehen zu erregen. Sie stand, ein Bein vor dem anderen gekreuzt, am Saum des Wassers, und ein braun gebrannter Mann, Typ Gigolo, schaute in ihre Richtung. Wer hatte das Foto aufgenommen? Ihr Vater? Kaum vorstellbar, dass er seine Frau fotografierte, während ein anderer Mann sie anstarrte.
Judith blätterte weiter, doch schon bald überkam sie die alte Traurigkeit. Weil sie Tom nicht im Laden anrufen konnte, ging sie in die Küche hinüber und setzte einen Espresso auf. Mit dem Löffel Zucker, den sie hineingab, schmeckte er bittersüß, und ihre Laune besserte sich schlagartig. Sie stellte die Tasse in die Spüle zurück, und als sie den Kopf hob und einen Blick aus dem Fenster warf, sah sie den Postboten auf sein gelbes Rad steigen und davonradeln. Eilig griff sie nach dem Haustürschlüssel und lief die zwei Stockwerke hinab. Vielleicht war der Steuerbescheid, auf den sie sehnsüchtig wartete, endlich gekommen. Ihre Steuerberaterin hatte ein Guthaben errechnet. Ein hübsches Sümmchen, von dem sie und Tom im Spätsommer verreisen wollten.
Ein praller DIN-A4-Umschlag ragte aus dem Schlitz. Judith ruckelte daran, doch er ließ sich nicht herausnehmen. Dummerweise konnte sie ihn ebenso wenig hineindrücken. Unmut stieg in ihr auf. Warum hatte der Postbote nicht geklingelt? Die alte Frau Meinhard im Parterre war immer zu Hause. Judith zerrte kräftiger daran, an einer Stelle riss die Briefhülle ein, dann bekam sie sie zu fassen und zog sie heraus.
Kein Absender, seltsam. Der Umschlag erweckte den Eindruck, als wäre er schon mehrere Male benutzt worden, und als Judith ihre Nase dranhielt, zuckte sie angewidert zurück. Er roch nach feuchtem Keller und nach Zigaretten. Aufmachen oder gleich wegwerfen, überlegte sie noch, als ihr Finger bereits unter die Lasche fuhr. Sie war kaum wieder oben in der Wohnung, da hatte sie den Brief ganz aufgerissen. In der Sendung befand sich ein weiterer verschlossener Umschlag, dazu ein Schreiben.
Judith entfaltete das hellblaue Briefpapier, das ebenfalls nach Zigaretten roch, und las:
Hamburg, den 28. April 2019
Liebe Judith,
erinnerst du dich noch an mich, mein Kind? Ich bin’s, Hilde. Sicher wunderst du dich und denkst, warum schreibt mir die alte Hilde? Vielleicht bist du auch verärgert, weil ich nicht zur Beerdigung deiner Mutter gekommen und dir nicht mal kondoliert habe. Es ging leider nicht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eine komplizierte Hüft-OP (ich musste dreimal unters Messer!), von der ich mich bis heute nicht richtig erholt habe. Ich bedaure es ungemein, ich hätte Irmchen so gern verabschiedet. Obgleich der Kontakt zwischen uns ja leider abgerissen war. (O ja, das war ein großer Fehler, ich bereue es zutiefst.) Nach einer längeren Reha konnte ich endlich wieder zurück nach Hause. Ein Weilchen ging auch alles gut – dank meiner beiden Neffen und eines Pflegeteams. Sie haben getan, was in ihrer Macht stand, alle wollten es mir richtig schön machen.
Aber … nun ja … es ist nicht einfach, alt zu werden. Meine Gelenke schmerzen, die Muskeln verweigern ihren Dienst, und manchmal … ja, manchmal lässt mich auch mein Gedächtnis im Stich. Daher bin ich vor einem Monat in eine Seniorenresidenz umgezogen. Judith, ich habe Glück gehabt. Es ist ein richtig behagliches Heim in Wandsbek, ja, wirklich! Ich habe meinen alten Fernseh- und Lesesessel und sogar einen winzigen Schreibtisch, an dem ich dir jetzt diesen Brief schreibe. Nein, unterm Strich kann ich mich nicht beklagen. Um auf den Balkon zu gelangen, muss ich nur einmal den Rollator über den Flur schieben. Das schaffe ich, und dann sitze ich da und schaue in eine prächtige Kastanie.
Im beiliegenden Umschlag findest du Briefe, die deine Mutter mir geschrieben hat. Stell dir vor, ich habe keinen einzigen weggeworfen! Ach, und ein paar Fotos, die uns als alberne junge Hühner zeigen (zum Piepen!). Gott bewahre, du sollst nicht alles aufbewahren, aber ich möchte dir die Briefe keinesfalls vorenthalten. Vielleicht behältst du sogar den einen oder anderen als Andenken an deine Mutter. Irmchen und mich hat etwas ganz Besonderes verbunden. Umso mehr schäme ich mich, dass ich nie wieder den Kontakt zu ihr gesucht habe. Es ist nicht mal etwas Spezielles zwischen uns vorgefallen (kein Streit oder dergleichen), das Leben hat uns einfach auseinandergerissen. Wenn das Schicksal es will, werden wir uns eines Tages wiedersehen, habe ich immer gedacht. Aber das Schicksal wollte es nicht. Das ist traurig. Ich hätte deiner Mutter noch so viel zu sagen gehabt. Zum Beispiel, wie bedeutsam sie für mein damaliges schüchternes Ich war. Dazu ist es nun nicht mehr gekommen, und mir bleibt lediglich zu hoffen, dass sie es gespürt hat.
Mach’s gut, liebe Judith. Du warst so ein gutes und begabtes Mädchen. Das hat Irmchen immer wieder gesagt.
Alles Liebe
Deine Hilde
Eine Weile saß Judith regungslos am Küchentisch, dann riss sie den zweiten Umschlag auf und kippte das Sammelsurium von Briefen, Postkarten Fotos, Eintrittskarten und bekritzelten Zetteln auf den Tisch. Tränen schossen ihr in den Augen. Dicht beschriebene Seiten mit der runden, sich nach rechts neigenden Handschrift ihrer Mutter. Niemals hatte sie ihre Mutter Briefe schreiben sehen. Einkaufszettel ja, manchmal eine Postkarte, aber womöglich war das alles vor ihrer Zeit gewesen. Timmendorfer Strand, den 8.9.1972, las sie, Hamburg, den 3.2.1969, ein Brief von 1977 fiel ihr in die Hände, da war sie gerade zwei Jahre alt gewesen. Sie grub sich weiter durch den Haufen, fischte mal hier, mal da ein Foto heraus und stieß auf Aufnahmen, die sie noch nie zu Gesicht bekommen hatte. Ihre Mutter mit Anna als Baby im Arm in einem Lokal an der Außenalster. Vielleicht Bodo’s Bootssteg? Hatte es das Café damals schon gegeben? Ihre Mutter in einer heiteren Silvesterrunde mit Hütchen auf dem Kopf. Ihre Mutter und Hilde barfuß auf Steinen am Meer balancierend. Ihre Mutter mit Hilde im Garten, im Hintergrund ihr Nachbar Hans Becker am Grill.
Judith begann in den Briefen zu stöbern, sie las sich fest und vergaß darüber, das opulente Abendessen vorzubereiten, das sie Tom versprochen hatte. Einmal im Monat kochte er ein Überraschungsmenü für sie, im nächsten Monat sie für ihn. Sie sah auf die Uhr – großer Gott, schon halb acht! – und empfand es plötzlich als Zumutung, in der Vergangenheit ihrer Mutter zu schnüffeln. Wozu sollte das gut auch sein? Ihre Mutter konnte nicht mal entscheiden, ob sie es wollte oder nicht.
Doch erst, als sie den Schlüssel in der Haustür hörte, stopfte sie die Briefe und Fotos zurück in den Umschlag und verstaute diesen in ihrem Schreibtisch. Vielleicht würde sie ihn ja auch vergessen. So, wie sie vieles vergessen hatte, was in den Tiefen der Schubladen schlummerte. Ganze Teile ihres Lebens waren dort vergraben. Fotos von Klassenfesten. Katharina mit ihren weißen Zähnen und den Schneewittchen-Haaren. Lene, zart, vornehm blass und rotblond. Und Robert. Immer wieder Robert. Aber davon wollte sie nichts mehr wissen. Das war alles viel zu lange her, um heute noch von Belang zu sein.
»Tom, wir gehen essen!«, rief sie gespielt munter in den Flur hinein.
Tom fragte nicht, wieso, weshalb, warum. Für den Bruchteil einer Sekunde hob er überrascht die Augenbrauen, dann ging er ins Schlafzimmer hinüber, um sich umzuziehen.
Zwei Wochen verstrichen. Vierzehn Tage, in denen Judith die Briefe nicht anrührte. Wozu auch? Nach den Ereignissen des letzten Jahres wollte sie sich zu nichts zwingen, nur noch Dinge tun, die Spaß machten, und wenn sie der Zeit beim Verrinnen zusah. Langeweile war ohnehin nicht ihr Problem. Sie bereitete sich auf die dicht aufeinanderfolgenden Castingtermine vor, fuhr zum Vorsprechen nach Lüneburg und nach Berlin und sprang vor Freude in die Luft, als es mit der Serie klappte. Drehbeginn war im Herbst. Zweihundert Folgen. Das bedeutete ein Dreivierteljahr Arbeit. Tom befahl ihr, die freie Zeit bis zum 7. Oktober auszukosten, sie nicht mit Hausarbeit oder dergleichen zu vergeuden. Aber das hatte Judith ohnehin nicht vor. Sie verabredete sie sich mit einer befreundeten Maskenbildnerin fürs Kino und Theater, faulenzte bis zum Nachmittag im Schlafanzug auf dem Sofa oder schlenderte über den Jungfernstieg, um später eine Schale Milchkaffee im Café Paris zu trinken. Ab und zu suchte sie auch Tom in seinem Laden in Winterhude auf und ging mit ihm mittagessen.
An manchen Tagen sah sie im Schreibtisch nach, ob Hildes Umschlag noch an Ort und Stelle lag, und immer wanderten ihre Gedanken unweigerlich zu ihrer Mutter. Das erste Mal seit Langem kamen keine Tränen mehr. Der anfangs gellende Schmerz war einer melancholischen Sehnsucht gewichen. Als wäre ihre Mutter allein dadurch, dass sich ein Teil ihrer Vergangenheit in dem Briefumschlag befand, wieder mehr in ihrer Nähe.
Lesen wollte Judith die Briefe trotzdem nicht. Aber sie wusste, dass sie es jederzeit tun konnte. Niemand würde sie davon abhalten oder es ihr übel nehmen. Und schon gar nicht ihre Schwester, die keine Meinung dazu hatte. Tom dagegen redete ihr seit dem Abend, an dem sie feudal ins Cox gegangen waren, gut zu. Er hätte an ihrer Stelle nicht einen Augenblick gezögert. Es war nicht verkehrt, Antworten auf Fragen zu erhalten, die sonst für immer im Verborgenen blieben.
Judith zögerte dennoch. Es ging ihr nicht allein um ihre Mutter. Jede Briefzeile würde sie zweifelsohne an die eigenen Schulfreundinnen erinnern. An dieses schmerzvolle Kapitel in der Vergangenheit, an dem sie viel zu lange geknabbert hatte. So viel war passiert. Dinge, an die sie nicht erinnert werden wollte. Und doch stellte sie sich so häufig die Frage, wie es wohl Katharina und Lene ergangen sein mochte. Wo hatte es sie hin verschlagen? Was taten sie? Hatten sie Kinder oder keine? Und war Katharina noch mit Robert zusammen?
Traurig, dass alles so gekommen war. Der Traum ihrer lebenslangen Freundschaft zerplatzt. Rund zwei Jahrzehnte war das jetzt her. Und nie wieder – das war das Bittere an der Sache – hatte sie Herzensfreundinnen wie Katharina und Lene gefunden. Vertraute, mit denen man lachen, streiten und sich versöhnen konnte. Tom war der Ansicht, dass Kinderfreundschaften ohnehin anders seien. Inniger, intensiver, dramatischer. Stritt man sich, raufte man sich wieder zusammen. So unterschiedlich man auch sein mochte. In späteren Jahren wurde es ungleich schwieriger, echte Freunde zu finden. Weil man bereits ein dick geschnürtes Päckchen gelebtes Leben auf dem Buckel trug und sich das mit den Marotten der anderen oft nicht vertrug. Eine Freundin, die Kette rauchte? Niemals! Eine, die stets alles besser wusste? Unerträglich. Oder eine, die nicht zuhörte, selbst aber so viel redete, dass man kaum zu Wort kam? Schon gar keine Option. Waren die Lebensmodelle erst festgezurrt, wurden die meisten, ohne es zu merken, engstirniger und kleinkarierter. Judith nahm sich davon nicht aus. Auch sie ging anderen mit ihrer Fachsimpelei über Method Acting, Filme und Dreharbeiten auf die Nerven, womöglich erweckte sie als bekanntes Gesicht aus dem Fernsehen sogar Neid. Da war es doch sehr viel entspannter, sich mit Gleichgesinnten aus der Filmbranche zu verabreden. Mit Maskenbildnerinnen, Kamerafrauen oder Schauspielerinnen, die wie sie beim Film zu Hause waren und Verständnis dafür hatten, wenn man wochenlang keine Zeit hatte und oft so ausgelaugt von den Dreharbeiten zurückkam, dass man nicht mal Lust hatte, sich auf einen Kaffee zu treffen.
Im Lauf der Jahre hatte Judith die interessantesten Frauen kennengelernt. Doch kaum hatte man sich ein wenig angefreundet, fuhr die eine Kollegin zum Dreh nach Thailand, die andere nach Krakau, und die dritte versank in Depressionen, weil keine Aufträge reinkamen. In diesem Beruf war es schwierig, Freundschaften zu pflegen oder gar zu intensivieren. Oft hatte man eine Freundin für dreiundzwanzig Drehtage, und dabei blieb es dann auch.
Umso mehr trauerte Judith den alten Zeiten nach. Und hätte es Robert nicht gegeben, in den sie sich als Sechzehnjährige Hals über Kopf verliebt hatte, wären sie, Katharina und Lene vielleicht noch immer das unzertrennliche Dreiergespann ihrer Kindheit. Dass ausgerechnet ein Mann Auslöser für das Zerwürfnis zwischen ihnen gewesen war, hatte sich Judith bis heute nicht verziehen. Ihre erste große Liebe. Blind und naiv war sie hineingestolpert. Aber all das war lange her, und sie wollte keine negativen Gedanken mehr daran verschwenden. Es ging ihr doch gut. Sie hatte ihr Leben und empfand es an den meisten Tagen als mehr als erfüllend. Fluffig, buttrig und süß wie der Zitronenkuchen ihrer Mutter. Beruflich lebte sie ihren Traum. Niemals hätte sie etwas anderes als Schauspielerin sein wollen. Und sie hatte Tom, den sie über alles liebte. Und natürlich Lisbeth, ihre großartige Tochter. Also war alles gut, und musste man nicht irgendwann großzügig sein und verzeihen können? So, wie sie Tom damals die Affäre mit Annika aus der Buchhaltung verziehen hatte? Und Lisbeth die Kifferei mit siebzehn?
Doch so sehr sie sich auch bemühte, die Wunden der Vergangenheit waren wie ein in die Haut gefrästes Tattoo. Es verblasste nur ein wenig, ließ sich jedoch nicht komplett entfernen. Sie sah Robert vor sich, seine verfilzten dunkelblonden Locken und seine erstaunlich karamellbraunen Augen hinter der runden Hornbrille. Er war nie einer dieser aalglatten Schönlinge gewesen, aber gegen ihn hatten die pickeligen Durchschnittsjungs in ihrer Klasse keine Chance gehabt. Meist trug er eine schwarze Anzughose, dazu ein ungebügeltes weißes Hemd und eine Krawatte seines Vaters, im Winter einen schwarzen Rolli, darüber eine abgewetzte schwarze Lederjacke vom Flohmarkt oder ein ausrangiertes Jackett. Masche oder nicht, er sah umwerfend darin aus. Es hätte bloß noch eine zerfledderte Sartre-Ausgabe in der Tasche seiner Anzugjacke gefehlt. Schaut mich an, bin ich nicht lässig? Ihr anderen seid gegen mich doch nur mittelmäßige Hohlköpfe. Nie sah man ihn in Jeans. Weil er nicht wie jeder sein wollte. Durchschnittlich, gewöhnlich. Dazu kamen die druckreifen Formulierungen, mit denen er so manchen Lehrer vor den Kopf gestoßen hatte. Weil auch sie gegen ihn blässlich und uninspiriert wirkten.
Judith hatte nicht mehr Gründe gebraucht, um sich in ihn zu verlieben. Es war Knall auf Fall passiert, und wie in einem Schleudersitz war sie in das furioseste Emotionschaos ihres Lebens hineingerauscht.
Judith
Hamburg, Juni 1991
Es regnete.
Seit Tagen hing eine steingraue Wolkendecke über der Stadt, aus der es unaufhörlich goss. Typisches Hamburger Schietwetter. Kein Grund, auch nur ein Wort darüber zu verlieren, aber Katharina ließ auf dem Weg zur Theater-AG, die in der Turnhalle der Schule stattfand, eine Tirade los.
»Mir reicht’s so was von!«, schimpfte sie und zog sich die Kapuze tief in die Stirn. »Und so was nennt sich Sommer! Das ist doch nicht mehr normal!«
»Wissen wir.« Lene verdrehte die mit Kajal umrandeten Augen, dann stupste sie Katharina die Kapuze vom Kopf.
»Pass bloß auf! Sonst muss ich dich gleich in die Alster werfen. Und das überlebst du nicht.« Mit rudernden Armen rannte Katharina hinter der kreischenden Lene her.
Judith folgte den beiden im Schutz der Überdachung der Fahrradständer. Was kümmerte sie das Wetter? Sie mochte es, wenn der Regen gegen das Fenster ihres Zimmers trommelte und der Wind an den Läden rüttelte. Dann ließ es sich besser träumen. Von Robert. Diesem Wahnsinnstypen, der der bekannten österreichischen Lewinsky-Theaterfamilie entstammte. Er war erst ein paar Monate in ihrer Klasse, und Judith hatte sich rettungslos in ihn verliebt. Im Unterricht saugte sie jedes Wort auf, wenn er komplizierte Sachverhalte in geschliffenen Sätzen erklärte. Die komplizierten Sachverhalte wurden dadurch nicht weniger kompliziert, aber sie liebte es, seiner satten Stimme mit dem österreichischen Singsang zu lauschen. Kein Äh oder Ähm kam ihm über die Lippen. Kein Gestammel, kein Ich weiß grad nicht. Robert wusste immer, was er sagen wollte, mit wem er sich unterhalten wollte, wann er welche Schulstunde schwänzen wollte, weil die Lehrer ihm sowieso nichts beibringen konnten.
Außerhalb der Schule gab er sich unnahbar. Er, der Künstlertyp mit der Hornbrille, der lieber rauchte, Pastis trank und Novellen schrieb, als sich in die Klasse zu integrieren oder Mädchen aufzureißen. Was er sicher erfolgreich hätte tun können. Nicht nur Judith schien entflammt zu sein. Vielleicht war er auch schwul, niemand wusste es genau. Einige munkelten, er sei in Wien vom Gymnasium geflogen, andere behaupteten, seine Eltern hätten das horrende Schulgeld des englischen Internats nicht mehr zahlen können. Er selbst verlor kein Wort darüber. Er war eben da, wie von einer fernen Galaxie in die norddeutsche Hansestadt katapultiert. Der schräge Vogel. Das Genie. Der Junge zum Verlieben.
Die Leiterin der Theater-AG, Frau Gerloff, war so entzückt von ihm, dass sie ihm nach kurzer Zeit ein eigenes Theaterprojekt anvertraute, das parallel zu den Proben von Romeo und Julia lief. Judith, Katharina und Lene hatten nie zuvor Theater gespielt und quollen über vor Stolz, als Robert sie für sein Stück herauspickte. Die männliche Hauptrolle in dem absurden Zweiakter, den er frei nach Eugène Ionesco verfasst hatte, spielte er selbst. Natürlich – wenn nicht er, wer dann? Als Beleuchter musste Klassenclown und Depp vom Dienst Friedrich herhalten, daneben verteilte er, weil die Leute ihn belagerten, großzügig Statistenrollen.
In den ersten Wochen waren alle glücklich, dabei zu sein und in Roberts Fahrwasser zu schwimmen. Als würde ein wenig von seinem Talent, ja, von seinem Genie auf sie abstrahlen. Doch nach und nach änderte sich sein Ton. War er bisher stets höflich und respektvoll gewesen oder hatte sie mit seinem Wiener Schmäh umgarnt, bekam er immer häufiger cholerische Wutausbrüche.
Verdammt noch mal, sprich lauter, Lene! Und guck nach vorne, Katharina, nach VORNE, das Publikum will nicht nur deinen Rücken sehen. Herrje, Friedrich, den Stuhl anleuchten, ist das denn so schwer?
Nur Judith ging er nicht ganz so harsch an. Entweder machte sie alles richtig, oder er verschonte sie, weil er sie mochte. Ganz bestimmt mochte er sie. Aber war er auch in sie verliebt? So wie sie in ihn? Sobald er die kleine runde Hornbrille abnahm und sie anlächelte, schmolz sie dahin. Abseits der Proben war er der galanteste Mensch, den sie sich nur vorstellen konnte. Mal hielt er ihr die Tür auf, mal gab er ihr, wenn sie ausgehungert zur Theater-AG kam, von seinen Kürbiskernbrot-Stullen ab, die mit würzigem Bergkäse belegt waren. Und dann entschuldigte sie ihn im Stillen für die Beschimpfungen, die die anderen über sich ergehen lassen mussten. Vielleicht stand er einfach nur unter Druck. Seine Familie war Segen und Bürde zugleich. Die lokale Presse war auf das Projekt aufmerksam geworden und wollte sich die Premiere nicht entgehen lassen. Dann würde sich zeigen, ob ein echter Lewinsky in ihm steckte, der dem Ansehen der Familie gerecht wurde.
Noch stand nicht fest, wer die Hauptrolle Rosalie bekommen und damit die bisher nur grob angedachte Liebesszene mit Robert spielen würde. Noch experimentierte er und schob seine Schauspielerinnen wie König, Dame und Läufer auf einem Schachbrett hin und her. Das verunsicherte Judith. Sie spielte gut, natürlich spielte sie gut, sonst hätte Robert sie öfter kritisiert, doch tief im Innern sah sie sich als Konkurrentin zu ihren Freundinnen. Zu Katharinas Temperament. Zu Lenes filigraner Schönheit, die erst auf der Bühne richtig zur Geltung kam. Was Judith auszeichnete, war Fleiß, gepaart mit einer guten Portion Bodenständigkeit. Aber reichte das? Natürlich wollte sie Rosalie sein! Katharina wollte es ebenso. Unbedingt! Ihr Ehrgeiz ließ gar nicht anderes zu. Nur Lene ging entspannter an die Sache heran. Es schien ihr nicht so wichtig zu sein, welche Rolle sie am Ende übernehmen würde. Dabei sein und sich ausprobieren war alles.
Judith erinnerte sich nicht einmal, wann genau sie sich in Robert verliebt hatte. Gerne hätte sie gesagt, es war gleich in der ersten Sekunde passiert, damals, als er in ihre Klasse gekommen war. Aber das stimmte nicht. Was für ein Wichtigtuer, hatte sie gedacht, als er mit eingefrästem Grinsen vor ihnen gestanden und Deutschlehrer Mattes ihn gebeten hatte, sich vorzustellen.
»Servus. Hi. Robert.« Er zog lässig am Kragen seiner Lederjacke, und die Klasse grölte vor Lachen.
»Robert Lewinsky«, ergänzte Herr Mattes. »Lewinsky. Habt ihr sicher schon mal gehört.«
Lewinsky kannte niemand. Mit Ausnahme von Judith.
Ihr Finger schnellte in die Luft. »Die Theaterfamilie Lewinsky?«, fragte sie und fand ihn noch affiger, als er ihr ein selbstgefälliges Lächeln hinwarf. Solche Typen konnte sie ja gut leiden! Hielten sich für den Nabel der Welt. Für eine sexy Kreuzung aus Sartre und Camus.
Selbstverständlich sagte ihr der Name Lewinsky etwas. Seit ihr Nachbar Herr Becker, ein guter Freund der Familie, den sie liebevoll Onkel Hans nannte, sie als Dreizehnjährige das erste Mal ins Deutsche Schauspielhaus eingeladen hatte, war sie infiziert. Theater! Die Bretter, die die Welt bedeuteten! Sie schaute sich jede Inszenierung im Fernsehen an, übte heimlich vorm Badezimmerspiegel das Gretchen, Lulu und Nora und war überglücklich, als Onkel Hans sie immer häufiger mit ins Theater nahm.
Und jetzt hatte sie einen echten Lewinsky in der Klasse. Das flößte ihr mehr Respekt ein, als würde ein Thronanwärter mit ihr die Schulbank drücken. Oft beobachtete sie ihn verstohlen im Unterricht, und als sie nach ein paar Wochen bemerkte, dass er Augen hatte, in denen man sich zu verlieren drohte, war es längst zu spät. Es gab keine Rückspultaste wie bei ihrem Walkman. Sie war rettungslos verknallt.
Katharina machte sich über sie lustig. Ausgerechnet dieser Angeber. Bestimmt vögelte der sich durch die halbe Schule. Lene hielt dagegen, er sei eh schwul, keine Chance, den könne sie vergessen. Vielleicht hatte sie recht, vielleicht würde Judith niemals an ihn rankommen, aber war das etwa ein Grund, ihn sich aus dem Kopf zu schlagen? Er zog eben sein eigenes Ding durch, nicht so wie alle anderen, und gerade das reizte sie.
An einem Dienstag – ein paar Wochen war das jetzt her – war er in der Pause auf Judith und ihre Freundinnen zugeschossen, hatte seinen Finger vorgestreckt und wie eine Pistole auf sie gerichtet.
»Ihr seid’s!«
»Was sind wir?«, fragte Judith.
»Diejenigen, welche.«
»Wie?«, hakte Katharina nach.
Nur Lene lächelte spöttisch. Sie machte immer den Eindruck, als könne sie Robert nicht besonders gut leiden.
»Ihr seid bei meinem Stück dabei. Also, natürlich nur, wenn ihr wollt.«
»Wollen wir?« Katharinas Blick ging erst zu Lene, dann zu Judith, deren Herz wie ein Trommelwirbel schlug.
»Wie kommen wir denn zu der Ehre?«, erkundigte sich Lene. »Du weißt doch gar nicht, ob wir spielen können. Wir haben nicht mal vorgesprochen.«
Alle in der Klasse wussten, dass Robert seit dem Wochenende Schülerinnen und Schüler für sein Theaterstück castete. Während sich Judith vorgenommen hatte hinzugehen – sie musste es tun, selbst wenn sie vor Angst sterben würde –, nahmen Katharina und Lene die Sache lockerer. Katharina fand Theater schon irgendwie spannend, aber es gab so viele andere Dinge, für die sich begeistern konnte. Mode, Tanzen, Musik. Lene hatte keine richtige Meinung dazu. Sie hielt sich für zu leise und zu schüchtern, um vor Publikum zu sprechen.
»Das kann sich ja bald ändern«, sagte Robert. »Kommt heute Nachmittag in den Proberaum.«
Punkt drei standen sie in der Turnhalle, und nach ein paar dilettantischen Durchläufen – Judith hatte vor lauter Aufregung gezittert – waren sie engagiert.
»Spinnt der?«, meinte Katharina, als sie wenig später wieder vor der Tür standen. »Wir waren schlecht.«
»Also, das stimmt jetzt nicht«, widersprach Lene.
»Aber auch nicht richtig gut«, entgegnete Katharina.
»Vielleicht sieht er ja Potenzial in uns«, meinte Judith. Sie war überglücklich, geradezu überwältigt, wollte es den Freundinnen jedoch nicht zeigen.
»Oder er will uns ins Bett kriegen«, mutmaßte Katharina.
»Uns alle drei gleichzeitig?« Lene rollte mit den Augen.
»Nicht gleichzeitig. Aber hintereinander.« Katharina kicherte. »Na, wär das was, Judi-Schatz?«
Judith kroch die Hitze ins Gesicht. Wie sie es hasste, dass sie immer noch wie ein Teenager rot wurde! Wann hörte das bitte schön endlich mal auf? War man mit sechzehn nicht längst zu alt dafür? Außerdem hielt sie es für extrem unwahrscheinlich, dass Robert den Umweg über das Theaterprojekt wählte. Warum sollte er das auch tun? Die Mädchen standen freiwillig bei ihm Schlange. Er musste andere Gründe haben. Sie interessant finden. Vielleicht tatsächlich begabt. Oder als Trio spannend.
Wie jedes Mal, wenn sie sich der Turnhalle näherten, geriet Judiths Herz aus dem Takt. Und als sie die Tür aufstießen und Roberts Stimme vernahmen, laut, ein wenig polternd, schlug es absurd schnell.
Knapp drei Wochen lang probte er nun schon mit ihnen, sie hatten den Neid ihrer Mitschülerinnen zu spüren bekommen, aber Judith war das egal. Im Gegensatz zu Katharina störte sie sich auch nicht daran, vorübergehend alle drei Personen spielen zu müssen. Mal schlüpfte Judith in die Rosalie, mal Katharina, dann wieder Lene. Und auch bei den Nebenrollen, der Hebamme und der Ärztin, wechselten sie sich ab.
Katharina fand das respektlos von dem Herrn Regisseur und Gott der Theater-AG. Und weil sie es überhaupt nicht einsah, in ihrer Freizeit gleich drei Rollen auswendig zu lernen, rückte sie jedes Mal mit den kopierten Texten an. Es ging ja auch so. Lene und Judith verzichteten auf Spickzettel. Ihr Ehrgeiz war entfacht, Robert von sich zu überzeugen. Kritisierte er sie für gewöhnlich hart und schonungslos, sagte er diesmal nichts. Weder nach dem ersten Durchlauf noch nach dem zweiten, und auch nach dem dritten Mal schaute er sie bloß mit undurchdringlicher Miene an.
»Sehen wir irgendwie blöd aus?«, fragte Katharina provozierend. »Oder willst du mit einer von uns ins Bett und überlegst noch, welche dir besser gefällt?«
Judith versetzte ihrer Freundin einen Stoß. Es zwang sie ja niemand, Robert anzuhimmeln, aber nur, weil es ihm manchmal an Feingefühl fehlte, musste sie sich ja nicht auf sein Niveau begeben.
Friedrich, der am Scheinwerfer hantierte, lachte röhrend auf. »Also, ich würde euch alle drei nehmen. Reihenfolge? Wurscht.«
»Dann fang am besten bei dir selbst an«, schoss Katharina zurück.
Lene stieß einen Seufzer aus. »Also echt, Leute. Das wird mir hier langsam zu doof. Entweder arbeiten wir konzentriert oder …«
»Lene, kommst du bitte mal?«, sagte Robert, und seine Gesichtsmuskeln entspannten sich.
»Okay?«
Die beiden verschwanden im Nebenraum, wo die Turngeräte standen, die nicht täglich gebraucht wurden. Gedämpft drangen ihre Stimmen zu den anderen herüber. Genaueres konnte man nicht verstehen.
»Musste das sein?«, fragte Judith.
»Wieso, ich fand’s witzig.«
»War es aber nicht.«
»Herrje, Robert ist schließlich nicht Gott!« Sie grinste ihr umwerfendes Grübchengrinsen, auf das die Jungs so abfuhren. »Mach dich mal locker, Judi. Dann spielst du auch gleich viel besser.«
»Willst du damit sagen, dass ich schlecht spiele?«
»Nein. Natürlich nicht.« Katharina legte ihr den Arm um die Schulter. »Aber du bist manchmal ein bisschen … Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ohne dass du gleich beleidigt bist.« Ihr Blick ging an die Decke, dann sprach sie weiter: »Verkrampft. Okay, wäre ich wohl auch, wenn ich so verknallt wäre wie du.«
»Sei bloß still!«, fuhr Judith ihr über den Mund.
Warum musste Katharina immer alles hinausposaunen, was ihr gerade in den Sinn kam? Wie peinlich, wenn Friedrich etwas mitbekam und es Robert petzte. Dabei konnte sich Judith durchaus vorstellen, dass Katharina selbst in Robert verschossen war. Wahrscheinlich konnte sie ihre Emotionen nur besser verbergen. Wenn man laut und frech war, kam niemand auf die Idee, dass tiefere Gefühle in einem schlummerten.
Einen Augenblick darauf kehrte Robert mit Lene zurück. Schulter an Schulter. Lächelnd. Meine Güte, was für ein hinreißendes Paar! Sie harmonierten perfekt miteinander. Die schöne Lene an der Seite des charismatischen Robert. Judith sah sie im Geiste in eleganter Abendgarderobe über den roten Teppich schreiten und schluckte gegen den Anflug von Neid an.
»Folgendes.« Robert wirkte nervös, während er sich mechanisch über die Locken strich und zu glätten versuchte, was sich ohne sein Zutun sowieso gleich wieder kringeln würde. »Lene spielt die Hauptrolle. Du, Katharina, bist die Hebamme, und du, Judith, die Ärztin.«
Stille. Ein paar Sekunden lang sagte niemand etwas. Die Luft schien zu vibrieren.
»Dann ist das so okay für euch?«, hakte Robert nach.
»Was heißt hier okay?«, entgegnete Katharina eine Spur eingeschnappt. »Du bist der Regisseur. Also entscheidest du auch. Logisch.«
Lene schabte sich mit den Schneidezähnen über den Daumennagel. Das tat sie häufig, sobald sie verunsichert war oder sich unwohl fühlte. »Also, ich muss nicht unbedingt«, sagte sie. »Ich will auch gar nicht … Ich meine, wenn ihr lieber wollt …«
»Nein, Lene, ich will dich für die Rolle«, sagte Robert. »Hebamme und Ärztin können von mir aus tauschen. Falls ihr da Probleme habt.«
»Nein, haben wir nicht«, erwiderte Katharina. »Oder, Judith?«
Judith zuckte mit den Schultern. Hebamme oder Ärztin – das war ihr egal. Im Grunde wollte sie ja nur eins: Rosalie spielen. Die labile Frau, die sich das Leben zu nehmen versuchte und von Robert gerettet wurde. Lene wiederum wollte ganz offensichtlich nicht von Robert gerettet, sprich geküsst werden, denn auf dem Heimweg beklagte sie sich über seine übergriffige Art.
»Wie kann der einfach so über mich bestimmen?«
»Weil er der Regisseur ist«, warf Katharina ein. »Hast du es immer noch nicht kapiert? Das haben solche Leute so an sich. Und warum willst du die Rolle eigentlich nicht? Judith würde ihr letztes Hemd dafür hergeben. Und ich auch.«
Lene hob verzagt die Augenbrauen. »Ich weiß nicht … Ich glaub, ich schaff das nicht. Ich bin immer noch zu leise. Keine Ahnung, warum er ausgerechnet mich will.«
»Na, warum wohl? Weil er scharf auf dich ist!« Katharina lachte gurgelnd auf. »War doch von Anfang an klar.«
Ende der Leseprobe