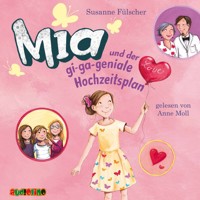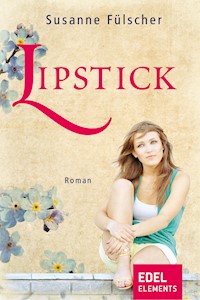
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die 29jährige Katja lebt seit acht Jahren mit Tom zusammen. Eine Beziehung wie eingeschlafene Füße, schon länger geht jeder seiner Wege. Dann lernt Katja den charismatischen Jan kennen: ein Blickkontakt in der U-Bahn. Wenig später trifft sie ihn auf einem Fest ihrer besten Freundin Greta wieder. Eine ebenso leidenschaftliche wie aussichtslose Affäre nimmt ihren Lauf: Katja folgt Jan auf eine erotische Odyssee durch halb Europa und versucht gleichzeitig, ihre Karriere als Daily-Soap-Autorin ins Rollen zu bringen. Und immer wieder funkt Hans, der Mann für alle Fälle, dazwischen, wodurch ihr Leben noch chaotischer wird. Mit sprühendem Witz und einem Schuss prickelnder Erotik - ein erfrischender, hochamüsanter Roman!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Susanne Fülscher
Lipstick
Roman
Edel:eBooks
Copyright dieser Ausgabe © 2013 by Edel:eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg.
Copyright © 1998 by Susanne Fülscher
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-112-5
edel.comfacebook.com/edel.ebooks
Das Buch
Die 29jährige Katja lebt seit acht Jahren mit Tom zusammen. Eine Beziehung wie eingeschlafene Füße. Schon länger geht jeder seiner Wege. Dann lernt Katja Jan kennen: ein Blickkontakt in der U-Bahn. Wenig später trifft sie den charismatischen Mann auf einem Fest wieder und läßt sich von ihm den Kopf verdrehen.
Dabei sind die Konstellationen mehr als ungünstig: Jan ist nicht nur verheiratet, er hat auch drei kleine Kinder. Trotzdem nimmt die leidenschaftliche Affäre ihren Lauf. Katja folgt Jan auf eine erotische Odyssee nach Portugal und Italien und versucht zugleich ihre Karriere als Daily-Soap-Autorin ins Rollen zu bringen. Immer wieder funkt Hans, der Mann für alle Fälle, dazwischen, wodurch ihr Leben noch chaotischer wird. Hin- und hergerissen zwischen den beiden Männern, taumelt Katja durch die schönsten Cafés Europas, von deren Erotik sie sich magisch angezogen fühlt.
Unter den unzähligen Gründen, warum man in ein Café gehen sollte, ist mir einer der liebste: die Pose. Sich hinsetzen, die Ellenbogen auf den Tisch stützen und manchmal die Beine mehr oder weniger elegant übereinanderschlagen.
Ich liebe Cafés aber auch aus anderen Gründen: weil man Zeitung lesen und einen ausgezeichneten Kaffee trinken kann, weil man einen hoffentlich geschmackvoll gestalteten Raum vorfindet, in dem auch andere Menschen sitzen, für deren Gesellschaft man nicht einen Pfennig dazubezahlen muß.
Meistens bin ich enttäuscht. Wenn der Kaffee nicht der ist, den man erwartet hat, und wenn die Bedienung einem die Tasse hinknallt, als wäre sie ein Silvesterböller, ist es eigentlich Zeit zu gehen.
Aber natürlich tut man das nicht, weil man sich gerade vorgenommen hat, die kleinen Katastrophen des Lebens nicht mehr so ernst zu nehmen. Also trinkt man seinen Kaffee, der möglicherweise zu gallig oder zu kalt oder zu wässerig ist, und blättert eine Zeitschrift durch, die einen nicht die Bohne interessiert. Das ist wunderbar.
Es ist das Drama meines Lebens, daß ich mich nicht verlieben kann. Weder in die Richtigen, noch in die Falschen, nicht mal in Zahnärzte, die Comme des Garçons tragen. Ich meine, jede Frau jenseits der neunundzwanzig sollte sich die Finger nach einem Mann lecken, der ein dickes Bankkonto und gesunde Spermien hat und zudem nicht geizt, wenn es um Ausstattung und Pflege seines Körpers geht, dem Autos und Fußball egal sind und der bei einer Unterhaltung fünf Sätze am Stück hervorbringt, die auch noch halbwegs einen Sinn ergeben.
Im übrigen bin ich sowieso dafür, daß Männer gebacken und anschließend beim Bäcker, möglicherweise auch im Supermarkt, verkauft werden. Man stelle sich vor, was für einen enormen Vorteil es hätte, wenn man einfach seine Bestellung aufgeben könnte: Suche Tomatenliebhaber, 1,80 groß, spärlich behaart, mittelbraunes Haar, leicht ausgebildeter Bi- und Trizeps, wenig Bauchansatz, 6000 netto, mit Vorliebe für 85er Brunello di Montalcino und mindestens einem Dries van Noten im Schrank. Die Bäckersfrau tippt die Angaben in den Computer, das dauert nicht länger als fünfundzwanzig bis dreißig Sekunden, und nach fünf Tagen kann man das gewünschte Exemplar abholen. Ach, fast hätte ich die steile Stirnfalte vergessen – einen Milchbubi wollen wir natürlich nicht, und die Rückgabegarantie sollte auch noch erwähnt werden.
Mein Modell hatte ich bereits vor acht Jahren abgeholt – von der Stange, versteht sich –, genaugenommen war es ein Überbleibsel aus einer Zeit, in der man bei Brot- und Brötchensorten noch keinen großen Wert auf Vielfalt legte, als man sich einfach für die Schrippe entschied, weil sie preisgünstig war und weil man sich nicht die Zähne an ihr ausbiß. Meine Schrippe hieß Tom und hatte im Laufe der Jahre vom Vollbart über den Schnauzer bis zum Dreitagebart alle Bartvariationen durchlaufen – als erfolgreicher Anwalt der Endneunziger war er schließlich beim dezenten Ziegenbart geblieben. So wie unsere Streitereien zum Thema Bart aufgehört hatten, waren auch unsere Gefühle füreinander langsam eingeschlafen, und wir fanden nur nicht den Absprung, die eine oder andere unserer gelegentlichen Affären als neues Brötchenmodell zu etablieren.
Es war einer der Tage, an denen ich mich verquollen und verpikkelt fühlte und mein Selbstbewußtsein an meine Gehirnpforte klopfte, um mir seinen Dienst zu quittieren. Das war ein ziemlicher Schlag, und noch während ich versuchte, das rebellierende Ding zu beruhigen, und ihm vorschlug, es noch einmal unter anderen Konditionen mit mir zu versuchen, setzte sich mir ein Mann gegenüber, die U-Bahn fuhr an, und ich verguckte mich in seine Schuhe. Mokkabraunes Leder, matt, die Schuhspitze quadratisch, lederne Schnürsenkel, weder Stiefel noch Halbschuh, alles in allem erstklassige Qualität. Mein Blick wanderte langsam an seinen Beinen entlang nach oben. Die Hose soweit nichts Besonderes, grobes schwarzes Leinen, darüber ein grau-weißes Hemd, kariert und zerknittert, schon war ich bei seinem Gesicht, und mein Blick verhakte sich in seinem.
Na und? sagte ich mir. Das macht dir jetzt gar nichts aus. Die Zeiten, in denen du solchen Augen auf der Stelle ausgeliefert warst, liegen schon lange hinter dir. Also schaute ich weg und konzentrierte mich einfach auf das vorbeifliegende Stadtgebirge und die paar mickrigen Bäume, die immerhin so nett waren, mir ein bißchen sommerliches Grün zu spendieren.
Mit sechs hätte ich mein entsprechend jüngeres Gegenüber neugierig und ein bißchen ängstlich beäugt, mit zehn wäre ich aufgesprungen und weggerannt, mit dreizehn hätte ich mich rotgesichtig an den Arm meiner Freundin gepreßt und erbarmungslos gekichert, mit siebzehn cool aus Kontaktlinsen geschaut und eine phänomenale Kaugummiblase fabriziert, mit zweiundzwanzig verzweifelt versucht, eventuelle Lippenstiftkrümel aus den Mundwinkeln zu entfernen, mit fünfundzwanzig wäre mir mein Freund zu Hilfe gekommen, liebevoll hätte er seine beringte und behaarte Hand auf meine gelegt und »Schatz, die nächste müssen wir …« gesagt, und mit neunundzwanzig benahm ich mich genau wie mit zwölfeinhalb, wurde rot und hatte nicht mal eine beste Freundin dabei, die mir ihren Arm zum Kichern bot.
Also raus. Ruhig aufstehen und zur Tür gehen, ohne auch nur einen einzigen Blick zurückzuwerfen. Dann stand ich an der Hoheluftbrücke, wo ich nicht das geringste zu suchen hatte, und sperrte mein Selbstbewußtsein in den Keller. Ich wollte es nicht eher rauslassen, bis es sich beruhigen und mir ein vernünftiges Angebot machen würde.
Natürlich hätte ich auf die nächste Bahn warten können, aber ich fand es plötzlich angebracht, zu Fuß zum Treffpunkt zu gehen. Zumal es der Sommer war, in dem ich beschlossen hatte, meinem Leben einen Sinn zu geben, und auf sich selbst wütend durch eine glühendheiße Stadt zu laufen war zumindest ein bißchen sinnvoll. Sinnvoller als meine Arbeit allemal. Ich war darauf abonniert, amerikanischen Serienhelden deutsche Wörter in den Mund zu legen, ein Dutzend Serien hatte ich schon abgearbeitet, flüsternd vorm Videorecorder gesessen, damit auch die Labiale hinhauten. Am liebsten hatte ich Jake aus dem Florida-Clan, den mit der Samtstimme und einem schwulen Augenaufschlag zum Verlieben. Daß er nicht sprechen konnte, fiel nur im Original auf, Gott sei Dank, niemals hätte ich Jaky-Boy als das entlarvt, was er tatsächlich war – als einen hundsmiserablen Schauspieler.
Es gibt nur anderthalb zwingende Gründe, als Synchronfrau durchs Leben zu gehen: Der erste heißt Geld, der zweite Freiheit, was sich allerdings nur darauf bezieht, daß man es sich an einem hellichten Sommertag erlauben kann, Fischbrötchen essend durch die Gegend zu wanken und ein Café anzusteuern, in dem man zwecks Karriereschub einen Klassenkameraden von früher trifft. Meiner hieß Ralf. Ralf Witthusen. Lateincrack und Leistungsschwimmer – jetzt heuerte er für Geld Menschen an, die bereit waren, eben jene Fließbandstorys zu schreiben, zu denen ich normalerweise nur die Synchrontexte verfaßte, damit Jaky-Boys Lippenbewegungen auch noch paßten. Genaugenommen hatte ich zwar keinerlei Erfahrungen mit dem Seriengeschäft, dachte mir aber, was soll’s, was andere können, kannst du schon lange.
Außerdem war es der Sommer, in dem der eine Teil der Menschheit sich vorgenommen hatte, den anderen Teil der Menschheit für dumm zu verkaufen, indem er auf allen Fernsehkanälen Seifenopern hervorzauberte, die von Stund an täglich wie das Amen in der Kirche über den Bildschirm flimmerten. Es war eine Seuche, die sich schon seit einiger Zeit angekündigt hatte, aber da es sich um eine unüberschaubar lange Inkubationszeit handelte, nahm man sie erst nicht ernst, und als bereits alle Sender infiziert waren, schaffte man es nicht mehr, die Notbremse zu ziehen. Gegenmittel unbekannt. Und während sich Forscher in aller Welt ihre Köpfe zermarterten, war ich in geheimer Mission unterwegs ins »Petit Café«, um das Virus demnächst möglichst schnell und für möglichst viel Geld unters Volk zu bringen. Operation Fernsehverseuchung – das entsprach voll und ganz meinem neuen Vorhaben, dem Leben endlich einen Sinn zu geben.
Ralf Witthusen. Es war uns beiden daran gelegen, die Sache so schnell wie möglich hinter uns zu bringen, zumal wir uns schon früher nicht aus lauter Zuneigung in den Armen gelegen hatten. Ralf, der asexuelle Besserwisser – heute fand ich ihn bieder und specknackig, beim Reden schob er die zu wulstig geratene Unterlippe vor, während seine wässerig-blauen Augen aus den Augenhöhlen hervortraten. Irgendwie erinnerte er mich an eine Kröte, genauer gesagt an einen Kurzkopffrosch, der – soweit ich mich an einen Dokumentarfilm über Froschlurche erinnerte – Termiten fraß.
Kein Wort über gemeinsame Schultage. Ich bestellte einen Milchkaffee und hörte mir an, warum diese geplante Seifenoper alle bisher dagewesenen in den Schatten stellen würde, warum sie es wert war, daß man einen großen Teil an Außenaufnahmen einplante und – zu guter Letzt – daß man wegen der angestrebten Eins-a-Qualität auch nur Eins-a-Autoren schreiben ließ.
»Und wieso fragst du dann mich?«
»Dein ehemaliger Synchronboß hat dich empfohlen.« Es hörte sich eine Spur verächtlich an – mir tat der arme Kerl fast leid. Einst hatte er hochtrabend akademische Lateinträume im Kopf gehabt, jetzt mußte er sich von Berufs wegen mit ehemaligen Schulkameradinnen herumschlagen, die er schon damals nur für Kichererbsen gehalten hatte. Kröten-Ralf trank Cola, er schwitzte dabei aus allen Poren seines Körpers, und wenn ich nur den Anflug von Anstand besessen hätte, wäre ich gegangen, nur um ihn mit meiner Anwesenheit zu verschonen. Aber da ich zum einen sadistisch veranlagt, zum anderen darauf erpicht war, die Menschheit zu verderben, blieb ich sitzen und klopfte meinem Selbstbewußtsein auf die Schulter, weil es sich gerade so wacker schlug. Es war zwar nicht leicht, Ralfs mühsam kopierten Werbe-Stakkato-Sprechstil zu ertragen, den er zudem mit wunderschönen Anglizismen anreicherte, aber schließlich war ich ja hart im Nehmen.
Familie A lag mit Familie B im Clinch, weil Familienvater A seinerzeit mit Familienmutter B ein Verhältnis hatte, zudem war die eine Familie vermögend, die andere weniger, was dazu führte, daß letztere vor Neid ergrünte, aber leider hatten sich die Kinder der beiden Familien vorgenommen, sich ineinander zu verlieben: Romeo und Julia im Seifenopernformat und natürlich mit der exakt bemessenen Fallhöhe der griechischen Tragödie.
Ich war von dem Konzept schlichtweg begeistert. Daß das Leben so bunt und vielschichtig sein konnte und daß mir ein in den Gesichtszügen entgleister Kurzkopffrosch namens Ralf Witthusen davon berichtete! Es war Hochsommer, meine Libido stand seit der U-Bahn-Episode in ihrem Zenit, und ich hatte das unfaßbare Glück, die zwischen die Werbespots gelegten Füllsel namens Daily Soap mitgestalten zu dürfen!
Nachdem alle Formalitäten geklärt waren, stand ich auf, und während ich es plötzlich für angebracht hielt, mich per Handschlag zu verabschieden, beugte sich Ralf vor und übergoß mich mit einer Geruchsmischung aus Schweiß und saurer Sahne, die bei der Hitze vorschnell einen Stich bekommen hatte.
»Du hörst von mir.«
»Ich höre von dir.«
Ich riß mich los und tauchte in den Glutofen Großstadt ein.
Tom sagte immer: »Baby, du schaffst das schon.« Tom war immer da, wenn ich ihn brauchte. Tom kochte mir Miracoli, er massierte mir den Rücken, gab mir die Hälfte der Stromrechnung, und meistens durfte ich auch die Sachen aufessen, die er in den Kühlschrank gelegt hatte.
Ausgerechnet heute mußte er mich im Stich lassen. Ausgerechnet heute hatte er sich zu seiner neuen weiblichen Bekanntschaft in die Federn gelegt.
»Bin bei Rita« stand in krakeliger Kinderschrift auf einem Zettel, der neben der Cappuccinomaschine lag. Wie aufmerksam! Wie überaus sensibel!
Ich beschloß, mich mit einer Flasche Rotwein auf den Balkon zu setzen und auf ihn zu warten. Auch wenn es mit Sicherheit länger dauern würde. Eifersucht, die keine sein durfte, weil er sich eigentlich nur an die Spielregeln hielt. Sex war nicht verboten, solange er sich außerhalb unserer vier Wände abspielte. Und das war, wenn man es nüchtern und objektiv betrachtete, gar nicht so unpraktisch. Die Betten zu Hause blieben sauber, und jedes Schäferstündchen behielt immer den gewissen Kick des Abenteuers – das hatte ich selbst ein paarmal ausprobiert.
Aber heute gönnte ich Tom keine Rita und Rita keinen Tom. Es war Sommer, alle Welt hockte irgendwo draußen in Biergärten und Cafés herum, hielt Händchen und träumte sich in die Blätterkronen der Bäume, während ich einsam auf unserer zwei Quadratmeter großen Betonplatte namens Balkon über der Straße schwebte und ein Auto nach dem anderen vorbeipreschen sah.
Ich trank ein Glas Nobile di Montepulciano und war danach um so mehr der Meinung, daß Tom sich verliebt hatte. Natürlich hatte er sich in Rita verliebt! In eine, die Rita hieß, konnte man sich nur verlieben! Mit Sicherheit war sie klein und zierlich, dunkelhaarig, charmant und genau sein Typ. Sie ließ ihre sensiblen Finger mit den spitzgefeilten Nägeln auf seinem Rücken auf- und abwandern, just in diesem Moment hatte sie seine Schulterblätter erreicht, fand den kleinen Leberfleck unterhalb des Nackens, küßte ihn, roch an seinem Haaransatz und wurde von einer derartigen Begierde überrumpelt, daß sie ihn auf der Stelle vergewaltigte.
Jetzt drehte ich völlig durch und wechselte, weil mir der Himmel plötzlich eine Spur zu blau erschien, ins Wohnzimmer, wo im selben Moment das Telefon klingelte.
Es war Greta. Sie wolle am Samstag ein Essen geben, sagte sie, und ob ich kommen könne, vielleicht mit Tom oder mit wem auch immer …
»Ich überstehe solche Abende auch ohne einen Mann an meiner Seite«, blaffte ich sie an. Nur weil sie stolze Besitzerin eines Ehemannes und eines Babys war, mußte sie nicht glauben, daß sie alle Welt darum beneidete.
Wie es ihrem Mäxchen gehe, erkundigte ich mich dann, und wurde postwendend und ohne Punkt und Komma über Abstillprobleme, Babyfutterskandale und dergleichen informiert. Gretas Stimme war dabei wie ein gleichmäßiges Schnarchen, das sich erst langsam in den Traum frißt und nicht weiter stört, aber sobald man davon aufwacht, derart zu nerven anfängt, daß man es sofort abstellen muß, um nicht wahnsinnig zu werden. Ich hörte ihrem Geschnarche anstandshalber noch eine Weile zu, aber dann setzte mir meine natürlich völlig unberechtigte Wut auf Männer und beste Freundinnen, auf schönes Wetter und guten Rotwein so verdammt zu, daß ich Greta abwürgte, auflegte und mich in mein Zimmer verkrümelte. Dort warf ich einen angeekelten Blick auf den Videorecorder und legte mich kurzentschlossen ins Bett, um vom Rest der Welt nichts mehr mitzukriegen.
Tom sog wie verrückt an seiner Zigarette. Das tat er immer, wenn er keine Lust hatte, mit mir zu reden, und wenn ihm zusätzlich sein schlechtes Gewissen zu schaffen machte. Postorgiastische Migräne nannte man das. Tag und Nacht ging das so, übervolle Aschenbecher bevölkerten jedes Quadratzentimeterchen unserer Wohnung, und wenn ich mal mit ihm sprechen wollte, wechselte er in den Sessel oder in den Küchenstuhl und suchte mit den Augen die Zimmerdecke ab.
Dabei war Rita seine Sache – diese Rita, die hübscher sein mußte als Toms Vorstellung von hübschen Frauen. Das konnte ich jedenfalls an seinem Blick ablesen. Und sowieso war ich nie sein Typ gewesen: zu blond, zu groß, zu athletisch, zu blaue Augen, zu bäuerlich-plumpe Hände, zu kräftige Fesseln – nicht mal meine Knie waren spitz genug. Tom hatte es in den acht Jahren, die wir zusammenlebten, mindestens einmal pro Monat geschafft, von spitzen Frauenknien zu schwärmen. Spitze Frauenknie waren sozusagen der Inbegriff von Weiblichkeit, die lenkten davon ab, daß die femininen Wesen in seiner Umgebung auch noch andere Eigenschaften besaßen – zum Beispiel einen Willen oder gar eine eigene Kontonummer.
Also gut, war er eben verliebt. Sollte er doch! Ich hatte schließlich meine Arbeit – ganze fünf Kassetten Florida-Clan stapelten sich auf meinem Schreibtisch –, einen vollen Kühlschrank, meine Erinnerungen an erotische Eskapaden von früher und außerdem die Aussicht auf einen neuen Job.
Eigentlich hätte ich nicht lange zu fackeln brauchen und mir sofort irgendeine Affäre zulegen können, aber erstens war ich durch die Abgabetermine meiner Synchronfirma an meinen Schreibtisch gefesselt, und zweitens hatte ich es in neunundzwanzig langen Jahren nicht hingekriegt, die Technik des Männeraufreißens zu lernen. Note fünf – da war wirklich nichts zu machen. Mir gelang ja nicht mal ein harmloser Flirtblick, ganz zu schweigen von einem eindeutigen Angebot, das ich mal eben so en passant lanciert hätte. Also war ich in der Regel auf chauvihafte Aufreißertypen fixiert, sonst passierte bei mir schlichtweg gar nichts.
Pech gehabt. Ich griff nach Toms Zigarettenschachtel und beschloß, vorerst kein Wort mehr mit ihm zu wechseln.
Ralf Witthusen rief bereits vier Tage später an und teilte mir mit, daß er die Outlines plus Bibel gerade kopiere, in einer Woche könne der Spaß dann losgehen, fünf Tage später müsse das fertige Probebuch auf seinem Tisch liegen, Bezahlung erfolge nur bei Abnahme.
In einem Anflug von Panik fragte ich, ob man eventuell auch verlängern könne.
»Fünf Tage sind fünf Tage«, herrschte Ralf mich an, und es knackte so laut in der Leitung, daß ich annahm, er knabberte gerade Termiten als Zwischendurchsnack. »Daran gibt es nichts zu rütteln.« Es war der gleiche Tonfall, in dem er früher besserwisserische Kommentare zu den Wortbeiträgen der Klassenkameraden abgegeben hatte, insbesondere zu denen der Mädchen. Ich wagte noch einzuwenden, daß es ja Menschen gebe, die auch an anderen Projekten arbeiteten, aber das überforderte Ralfs seit Ende der Schulzeit wohl lädierten Intellekt, und so legte ich auf.
Ralf Witthusen. Manche Antipathien blieben eben ein Leben lang Antipathien. Auch gut. Vorerst würde ich meinem Jaky-Boy dazu verhelfen, sich in seine Halbschwester May zu verlieben, um fünfzehn Folgen später – dafür legte ich meine Hand ins Feuer – wieder die Trennung vorzubereiten. Das Thema Inzest eignete sich doch nicht, um Jaky sein ganzes weiteres Leben damit zu quälen. Und was das Witthusen-Teil anging: Ich würde nicht lange fackeln und die Story in einer Nacht runterreißen.
Tom kam nur noch nach Hause, um frische Wäsche zu holen und die dreckige abzuladen, die ich selbstverständlich nicht wusch.
Dann entschwand er wieder, weil seine Rita darauf wartete, ihn mit der A-tergo-Stellung zu beglücken. Einmal rief er aus seiner Kanzlei an und wollte ernsthaft wissen, wie es mir gehe.
»Prima«, sagte ich. »Die Sonne scheint, ich sitze am Schreibtisch, und übermorgen darf ich auf eine Party gehen.«
»Dir macht es doch nicht etwa was aus?« fragte er dann.
»Es«. Er hatte »es« gesagt und meinte Coitus à la vache, prolongatus, inter femora … und wie all die netten Dinge in meinem ebenso netten blauen Duden bezeichnet wurden. Was konnte ich nur an ihnen auszusetzen haben, und so sagte ich ihm, ich hätte »es« schon immer sehr nett gefunden, warum solle »es« mir also etwas ausmachen, und wenn er mich schon so dezidiert nach meiner Meinung frage, am besten gefalle mir Cunnilingus, unterstützt durch solide Handarbeit mit anschließendem Marathon durch das Kamasutra, aber am wichtigsten sei die begleitende Sinfonie aus Küssen, die er ja nie hingekriegt habe.
Unser Gespräch endete wie das mit Ralf Witthusen. Ich legte einfach auf. »Es« war eine Sache, die mich momentan einfach zu sehr aufregte, zumal ich mich fühlte, als hätte man kurzerhand ein paar Eifersuchtsgefühle bei mir angepiekst, die ich schon verloren geglaubt hatte. Auch wenn ich Tom nicht gerade liebte, hatte er nicht das Recht, eine andere zu lieben. Das gehörte einfach nicht in meinen Lebensplan! Wie so vieles nicht, was um mich herum geschah.
Ich fand, ich hatte ungefähr ein Dutzend Vollkornbrötchen an meiner Seite verdient, die mich anhimmelten, mir die Füße küßten und Haus und Hof führen wollten. Statt dessen wählte nur ein jämmerliches Exemplar von Exklassenkamerad meine Telefonnummer und hielt es noch nicht mal für nötig, das richtige Maß an Contenance an den Tag zu legen.
Ein Kind! Ich will ein Kind! flüsterte mir dann eine bisher unbekannte Stimme zu, und ich fragte mich, wie ich nur auf so eine absurde Idee kam. Keine Frau sollte sich ein Kind anschaffen, nur weil sie der Meinung ist, daß alle Männer dieser Welt nichts taugen.
Aber da ich sowieso nicht in der Lage war, allein in irgendwelchen Spelunken oder Diskos herumzuhängen, um mir einen Mann aufzureißen, trat genau das Gegenteil vom Befruchtetwerden ein: Ich lag nachts stundenlang wach und redete mir ein, was für ein trauriges, einsames Leben ich doch führte, eine richtig zu bedauernde Person sei ich, ohne Gegenwart und ohne Zukunft, und manchmal ging mir mein eigenes Gejammer derart auf die Nerven, daß ich mir die Decke über den Kopf zog und fast keine Luft mehr bekam. Halleluja …
Es passierte oft, daß ich nachts aufstand, zum Kühlschrank ging, ein paar Happen aß und mich dann wieder zufrieden in meine Decke rollte. An dem Tag, als Tom auch noch seine dreckige Wäsche abholte, um sie in Ritas Waschmaschine zu stopfen, stand ich ebenfalls nachts um zwölf auf, verschlang einen Rest Greyerzer, die letzte Scheibe Brot und hatte danach ein Hungerloch im Magen, als hätte ich den ganzen Tag über noch nichts zu futtern bekommen.
Ich überlegte kurz – es gab nur drei Möglichkeiten. Ich konnte mich wieder ins Bett legen und den Hunger einfach ignorieren, den Pizzaservice anrufen oder mich gleich anziehen und in eine Kneipe gehen. Schon war ich im Bad, putzte meine Zähne, klatschte ein bißchen Wasser und Schminke ins Gesicht. Ich griff nach meinen Kleidern vom Tag, Jeans, T-Shirt und Strickjacke, und erst als ich auf die Straße trat, merkte ich, was ich da eigentlich tat: Mitten in der Nacht verließ ich die Wohnung, nur um in irgendeiner gottverdammten Kaschemme meinen Magen zu beruhigen.
Es war ein wenig kühl geworden. Ich schlang die Arme fest um meinen Körper und steuerte die nächstgelegene Kneipe an – das »Borchers«, ein aufgemöbeltes Studentenlokal, in dem zuweilen auch Hamburger Säuferprominenz verkehrte.
Die Erikastraße lag wie immer friedlich und völlig still da. Ich passierte den Käseladen, den Penny-Markt, verließ dann, während ich die Straße überquerte und schon das Stimmengewirr der späten Kneipengänger vernahm, die dörfliche Idylle. Trotz der Nachttemperaturen waren alle Holzbänke unter den gigantischen Kastanien an der Vorderfront des »Borchers« belegt. Ich ging rein, aber auch drinnen war es um diese Uhrzeit voller, als ich erwartet hatte. Ohne Rücksichtnahme drängelte ich mich am Tresen vorbei und versuchte all die bierseligen Blicke zu ignorieren. Ganz hinten an der Heizung war noch ein kleiner Tisch frei, links von mir eine Gruppe junger Leute mit langen Haaren und hippen Klamotten, rechts ein linksliberal-emanzipatorischer Frauentisch – oder was ich dafür hielt.
Sollte mir recht sein. Das Essen war schnell ausgewählt – in solchen Kneipen konnte man nur überbackenen Camembert bestellen –, dazu orderte ich ganz gegen meine Gewohnheit ein Bier.
Und was, wenn ich jetzt die Beherrschung verlieren würde und einfach zu heulen anfing? Ohne ein Quentchen Selbstbewußtsein in der Tasche passierte das schneller als gedacht. Nahe am Wasser gebaut, die Kleine – ich haßte alle, die so etwas sagten. Und ich haßte Ralf Witthusen und Tom. Beide hatten sie die verschiedensten Facetten zynischen Grinsens drauf, der eine subtiler, der andere plumper, und je länger man mit ihnen zusammen auf dieser Welt herumturnte, desto besser gelang es ihnen, einen zu demütigen.
Der Camembert schmeckte wunderbar. Nach früher, genauer gesagt nach Seminarschluß, und mit einem kräftigen Schmatzen warf ich all meine Vorstellungen von einer guten Küche über Bord. Bier in sich reinschütten, den Preiselbeersaft von den Fingern abschlecken, danach eine Zigarette anzünden und den Rauch wie eine schlingernde Wand vor sich auftürmen.
Ich entdeckte ihn eher als er mich, obwohl er genau auf meinen Tisch zusteuerte. Es war sein Gang, der schnelle, hektische Schritt – einfach unverwechselbar.
»Hallo, Paul!«
Eine Zehntelsekunde lang war ich versucht, seine Überraschung auszunutzen und zu türmen, aber da ich dank meiner Eltern nicht im D-Zug durch die Kinderstube gerast, sondern ordentlich in einer Bimmelbahn dahergezuckelt war, blieb ich sitzen und wartete, bis er mir unter Zuhilfenahme seines ganzen Gewichts einen feuchten Kuß aufgedrückt hatte. Katja! Mein Gott! So lange nicht gesehen! Gut siehst du aus! Was machst du hier? Und Tom? Und die Zeitung? …?
Immer noch dieser näselnde Tonfall und die Doppelgrübchen in jeder Wange, die sich in seinem Gesicht gleich zu Vierfachgrübchen addierten. Niemand hatte sich um seine Koteletten gekümmert, sie waren leicht aus den Fugen geraten und zudem von einzelnen weißen Fäden durchzogen. Ich sprach ein paar belanglose, konfus zusammengewürfelte Sätze. Was sollte ich nur so schnell auf die vielen Fragen antworten – vier lange Jahre hatten wir nichts voneinander gehört.
Ein Mensch mit einer Sweatshirt-Kapuze stand hinter ihm und bohrte die Hände tief in die Hosentaschen.
»Das ist Hans«, sagte Paul als er meinen Blick bemerkte, woraufhin die Kapuze, die ich schon eindeutig dem männlichen Geschlecht zugeordnet hatte, »hallo« sagte und sich einfach neben mich plazierte. Ich warf ihr ebenfalls ein knappes »Hallo« hin und überlegte dann, woher ich sie kannte.
»Wir haben zusammen Anglistik studiert«, erklärte Paul seinem Freund, »und Germanistik«, und ich nickte dazu, als habe er etwas sehr Bedeutsames gesagt.
Dann fiel es mir ein: Ich kannte Hans nicht. Er hatte nur eines dieser unauffälligen Gesichter, die man schon sein ganzes Leben zu kennen glaubt. Eine Nase, zwei Augen und einen Mund, vermutlich verwaschen aschblonde Haare – genauer hätte ich ihn nicht zu beschreiben gewußt, wäre er zum Beispiel im Park über mich hergefallen.
Paul setzte sich mir gegenüber, eine unangezündete Zigarette klebte zwischen den Lippen. »Dürfen wir?«
Ich nickte artig. Eigentlich gehörten Spontanwiedersehen dieser Art nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, zumal wenn irgendwelche undefinierbaren Kapuzenfreunde als Assistenten anwesend waren. Vor denen mein Leben der letzten vier Jahre in Kurzform auszubreiten lag mir nicht besonders. Außerdem hatte ich schon den letzten Schluck Bier intus. Und außerdem wollte ich nach Hause, aber da ich es nicht fertigbrachte, Paul zu enttäuschen, blieb ich sitzen. Braves Mädchen. Die Bimmelbahn hatte so einiges bewirkt.
Paul fixierte mich aus dunkelbraunen Augen und wartete ab, was ich sagen würde. Er schien zu lächeln, obwohl sich die Haut um seine Augen kein bißchen bewegte. Als ich immer noch keinen Ton von mir gab, meinte er schließlich, daß die Kapuze, die mich jetzt ebenfalls anstarrte, ein Sandkastenfreund sei, erst kürzlich nach Hamburg gezogen. Es interessierte mich brennend, also sagte ich: »Ach, ist ja interessant.«
Die beiden bestellten Bier, was schon nach kurzer Zeit gebracht wurde. Die Kapuze moserte über die nicht vorhandene Schaumkrone, wir prosteten uns zu, und da Paul keine Anstalten machte, etwas von sich aus zu erzählen, fragte ich ihn, was er denn so treibe.
Während die Kapuze ihre Kapuze abnahm (unter der tatsächlich aschblondes Haar zum Vorschein kam) und sich in den Anblick ihres Bierglases versenkte, sagte Paul nur einen einzigen Satz: »Ich bin solo, ich fahre einen verdreckten Golf, und wenn ich nicht gerade gegen Honorar Hochzeitszeitungen zusammendichte, jobbe ich bei der Post.«
Fast wie früher. Es beruhigte mich beinahe, daß es noch mehr Menschen auf dieser Welt gab, die nicht im Freistil durch das Karriereschwimmbecken schossen.
»Komm, laß uns über was anderes reden. Vergangenheit ist langweilig.« Paul langte gierig nach seinem Bierglas, um dann nur kurz daran zu nippen.
»Und du?« Mit der Professionalität einer Fernsehmoderatorin wandte ich mich Hans zu.
»Dealer«, sagte er und wollte sich über seinen Witz halb totlachen.
»Ist ja beeindruckend.« Statt ihn anzusehen, guckte ich durch die milchige Scheibe in das dunkle Loch der Nacht.
»Hans kauft Weine ein. In Italien.«
»Auch beeindruckend«, fügte ich hinzu. »Ich lebe davon, daß ich Kuhaugen seziere.«
Die beiden Jungs lachten, was ich absolut nicht begreifen konnte, nicht mal zu dieser Uhrzeit und mit einem Preiselbeercamembert im Magen.
Irgendwie wollte unsere Unterhaltung nicht in Gang kommen, und ich fragte mich, ob es wohl an mir lag – vom ersten Moment an hatte ich es nicht auf ein Gespräch angelegt.
Was ja auch kein Wunder war. Zwei Freunde, die ein Bier trinken gingen, waren meines Erachtens zwei Freunde, die tatsächlich nichts anderes im Sinn hatten, als sich zwei Halbe zu genehmigen, fünf Zigaretten zu rauchen und sich damit zu beruhigen, daß haufenweise Gleichgesinnte um sie herum saßen, die ebenfalls so taten, als sei dies das wahre Leben, während die Leute, die das falsche Leben lebten, längst im Bett lagen. Ich mußte plötzlich grinsen.
»Was hast du?« fragte Paul.
»Nichts. Ihr seht nur gerade so aus, als wärt ihr mit dem Schuppen hier verwachsen.«
»Häh?« machte Hans, und Paul erwiderte ziemlich giftig, warum ich denn überhaupt hier säße, normalerweise ginge ich bestimmt nur in Edelläden.
»Kommt drauf an«, sagte ich.
»Worauf zum Beispiel?« wollte Paul wissen.
»Auf so einiges. Und wie du dich vielleicht noch erinnerst, wohne ich ja gleich um die Ecke.«
»Dann zeig uns doch mal eine deiner Designerkneipen.«
»Ich wüßte nicht, wozu«, sagte ich knapp und studierte Pauls Gesicht, das plötzlich etwas Spöttisches und zugleich Verwegenes hatte. Die Stirn in Falten gelegt, die Mundwinkel leicht nach unten gezogen, so hatte ich ihn früher nie erlebt. Entweder wollte er mich vor seinem Kapuzenfreund lächerlich machen, oder er legte es darauf an, noch heute nacht dem großen Abenteuer zu begegnen.
»Hans kennt die Hamburger Szene nicht.«
»Du doch auch nicht.«
»Ja eben!«
Ich setzte mein Glas so heftig an die Lippen, daß meine Nase fast im Bier ertrank. Paul und Hans. Plötzlich war ich hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, mich einfach auf meinem Bett auszustrecken, und der Lust auf eine wilde Nacht. Tanzen und trinken und den beiden Provinznasen zeigen, was eine richtige Stadt war.
Wir bezahlten vorn am Tresen, die Kapuze war im Stehen größer und kräftiger, als ich vermutet hatte. Mit Hans’ Polo fuhren wir dann auf den Kiez, und einen kleinen Moment lang dachte ich mit Entsetzen daran, daß die unerledigten Videokassetten wahrscheinlich gerade dabei waren, sich unaufhaltsam zu vermehren, und wenn ich am frühen Morgen nach Hause käme, würden mir die Videobänder schon auf dem Flur entgegenquellen …
Im »Lounge« war es heiß und voll, und die Musik war so laut, daß wir Gott sei Dank nicht zu reden brauchten. Ich fühlte mich wohlig träge, nur von der unbändigen Lust befallen, mir einen anzupicheln. Normalerweise trank ich nicht. Vielleicht mal ein Glas Wein zum Essen, aber es kam mir nicht in den Sinn, Alkohol in mich reinzuschütten, damit ich eine andere wurde.
Ohne mich vorher zu fragen, brachte Paul mir ein Glas Sekt, wohingegen Hans und er sich ein Bier genehmigten. In seiner Welt gab es wohl Herren- und Damengetränke – eigentlich eine Frechheit. Ich trank hastig und beguckte die zappelnde und zuckende Menschenmenge. Wenn ich jetzt tanzen ging, würde ich mit Sicherheit eine Stunde wegbleiben und die Herren sich selbst überlassen.
»Alles okay?« schrie ich den Jungs zu, die in dem fahlen Licht seltsam wächsern aussahen.
»Hans hat an eine etwas andere Musik gedacht«, rief Paul.
»Woran denn? Techno? Hip-Hop?«
»Jedenfalls nicht so ein langsames, angesoultes Jazz-Zeug.«
»Ignorant!«
»Aufgeblasene Ziege!« Paul lachte und nahm mich in den Arm.
»He, he!« Ich machte mich los, leerte mein Glas und holte eine zweite Runde Getränke. Endlich war das Eis gebrochen und Paul wieder der alte.
Als ich zurückkam, hüpfte Paul zu meinem Erstaunen auf der Tanzfläche herum. Ich drückte Hans zwei Biergläser in die Hand und nippte an meinem Tequila.
Trotz lärmender Bässe war mir das Schweigen unangehm.
»Na? Schneckenhaus?« brüllte ich Hans schließlich ins Ohr und zog an seiner Kapuze.
»Genau!« Er pustete das Wort etwas feucht in mein Ohr, unverkennbar Kenzo.
»Und wieso Kenzo?« Meine Stimme kam mir heiser vor, und ich war mir nicht sicher, ob die einzelnen Silben nicht von der Musik verschluckt worden waren.
»Manchmal will auch ich was Besonderes sein.«
Ich schwieg lieber. Wie konnte man so was nur von sich selbst sagen und dann auch noch bei einem aufdringlichen Duft wie Kenzo?
»Tanzt du nicht?« Ich hatte wieder seine Tröpfchen am Ohr und schüttelte der Einfachheit halber nur den Kopf. Warum sollte ich ihm auch groß erklären, daß mir der Alkohol schon zusetzte und ich in diesem Zustand selten Lust auf Bewegung – welcher Art auch immer – hatte.
»Und du?«
»Tanze nie. Ich mach mich doch nicht lächerlich.«
»Ach so«, sagte ich nur und dachte, das hast du bereits getan.
Dann ließ ich ihn stehen und ging aufs Klo. Während ich mir die Lippen nachpinselte, fragte ich mich ernsthaft, was ich hier eigentlich wollte. Ausspannen? Vor der Arbeit flüchten? Mir einen der Jungs erotisch trinken? Keine Ahnung, warum ich auf einmal fünf Mark aus dem Portemonnaie kramte und Kondome zog. Eigentlich konnte ich fürs gleiche Geld einen Haufen Lakritze kaufen, die mit Sicherheit viel besser schmeckte. Oder eine Schachtel Zigaretten. Für Notfälle.
Als ich wieder rauskam, gönnte ich mir einen zweiten Tequila an der Bar. Obwohl mir fast schon übel war, genoß ich das Flirren im Kopf, tanzte doch einmal – kein Paul zu sehen, nur Hans hatte am Rand der Tanzfläche Stellung bezogen und lehnte lässig an einer Säule. Ich torkelte geradewegs auf ihn zu, hatte dann seine Hand auf meiner Schulter. Fast grob schob er mich durch die Menge Richtung Ausgang.
»Wo ist Paul?«
»Müde. Ich fahre dich nach Hause.«
Ich leistete keinen Widerstand. Draußen war es plötzlich schwülwarm; in der Ferne grummelte es.
»Das könnte noch was geben«, sagte Hans, ohne zu wissen, was er da eigentlich redete.
Ich antwortete nicht. Meine Zunge lag pelzig und riesengroß im Mund, ein Stück Fleisch, das nach anderem Fleisch japste, und es war ihm fast egal, was für eine Sorte es abkriegen würde. Hans’ Hand fühlte sich wie Blei auf meiner Schulter an. Wir gingen stumm ein paar Meter, sein Polo stand in einer Seitenstraße. Während er mir die Beifahrertür aufschloß und ich mich auf den Sitz quetschte, zerteilte ein Blitz den Himmel. Zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig – Donner. Ich schaute Hans von der Seite an. Sonderbar sah er aus. Wie eine Zeichentrickfigur aus meiner Kindheit, deren Name mir entfallen war. Rundes Gesicht, spitze Nase, Strichmännchenmund. »Lolek und Bolek« oder so.
Wir fuhren los. Hans drehte am Radioknopf, fand schließlich einen Sender, der irgend etwas von Tschaikowsky spielte.
Innerhalb der nächsten Sekunden war das Gewitter über uns, und der einsetzende Platzregen verwandelte die City in eine riesengroße Waschanlage.
»Wir sollten irgendwo ranfahren«, sagte ich, obwohl man nicht mal mehr sah, wo irgendwo war. Hans ging langsam vom Gaspedal und lenkte den Wagen zentimeterweise nach rechts, polterte über einen Kantstein, bremste. Er lehnte sich zurück, atmete tief durch.
Es ist das Drama meines Lebens, daß ich nicht einschlafen kann. Nicht mal nach so einer Nacht.
Camembert und Paul und dann Hans. Ich war nicht verliebt, kein bißchen, sonst hätte ich nicht so ein gräßliches Hungerloch im Magen verspürt. Ein Krater, der sich immer mehr auftat, je länger ich darüber nachdachte, weshalb ich Menschen küßte, die ich nicht küssen wollte.
Sicher, der Appetit kommt beim Essen … Hans hielt mein Gesicht in seinen Händen und konnte doch gar nicht wissen, wie schnell mich das zu Fall bringt.
»Der Regen läßt nach«, sagte er, als würde das irgendeine Wendung in unsere Angelegenheit bringen, und er preßte sich an mich und stöhnte leise. Eine Welle der Erregung rollte im selben Moment durch meinen Körper, ich befreite mich trotzdem aus seinen Armen und schob die Arbeit vor.
»Was? Jetzt?«
»Ja – genau. Jetzt«
»Ach Gott.«
Mehr fiel ihm nicht dazu ein. In der Ferne ein einsames Grollen, Hans küßte mich noch einmal, diesmal wilder.
»Komm …« Sein Mund war warm und feucht an meinem Ohr, halb ließ ich mich ziehen, halb kletterte ich auf seinen Schoß, suchte nach diesen verfluchten Dingern, die ich gerade im Klo erstanden hatte. Er öffnete seine Hose, wir machten es im Auto, während der Regen ganz aufhörte, und ich vermutete, daß uns die Passanten, falls es sie denn zu dieser Stunde gab, sehen konnten.
Hatte er mich nach Hause gefahren? Vermutlich ja. Also wußte er, wo ich wohnte, und ich wußte, daß ich die Nacht mit der Kapuze lieber aus meinem Leben streichen wollte. Es war kurz nach halb fünf, und mein Schädel dröhnte. Eine leichte Übelkeit sickerte durch alle Kanäle meines Körpers. Ekel vor dem Tag, der die Spuren der vergangenen Stunden in mein Gesicht schreiben würde.
Etwa gegen sieben schlief ich ein, ein anstrengendes Dahindämmern mit tausend wirren Gedanken, trotzdem stand ich um Punkt neun auf und hoffte, daß sich mein Magen nicht um sich selbst drehen würde.
Unglückseligerweise war dieser Morgen nicht einfach nur ein gewöhnlicher Morgen, sondern auch der Beginn des Tages, an dem das Essen bei Greta stattfinden sollte. In meinem Kopf hämmerte es. Ich riß die Gardinen auf und verfluchte den Sommerhimmel, der schon wieder nicht vorhatte, sich in eine seiner grauen Hüllen zurückzuziehen.
In der Küche saß Tom. Ich rannte aufs Klo und mußte kotzen. Es dauerte ziemlich lange, und während ich noch abwartete, ob auch wirklich alles rausgekommen war, hämmerte Tom an die Badezimmertür und fragte sinnvollerweise, ob auch alles in Ordnung sei.
»Nur ein paar Spritzer auf der Brille«, keuchte ich und tauchte kurz darauf groß und kreideweiß und mit runden Knien auf dem Flur auf. Das konnte ja nichts werden mit uns.
Tom nahm mich in den Arm und verkündete stolz, er habe schon Tee gekocht.
»Wo kommst du eigentlich her?« fragte ich.
»Von draußen«, antwortete Tom frech.
»Und was hast du hier zu suchen?«
»Ich meine mich zu erinnern, daß ich genausoviel Miete zahle wie du.«
»Ist Rita unpäßlich?« Ich schenkte mir Tee ein und wunderte mich, daß ich schon wieder keifen konnte.
Tom zuckte die Achseln. »Ich wohne hier.«
»Davon habe ich aber nicht viel gemerkt.«
»Was willst du eigentlich?« Er stand auf, durchmaß die Küche mit ein paar großen Schritten und blieb am Fenster stehen. »Ich dachte, wir hätten uns geeinigt.«
»Jaja! Jeder zieht sein Ding durch. Aber dies hier ist kein Hotel!«
Nicht nur, daß ich körperlich zerschlagen war, jetzt fühlte ich mich auch noch psychisch am Ende. Mit einer hektischen Bewegung griff ich nach meinem Teebecher und zog mich in mein Zimmer zurück. Ohne zu duschen und noch im Schlafanzug, setzte ich mich an den Schreibtisch. Videorecorder an, Kassette rein. Ich haßte diese Szene, in der Amanda ihrem Daddy mitteilte, daß sie keinesfalls in seiner Firma weiterarbeiten werde. So viele Labiale, alle im On gesprochen, nicht mal ein dusseliges Halb-Conter dabei. Ich legte die Füße hoch, spulte ein bißchen zurück, ließ Amanda ihren idiotischen Satz sagen, spulte wieder zurück, probierte eine Übersetzung, dann noch eine: »Mein Entschluß steht fest, Daddy, gib mir die Schlüssel«, sprach ich ins Diktaphon, und mir war klar, daß hier rein gar nichts hinhaute. Verdammt, heute machte mich alles fertig! Jede noch nicht getextete Szene, jedes einzelne Wort, das es nicht auf meinem Diktiergerät gab, war eine Qual. Trotzdem arbeitete ich verbissen weiter und versuchte zu ignorieren, daß es irgendwo in dieser Wohnung einen Tom gab. Die Jalousien hatte ich runtergelassen, nur ein einziger Sonnenstrahl war durch einen winzigen Spalt gekrochen und tanzte jetzt frech an der Wand auf und ab. Immerzu diese Schwüle – was war das eigentlich für ein Sommer?
Ich zog mein Schlafanzugoberteil aus, textete oben ohne weiter, was aber auch nicht lange gutging, weil ich mittels Bleistifttest prüfte, ob mein Busen etwa schon hing – zum Glück verschonte er mich wenigstens damit!
Gegen halb zwei klopfte es an meine Tür. Ohne daß ich ihm die Erlaubnis erteilt hätte, kam Tom rein und schlang von hinten seine Arme um mich. Er streichelte meine Brüste, und mir war wirklich schleierhaft, warum ich in diesem Moment Lust auf ihn bekam. Noch nie hatte ich vorm Bildschirm gefickt und dazu noch so verteufelt gut.
Es gibt mehr erotische Cafés auf dieser Welt, als man sich vorstellen kann.
Erotische Cafés sind solche, in denen Espressomaschinen hinter einer langen Theke zischen und Tassen mit ihren dazugehörigen Untertassen unaufhörlich klappern. Dabei ist es natürlich kein x-beliebiges Zischen und Klappern, nein. Ein erotisches Café klingt wie ein Klavierkonzert von Chopin, mindestens, und wenn das fortwährende Gemurmel und das Klappen oder Knarren der Eingangstür noch hinzukommen, kann schnell eine Mahler-Sinfonie daraus werden.
Man sitzt zum Beispiel auf einer rotgepolsterten Lederbank, im Rücken in Kopfhöhe einen circa fünf Meter langen Spiegel, und spürt, wie ein gewisses Kribbeln über die Füße langsam nach oben steigt und in Regionen verharrt, die man besser einem Liebhaber überlaßt. Was dann? Entweder, man wechselt auf einen der härteren Caféhausstühle, die mit der Rattansitzfläche, oder aber man nimmt schnell die Karte zur Hand. Einen Cappuccino, bitte! ruft man dem Ober zu – der trägt natürlich eine lange weiße Schürze und fängt einen mit seinen Glutaugen ein. Wenige Minuten später steht die weiße oder dunkelbraune Tasse vor einem, man versenkt einkleines Häufchen Zucker in der Milchhaube, plop macht es ganz leise, um nicht zu sagen unhörbar, man nimmt den Löffel und verührt zärtlich das Kakaopulver im Schaum, nippt vorsichtig, die Lippen leicht geöffnet, nur ein gehauchter Kuß, und wenn das Ensemble aus italienischem Espresso, Wasser, Milch und Zucker bereits die richtige Temperatur hat, taucht man mutig ein, nimmt einen richtigen Schluck, läßt Zunge und Seele schmecken, was das Leben zu bieten hat!
Uff! Wie viele Schlucke braucht es bis zum Orgasmus? Zwei, drei? Die halbe Tasse, oder kommt man erst beim letzten Schluck, wenn einem der schwarz-süße Sud durch die Kehle rinnt?
Das erotische Café hat an alles gedacht und die Dusche danach natürlich schon mitgeliefert. Man greift zum Wasserglas, das schüchtern an der äußersten Kante des Tabletts steht, trinkt davon, und nachdem man bezahlt hat (Trinkgeld bitte nicht vergessen!), verläßt man beschwingt das Café.
Gegen Abend waren Tom und mein Katerkopfschmerz endlich ausgeflogen. Wahrscheinlich hatten sie sich ewige Freundschaft geschworen und gingen gerade gemeinsam einen trinken.
Mir sollte es nur recht sein. Ich für meinen Teil hatte mir das bei Tom abgeholt, was mir schon viel früher zugestanden hatte – und damit basta. Schwamm über das Ende einer Liebe. Was Tom dachte, interessierte mich nicht, genausowenig, ob er es wieder wollte. Es spielte einfach keine Rolle mehr. Ein Gefühl des Triumphes breitete sich langsam in mir aus, entlud sich feuerwerksartig in meinem Kopf, wo es dann eine Weile vor sich hin jubilierte, bevor es in Form eines satt-zufriedenen Seufzers verglomm.
Schon saß ich wieder vorm Videorecorder, und während ich wie eine Sprechmaschine Sätze ausprobierte, dachte ich, daß das Leben doch großartig war. Ich konnte mir jederzeit ein Stück von dem Kuchen abschneiden, ohne Gefahr zu laufen, mir dabei gleich einen ganzen Finger abzusäbeln. Äußerst praktisch. Keine Gefühle, keine Schmerzen – eine simple Gleichung, die man Kindern ruhig schon im Vorschulalter beibringen sollte.
Amanda lief mittlerweile hektisch durch ihre sterile Wohnzimmerkulisse, fünf Sekunden ohne Worte, fünf geschenkte Sekunden für mich als Texterin! Dann klingelte – wie konnte es anders sein – ihr Liebhaber Howard. Sie fielen sich kurz und gefühllos in die Arme, um dann ihren üblichen Stuß abzulassen. Amanda hatte immer noch die Firma ihres Daddys am Wickel, Howard hörte sehr interessiert zu, während er sich an Amandas Bar einen Drink mixte, in dem die Eiswürfel dallasmäßig nur so klirrten.
Ich fragte mich ernsthaft, warum man diesem Amanda-Mund, der große Ähnlichkeit mit der Schnauze eines Pferdes aufwies, keinen dezenteren Lippenstift verpaßte hatte, ganz abgesehen davon, daß ich ihre prononcierte Sprechweise, die eine Übereinstimmung der Lippenbewegungen unmöglich machte, aus vollem Herzen haßte. Zum Teufel mit dem Florida-Clan!
Zwei Stunden später saß ich im Taxi und zerbrach mir über zwei Dinge den Kopf: Konnte Hans meine Telefonnummer rauskriegen, und mochte Greta eigentlich Prosecco, den ich ihr als Gastgeschenk zugedacht hatte? Die erste Frage hakte ich relativ schnell ab: Er konnte, wenn er wollte, er war ja nicht auf den Kopf gefallen. Und falls er es tatsächlich wagen sollte, bei mir anzurufen, hatte ich immer noch die Möglichkeit zu überlegen, ob mir ein weiteres Stück Kuchen behagte. Frage zwei erübrigte sich dann, weil das Taxi nur fünf Minuten brauchte und Greta mir schon entgegenschoß und die Flasche an sich riß, wobei sie mindestens fünfmal »Hmm. Lecker!« sagte.
Ich küßte Greta auf den Mund. Sie sah hinreißend aus in einem schlichten schwarzen Kleid, das an ihrem zierlichen Körper herabfloß. Wie machte sie das nur? Parasit Mäxchen hatte ihr gerade monatelang den Busen ausgeleiert, und trotzdem konnte man sie im Zweifelsfall nicht von einer Sexbombe Marke Kindfrau unterscheiden.
»Ich glaube, ich bin völlig unpassend angezogen«, flüsterte ich ihr zu, während sie mich um die Taille packte und in den Flur zerrte.
»Ach was.«
»Doch was!« Ich sah an mir herunter. Graues Leinenschlabberhängerteil, und was mein Gesicht betraf, hatte ich mir nicht mal die Mühe gemacht, die Spuren der nächtlichen Entgleisung zu beseitigen.
»Wer dich liebt, liebt dich auch so.« Greta bleckte die Zähne und sah gar nicht mehr so allerliebst aus wie normalerweise. »Außerdem hast du doch sonst mehr Selbstbewußtsein.«
»Okay«, sagte ich. Zum Thema Selbstbewußtsein bezog ich lieber nicht öffentlich Stellung.
Greta führte mich ins Wohnzimmer, wo sich schon einige Gäste versammelt hatten. Sie standen in einem Grüppchen zusammen, uniform schwarz gekleidet, und redeten mit gedämpften Stimmen.
Greta hatte sich alle erdenkliche Mühe gegeben, den Eßtisch zu einer festlichen Tafel umzufunktionieren: eine weiße Decke, die bis auf den Fußboden fiel, silberne Leuchter, Silberbesteck – beides reichlich angelaufen –, Platzteller, Weißwein-, Rotweingläser und allerhand bunte, perfekt arrangierte Sommersträuße. Es sah wirklich prächtig aus. Gretas Mann und Gebieter Micha hatte bereits die Aperitifs eingeschenkt und gab mir Küßchen links, Küßchen rechts.
»Die anderen kennst du?« fragte er.
»Sicher«, sagte ich und machte wohlerzogen meine Runde. Shakehands mit all den schwarzen Gestalten.
Insgesamt waren sechs Leute eingeladen, zum Teil Michas Arbeitskollegen, ein paar kannte ich noch von früheren Studentenfeten.
Schlagartig wurde mir klar, wie sich die Zeiten geändert hatten. Heute war Stil gefragt, ein gediegen-nobles Ambiente, man spielte Erwachsensein oder das, was man dafür hielt. Um keinen Preis hätten wir uns zu Studienzeiten mit trockenem Sherry zugeprostet, um uns dann, während wir über die Schwankungen an der Börse oder über neues italienisches Design palaverten, zu Tisch zu setzen. Ich war plötzlich wütend, wütend auf den Lebenstil meiner Freunde und auf mich selbst, weil ich doch ein Teil von ihnen war und das Spiel mitspielte.
Es klingelte. »Jan und seine Frau Katharina«, sagte Micha. »Wir haben zusammen studiert.«
Wie grauenvoll, dachte ich. Noch so ein BWLer, und dann betrat plötzlich der Mann aus der U-Bahn den Raum, an seiner Seite eine kleine, grazile und außergewöhnlich hübsche Frau. Ich geriet in Panik. Als hätte ich mit ihm letzte Nacht Sex im Auto gehabt. Ich schluckte ein paarmal, zwang mich zur Ruhe. Es gab nicht den geringsten Grund, Amok zu laufen. Vielleicht erinnerte er sich nicht mal mehr an mich …
Die beiden fingen jetzt auch mit einer formvollendeten Shakehands-Runde an, während die Innenflächen meiner Hände von einer Sekunde zur nächsten schweißnaß wurden. Kalter Schweiß. Eins der ekelhaftesten Dinge, die man sich vorstellen kann.
Es kam nicht dazu, daß er in meiner feuchten Hand ausrutschte. Ich stand da wie damals beim Sportunterricht, wenn mich niemand in seiner Mannschaft haben wollte – zu groß, zu plump, der unbewegliche Bauerntrampel vom Dienst. Dabei war ich jetzt eigentlich ganz froh darüber, es wäre ein denkbar ungünstiger Einstieg gewesen. Mittlerweile stand besagter Jan mit seiner Frau bei Jochen und Annette, ich sah ihn wild mit den Händen gestikulieren, während Annette und Jochen, jeweils ein Bein eingeknickt, zu ihm aufsahen.
Wenn man es genau nahm, war er kein wirklich schöner Mann, eher ein extremer Mann. Alles an ihm schien mir ein wenig übertrieben: seine Größe, sein Dünnsein, die Länge seiner Nase. Sein Mund wirkte gierig, ja maßlos, und seine sprechenden Hände schienen den ganzen Raum auszufüllen. Eigentlich konnte ich Männer nicht leiden, die es darauf anlegten, daß selbst die frisch hingestellten Blumen neben ihnen verblaßten. Ärgerlich kippte ich meinen Sherry in mich rein und ging zu Greta in die Küche, die gerade dabei war, die bereits fertigen Flußkrebsschwänze in den Ofen zu schieben.
»Wer ist dieser Jan?« fragte ich leise.
»Micha kennt ihn schon seit einem halben Jahrhundert.« Greta wusch sich jetzt ausgiebig ihre Hände und sah mich dabei grinsend an.
»Und warum kenne ich ihn nicht?«
»Sag bloß, er gefällt dir.«
»Ach was!« Ich sagte das so heftig, daß Greta eher das Gegenteil annehmen mußte.
»Ich glaube, seine Frau leidet ziemlich unter ihm.«
»Inwiefern?«