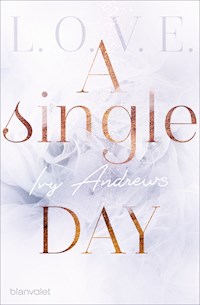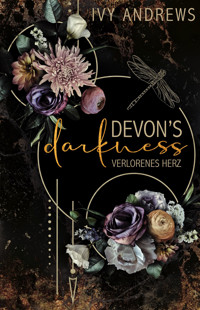6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ivy and Ava Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie ist reich und schön, ihr Leben ist eine einzige Schlagzeile, und sie hasst alles daran. Er ist ihr Bodyguard. Sein Auftrag ist es, sie zu schützen – zur Not auch vor sich selbst. It-Girl London Hyatt will Rico Ackles heiraten, den neuen Star-Quarterback der Miami Dolphins. Aus Gründen, die nichts mit Liebe, aber alles mit Freiheit zu tun haben. Nur so kann sie der Vormundschaft ihres Vaters entkommen. Womit sie nicht rechnet, ist der brutale Gegenwind der Football-Fans, die in ihr ein ernsthaftes Risiko für den Erfolg des Teams sehen. Sicherheitsexperte Tanner Morrison soll sie schützen, doch bald stellt sich heraus, dass der heiße Bodyguard die eigentliche Gefahr ist – nicht nur für Londons Pläne, sondern vor allem für ihr Herz. Band eins der »Miami Memories«-Reihe von Ivy Andrews, eine heiße Bodyguard-Romance. Wenn du diese Tropes liebst, ist die Geschichte von London und Tanner perfekt für dich: • Good Guy • Soul Mates • Marriage Pact • Forbidden Love • Dark Secret
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
LONDON’S LIGHTNESS
VERLORENE TRÄUME
MIAMI MEMORIES
BUCH 1
IVY ANDREWS
INHALT
Widmung
Vorwort
1. Von Streifzügen zu später Stunde und sorgenvollen Schreckensszenarien
2. Von fruchtbaren Fluchtversuchen und fruchtlosen Fahndungen
3. Von gebrochenen Gelübden und großartigen Geschwisterbanden
4. Von perfekten Pfannkuchen und perfiden Plänen
5. Von dreisten Drohgebärden und diplomatischen Dialogen
6. Von manipulativen Machtspielen und machomäßigen Muskelvergleichen
7. Von einem maulendem Muscle Mountain und maximalem Melancholie-Mood
8. Von pompösen Poollandschaften und einer perfekten Promi-Präsenz
9. Von aufmerksamkeitszehrenden Atemübungen und abrupten Attacken
10. Von engagierten Ersthelfern und erstaunlichen Emotionsstrudeln
11. Von körperlosen Köpfen und kolossalem Körperkontakt
12. Von machtvoller Marmeladenglasmagie und mysteriösen Magnetismusmomenten
13. Von verlockender Verbundenheit und verschwiegener Vergangenheit
14. Von panischen Präsentiertellersituationen und prickelnden Plaudereien
15. Von homophoben Hassverbrechen und hektischen Hilfsaktionen
16. Von konsequentem Krisenmanagement und kalkuliertem Konfliktpotenzial
17. Von bigotten Bilderbuch-Boomern und beispiellosen Befreiungsschlägen
18. Von fragwürdigen Fake-Identitäten und feinen Freundschaftsgesten
19. Von kniffligen Kletterpartien und komischem Kopfkino
20. Von gemeinsamen Glücksmomenten und grandiosem Gelegenheitssex
21. Von erschreckenden Erkenntnissen und emotionalen Erklärungsversuchen
22. Von tränenreichen Tabubrüchen und tiefsitzenden Traumata
23. Von verdrossenen Verflossenen und verbaler Vergangenheitsbewältigung
24. Von Londons liebkosenden Lippen und einem leidenschaftlichen Leibwächter
25. Von sinnlichen Sexkapaden und schmerzhaften Schuldgefühlen
26. Von heldinnenhafter Haltung und helfenden Händen
27. Von besorgniserregenden Belagerungszuständen und (ein-)bruchsicherem Bungalow-Bunker
Epilog – drei Wochen später
Über die Autorin
Weitere Bücher von Viola Plötz
Danksagung
A single night – L.O.V.E. 1
A single word – L.O.V.E. 2
A single touch – L.O.V.E. 3
A single kiss – L.O.V.E. 4
Devon' s Darkness: Verlorenes Herz
Triggerwarnung
»Nothing can dim the light that shines from within.«
MAYA ANGELOU
WIDMUNG
Die Gewalt, die Frauen durch Männer erfahren, ist real. Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners getötet.
Dieses Buch ist allen Frauen gewidmet, die Opfer sexualisierter Gewalt wurden, sowie denen, die partnerschaftliche Gewalt erlebt haben oder noch immer erleben müssen.
Mir kommt es manchmal so vor, als würde sich niemand dafür interessieren, was passiert und wie groß die Tragweite dieser geschlechtsspezifischen Gewalt ist. Mehr als einmal hatte ich in den letzten Tagen (Stichwort: Verhandlungen zur Frauenrechts-Richtlinie der EU) das Gefühl, dass wir unsichtbar sind, aber ich sehe euch und ich wünsche mir für euch, dass ihr einen Weg findet, die Traumata aufzuarbeiten, damit sie euch nicht auf Schritt und Tritt verfolgen. Jede Einzelne von euch verdient es, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Vielleicht liest du das und fragst dich: »Wie? Wie soll das nach allem, was mir widerfahren ist, möglich sein?« Ehrlich, ich weiß es nicht. Es gibt gute und es gibt schlechte Tage. Und ich weiß, dass die schlechten Tage oft überwiegen. Ich weiß das wirklich, aber jeder Tag hat nur vierundzwanzig Stunden, die man überstehen muss.
VORWORT
Liebe Leserin, lieber Leser and everybody in between, vielleicht kamen dir der Klappentext oder die Namen der Hauptfiguren bekannt vor. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn dieser Roman basiert auf der Novelle »Miami Millionaires Club – Tanner«, die ich vor ein paar Jahren als Ava Innings geschrieben habe.
Wie ich zugeben muss, habe ich im Nachhinein immer etwas bedauert, dass Londons Geschichte nicht mehr Platz bekommen hat. Bei ihrem Bruder Devon war ich schlauer und habe den Roman direkt aus der Millionaires-Club-Reihe ausgegliedert, sodass ich nicht das Novellenformat einhalten musste, auf das wir uns damals als Autorinnen geeinigt hatten.
Im November 2022 dann passierte eine kleine Katastrophe, denn ich löschte – nachdem ich dem Link in einer vermeintlichen Mail von Amazon folgte, die sich jedoch als Phishingmail entpuppte – panisch und völlig kopflos meinen Amazonaccount und somit unglücklicherweise auch das damit verbundene KDP-Konto.
Auf einen Schlag waren meine bisher veröffentlichten Bücher gelöscht – und das mitsamt aller Bewertungen. Amazon konnte das Konto nicht wiederherstellen, und ich war am Boden zerstört – zumindest ein paar Tage lang, denn wie heißt es so schön:
Gibt das Leben dir Zitronen, mach Limonade draus – oder hol wahlweise den Tequila raus.
Zugegeben, habe ich weder das eine noch das andere getan, aber ich habe beschlossen, diese Chance für die Neuauflagen meiner Bücher zu nutzen. Zum einen bilde ich mir ein, dass ich mich im Laufe der letzten Jahre als Autorin weiterentwickelt habe, zum anderen habe auch ich mich verändert und mit mir meine Ansichten – außerdem weiß ich heute viel mehr als noch vor ein paar Jahren. Das gilt, diesen Roman betreffend, vor allem für Traumata und deren Verarbeitung, da ich mich in den vergangenen Jahren noch einmal eingehender mit meinen eigenen traumatischen Erfahrungen auseinandergesetzt habe.
Lange habe ich an diesem Roman geschrieben und ihn wieder und wieder überarbeitet, denn dieses Mal wollte ich alles richtig machen und gerade in Bezug auf Londons Vergangenheit nichts bagatellisieren. An dieser Stelle möchte ich auf die Triggerwarnung (siehe Inhaltsverzeichnis) hinweisen.
London’s Lightness zu überarbeiten, oder sind wir ehrlich, neu zu schreiben, denn geblieben ist nicht viel mehr als die Grundidee, war daher eine echte Herausforderung und stellenweise mit viel Schmerz und Tränen verbunden.
Dennoch bin ich froh, dass ich mich an dieses Projekt gewagt habe. Zumal von allen Seiten immer wieder die Frage aufkam, ob sich das lohnen würde, und mir mehr als einmal geraten wurde, mich lieber neuen Geschichten zu widmen.
Ob sich diese Geschichte finanziell lohnt, weiß ich nicht. Das steht in den Sternen, aber ich kann mit voller Überzeugung sagen, dass es sich für mich gelohnt hat. Ich bin wirklich stolz, was aus dieser kleinen Novelle geworden ist.
Nun wünsche ich dir zum Abschluss dieses Vorworts ein paar schöne Lesestunden mit London, Tanner und ihrer Geschichte.
Von Herzen ganz viel Spaß.
Deine Ivy
VON STREIFZÜGEN ZU SPÄTER STUNDE UND SORGENVOLLEN SCHRECKENSSZENARIEN
LONDON
Nicht jeder ist dafür geschaffen, ein Doppelleben zu führen. Die meisten Menschen verfügen nicht über die nötigen Fähigkeiten, da in den bunten Strauß der Qualitäten – neben schauspielerischem und organisatorischem Talent – auch ein hohes Maß an Skrupellosigkeit und Resilienz gehört.
Denn zugegeben: Dieser ganze Scheiß ist ziemlich belastend. Doch es ist nicht so, als hätte ich eine Wahl – nicht wirklich zumindest.
Unglücklicherweise führt mich genau dieses Doppelleben in einen Park.
Nachts.
Allein.
Die Dunkelheit ist nicht dein Feind, wispert eine Stimme in meinem Kopf, die dem rationalen Teil in mir gehört. Allein der Versuch, mich zu beruhigen, hat allerdings den gegenteiligen Effekt, denn ich bin nicht blöd. Ich fürchte mich nicht vor der Dunkelheit, sondern bloß vor dem, was darin lauert. Oder sind wir ganz konkret: Es sind die Männer, die mir Angst machen, und es ist die Erfahrung, die mich gelehrt hat, dass diese Angst durchaus begründet ist.
Und als Frau habe ich nachts, so wurde es mir beigebracht, in einem Park nichts zu suchen – selbst dann nicht, wenn er so zentral gelegen, gut beleuchtet und halbwegs überschaubar wie der Bayfront Park ist.
Sollte mir etwas passieren, dann hieße es unweigerlich: Was hatte sie auch dort zu suchen? Warum treibt sie sich dort nachts im Dunkeln rum? Noch dazu allein! Und dann würde man noch einen Schritt weiter in der Argumentationskette gehen und sagen: Nun ja, da ist sie selbst dran schuld, da fehlt mir jedes Mitgefühl, denn wer sich in Gefahr begibt, der muss eben mit so etwas rechnen. Sie hat es ja regelrecht darauf angelegt, hat es quasi provoziert.
Das Unrecht ist so offensichtlich, es könnte kaum größer sein. Statt Männer jedoch in ihre Schranken zu weisen, sie hart und unnachgiebig zu verfolgen und zu bestrafen, wenn sie sich an Frauen vergehen, gibt man uns die Schuld. Wie selbstverständlich spricht man uns ab, Raum an Orten wie dem Bayfront Park einzunehmen – zumindest ab einer gewissen Uhrzeit. Doch das kann unmöglich die Lösung für das Problem sein.
Und ich gebe es ehrlich zu: Ich beneide Männer darum, dass es ihnen möglich ist, diesen Raum vergleichsweise angstfrei einzunehmen. Ich sage bewusst vergleichsweise, weil Männer durchaus Gefahr laufen, an solch einem Ort Gewalt zu erfahren – meist durch andere Männer, aber ehrlich: Aktuell ist das nicht mein Problem.
Mein Problem besteht aus der Gruppe junger Männer, die auf mich zukommt. Der Wind, der vom Meer zu mir weht, trägt ihre Stimmen mit sich, zieht an meiner Kapuze, unter der ich zusätzlich noch eine Mütze trage – auf keinen Fall will ich als Frau erkannt werden.
Die Männer grölen und versuchen, einander zu übertönen, und ich verfluche mich für meine Entscheidung herzukommen.
Ich hätte Devon schreiben müssen, dass es nicht geht, dass es zu gefährlich ist. Aber er klang beschissen, weshalb ich das Risiko eingegangen bin. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, verfolgt zu werden, verdammt groß ist. Wenn wir erwischt werden, wird mein Vater dafür sorgen, dass wir uns nie wiedersehen.
Der Gedanke flutet meine Eingeweide mit Eiswasser, sorgt dafür, dass mich eine Welle der Übelkeit erfasst. Er ist absolut unerträglich, und obwohl es ein alles dominierendes Gefühl ist, habe ich mit einem Mal das Gefühl, beobachtet zu werden.
Meine Therapeutin nennt es Hypervigilanz, ich bezeichne es eher als meinen Spinnensinn. Habe ich von Tom geklaut, als wir uns vergangenes Jahr bei der Premiere von Stellar Symphonie getroffen haben. Dr. Decker konnte mit meiner Marvel-Anspielung nicht wirklich etwas anfangen. Was das angeht, hat sie echte Bildungslücken.
Mein Gefahren-Radar schlägt jedenfalls gewaltig aus, und nur mühsam gelingt es mir, die aufsteigende Panik zu unterdrücken.
Ein Blick zu den sich nähernden Typen sagt mir, dass nicht sie es sind, die mich beobachten. Keiner von ihnen beachtet mich – zumindest nicht bisher. Nein, von ihnen geht aktuell keine Bedrohung aus. Sie sind viel zu sehr damit beschäftigt, sich gegenseitig ein Bein zu stellen, und lachen, als einer von ihnen sich deshalb wirklich fast langlegt – nur gerade so gelingt es ihm, sich an einem seiner Kumpel festzukrallen, der durch das zusätzliche Gewicht selbst ins Straucheln gerät. Schließlich gehen beide zu Boden, was zu noch mehr Erheiterung bei den anderen Typen führt.
Männer!
Unwillkürlich denke ich an Zoey und an das, was sie neulich von ihren Klassenkameraden erzählt hat. Die sind wohl ähnlich drauf, aber die sind erst acht.
Nachdrücklich versuche ich, meine umherhuschenden Gedanken unter Kontrolle zu bekommen. Es ist so viel einfacher, an Zoey und ihren schulischen Struggle zu denken, als mich meiner Angst vor den Typen oder einem möglichen Verfolger zu stellen.
Vorsichtig riskiere ich einen Blick über die Schulter, doch meine Augen können niemanden ausmachen, der in meine Richtung starrt.
Das Gefühl ist allerdings immer noch da. Die feinen Härchen in meinem Nacken haben sich aufgestellt. Gänsehaut explodiert dort, breitet sich in rasender Geschwindigkeit über meinen kompletten Körper aus.
Verdammt, vielleicht sind sie dir doch gefolgt!, warnt mein Instinkt mich.
Oder ist es bloß die Paranoia?
Muscle Mountain und Slim Shady hätten mir schon einen Peilsender implantieren müssen, um sich an meine Fersen zu heften. Der Gedanke an meine Aufpasser … sorry, ich meine natürlich Bodyguards, triggert mein schlechtes Gewissen. Ein neuerliches Zwicken in der Magengegend ist die Folge.
Ich mag die beiden echt gern, doch nachdem ich ihnen entwischt bin, wird Dad den Vertrag mit Morrison Sentinel Services wohl kündigen – oder den Laden in seinem Zorn gleich einstampfen. So oder so fürchte ich, dass meine Leibwächter in Kürze meine Ex-Leibwächter sein werden.
Der Knoten, der einmal mein Magen war, verkrampft sich so sehr, dass mir erneut übel wird.
Keine Zeit für Gewissensbisse!
Einmal tief durchatmend, schiebe ich meine moralischen Bedenken beiseite.
Devon braucht mich! Ich kann ihn nicht im Stich lassen!
Einmal mehr an diesem Tag hasse ich mein Leben und den Mann, der dafür verantwortlich ist, dass ich dazu gezwungen bin, mich nachts heimlich davonzustehlen, um den Menschen zu sehen, der mir am meisten bedeutet.
Wüsste mein Vater, mit wem ich mich treffe, würde er durchdrehen, mich wegsperren und mir auch noch das letzte bisschen Freiheit entziehen.
Die Ungerechtigkeit über die Situation sorgt dafür, dass mein Verfolgungswahn verpufft und ich auch die Typen, die inzwischen nur noch wenige Meter von mir entfernt sind, einen Moment lang vergesse. Meine Hände ballen sich in den Taschen meiner Lederjacke zu Fäusten und meine Zähne mahlen.
So sollte mein Leben nicht sein. Ich habe es so satt, eine Gefangene zu sein und derart kontrolliert zu werden.
»Du bist so ein Wichser!«, pöbelt einer der Männer und drängt sich so wieder in mein Bewusstsein. Er rempelt seinen Kumpel, den Wichser, an – einige der anderen lachen. Allein dieses Lachen ist so laut, so raumgreifend, dass mein Penisneid sich wieder bemerkbar macht.
Wobei die Bezeichnung leider etwas irreführend ist. Ich neide natürlich niemandem seinen Penis. Der an sich ist mir reichlich egal. Was mir nicht egal ist, ist die Tatsache, dass für Frauen andere Regeln gelten als für Männer – darauf bin ich, wie bereits erwähnt, neidisch. Der Penis wäre also bloß Mittel zum Zweck, um gleichziehen zu können.
Ich wette, dann würde ich mich in dieser Situation auch bedeutend sicherer fühlen. Die Kerle sind zu siebt und sichtlich betrunken. Dass Alkohol im Spiel ist, macht mich direkt um ein Vielfaches nervöser. Das Adrenalin pumpt inzwischen so heftig durch meinen Körper, dass ich an mich halten muss, nicht kopflos davonzurennen.
Chill mal deine Eierstöcke! Alles ist gut!
Leider suggeriert das dreckige Lachen der Kerle meinem Körper das komplette Gegenteil. Statt die Flucht zu ergreifen, senke ich den Blick und hoffe, mein dicker Hoodie, die verwaschene, weite Jeans und die Lederjacke verbergen, dass ich eine Frau bin. Basecap, die Doc Martens und meine gedrungene Haltung sollten ihr übriges zu meinem Täuschungsmanöver beitragen.
Nachdem ich die Männer passiert und einige Meter zwischen uns gebracht habe, kickt die Erleichterung und mein Körper relaxt. Erst da wird mir bewusst, wie verkrampft ich war, denn die Entspannung schmerzt regelrecht. Sie fließt in meine Muskeln, dringt jedoch nicht gänzlich zu meinem Hirn vor. Dort gibt es einen Teil, der immer noch den Fluchtreflex unterdrücken muss.
Es ist vorbei!
Und es ist nichts passiert!
Mit der Stimme in meinem Kopf, die beruhigend auf mich einredet, eile ich weiter durch die Nacht. Ihre Bemühungen sind vergebens, denn ich kann nicht aufhören, die Dunkelheit unablässig nach Gefahren abzusuchen.
Kurz bevor ich den vereinbarten Treffpunkt erreiche, erobert eine neue Angst mein gestresstes Hirn: die Angst um Devon, die ich ziemlich erfolgreich verdrängt hatte.
Die Sorge krallt sich um mein Herz, droht, es zu zerquetschen, während mein Hirn mir einen Haufen Fragen vor die Füße kotzt, die ich nicht beantworten kann.
Was wird mich erwarten? Wird er noch am vereinbarten Treffpunkt sein oder ist er gegangen? Hat er was genommen? Und wie reagiere ich, wenn das der Fall sein sollte?
Bange Minuten lang produziert mein Hirn ein Schreckensszenario nach dem anderen.
Erneut wird mein Körper in den Alarmzustand katapultiert. Mein Magen schlägt einen Purzelbaum und die Vorstellung, Devon könnte rückfällig geworden sein, schnürt mir die Kehle zu, raubt mir für Sekunden den Atem. Bei der Vorstellung droht mein Herz, in tausend Stücke zu zerspringen … Ich kann ihn nicht wieder verlieren. Doch genau das wäre die Konsequenz, würde er wieder zu Drogen greifen.
Er hat dich angerufen und um Hilfe gebeten, erinnere ich mich nachdrücklich.
Was allerdings bloß bedeutet, dass er eine ernsthafte Krise hat und mich braucht, um sie durchzustehen. Die Gefahr eines Rückfalls ist also sehr real.
Als ich den Platz erreiche, auf dem sich die Pepper Fountain befindet, entdecke ich Devon schon von Weitem. Mein Herz beginnt zu rasen – dieses Mal vor schierer Freude. Devon lehnt mit dem Rücken zu mir am Geländer, das den ehemaligen Brunnen umgibt, und telefoniert. Ich halte inne, lasse den Anblick der Szenerie auf mich wirken. Der Bayfront Park reicht – wie der Name es besagt – bis ans Wasser, auf dem sich die Lichter des Frachthafens spiegeln. Auch um diese Zeit stehen die großen Kräne nicht still. Schiffe werden be- oder entladen.
Von irgendwo weht Partymusik herüber, und ich würde mein Taschengeld der letzten drei Monate darauf verwetten, dass Devon genau auf dieser Party war, ehe er mich anrief. Als ich mich auf der Suche nach der Quelle umschaue, verspüre ich wieder dieses sonderbare Gefühl.
Die Paranoia kickt hart, und nach einem kurzen Rundumblick bin ich mir sicher, dass es Paranoia ist, denn ich entdecke niemanden, der mich beobachtet. Dafür wird mir klar, dass die Beats aus Richtung der Seafair Yacht kommen, wo eine Party steigt.
Kurz frage ich mich, wieso Devon dort war und vor allem mit wem … Dann schüttle ich den Gedanken ab und setze mich in Bewegung. Devon telefoniert noch immer, aber ich kann nicht länger warten: Ich muss mich versichern, dass er in Ordnung ist.
Also stelle ich mich einfach neben ihn, lehne mich ebenfalls an die Absperrung und lausche. Wenig erfolgreich, denn mein Spanisch ist so eingerostet, dass ich kaum ein Wort verstehe. Dad hat unserer Haushälterin Amelia und mir verboten, Spanisch miteinander zu sprechen.
Man müsste eigentlich echt fragen, was er mir nicht verbietet. Devon darf ich nicht sehen, Spanisch darf ich nicht sprechen – und das, obwohl diese Stadt kaum multikultureller sein könnte.
Noch einmal versuche ich zu lauschen, doch Devon redet schnell … Er wirkt aufgebracht und als er meinen neugierigen Blick bemerkt, löst er sich vom Geländer und bringt etwas Abstand zwischen uns, um seine Unterhaltung ungestört zu Ende bringen zu können.
Kurz betrachte ich ihn, doch der Schmerz, der mit seinem Anblick einhergeht, ist nicht auszuhalten. Stattdessen starre ich auf den trostlosen Brunnen vor mir. In den 90ern war die Pepper Fountain angeblich mal eine echte Sehenswürdigkeit – nicht, dass ich das mitbekommen hätte, zu diesem Zeitpunkt war ich schließlich noch nicht einmal geboren.
Dad nannte mich neulich einen Millennial. Natürlich habe ich ihm erklärt, dass ich zur Gen Z gehöre, und ihm sogar einen Beitrag dazu rausgesucht, woraufhin er sagte, ich solle nicht alles glauben, was im Internet steht.
SEUFZ!
Allerdings weiß ich auch aus dem Internet, dass der Brunnen trockengelegt wurde, weil die Kosten, mehr als eine halbe Million Dollar im Jahr, der Stadt zu hoch waren – und ich gestehe: Ich befürworte, dass an dieser Stelle gespart wurde, schließlich kann man das Geld viel sinnvoller nutzen, als eine Touristenattraktion damit zu unterhalten.
Projekte für sozialbenachteiligte Kinder, Obdachlose oder Senioren, Unterstützung von Alleinerziehenden oder Personen mit Behinderung, Suchtprävention, Ausstiegshilfen für Bandenmitglieder oder Prostituierte, Therapieplätze, und und und …
Früher habe ich all das nicht gesehen, doch seit einigen Jahren ist mir klar, wie unglaublich privilegiert ich bin, und daher unterstütze ich – im Rahmen meiner Möglichkeiten – diverse Charity-Projekte.
Nicht, dass davon irgendwer etwas mitbekommen würde, denn vor der Öffentlichkeit versuche ich, zu verbergen, woher die Spenden stammen, und Dad denkt nach wie vor, ich würde das Geld mit vollen Händen zum Fenster hinauswerfen – und das ist gut so.
Harry Hyatt, seines Zeichen Immobilienmogul und Selfmade Milliardär, glaubt nämlich, nur weil er es bis an die Spitze geschafft hat, jeder könnte erfolgreich sein.
Doch er irrt sich: Es gibt zahlreiche Gründe, weshalb die Geschichte vom Tellerwäscher, der zum Millionär wird, nichts weiter als ein Ammenmärchen ist. Natürlich gibt es einige wenige Ausnahmen, denen dieser Aufstieg gelingt – das will ich gar nicht abstreiten. Doch im Prinzip ist es eine Geschichte, die man Kindern erzählt, damit diese sich brav in die Leistungsgesellschaft einfügen.
Allerdings kann nun einmal nicht jeder diesem Druck standhalten … Das habe ich auf die harte Tour lernen müssen. Ich selbst wäre vermutlich nicht dazu in der Lage, auf eigenen Beinen zu stehen – zu sehr kämpfe ich mit meinen Dämonen.
Dad ignoriert jedenfalls gerne, dass Menschen sehr unterschiedliche Voraussetzungen haben. Nicht umsonst wird die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer, denn auch Bildung muss man – und frau erst recht – sich erst einmal leisten können. Dass er das System, von dem er seit Jahrzehnten profitiert, nicht hinterfragt, macht einen Diskurs zwischen uns nahezu unmöglich. Wenn man ihm zuhört, dann könnte man meinen, er sei der einzige hartarbeitende Mensch auf der Welt.
Seine Selbstgerechtigkeit kotzt mich an – vor allem, wenn ich an Parker denke, die jeden verdammten Tag Unglaubliches leistet, um sich und Zoey über die Runden zu bringen. Bei dem Gedanken an beide wird mir ganz warm ums Herz und dann – den Bruchteil einer Sekunde später – ganz schwer, weil ich gezwungen bin, die einzigen Freunde, die ich wirklich habe, zu belügen.
Parker hat keine Ahnung, wer ich in Wirklichkeit bin. Niemand hat es. Und es ist wirklich unglaublich, dass bisher keiner hinter mein Geheimnis gekommen ist. Auch nach all den Monaten, kann ich immer noch nicht glauben, wie leicht sich die Menschen von einem britischen Akzent, Kontaktlinsen und ramponierten Klamotten täuschen lassen. Der gefälschte Ausweis sowie die ebenfalls gefälschten Fotos besitzen wohl einiges an Überzeugungskraft, denn trotz des Wissens um Bildbearbeitungsprogramme wie Photoshop und dem Einsatz von KIs neigen die Leute dazu, das zu glauben, was sie sehen.
Der Grund, weshalb ich mit alldem jedoch durchkomme, ist – und da glaube ich ganz fest dran: der Fake-Pony. Kein Mensch würde annehmen, dass Stilikone London Hyatt so eine blöde Frisur tragen würde. Zurecht, denn ich sehe so schlimm aus: Ein Pony steht mir null.
Aber ich will mich nicht beschweren: Diese kleine Scharade ermöglicht mir schließlich, mich dem Zugriff meines Vaters zu entziehen und dem Goldenen Käfig, in den er mich gesperrt hat und dessen Schlüssel er am liebsten wegwerfen würde, zu entkommen – zumindest vorübergehend.
»Hey!« Devons Stimme reißt mich aus meinen Gedanken. Sie klingt rau, fast so, als hätte er sie eine Weile lang nicht benutzt oder als wäre er wahlweise zum Kettenraucher mutiert. Eher unwahrscheinlich in diesem Land, in dem das Rauchen regelrecht geächtet wird.
Ich will nicht indiskret erscheinen, also frage ich nicht, mit wem er telefoniert hat – auch wenn die Neugier mir ein Loch in den Bauch zu brennen droht.
»Hey!«
»Danke, dass du gekommen bist. Ich …« Fahrig fährt er sich mit einer Hand durch das hellbraune Haar. Mit einem beklemmenden Gefühl im Bauch stelle ich fest, dass sie zittert.
Es kostet mich eine gewaltige Anstrengung, ihn nicht zu drängen, den Satz zu beenden, oder Devon eingehend zu mustern und nach weiteren Anzeichen für Drogenkonsum zu suchen.
Scheinbar gebe ich mir nicht genug Mühe, denn er sagt: »Keine Sorge! Ich habe nichts genommen, ich bin nur …« Er verstummt, senkt seinen Blick.
Was bist du nur?, will ich ihn am liebsten fragen, doch ich gebe ihm Zeit, selbst wenn diese Sekunden mir wie eine Ewigkeit erscheinen.
»Ich war mit einer Freundin aus und …« Er nickt in Richtung der Yacht. »Ich hätte damit rechnen müssen, dass so etwas passiert.«
»Irgendwer hat Drogen genommen?« Meiner Stimme einen neutralen Klang zu geben, fällt mir angesichts der Ängste, die ich gerade ausstehe, extrem schwer. Devon hat zwar gesagt, dass er nichts genommen hat, doch er hat bereits zuvor gelogen, wenn es um dieses Thema ging.
Er nickt. »So ein Dude auf dem Klo. Er hat sich eine Line reingezogen und mir dann was angeboten.« Er schluckt hart. Ich sehe das Verlangen nach dem Koks in seinen Augen und auch die Scham, weil er sich danach sehnt. »Ich bin raus und hierher, aber …« Er vergräbt seine Hände tiefer in den Hosentaschen, zieht dabei die Schultern hoch. Sein gequälter Gesichtsausdruck bricht mir beinahe das Herz. »Ich will da rein!«, gesteht er mir mit bebender Stimme. »Ich weiß nicht warum, aber heute ist es schlimm. Richtig, richtig schlimm.«
Er redet vom Suchtdruck, davon, dass dieser droht, ihn in die Knie zu zwingen.
Gut, dass ich gekommen bin. Gut, dass ich hier bin und ihn in die Arme schließen kann.
»Komm her!«
Devons ebenmäßiges Gesicht verrutscht zu einer Grimasse, ein Schluchzer entweicht seiner Kehle. Mit einem schnellen Schritt überbrückt er die Distanz zwischen uns und schließt seine Arme um mich. Er umklammert mich so fest, dass mir einen Moment lang die Luft wegbleibt.
»Alles ist gut!« Ich streichle über seinen Rücken, während in meinem Kopf das reinste Chaos tobt. Die Gefahr ist noch nicht gebannt, aber ich bin da und kann ihm helfen, kann ihn ablenken und auf andere Gedanken bringen, auch wenn seine sich momentan noch an dem Blow festgefressen haben. »Du schaffst das!«, spreche ich ihm Mut zu. »Du bist stark!«
Er gibt ein Schnauben von sich, das so bitter klingt, wie das verdammte Koks angeblich schmeckt. »Wäre ich stark, wäre ich erst gar nicht in dieser Situation!«
Ich weiß nicht, was ich darauf erwidern soll. Mein erster Impuls ist zu widersprechen, aber ich unterdrücke ihn, weil wir diese Diskussion schon so oft hatten.
Jeder geht mit traumatischen Erfahrungen anders um, und Devon unterlag dem Irrglauben, die Drogen würden ihm helfen. Was sie in gewisser Weise und für eine bestimmte Zeit auch getan haben. Vorübergehend hat ihn das Koks gerettet. Es hat ihm ein Hochgefühl verschafft und die Dunkelheit verdrängt, doch kein Trip hält ewig und irgendwann kommt man davon runter – ob man will oder nicht. Und da man es nicht will, weil das Schwarz noch schwärzer und die Hoffnungslosigkeit noch hoffnungsloser erscheint, pfeift man sich die nächste Line durch die Nase. Schneller und schneller und schneller und dann ist da nicht nur das Trauma, das einen aufzufressen droht, sondern auch die Sucht, die ihren Tribut fordert.
Ganz gleich, was er sagt: Er ist stark, und niemand, wirklich niemand, sollte sich ein Urteil über ihn bilden.
»Ich habe noch Zeug auf dem verdammten Boot.«
»Dein Jackett«, rate ich, denn er trägt bloß ein weißes Hemd zu einer schwarzen, gut geschnittenen Anzughose. Die Ärmel hat er aufgerollt, sodass seine Tattoos darunter hervorblitzen. Sie machen echt was her, und wie immer saugt sich mein Blick an ihnen fest.
Irgendwann werde ich ihn fragen, wer der beste Tätowierer in Miami ist, und dann bekomme ich auch ein Tattoo. Oder zwei oder drei … Dann gibt es niemanden mehr, der mich davon abhalten kann, und ich kann mit meinem Körper endlich machen, was ich will.
»Yep! Das hängt noch über irgendeinem Stuhl und da würde ich es auch hängen lassen, wäre nicht meine verdammte Key Card da drin.«
»Ohne die du nicht in den Hafen kommst«, schlussfolgere ich, denn Devon lebt – seit er mir seine Wohnung überlassen hat – auf einem Boot. Seinem Boot. Und eigentlich ist die Bezeichnung »Boot« irreführend, denn es handelt sich um eine ausgewachsene Motoryacht, die genug Schlafmöglichkeiten für zehn Gäste bietet.
»Deine Freundin …«, ich betone diese Bezeichnung überdeutlich, denn Devon hat keine Freundinnen, »… kann uns das Jackett nicht zufällig bringen?«
»Sie ist nicht wirklich meine Freundin und sie ist sauer, weil ich verschwunden bin, ohne ihr Bescheid zu geben.«
»Schätze, sie weiß nichts von deinem Problem.«
»Richtig geschätzt, Kleines!« Er zwinkert mir zu, doch der Geste fehlt das Commitment. Sie wirkt aufgesetzt und schwach, kein Zwinkern, das einem die Knie weich werden lässt oder gleich die Beine weghaut.
»Das üben wir bei Gelegenheit noch mal!«
»Was genau?«
»Die Sache mit dem Zwinkern.« Ich hake mich bei ihm unter und steuere die Yacht an, auf der sich sein Zeug befindet. Bunt und glitzernd spiegeln sich die Lichter der umliegenden Wolkenkratzer des Bankenviertels auf dem Wasser. Ich wünschte, ich könnte den Anblick mehr genießen, könnte mich in den Reflexionen verlieren, doch unglücklicherweise ist alles, woran ich denken kann, die Tatsache, dass ich gleich an Bord der Yacht gehen muss. Menschen werden mich erkennen. Sie werden mich fotografieren, und wenn ich Pech habe, fliegt alles auf. Hier in Downtown Miami sitzen wir quasi auf dem Präsentierteller.
»Ich hole es!«
Ohne ihn anzusehen, sage ich: »Das wirst du nicht tun!«
Devon öffnet den Mund, um zu widersprechen, doch ich lasse ihn nicht zu Wort kommen.
»Vergiss es! Du wirst keinen verdammten Fuß auf dieses Schiff setzen!«
»Wenn dich jemand erkennt, Kleines, und man wird dich erkennen, dann …« Er lässt den Satz unvollendet in der tropischen Nachtluft hängen, spricht seine schlimmsten Befürchtungen nicht aus, doch wir wissen beide: Mein Vater würde mich einsperren und den Schlüssel wegschmeißen, wenn er wüsste, mit wem ich mich gerade herumtreibe.
Ich ignoriere die Bemerkung und auch das nervige Kleines, mit dem er mich immer anspricht, doch im Stillen mache ich mir eine Notiz, dass er mich nun schon zum zweiten Mal so genannt hat.
»Sag mir, wo ich das Jackett finde!«
Er seufzt, merkt jedoch an meinem unnachgiebigen Tonfall, dass ich nicht diskutieren werde. »Isabella und ich saßen am Tisch des Gastgebers.«
»Und wer ist der Gastgeber?«
»Ihr Vater. Er feiert da drin …«, Devon deutet mit seinem kantigen Kinn in Richtung der Yacht, »… seinen sechzigsten Geburtstag.«
Mir entfährt ein freudloses Geräusch, ein Laut zur Hälfte Schnauben, zur Hälfte Lachen. »Du warst auf einer Familienfeier dieser Größenordnung, aber sie ist nicht deine Freundin? Ich schätze mal, auch davon weiß sie nichts.«
»Wir kennen uns seit zwei Tagen. Sie glaubt ganz sicherlich nicht, dass ich ihre große Liebe bin, Kleines.«
Einen winzigen Moment lang kaue ich auf dieser Information herum. Jeder andere würde sich frage, warum diese Isabella Devon dann auf die Feier ihres Vaters mitgeschleppt hat. In meinen Augen liegt die Antwort allerdings auf der Hand: Sie wollte ihn ärgern. Und Devon … Devon ist ein echtes Ärgernis. All die Tattoos, die Rockstar-Vibes, die von ihm ausgehen, seine gesamte Bad-Boy-Attitüde … Isabellas Vater wird vor Wut kochen.
»Und zu meiner Verteidigung: Ich hatte keine Ahnung, was sie im Schilde führt. Sie sagte, ich soll einen Anzug anziehen und dass wir schick ausgehen würden. Damit war ich fein.« Sein Mundwinkel zuckt kaum merklich, verrät jedoch, dass er wegen dieser ganzen Nummer ziemlich angepisst ist.
Und mir wird klar, warum der Suchtdruck so hoch ist. »War bestimmt ziemlich unangenehm.«
Er schenkt sich eine Antwort, nickt nicht einmal.
Gerne würde ich etwas sagen, um ihn zu trösten, doch mir fällt nichts ein. »Auf einer Skala von eins bis zehn … Wie unangenehm war es denn?«
»Der Typ erinnert mich an Harry.« Getriggerte Kindheitstraumata … wundervoll! Wenn das mal kein Auslöser für einen Rückfall ist, dann weiß ich auch nicht.
»Tut mir leid.« Ich deute auf eine Bank, die unter einer Palme steht. »Warte da drüben!«
Er nickt knapp und folgt meiner Aufforderung, ohne Einwände zu erheben.
Ich wende mich der Yacht zu. Vor ein paar Jahren war ich dort einmal auf einer Ausstellung. Die Vorstellung, dass meine Bilder dort hängen könnten, blitzt in mir auf … Doch diese Tür ist mir verschlossen – und das, obwohl der Türsteher mich sofort erkennt. Ich sehe es daran, wie seine Augen sich weiten.
»Willkommen an Bord, Miss Hyatt.« Er studiert die Gästeliste, sieht unsicher zu mir.
»Ich stehe da nicht drauf«, komme ich ihm zuvor. »Es gibt ein Problem.« Ich schildere ihm eine Variante der Situation, schiebe einen Streit zwischen Devon und der Tochter des Gastgebers vor und behaupte, dieser sei der Grund, weshalb mein Bekannter nicht zurück an Bord will. »Wären Sie so freundlich und würden mir sein Jackett bringen?«
»Ich werde es veranlassen.« Er gibt über sein Headset einige Anweisungen, und ich warte.
Es dauert geschlagene zehn Minuten, dann taucht Isabella auf – nun ja, zumindest nehme ich an, dass es sich um Devons Nicht-Freundin handelt. Auch ihre Augen weiten sich, als sie mich sieht, weshalb ich mich wohl nicht vorstellen muss.
»Das Jackett und der Helm!« Der Helm? Wie es aussieht, ist Devon mit seinem Motorrad da. Sie reicht mir beides. Der Ausdruck in ihren Augen verrät ebenso viel über das, was in ihr vorgeht, wie ihr Tonfall. Sie klingt verschnupft, denkt vermutlich, ich sei eine Rivalin. So ganz egal scheint Devon ihr also doch nicht zu sein.
Oder vielleicht verliert sie auch einfach nur nicht gerne.
Nun ja, dafür müsste es ja überhaupt erst mal etwas zu gewinnen geben, stoppe ich die bittersüße Stimme in ihren Mutmaßungen.
»Danke! Einen schönen Abend noch, Isabella.«
Ich drehe mich um und gehe über die Gangway zurück an Land. Doch noch ehe ich den Fuß auf festen Boden gesetzt habe, lässt ein »Warte!« mich innehalten. Es klingt nicht schroff, bloß verunsichert.
Als ich mich umdrehe, sehe ich, dass Isabella mir auf die Gangway gefolgt ist. »Woher kennst du Devon?«
Ich ziehe eine Augenbraue hoch, versuche, mir meine Belustigung nicht anmerken zu lassen. Glaubt sie wirklich, ich würde ihr eine Antwort auf diese Frage geben? »Woher kennst du ihn?«
»Haben uns in einer Bar kennengelernt.«
Eine Bar? Kein guter Ort für einen Ex-Junkie.
Alkohol ist zwar nicht Devons Problem, aber er macht leichtsinnig. Veranlasst Devon womöglich zu denken, dass einmal keinmal ist und er sich ruhig eine Line gönnen könnte. »Du hast ihn für irgendeinen Nobody gehalten.« Es ist keine Frage, sondern eine Feststellung. Isabella beißt sich ertappt auf die Unterlippe, also setze ich noch einen drauf. »Einen Typen, bei dem sich die Nackenhaare deines Vaters aufstellen.«
»Ich …«, beginnt sie, doch ich schüttle den Kopf, und sie verstummt.
»Wenn du deinen Vater ärgern willst, ist das deine Sache. Tu, was du nicht lassen kannst.« Sie schluckt beklommen. »Aber halt dich von Devon fern!« Einen Moment lang sieht es so aus, als würde sie etwas erwidern wollen. Sie ist gewohnt zu bekommen, was sie will. Das verstehe ich. »Ich meine es ernst«, warne ich sie daher, und die Eindringlichkeit, mit der ich meine Worte anfüttere, sorgt dafür, dass Isabella nickt.
»Bitte sag ihm, dass es mir leidtut. Es … es war nichts Persönliches.«
»Nicht für dich!«, gebe ich kalt zurück und dann gehe ich. Es fällt mir schwer, denn es gibt so viel, was ich ihr gerne sagen würde, doch ich zwinge mich, all das, was mir auf der Zunge liegt, hinunterzuschlucken.
Sie hat ihn benutzt – allein das ist mies, doch wenn ihr Vater Devon wirklich an meinen erinnert, dann könnte es persönlicher nicht sein – und auch nicht schmerzhafter. Ich kann mir vorstellen, wie man Devon heute Abend behandelt hat: selbstgefällig und von oben herab. Es gibt Gründe dafür, warum das Gefühl, nicht gut genug zu sein, an ihm nagt.
Bei Devon angekommen, reiche ich ihm Helm und Jackett.
»Danke!« Das Wort könnte nicht neutraler und belangloser klingen, doch da Devon normalerweise nicht um Hilfe bittet, kann ich mir vorstellen, wie schwer es ihm fällt, es auszusprechen.
Ich quittiere es mit einem Achselzucken und beschließe, keine große Sache daraus zu machen, aber es ist eine große Sache. Er hat mich angerufen, hat mich gebeten zu kommen. Er wollte mich hier – bei sich – haben. »Isabella sagte, es tue ihr leid.«
»Isabella kann mich mal!« Er schlüpft in das Sakko. Ich beobachte ihn dabei. Seine Bewegungen wirken hart und eckig, verraten deutlich, wie viel Wut in ihm brodelt.
Benutzt zu werden, ist ein Scheißgefühl.
»Fuck!«, stößt Devon plötzlich hervor, wendet sich ab und stülpt sich den Helm über den Kopf.
Und dann erhellt ein Blitz die Nacht und noch einer und noch einer, und ich realisiere, dass meine Paranoia keine Paranoia war, sondern dass mich mein Spinnensinn absolut zuverlässig vor der Gefahr gewarnt hat.
Scheiße!
»London! London, hier!«, ruft irgendeiner dieser ätzenden Paparazzi, die es – weiß der Himmel wie – geschafft haben, mich aufzuspüren.
Eine Hand schließt sich um meine. »Komm!«
Devon beginnt zu rennen, und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu versuchen, mit ihm Schritt zu halten. Hinter uns höre ich die Rufe und das Getrampel unserer Verfolger, doch als Devon sich auf sein Motorrad schwingt und es startet, gehen sie im Dröhnen des Motors unter.
Eilig steige ich hinter ihm auf das Bike, umklammere seine Mitte … Gleißendes Licht blitzt auf, und ich weiß, dass dieses Bild mit mir und einem Unbekannten mit Motorradhelm morgen in allen Zeitungen und für jeden zu sehen sein wird.
Während Devon Gas gibt und die Maschine mit uns davonschießt, hoffe ich inständig, dass niemand sein Gesicht ablichten konnte. Der Gedanke, es könnte anders sein, und die Konsequenzen, die daraus resultieren würden, treiben mir die Tränen in die Augen.
Ich klammere mich fester an Devon, fast so, als könnte ich dadurch verhindern, ihn wieder zu verlieren.
VON FRUCHTBAREN FLUCHTVERSUCHEN UND FRUCHTLOSEN FAHNDUNGEN
TANNER
»Boss, wir haben ein Problem!«
Mühsam unterdrücke ich ein frustriertes Stöhnen und schenke meiner Schwester einen entschuldigenden Blick. »Fünf Minuten!« Becca gibt angesichts meiner Beteuerung ein amüsiertes Schnauben von sich.
Als ich den Stuhl zurückschiebe und aufstehe, höre ich noch, wie sie ein »Workaholic!« zwitschert. Gerne würde ich etwas darauf erwidern, doch ein Dementi wäre nun einmal glatt gelogen. Ja, ich arbeite viel. Zu viel … Dieser Tatsache bin ich mir durchaus bewusst.
Schnellen Schrittes verlasse ich mit dem Handy am Ohr die Terrasse des Seaside Serenity, kehre dem wunderschönen Meerblick und meiner Schwester den Rücken zu und eile Richtung Ausgang. Das Restaurant ist eines der angesagtesten von ganz Miami. Es war schwer, so kurzfristig einen Tisch zu bekommen – selbst für mich, doch Noah und seine Kontakte zum Chef haben es letztlich möglich gemacht.
Als ich hinaus auf den Bürgersteig trete, lande ich mitten im Nachtleben. South Beach ist für seine zahlreichen Clubs und Restaurants bekannt und auch unter der Woche ist hier immer jede Menge los.
Ich schiebe mich an einer Gruppe Frauen vorbei, die offensichtlich einen Junggesellinnenabschied feiern, und suche mir eine halbwegs ruhige Ecke, um mit Jim zu telefonieren – auch wenn ich zu wissen glaube, warum er mich anruft.
Das Problem ist dreiundzwanzig Jahre alt und hört auf den Namen London Hyatt. Sie ist das, was die Medien gemeinhin als It-Girl bezeichnen, unglücklicherweise ist sie leider so viel mehr. Gewieft und einfallsreich wären die ersten zwei Adjektive, die mir in den Sinn kommen, wenn ich sie beschreiben müsste.
»Bitte sag nicht, dass sie euch schon wieder entwischt ist!«
»Dann müsste ich dich belügen, Boss, und das wäre ein Kündigungsgrund.«
Schnaubend brumme ich: »Wenn du deinen Job ständig verkackst, Jim, ist das auch ein Kündigungsgrund.«
»Sorry!«, gibt er zähneknirschend zurück. »Sie ist nun mal ein cleveres, kleines Miststück!«
»Rede nicht so über sie! Du kannst sie clever nennen und von mir aus auch klein, denn aus deiner Perspektive ist sie das unbestritten.«
»Aus der ist fast jeder klein, Boss.« Was stimmt, denn Jim ist ein Hüne. Ich verrenke mir jedes Mal fast den Hals, wenn ich zu ihm aufschaue, und habe ihn London zur Abschreckung zur Seite gestellt. Niemand will sich mit einem muskelbepackten 2-Meter-Mann anlegen, der einen mit ausdrucksloser Miene niederstarrt.
»Mag sein, und trotzdem will ich nicht noch mal hören, dass du sie als Miststück bezeichnest.«
Er gibt ein unwirsches Brummen von sich, was ich mal großzügig zu seinen Gunsten auslege.
»Also, was ist passiert?«
»Sie ist aus dem Fenster des Massagesalons geklettert und abgehauen. Das Schlimmste ist, dass wir sie nicht mal orten können, weil sie ihr Handy dort zurückgelassen hat.«
»Sie könnte also auch entführt worden sein?«, hake ich nach und versuche zu ignorieren, dass mein Herzschlag sich bei dem Gedanken fast verdoppelt.
»Nein, der Masseur, …«
»Nils Erikson.« Natürlich wurden alle Mitarbeiter des Spas im Vorfeld überprüft – insbesondere die, die mit London in direktem Kontakt standen.
»Genau! Er sagte, sie hätte ihn gebeten, uns auszurichten, dass sie einen wichtigen privaten Termin hat.«
»Er könnte lügen«, gebe ich zu bedenken. »Ich will, dass jemand ihn überwacht. Und was London betrifft: Gab es etwas, wo sie unbedingt hinwollte? Eine Party? Ein Empfang? Eine Vernissage?«
»Eine was?«
»Die Eröffnung einer Kunstausstellung!«
»Sag das doch gleich!«
Durch die Leitung kann ich Jim denken hören … Ich mache nicht den Fehler, ihn für langsam zu halten. Er ist gründlich, und ich weiß, dass er in Gedanken jede Unterredung Revue passieren lässt. Sollte London irgendetwas erwähnt oder auch nur angedeutet haben, wird er sich daran erinnern. Denn sein gutes Gedächtnis und seine wirklich beeindruckende Beobachtungsgabe machen ihn zu dem ausgezeichneten Personenschützer, der er ist.
Insgeheim weiß ich auch, dass ich ihm keinen Vorwurf dafür machen kann, dass London ihm und Nick erneut entwischt ist. In unserem Job gibt es kaum etwas Schlimmeres als eine Schutzperson, die den Schutz ablehnt, denn dagegen kann man kaum vorgehen. Vor allem dann nicht, wenn die Person viel schlauer ist, als die Presse behauptet – was bei London der Fall ist.
Die Medien fokussieren sich auf ihr Äußeres und ihre wechselnden Liebhaber – und auch nach Jahren ist ihr öffentlicher Zusammenbruch noch immer Thema, wenn die Sprache auf sie kommt. Zwar hat sie sich damals keine Glatze geschoren, doch sowohl die öffentliche Szene, die sie ihrem damaligen Ehemann – einem mittelmäßigen, aber gehypten Musiker – in einem Club gemacht hat, als auch der Diebstahl seines Bugatti Chiron gingen viral. Kurz darauf beschloss ein Richter, dass es besser für London sei, dem Antrag ihres Vaters auf Vormundschaft stattzugeben.
Harry Hyatt ist es auch, der davon überzeugt ist, seine Tochter benötige Personenschutz – dumm nur, dass sie das offensichtlich anders sieht und jede Gelegenheit nutzt, um sich aus dem Staub zu machen.
Bei unserer letzten Unterredung hat Harry Hyatt mich ernsthaft gefragt, ob man seiner Tochter nicht einen Chip verpassen könnte, um sie immer orten zu können. Er hätte etwas über Bodyhacking gelesen, und theoretisch sei das ja möglich.
Allein bei der Erinnerung an dieses Gespräch spüre ich das Unwohlsein und Entsetzen erneut in mir aufsteigen. Noch immer bin ich fassungslos darüber, glücklicherweise fand ich in dem Moment klare Worte, und er tat, als hätte ich bloß eine witzige Bemerkung nicht richtig verstanden.
Eine Sache verstand ich in diesem Moment allerdings überdeutlich: Das Urteil dieses Richters war ein gigantischer Fehler. Und so sehr ich Harry Hyatt verabscheue, so muss ich doch zugeben, dass ich mir in diesem Moment nichts sehnlicher wünsche, als London aufspüren zu können – egal mit welchen Mitteln. Doch mir sind die Hände gebunden und die Hilflosigkeit macht mich wütend.
Fest presse ich meine Zähne aufeinander, um das Gefühl zu beherrschen. Mein Kiefer schmerzt, als ich schließlich frustriert die Luft einsauge. Es gibt Gründe, warum Harry Hyatt meint, dass seine Tochter Leibwächter braucht. Gute und valide Gründe. Harry Hyatt ist ein Multi-Milliardär. Die Gefahr, seine Tochter könnte entführt werden, um Lösegeld zu erpressen, ist also durchaus real. Doch es gibt auch Leute, die ihren Vater so sehr hassen, dass sie ihm drohen, seine Tochter zu entführen, zu foltern und zu ermorden. Und dann wären da noch all die Leute, die London hassen. Einfach nur, weil sie jung, schön, weiblich, berühmt und privilegiert ist, und ihr Morddrohungen oder Briefe mit all diesen widerlichen Fantasien schicken.
In meinem Job sollte ich idealerweise verstehen, wieso manche Menschen ihre Wut auf Prominente projizieren und rein rational tue ich das auch, aber wirklich nachvollziehen kann ich es nicht. Ich verstehe Menschen zugegeben sogar sehr, sehr oft nicht. Um ehrlich zu sein, werde ich wohl nie nachvollziehen können, warum Leute die Kommentarspalten der Social-Media-Plattformen mit bösartigen und grausamen Bemerkungen füllen und jemandem, den sie nicht einmal kennen, wünschen, dass er elendig verreckt, weil er nervig ist.
Zugegeben, jetzt und hier, in diesem Moment finde ich London Hyatt ebenfalls unglaublich nervig. Allerdings ist es nicht sie als Person des öffentlichen Lebens oder sie als Frau, die dieses Gefühl in mir auslöst, sondern sie als leichtsinnige Schutzperson, für deren Sicherheit ich letztlich die Verantwortung trage.
Und aus diesem Grund, weil sie derart uneinsichtig ist, denke ich auch, dass die größte Gefahr für sie von ihr selbst ausgeht. Ich glaube zwar nicht, dass sie sich gerade auf einer Party volllaufen lässt oder sich irgendein Zeug durch die Nase pfeift, doch wissen tue ich es nicht. Alkohol- und Drogenmissbrauch sollen jedenfalls einer der Hauptgründe dafür gewesen sein, dass ihr Vater zu ihrem Vormund ernannt wurde. Und sollte etwas Derartiges passieren, wird Harry Hyatt mich dafür zur Verantwortung ziehen.
Kurz überlege ich, ob ich Noah in weiser Voraussicht kontaktieren sollte: In Fällen wie diesem lobe ich es mir, dass mein bester Freund als Miamis Staranwalt gehandelt wird.
Harry Hyatt mag die Möglichkeit dazu haben, die besten Rechtsvertreter der Welt zu engagieren, doch ich habe einen Noah Kennedy in meinen Reihen und ich bin definitiv bereit dazu, ihn zu benutzen.
»Boss, ich bin mir sicher, dass sie nichts angedeutet hat – weder eine Party noch ein Empfang und schon gar keine Kunstaustellungseröffnung …«
»Wäre auch zu schön gewesen.«
»Das kleine Luder …«
Ich räuspere mich, woraufhin Jim vermutlich gerade mit den Augen rollt, weil er nicht schnallt, warum ich solche Äußerungen ablehne. Ursprünglich stammt die Bezeichnung Luder aus dem Jägerjargon und bezeichnet ein totes Tier, das als Lockmittel für Raubwild verwendet wird. Erst ein Köder, mittlerweile ein geläufiges Wort für Frauen, die bewusst mit ihren Reizen prominente Männer in die Falle locken. Was diese sogenannten Luder – gesellschaftlich gesehen – ziemlich verachtenswert macht. Wir haben hier also neben diesem ätzenden Narrativ auch noch Objektifizierung in Reinform.
Jim tut gut daran, nicht zu diskutieren. »Kommt nicht wieder vor, Boss. Aber ohne Scheiß, ich habe keinen blassen Schimmer, wo Miss Hyatt stecken könnte. Dass sie sich für Kunst interessiert, kann ich mir jedoch beim besten Willen nicht vorstellen.«
»Fuck!« Der Fluch huscht mir über die Lippen, lässt sich nicht zurückhalten. Auch wenn ich genau weiß, dass Jim und Nick ihr Bestes getan haben, um London zu bewachen, würde ich sie beim Gedanken an das Gespräch, das mir bevorsteht, am liebsten feuern.
Musst du nicht, das macht Harry Hyatt bereits, wenn seine Tochter nicht bald wieder auftaucht.
Der Miesepeter in mir, der sich da gerade zu Wort gemeldet hat, hat recht, aber ich bin niemand, der aufgibt, bin niemand, der den Kopf in den Sand steckt. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie sich dieses Gespräch verhindern lässt: Wir müssen London finden.
»Gib mir Nick!«
»Hast Glück, er kommt gerade.«
Jim reicht mich weiter, doch ehe ich mir die ganzen Vorkommnisse noch mal von Nick schildern lassen kann, sagt er: »Ihr Masseur sagte, dass sie telefoniert hätte.« Er klingt atemlos.
»Mit wem?«
»Gucke gerade nach.«
»Brauchst du Hilfe? Ich kann euch jemanden von der IT …«
»Nicht nötig, habe mir ihren Code gemerkt.« Eine Minipause entsteht, dann verkündet Nick: »Und sie hat ihn seitdem nicht geändert.« Erleichterung schwingt in seiner Stimme mit, ergreift auch von mir Besitz.
Sie verpufft jedoch schlagartig, sobald er sagt: »Da ist kein Anruf eingegangen. Der letzte ist von heute Mittag.«
»Mit wem hat sie da gesprochen?«
»Mit dem Studio, davor mit den Social Media Leuten …« Er nennt mir die Namen aller Personen, mit denen London in den vergangenen drei Tagen telefoniert hat.
»Vielleicht hat sie den Anruf nur vorgetäuscht.« Jim wirft ein, was mir bereits in den Sinn gekommen ist.
»Ja, vielleicht, oder sie hat ein Handy, von dem wir nichts wissen.«
»So oder so haben wir keine Chance herauszufinden, mit wem sie gesprochen hat.«
Im Stillen gebe ich Nick mit dieser Schlussfolgerung recht.
»Sie ist mit Abstand die grässlichste Schutzperson aller Zeiten«, lamentiert Jim, fast so, als hätte Jammern jemals dabei geholfen, ein Problem zu lösen. »Es ist unmöglich, sie zu bändigen oder dazu zu bringen, sich vernünftig zu verhalten. Es gibt Gründe, warum ihre Eskapaden seitenweise sämtliche Klatschblätter der Welt füllen.«
»Du nimmst doch jetzt nicht ernsthaft schmierige Boulevardblätter zur Hilfe, um deine These zu untermauern.« Meinen Angestellten ist meine Abneigung gegen die Regenbogenpresse hinreichend bekannt. Natürlich weiß ich, dass die Magazine an sich nicht das Problem sind. Würde sie niemand kaufen, gäbe es sie schlicht und ergreifend nicht.
Und auch das ist noch so eine Sache, die ich nie verstehen werde. Wieso interessieren sich die Leute so sehr für das vermeintliche Leben der Reichen und Schönen? Haben sie kein eigenes? Oder ist ihres schlicht und ergreifend langweilig?Und wie kommt es, dass ihnen diese Sensationslust, dieser Voyeurismus, nicht einmal peinlich ist?
Nein, beim besten Willen: Diesem bigotten Promi-Klatsch kann ich nichts abgewinnen. Es ist einfach nur respektlos und widerlich. Ganz zu schweigen davon, dass dieser öffentliche Druck fatale Auswirkungen auf die mentale Gesundheit der Prominenten hat. Ich habe gestandene Rockstars weinen sehen, weil ihnen die Paparazzi ständig auflauerten und ihnen die Luft zum Atmen raubten. Und ja, vielleicht liegt es genau an solchen Erfahrungen, dass mir bewusst ist, dass Promis auch nur Menschen sind und wie jeder andere Ecken und Kanten, Wünsche, Träume und Hoffnungen, aber auch Unsicherheiten und Ängste haben. Oder wie der erwähnte Rockstar einmal sagte: »Auch ich beuge zum Kacken die Knie.«
Diese Menschen führen vielleicht kein normales Leben, aber sie sehnen sich nach Normalität … Sie alle tun das. Sie kämpfen mit negativer Berichterstattung, mit schamlosen Paparazzi, mit bösartigen Gerüchten und grausamen Kommentaren im Internet, dabei wollen sie bloß tun, was sie lieben, und abseits davon ihre Ruhe haben.
»Meine These?«, poltert Jim. »Es ist ein verdammter Fakt, dass sie die furchtbarste Schutzperson of all times ist.«
»Ich fand diesen kleinen Bengel von Senator Atkins schlimmer!« War klar, dass Nick diese Story zur Sprache bringen würde.
»Leute, ich will wirklich keine Diskussionen darüber führen, wer Platz 1 der FSOAT-Liste belegt. Wir haben hier eine ernsthafte Krise. Eine, die unseren Ruf für immer zerstören könnte. Das verhindern wir nur, wenn wir London finden.«
»Vielleicht ist sie bei Rico.«
Ich muss nicht nachfragen, welchen Rico Nick meint … Die Rede ist von Rico Ackles, dem NFL-Star-Quarterback, der gerade erst einen Fünfjahresvertrag bei den Miami Dolphins unterzeichnet und dafür die gigantische Summe von 46 Millionen Dollar eingestrichen hat. Die Presse handelt ihn als den neuen Dan Marino, weshalb die Paparazzi regelrecht Jagd auf ihn machen.
Unglücklicherweise sind weder die Medien noch die Fans begeistert davon, dass er sich erst kürzlich mit London verlobt hat.
Zugegeben: Ich teile ihre Befürchtungen, die Leistung ihres Starspielers könnte unter dieser Beziehung leiden. Die Presse jedenfalls tut ihr Bestes, die Massen mit Geschichten rund um den Vorzeigeathleten und die divenhafte Skandalnudel zu unterhalten. Glaubt man den Medien, besteht Londons Leben nach wie vor aus einer Aneinanderreihung peinlicher Skandale. Hier mal ein vergessenes Höschen unter einem ihrer Kleider, die kaum ihren Po bedecken, da ein Alkoholexzess mit peinlichen Folgen. Zu viele, zu laute Partys, die falschen Freunde, eine überstürzte Heirat, eine ebenso schnelle Trennung … Auf dieses Image hat sich die Klatschpresse eingeschossen, und ganz gleich, was London macht, sie stellen sie als naives Dummchen dar, das man nicht ernst nehmen kann.
»Checkt, ob sie bei Rico ist, und behaltet auch die Sozialen Medien im Auge. London erregt schließlich, egal wo sie auftaucht, eine Menge Aufsehen.«
Wobei wir wieder beim Problem der ganzen Sache wären. London Hyatt muss das Rampenlicht nicht suchen. Das Rampenlicht findet sie. Und diese Berühmtheit … dieser Fame hat seinen Preis.
Im Zuge der Verlobungsbekanntgabe haben die Vergewaltigungs- und Morddrohungen deutlich zugenommen – etwas, das London vermutlich nicht einmal weiß. Mein Team und ich mussten einen NDA unterschreiben, dass wir ihr gegenüber in dieser Angelegenheit Stillschweigen bewahren. Ich habe Harry Hyatt zwar gesagt, es wäre meiner Meinung nach sinnvoll, London über all den Mist zu informieren, doch er ist niemand, der viel auf den professionellen Rat von wem auch immer gibt. Harry Hyatt hält sich für den Besten – in egal welcher Disziplin. Er würde auch mit Astrophysikern und Herzchirurgen diskutieren und deren Expertise anzweifeln.
Abgesehen davon ist er ein Choleriker und Egomane, also genau die Art von Arbeitgeber, die man sich wünscht.
Mir gegenüber hat er behauptet, seine Tochter nur beschützen zu wollen, doch ehrlich gesagt kaufe ich ihm die Sache mit dem liebevollen und fürsorglichen Vater nicht ab.
London ist dreiundzwanzig Jahre alt. Sie sollte wissen, wenn sie auf diese Art bedroht wird. Wie ernst man diese Schreiben nehmen kann … Nun ja, das muss im Einzelfall geklärt werden. Aktuell stehen fünf Personen auf der Gefährderliste. Bei dem Rest handelt es sich unserer Einschätzung nach bloß um Schaumschläger, die sich durch solche Aktionen mächtig fühlen.
»Wegen Rico: Er hat ein Auswärtsspiel«, meldet sich Nick zurück. Natürlich, der Saison-Auftakt in New York. Den hatte ich angesichts dieser Krise gar nicht mehr auf dem Schirm. Die Dolphins gegen die Jets. An sich eine spannende Kombi, aber gesehen hätte ich es wohl dennoch nicht. Ich stehe nun einmal mehr auf Rugby. »Hör mal, Boss, sollte diese Verlobung wirklich ein Fake sein, wie behauptet wird, dann trifft London sich vielleicht mit einem anderen, wenn Rico nicht in der Stadt ist.«
Warum ist sie überhaupt in der Stadt? Warum begleitet sie ihn nicht? Sollte sie ihn und das Team nicht anfeuern?
»Möglich«, gebe ich Nick recht. Es gibt jede Menge Leute, die diese Verlobung für einen PR-Gag halten. Dafür spräche, dass die Datingphase extrem kurz war. Deutlich zu kurz, um einander gut kennenzulernen oder tiefere Gefühle zu entwickeln.
Eine andere Gruppierung glaubt, dass London in alte Muster verfallen ist und sich die Fehler der Vergangenheit wiederholen. Eine weitere überstürzte Ehe, der schon bald darauf die Scheidung folgt.
Die dritte Gruppe hält das Ganze für die große Liebe – frei nach dem Motto »Gegensätze ziehen einander an« und vielleicht ist es so. Möglicherweise reden wir hier – entgegen allen Erwartungen und Wahrscheinlichkeiten – von der einen wahren Liebe.
»Wir müssen herausfinden, warum sie sich ständig abseilt.« Nicks Bemerkung reißt mich aus meinen Gedanken.
»Oder herausfinden, wo sie ist. Dann können wir vielleicht Schlüsse ziehen, was der Grund ist. Fassen wir zusammen …«
»… was auch immer sie tut, muss sie heimlich tun«, benennt Nick den ersten Punkt, von dem wir uns sicher sind, dass er stimmt.
»Exakt. Abgesehen davon konnten wir bisher kein Muster erkennen, wann sie sich absetzt.« Nachdem sie uns das erste Mal entwischt war, habe ich die Berichte unserer Vorgänger studiert. Harry Hyatt hatte diese Sicherheitsagentur nicht nur zu Londons Schutz angeheuert, sondern sämtliche Aufträge in diesem Bereich an das Unternehmen vergeben. Noch laufen diese Verträge, doch er gedenkt, sie anderweitig zu vergeben … Möglicherweise an uns, doch dafür müssten wir sicherstellen, dass London uns nicht erneut abschüttelt.
Falsch! Ich kenne die Stimme meines inneren Kritikers nur allzu gut, weshalb ich genau weiß, was er einwerfen wird. Erst einmal sollten wir sie finden. Schließlich können wir nicht verlieren, was wir nicht haben.
»Wenn es kein Liebhaber ist, dann hat sie vielleicht ein Drogenproblem.« Jim schaltet sich ein. »Viele dieser reichen, gelangweilten Kids nehmen irgendwelches Zeug.«
Ein Punkt, dem ich gerne widersprechen würde. Niemand wacht morgens auf und beschließt, dass es cool wäre, ein Junkie zu werden. Es ist nicht Langeweile, die diese Kids zu Drogen greifen lässt: Es ist die Leere, die sie empfinden, und der Wunsch, sie mit etwas zu füllen.
Unwillkürlich wandern meine Gedanken zu Noah. Die Vergangenheit, in der wir beide unser Leben so gar nicht im Griff hatten, streckt ihre Klauen nach mir aus. Als ich jung war, gab es für mich bloß Rugby und Partys. Ich dachte, ich wäre unbesiegbar, dachte, ich könnte alles erreichen. Keine Herausforderung war zu groß, es gab kein Wagnis, das ich nicht eingegangen wäre, und dann … Dann kam Grace, und alles hat sich geändert. Es war gut. Nein, es war mehr als gut. Es war perfekt. Sie hat aus mir einen besseren Menschen gemacht, hat mich Mitgefühl gelehrt und auch, dass ich mich nicht immerzu beweisen muss. Dass ich gut bin, wie ich bin. Bei ihr konnte ich ich selbst sein.
Die Erinnerungen an sie sind auch nach all den Jahren ein stechender Schmerz, der Besitz von meinem ganzen Körper ergreift. Energisch schüttle ich die Vergangenheit ab, versuche, mich auf die aktuelle Krise zu fokussieren, doch all das, was einmal war, hält mich im Klammergriff gefangen. Grace’ Tod, Noahs und mein Absturz, der darauf folgte, all unsere Sünden …
Was vergangen ist, kannst du nicht ändern! Dieses Mal ist es nicht der unnachgiebige Kritiker, der spricht. Oder wenn er es doch ist, dann hat er sich Grace’ Stimme angeeignet. Wenn, dann gelingt es ihm, sie mit Wärme und Mitgefühl zu füllen.
So oder so, selbst wenn die Stimme zu einem Geist aus meiner Vergangenheit gehört, so hat sie recht. Man kann nicht ändern, was bereits geschehen ist, aber man kann es bedauern und man kann daraus lernen. Ich habe viele Menschen enttäuscht … Einer davon sitzt an einem Tisch für zwei Personen und wartet auf meine Rückkehr.
Becca nennt mich einen Workaholic, aber die Arbeit, meine Firma ist es, die mich bei Verstand hält. Sie verhindert, dass ich die Fehler der Vergangenheit wiederhole. Meditation und Yoga, regelmäßige Sporteinheiten geben mir in meinem turbulenten Alltag die Auszeiten, die ich brauche, um zu arbeiten.
Ich weiß, ich sollte arbeiten, um zu leben, aber ich lebe, um zu arbeiten. Meine Arbeit bewirkt Gutes. Sie hilft mir, mich nicht zu verlieren, und sie schützt Menschen … Wo wir wieder bei London wären.
»Wie ist denn euer Eindruck von ihr? Könnten da Drogen im Spiel sein? Gibt es Anzeichen?«
»Die Presse sagt ja.«
»Die Presse, Jim, sagt auch, dass sie im elften Monat mit Fünflingen von einem Alien schwanger ist.«
»Vermutlich lässt sie sich gerade schwängern.« Ich kann mir bildlich vorstellen, wie der hagere Nick dazu vielsagend mit den Augenbrauen wackelt. Er erinnert mich immer ein wenig an John Belushi in Blues Brothers, genauer gesagt an das Negativ, denn er trägt statt eines schwarzen Trilby einen Panama-Hut aus Naturstroh, der seinem beigen Anzug einen legeren Touch verleiht. Ein Outfit, das weitaus besser zu Miami passt, wie ich zugeben muss.
»Wenn sie das tut, schneidet der alte Hyatt uns die Eier ab und verspeist sie zum Frühstück.«
Nick lacht über Jims Bemerkung, doch ich finde sie alles andere als witzig. »Wenn etwas Derartiges passiert, dann ist die Kacke am Dampfen. Ihr müsst sie finden!«
»Was wirst du tun?«
»Meine Schwester versetzen und in die Zentrale fahren. Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt.«
»Geht klar, Boss!«
Meiner inneren Anspannung folgend, lege ich meinen Kopf in den Nacken, lasse ihn einmal von rechts nach links kreisen, in der Hoffnung, das Gefühl dadurch abschütteln zu können. Vergeblich! Es knackt zwar, doch die Last bleibt, sitzt zwischen meinen Schultern, und das Bild von Atlas, der die Erde auf seinen trägt, blitzt kurz vor meinem inneren Auge auf. Zwar bin ich kein Titan, und es ist auch nicht das Schicksal der Welt, das es zu stemmen gilt, dennoch macht mir die Verantwortung manchmal zu schaffen.
Und ohne Anhaltspunkt können wir nur hoffen, dass London wohlbehalten wieder auftaucht. Diese Tatenlosigkeit … nein, sind wir ehrlich, dieser Kontrollverlust ist es, der mir an die Substanz geht.
Im Stillen schicke ich ein Stoßgebet zum Himmel, wünsche mir von Herzen, dass es ihr gutgeht. Die Sorge raubt mir den Atem, auch die stille Ermahnung, diese Sache nicht zu nah an mich heranzulassen, fruchtet nicht.
Ich muss in die Zentrale, muss irgendetwas tun, selbst wenn es sich dabei nur um blinden Aktionismus handelt.
Vor dem Restaurant wartet Becca auf mich, eine Tüte in der Hand, in der sich allem Anschein nach unser Abendessen befindet. »Hier gehen wir nicht noch mal hin. Weißt du, was sie gesagt haben, als ich sie darum bat, das Essen einzupacken?« Ich komme nicht einmal dazu, den Mund zu öffnen, da serviert Becca mir die Antwort bereits auf dem Silbertablett. »Sie seien kein Takeaway, und es klang, als wäre das eine unheilbare Krankheit.« Ihre braunen Rehaugen mustern mich. Was sie sieht, gefällt ihr offenbar nicht, denn der Ausdruck darin ist mit einem Mal besorgt. »Du siehst gestresst aus. Was ist los?«
»Schwierige Schutzperson und noch schwierigerer Auftraggeber.«
»Sie akzeptiert die Maßnahmen nicht?«, mutmaßt meine schlaue Schwester, wissend, dass das der häufigste Grund für Probleme ist, wenn Klient und Schutzperson nicht dieselbe Person sind.
Nickend bestätige ich ihren Verdacht. »Sie ist abgehauen, und wir stehen wie die letzten Vollpfosten da.« Meinem Geständnis folgt eine Reaktion meines Körpers, die so heftig ist, dass ich ein Schaudern nur mit Mühe unterdrücken kann. Eine eiserne Hand schließt sich um mein Herz und drückt zu, hält es im Klammergriff. Woher genau die Angst kommt, die mir die Luft zu rauben droht, kann ich nicht sagen. Aber sie ist da und sie ist ziemlich überwältigend.
Becca scheint mir meine Besorgnis anzusehen, denn sie fragt: »Schwebt die Schutzperson denn in akuter Gefahr?«
»Ja, auch wenn sie davon nichts weiß, weil ihr Vater nicht möchte, dass sie davon erfährt.«
Beccas Augen weiten sich erschrocken. »Ein Kind ist euch entwischt? Dann müssen wir es suchen!«
In einer beruhigenden Geste hebe ich beide Hände. »Nein, es ist kein Kind … Der Fall ist etwas außergewöhnlich.«
Becca blinzelt verwirrt. Einmal, zweimal, dann hat sie die richtigen Schlüsse gezogen. »London Hyatt.« Ihre Stimme ist ein Flüstern, mehr nicht. Gerade laut genug, dass ich den Namen verstehen kann.
Beccas schnelle Auffassungsgabe sollte mich längst nicht mehr verwundern, allerdings ist diese Schlussfolgerung selbst für mich, der sie sein Leben lang kennt, überraschend. Schicksalsergeben nicke ich. »Wie kamst du jetzt auf sie?«