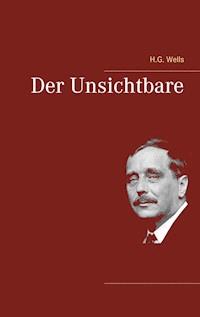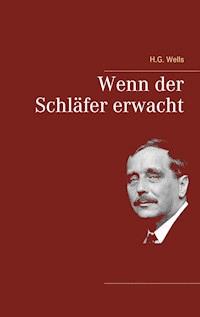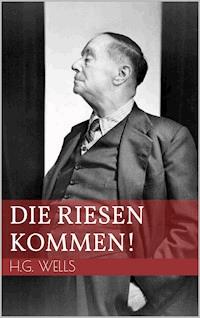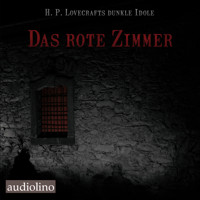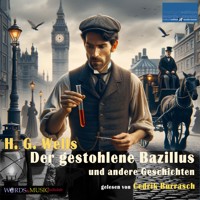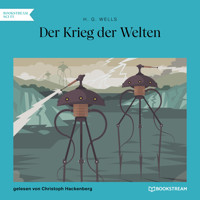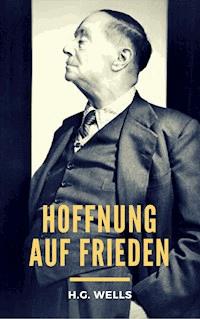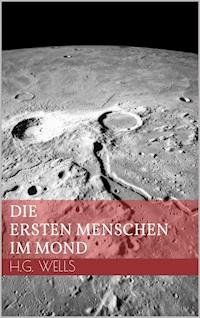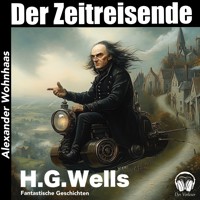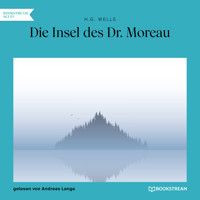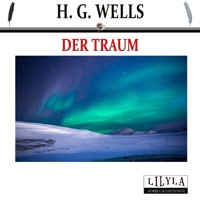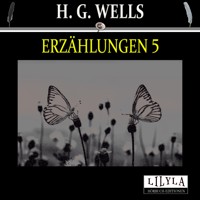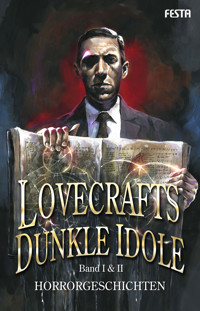
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Diese Auswahl von 28 unheimlichen Geschichten verursacht dem Leser nicht nur eine Gänsehaut nach der anderen, sondern beantwortet auch die Frage vieler Fans von H. P. Lovecraft: Welche Autoren beeinflussten das finstere Genie? Welche Horrorgeschichten mochte der Vater der modernen Horrorliteratur am liebsten? Zeitlose Meisterwerke und Raritäten von Lovecrafts dunklen Idolen. Buch 1: Lovecrafts dunkle Idole Vorwort Matthew Phipps Shiel: Das Haus im Sturm Maurice Level: Der Abdruck der Hand Francis Marion Crawford: Das Totenlächeln Irvin S. Cobb: Fischkopf Mary E. Wilkins-Freeman: Die Schatten an der Wand Jean Marie Villiers de l'Isle-Adam: Die Marter der Hoffnung Ambrose Bierce: Halpin Fraysers Tod Lafcadio Hearn: Als ich eine Blume war Lafcadio Hearn: El Vómito Lafcadio Hearn: Die Pest Lafcadio Hearn: Tote Liebe Robert H. Barlow: Eine blass erinnerte Geschichte Ralph Adams Cram: Das Tote Tal Buch 2: Das rote Zimmer Vorwort H. P. Lovecraft: Brief an Fritz Leiber jun. Herbert George Wells: Das rote Zimmer Clemence Housman: Die Werwölfin John Buchan: Das grüne Gnu H. F. Arnold: Telegramm in der Nacht Mearle Prout: Das Haus des Wurmes M. L. Humphreys: Das obere Stockwerk Théophile Gautier: Der Mumienfuß Arthur J. Burks: Die Glocken des Ozeans Robert Louis Stevenson: Die Leichenräuber Arthur Machen: Die weißen Gestalten Edward Lucas White: Lukundoo Edgar Allan Poe: Die Auslöschung des Hauses Usher C. L. Moore: Der Kuss des Schwarzen Gottes Lord Dunsany: Die erschütternde Geschichte von Thangobrind, dem Juwelendieb
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 853
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Herausgegeben von Frank Festa
Impressum
Nachdruck der beiden gebundenen Ausgaben Lovecrafts dunkle Idole und Das rote Zimmer – Lovecrafts dunkle Idole II, Festa Verlag.
Copyright © dieser Ausgabe 2018 by Festa Verlag, Leipzig
Titelbild: Timo Wuerz
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-86552-664-9
www.Festa-Verlag.de
Inhalt
Impressum
Inhalt
Band I: Lovecrafts dunkle Idole
Vorwort
Matthew Phipps Shiel
Das Haus im Sturm
Maurice Level
Der Abdruck der Hand
Francis Marion Crawford
Das Totenlächeln
Irvin S. Cobb
Fischkopf
Mary E. Wilkins-Freeman
Die Schatten an der Wand
Jean Marie Villiers de l’Isle-Adam
Die Marter der Hoffnung
Ambrose Bierce
Halpin Fraysers Tod
Lafcadio Hearn
Als ich eine Blume war
El Vómito
Die Pest
Tote Liebe
Robert H. Barlow
Eine blass erinnerte Geschichte
Ralph Adams Cram
Das Tote Tal
Band II: Das rote Zimmer
Vorwort
H. P. Lovecraft an Fritz Leiber jun.
Herbert George Wells
Das rote Zimmer
Clemence Housman
Die Werwölfin
John Buchan
Das grüne Gnu
H. F. Arnold
Telegramm in der Nacht
Mearle Prout
Das Haus des Wurmes
M. L. Humphreys
Das obere Stockwerk
Théophile Gautier
Der Mumienfuß
Arthur J. Burks
Die Glocken des Ozeans
Robert Louis Stevenson
Die Leichenräuber
Arthur Machen
Die weißen Gestalten
Edward Lucas White
Lukundoo
Edgar Allan Poe
Die Auslöschung des Hauses Usher
C. L. Moore
Der Kuss des Schwarzen Gottes
Lord Dunsany
Die erschütternde Geschichte von Thangobrind, dem Juwelendieb
Quellen- und Copyrightvermerke
Entdecke die Festa-Community
Band I: Lovecrafts dunkle Idole
Vorwort
Wie das Werk keines anderen Autors beeinflussten die Erzählungen des Amerikaners Howard Phillips Lovecraft (1890–1937) die moderne unheimlich-fantastische Literatur – und sie dominieren das Genre auch heute noch. Neben Edgar Allan Poe und Ambrose Bierce zählt Lovecraft zu den drei ›Eckpfeilern der amerikanischen Horrorliteratur‹.1 Somit wurde H. P. Lovecraft posthum zum bedeutendsten Autor unheimlicher Dichtung im 20. Jahrhundert.
Führende Horrorautoren – Schriftsteller wie Robert Bloch, Ramsey Campbell, T. E. D. Klein, Brian Lumley, Graham Masterton, Stephen King, Thomas Ligotti, Karl Edward Wagner, F. Paul Wilson oder Poppy Z. Brite, um nur wenige zu nennen, zeigen sich von Lovecrafts Werk inspiriert; sie alle haben auch Geschichten zu H. P. Lovecrafts Cthulhu-Mythos verfasst. Es ist sicher nicht verfehlt, inzwischen von einer echten ›Lovecraft-Schule‹ zu sprechen.
Speziell das Frühwerk seiner ›Schüler‹ wurde durch Lovecrafts Einfluss geprägt, gab ihren Texten einen gewissen Touch ›kosmischen Schreckens‹. Dem Gros gelang es jedoch bald, sich von ihrem literarischen Vorbild zu lösen, um individuelle dunkle Fantasien zu entwerfen. Das beste Beispiel dafür ist der Engländer Ramsey Campbell, der sein erstes Buch The Inhabitant of the Lake and Less Welcome Tenants (1964) noch ganz im Schatten Lovecrafts verfasste, um bereits ein Buch später in Demons by Daylight (geschrieben 1968/69) seine modernen Großstadtdämonen zu entwickeln, die der Psyche seiner Protagonisten entspringen – oder doch nicht?
Auch in Europa wirkt Lovecrafts Einfluss, besonders in Italien und Frankreich. Im deutschsprachigen Raum erschienen erste Übersetzungen und die erste Zusammenstellung seiner Kurzgeschichten Mitte der 60er-Jahre. Sie regten auch hier eine Anzahl sehr unterschiedlicher Autoren an, etwa H. C. Artmann, Hugh Walker, Arno Schmidt, Karl und Doris Grünning, Uwe Vöhl oder Wolfgang Hohlbein, in dessen Hexer-Serie Lovecraft sogar der Hauptprotagonist wurde. In den 80er- und 90er-Jahren vergrößerte sich noch die Zahl der Autoren, die sich Lovecraft bewusst zum Vorbild nahmen; zweifellos ist sein Einfluss nach wie vor sehr groß.
Beginnen möchte ich diese Reihe ganz vorne, mit Lovecrafts Vorbildern, seinen ›dunklen Idolen‹, denn neben der vorrangigen Absicht, mit dieser Auswahl von 13 klassischen unheimlichen Geschichten – darunter drei deutschen Erstveröffentlichungen – zu unterhalten, möchte ich in diesem Buch gerade für den Lovecraft-Fan anschaulich machen, welche literarischen Wurzeln das Werk H. P. Lovecrafts hat.
Welche Autoren beeinflussten ihn? Welche Art von Geschichten mochte er am liebsten?
Lovecraft hat sich oft schriftlich zu diesem Thema geäußert. In seinen unglaublich vielen Briefen – man schätzt ihre Zahl auf etwa 100.000, aber nur ein kleiner Teil ist erhalten geblieben – schwärmt er häufig von seinen Idolen und literarischen Entdeckungen, die ihn zu seiner Zeit begeisterten. Weiterhin schrieb er einige Essays über die von ihm bewunderten Schriftsteller; und natürlich gibt seine umfangreiche Abhandlung über die Weird Fiction, Supernatural Horror in Literature, den besten Überblick.
Wann traf eine Erzählung den Geschmack Lovecrafts?
Lovecraft schätzte vor allem solche Geschichten, die nicht die traditionellen Motive der Gespensterstorys benutzten – er verlangte eine stärkere Kraft des Schreckens, den ›cosmic horror‹: »Ganz allgemein können wir sagen, dass eine unheimliche Geschichte, deren Absicht es ist, zu lehren oder einen sozialen Effekt zu erzeugen, oder eine, worin der Schrecken letztlich durch natürliche Mittel erklärt wird, keine echte Geschichte des Grauens ist. Dennoch bleibt die Tatsache, dass solche Erzählungen häufig, in isolierten Absätzen, atmosphärische Schilderungen enthalten, welche das Kriterium der wahren übernatürlichen Horrorliteratur erfüllen. Daher müssen wir eine unheimliche Geschichte nicht anhand der Absichten des Verfassers beurteilen, auch nicht nach der reinen Mechanik der Handlung, sondern anhand der emotionalen Ebene, die sie an ihrer am wenigsten ›weltlichen‹ Stelle erreicht. Wird das angemessene Gefühl ausgelöst, so muss ein solcher ›Höhepunkt‹ aufgrund seines Eigenwertes als unheimliche Literatur anerkannt werden, ganz egal, wie prosaisch sich die Geschichte späterhin entwickelt. Der wahre Test für das wirklich Unheimliche besteht einfach in Folgendem: Wird beim Leser ein tief empfundenes Gefühl der Furcht sowie des Kontaktes mit unbekannten Sphären und Mächten erzeugt, ein subtiles Verhalten ängstlichen Lauschens nach dem Schlag schwarzer Schwingen oder dem Schleichen von Gestalten und Wesen von außerhalb, vom äußersten Rand des bekannten Universums? Je vollständiger und vereinheitlichter eine Geschichte diese Atmosphäre vermittelt, desto besser ist sie selbst als Kunstwerk in dem gegebenen Medium zu verstehen.«2
Obzwar die hier gesammelten Horrorgeschichten zu Lovecrafts Favoriten zählen und ihre literarische Qualität in ihrem Genre wirklich überdurchschnittlich ist, wird deutlich, dass jenes von Lovecraft geforderte Kriterium »kosmischen Grauens« niemand besser erfüllte als er selbst.
Frank Festa
1 S. T. Joshi in The H. P. Lovecraft Centennial Conference: Proceedings, Necronomicon Press/West Warwick/USA 1991
2 Alle benutzten Übersetzungen aus Supernatural Horror in Literature mit freundlicher Genehmigung von Joachim Körber; entnommen aus H. P. Lovecraft – Die Literatur des Grauens, Edition Phantasia, Linkenheim 1985. Alle restlichen Übersetzungen der Sekundärtexte stammen vom Herausgeber.
Matthew Phipps Shiel
Ich freue mich sehr, mit der nun folgenden Erzählung ein echtes Meisterwerk der literarischen Fantastik in deutscher Erstveröffentlichung präsentieren zu können – ›The House of Sounds‹ von Matthew Phipps Shiel.
Es war W. Paul Cook, einer seiner Freunde aus der United Amateur Press Association, der Lovecraft mit Shiels Werk bekannt machte. Cook lieh Lovecraft 1925 einige Bücher. An Frank Belknap Long schrieb Lovecraft im Oktober: »(…) Das andere Buch, das Cook mir lieh, ist völlig anders – oh, wie anders! –, es enthält, was wir beide, Cook und ich, als einzigartiges Meisterwerk feiern – die großartigste Horrorgeschichte der Generation, und von einem lebenden und beinahe ganz unbekannten Autor (…) ›The House of Sounds‹. (…) Wie kann ich ihren giftig-grauen heimtückischen Wahnsinn beschreiben? Wenn ich sage, dass sie ›The Fall of the House of Usher‹ sehr gleicht oder dass sie Ähnlichkeit hat mit meinem ›Alchemist‹ (1908), habe ich gar nichts ausgedrückt über den zutiefst einmaligen Wahn arktischer Öde, titanischer Meere, irrsinniger metallischer Türme, jahrhundertealter Böswilligkeit, rasender Wellen und Katarakte, und, grauenhaft über allem, beharrlich, hirnzermarternd, Pan-verfluchter kosmischer LÄRM … Gott! Aber nach dieser Geschichte sollte ich nie mehr versuchen, etwas Eigenes zu schreiben. Shiel hat es viel besser gemacht als ich in meinen besten Geschichten, ließ mich atemlos und sprachlos zurück. Und dieser Mann ist praktisch noch unbekannt in Amerika – und geradeso in seiner Heimat England.«
Im November bat W. Paul Cook Lovecraft um einen Aufsatz über die unheimliche Literatur, den er in seinem Magazin The Recluse abdrucken wollte. Lovecraft schrieb eine erste Fassung von Supernatural Horror in Literature etwa zum Jahreswechsel 1925/26, aber erst im August 1927 erschien der Text im Recluse, neben Gedichten von C. A. Smith und Frank Belknap Long sowie Erzählungen von Donald Wandrei und H. Warner Munn. Geplant als vierteljährliche Schrift, blieb es die einzige Ausgabe, die jemals erschien.
In seinem Essay äußert sich Lovecraft zurückhaltender über Shiel, aber immer noch enthusiastisch: »Shiel, Autor zahlreicher unheimlicher, grotesker und abenteuerlicher Romane und Geschichten, erreicht manchmal ein hohes Niveau entsetzlicher Magie. ›Xelucha‹ ist ein verderblich-bösartiges Fragment, aber es wird noch übertroffen von ›The House of Sounds‹, unzweifelhaft Mr. Shiels Meisterwerk, das in den ›gelben Neunzigern‹ überladen geschrieben (1896 unter dem Titel ›Vaila‹ in der Sammlung Shapes in the Fire) und mit mehr künstlerischer Zurückhaltung im frühen 20. Jahrhundert überarbeitet wurde. In ihrer endgültigen Form verdient diese Geschichte einen Platz unter den hervorragendsten Stücken ihrer Art. Sie erzählt von einem schleichenden Grauen und einer Bedrohung über Jahrhunderte hinweg auf einer subarktischen Insel vor der Küste Norwegens, wo im Brausen dämonischer Winde und dem ununterbrochenen Tosen höllischer Wogen ein rachsüchtiger toter Mann einen Messingturm des Schreckens erbaute. Es erinnert sehr an Poes ›The Fall of the House of Usher‹ und ist doch auch wieder grundverschieden davon (…).«
Matthew Phipps Shiell (das zweite L strich er, als er zu publizieren begann) wurde am 21. Juli 1865 in Westindien geboren. Er war irischer Abstammung. Sein Vater ernannte ihn 1880 zum König des unbewohnten Karibik-Inselchens Redonda. Shiel studierte Sprachen und Medizin in London, bis er 1895 sein erstes Buch veröffentlichte, Prince Zaleski. Er schrieb mehr als 30 Bücher, die meisten davon nicht zum fantastischen Genre gehörend, und starb im Februar 1947 in England.
Rein A. Zondergeld urteilt in seinem Lexikon der phantastischen Literatur, dass ›The House of Sounds‹ eine »auch sprachlich bis ins Lächerliche übersteigerte Nachahmung von Poes ›The Fall of the House of Usher‹« sei. Ein Fehlurteil, wie ich finde. Der Leser kann sich nun selbst eine Meinung bilden.
Das Haus im Sturm
E caddi come lúom cui sonno piglia.
– Dante
Vor etlichen Jahren, als ich noch ein junger Mann war, ein Student in Paris, kannte ich den großen Carot und beobachtete an seiner Seite viele jener Fälle von Geisteskrankheit, in deren Analyse er ein solcher Meister war. Ich erinnere mich an ein kleines Mädchen aus dem Marais, das sich bis zum Alter von neun Jahren in nichts von seinen Spielkameradinnen unterschied; doch eines Abends, als es im Bett lag, flüsterte es seiner Mutter ins Ohr: »Mama, kannst du nicht den Klang der Welt hören?« Es scheint, dass sie gerade in Geografie gelernt hatte, dass sich unser Globus mit ungeheurer Geschwindigkeit in einer Umlaufbahn um die Sonne dreht; und ihr Klang der Welt war nichts als ein leises Rauschen im Ohr, hörbar nur in der Stille der Nacht. Innerhalb von sechs Monaten war sie völlig irre.
Ich erwähnte den Fall meinem Freund Haco Harfager gegenüber, der damals zusammen mit mir ein altes Haus in St. Germain bewohnte, welches hinter einer Mauer und einem Dschungel aus Gebüsch verborgen lag. Er hörte mir mit außerordentlichem Interesse zu und binnen Kurzem saß er eingehüllt in Trübsinn da.
Auch ein anderer Fall, den ich zum Besten gab, machte einen großen Eindruck auf meinen Freund: Ein junger Mann, ein Spielzeugmacher aus St. Antoine, der an Schwindsucht litt – doch er war fleißig und kein Trinker –, kehrte eines Tages in der Dämmerung zu seiner Dachkammer zurück. Auf dem Weg kaufte er zufällig eines jener aufrührerischen Journale, die unter dem Licht der Laternen auf den Boulevards kursierten. Diese einfache Tat war der Beginn seines Schicksals. Er war nie ein eifriger Leser gewesen und wusste wenig von dem Wirbel und dem Aufruhr in der Welt.
Doch am nächsten Tag kaufte er ein anderes Journal. Bald erwarb er sich Kenntnisse über Politik, über die großen Bewegungen, den Tumult des Lebens. Und dieses Interesse begann alles andere zu verschlingen. Bis spät in die Nacht – jede Nacht – lag er brütend über dem Getöse der Taten, über den gedruckten Leidenschaften. Jedes Mal erwachte er mit dem Gefühl körperlicher Krankheit, doch frisch im Geiste – und kaufte eine Morgenzeitung. Und je mehr seine Zähne knirschten, desto weniger bekamen sie zu essen. Er wurde nachlässig; seine Arbeit wurde unregelmäßig, er wälzte sich den Tag über auf dem Bett herum. Er ging in Lumpen gekleidet. Als das gewaltige Interesse in seiner zerbrechlichen Seele wuchs, verließ ihn jedes andere, geringere Interesse. Es kam der Tag, an dem er sich nicht mehr um sein eigenes Leben sorgte, und ein anderer Tag, an dem er sich die Haare vom Kopf riss.
Über diesen Mann sagte der große Carot zu mir: »Man weiß wirklich nicht, ob man über einen solchen Fall kichern oder weinen sollte. Beachten Sie einmal, wie unterschiedlich die Menschen sind. Es gibt Köpfe, die exakt so sensibel sind wie ein Strahl flüssigen Bleies: Jeder Hauch regt sie auf und verwirrt sie – und was ist, wenn ein Hurrikan kommt? Für solche Leute ist diese Ordnung der Dinge ganz klar keine geeignete Heimat, sondern eine Todesmaschine, eine unheilvolle Ungeheuerlichkeit. Für einige ist der brausende Schrei des Seins zu grausam – sie können die Welt nicht ertragen. Ich sage: Lasst jeden auf seinen eigenen kleinen Fetzen Existenz achtgeben und das monströse Automaton alleinlassen. Hier in diesem armen Spielzeugmacher haben Sie einen Fall des Ohrs: Es ist nur eine Neurose, Oxyecoia. Großartig war jener griechische Mythos der ›Harpyien‹; von ihnen ist dieses Geschöpf fortgerissen worden – oder besser, er wurde an einem Arm von den Rädern des Universums erfasst, und so ging er zugrunde. Es ist ein ziemlich entzückender Ausgang – eine Entrückung in einem flammenden Streitwagen! Erinnern Sie sich nur daran, dass der erste Körperteil, der erfasst wurde, die Ohrmuschel war; er wandte sein Ohr dem Geheul der Welt zu und endete selbst heulend. Zwischen dem Chaos und unseren Schuhsohlen schwingt nur die dünnste Membrane, das versichere ich Ihnen! Ich habe einen Mann gekannt, der die folgende Gehörbesonderheit hatte: Jedes Geräusch überbrachte ihm einige Kenntnis von dem Umstand, der das Geräusch verursacht hatte. Zum Beispiel verriet ihm eine Stange aus einem Kupfer-Zinn-Gemisch, die auf eine Stange aus einem Eisen-Blei-Gemisch schlug, nicht nur die Anteile jedes Metalls in jeder Stange, sondern auch sozusagen einige Kenntnis über die wesentliche Bedeutung und den Geist von Kupfer, von Zinn, von Eisen und von Blei. Auch ihn haben die Harpyien hinfortgerafft.«
Ich habe erwähnt, dass ich einige dieser Fälle meinem Freund Harfager berichtete, und ich war erstaunt über die offensichtlichen Anstrengungen, die er unternahm, um sein Interesse zu verbergen, über seine weit offen stehenden Nasenflügel …
Schon ganz zu Beginn, als wir dieselben Seminare in Stockholm besuchten, war eine Vertrautheit zwischen uns entstanden. Doch es war keine Vertrautheit, die von den üblichen Zeichen der Freundschaft begleitet wurde. Harfager war das scheueste, zurückgezogenste aller Wesen. Obwohl unser gemeinsamer Haushalt (der durch Zufall während einer mitternächtlichen séance zustande gekommen war) nun schon einige Monate dauerte, wusste ich nichts von seinen Plänen. Tagsüber lasen wir zusammen; er war in der Vergangenheit versunken, mich nahm die Gegenwart in Anspruch; am späten Abend ruhten wir auf Sofas vor der großen Höhlung eines Louis-Onze-Kamins und rauchten schweigend beim sterbenden Feuer. Bisweilen lockte mich eine soirée oder eine Vorlesung aus dem Haus, doch außer einem einzigen Mal habe ich nie bemerkt, dass Harfager es verlassen hätte. Als ich damals zufällig auf ihn stieß, war ich durch die Rue St. Honoré geeilt, in der ein Brausen des Verkehrs über das alte Pflaster ratterte, das es dort noch gibt. In diesem Tumult stand er in lauschender Haltung; und einen Augenblick lang erkannte er mich nicht.
Sogar in meinen Jugendtagen hatte ich in meinem Freund den geborenen Patrizier gesehen – nicht dass seine Person einen Eindruck von Dünkel oder Reichtum ausgestrahlt hätte: im Gegenteil. Er deutete jedoch ein unerrechenbares Alter seines Geschlechts an, und ich habe nie einen Adligen getroffen, welcher dermaßen in seinem Äußeren die Sicherheit des geborenen Prinzen trug, dessen bleiche Blüte aus dem Gestern stammt und morgen vergehen wird, doch dessen Wurzeln hinab durch die Zeitalter schießen. So viel wusste ich über Harfager und auch, dass auf der einen oder anderen seiner Inseln nördlich von Zetland seine Mutter und eine Tante lebten und dass er etwas schwerhörig war, aber dennoch bei gewissen Klängen tausend Qualen oder Freuden unterworfen wurde, so bei dem Gewinsel einer Tür, dem Ton eines Vogels …
Er war etwas unter mittelgroß und neigte zur Beleibtheit. Seine Nase erhob sich adlerhaft unter jener Art von Stirn, die ›musikalisch‹ genannt wird – das heißt, mit Schläfen, die sich auswärts zu den Wangenknochen neigen und so Platz für die Basis des Gehirns machen; während die Richtung der schwerlidrigen Augen und der Augenbrauen eine nach unten hängende war. Er trug einen dünnen Backenbart. Doch das Hauptmerkmal seines Gesichts waren die Ohren, die beinahe rund, sehr klein und eng anliegend und ohne jene äußere Krümmung waren, die man ›Helix‹ nennt. Ich erfuhr, dass dies schon lange ein Charakteristikum seines Geschlechts war. In das ganze fahle Gesicht meines Freundes war eine Aura trauriger Unfähigkeit eingeschrieben, eine äußerste Sorgenschwere: Man war versucht, ihn ›Sardanapalus‹ zu nennen, hinfälliger Letzter aus Nimrods Geschlecht.
Nach einem Jahr fand ich es nötig, Harfager gegenüber mein Vorhaben zu erwähnen, Paris zu verlassen. Wir ruhten uns in jener Nacht in unserem Schlupfwinkel am Kamin aus. Er erwiderte auf meine Neuigkeiten ein höfliches ›Tatsächlich!‹ und fuhr fort, sich an dem Kaminfeuer zu weiden, doch nach einer Stunde wandte er sich mir zu und bemerkte: »Nun, es scheint eine harte Welt zu sein.« Gelegentlich äußerte er Binsenweisheiten in einem solchen Tonfall einer erstaunlichen Entdeckung, doch sein ernster Blick, seine nunmehrige Verzagtheit erstaunten mich. »Was soll das heißen?«, fragte ich.
»Mein Freund, verlass mich nicht!« Er breitete seine Arme aus.
Ich erfuhr, dass er das Objekt einer teuflischen Bosheit, das Opfer einer schrecklichen Versuchung war. Dass ein Zauber, eine lockende Hand, eine lauernde Lust ihn beständig zu verführen drohte, der zu entkommen die größte Anstrengung seines Lebens war (und der er besonders in der Einsamkeit ausgesetzt war); und dass es so etwa seit jenem Tag war, als er im Alter von fünf Jahren von seinem Vater aus seinem trostlosen Heim im Ozean fortgeschickt worden war.
Und von wem ging diese Bosheit aus? Er sagte mir, von seiner Mutter und seiner Tante.
Und was war seine Versuchung? Er sagte, es sei die Versuchung, zurückzugehen, in hungernder Raserei zurück zu jenem Heim zu eilen.
Ich wollte wissen, aus welchen Motiven und in welcher Weise sich die Bosheit seiner Mutter und seiner Tante manifestierte. Er antwortete, dass er glaube, es gebe kein bestimmtes Motiv, sondern nur eine schicksalsbestimmte Böswilligkeit, und dass die Art, in der sie sich manifestiere, in den Gebeten und Befehlen bestehe, mit denen sie ihn bestürmten, wieder den Sitz seiner Ahnen einzunehmen.
All das konnte ich nicht verstehen, und das sagte ich ihm auch. Worin bestanden diese Anziehungskraft und diese Gefahr seines Heims? Darauf erwiderte Harfager nichts. Er erhob sich aus seinem Sessel, verschwand hinter den Kaminvorhängen und verließ den Raum. Er kam mit einem in Leder gebundenen Quartband zurück, der sich als Gascoignes Chronik nordischer Familien herausstellte, gedruckt in englischer Fraktur.
Die Textstelle, auf die er zeigte, las ich so: »Nun begab sich der ältere jener beiden Brüder, Harold, von schicklichem Charakter und voller Verwegenheit, auf eine Wallfahrt nach Dänemark, von wo aus er sich wieder nach Hause nach Hjaltland (Zetland) begab und mit sich die liebreiche Thronda als seine Frau brachte, welche eine Tochter königlichen Geblüts aus Dänemark war. Und sein jüngerer Bruder Sweyn, welcher traurig und höflich war, jedoch den anderen an List bei Weitem übertraf, empfing ihn guter Dinge.
Doch bald darauf wurde Sweyn vor lauter Liebe zu Thronda, seines Bruders Frau, schwer krank. Und siehe, während der werte Harold an dem Bette weilte, in welchem Sweyn krank daniederlag, fügte Sweyn ihm einen gewaltigen Schlag mit einem Schwert zu, legte seine Hände ohne langes Zaudern in Fesseln und warf ihn auf den Grund eines tiefen Verlieses. Und weil Harold sich nicht höchstselbst der Herrschaft über Thronda, sein Weib, begeben wollte, schnitt ihm Sweyn beide Ohren ab und stach eines seiner Augen aus und ging nach etlichen solcher Torturen daran, ihn zu morden. Doch eines Tages zerriss der heldenhafte Harold seine Fesseln, umfasste seinen Widersacher, rang mit ihm, überwand ihn und entkam. Dennoch begann er zu taumeln, als er zum Somburg-Kopf gelangte, nicht weit vom Schloss entfernt, und obwohl er leichtfüßig war, konnte er nicht mehr weiterlaufen, da er aufgrund der langen Foltern durch seinen Bruder geschwächt war. Und als er dort ohnmächtig lag, stieß sein Bruder auf ihn, und nachdem er ihn mit einem Pfeil verwundet hatte, warf er ihn vom Somburg-Kopf hinab ins Meer.
Nicht lange hiernach schenkte Thronda (obwohl sie weder die Weise kannte, in welcher ihr Herr zu Tode gekommen war, noch wirklich wusste, ob er tot war oder lebte) Sweyn ihre Gunst und wurde unter großem Prunk und dem Klang tönenden Blechs (Trompeten) seine Frau. Und kurz darauf gingen beide fort, um sich fortan an fernen Orten aufzuhalten.
Nun ereignete es sich, dass Sweyn durch einen Traum bestimmt wurde, ein großes Haus in Hjaltland für die heimkehrende Lady Thronda errichten zu lassen; zu diesem Behufe bestellte er einen gewitzten Baumeister und sandte ihn nach England, um Männer für die Erbauung dieses starken Hauses zu werben, während er mit seiner Lady in Rom verblieb. Dann kam dieser Architekt nach London, doch auf dem Weg von dort aus nach Hjaltland ertrank er zusammen mit all seinen Mannen, allen und jedem.
Und nach der festgesetzten Zeit von zwei Jahren sandte Sweyn einen Brief nach Hjaltland, um zu erfahren, wie es um sein großes Haus bestellt war, denn er wusste nichts von dem Untergang des Architekten, und bald hernach erhielt er die Antwort, mit dem Haus gehe es gut voran und es werde auf der Insel Rayba errichtet. Doch dies war nicht die Insel, die Sweyn für das Gebäude ausersehen hatte, und er war voller Angst und fiel beinah vor Grauen tot um, denn vor sich in dem Brief sah er die Art der Handschrift seines Bruders Harold. Und dann sagte er in dieser Weise: ›Sicherlich lebt Harold, denn sonst wär’ dieser Brief von Geisterhand geschrieben.‹ Und ihm war viele Tage weh; er sah, dass dies ein todbringender Streich war.
Danach kehrte er nach Hjaltland zurück, um zu erfahren, wie es um die Sache stand, und dort war das alte Schloss auf dem Somburg-Kopf zusammengestürzt und eingerissen. Da packte Sweyn das Weh und er schrie: ›Um Jesu Gnade, was ist aus dem ganzen großen Haus meiner Väter geworden? O weh! Dieser gottlose Tag der Vorsehung!‹ Und einer der Leute erzählte ihm, dass eine Arbeiterschar aus fernen Landesteilen es abgerissen habe. Und er fragte: ›Wer hat ihnen das befohlen?‹, doch das konnte niemand beantworten. Dann sagte er wiederum: ›Ist mein Bruder Harold nicht noch lebendig? Denn ich habe seine Handschrift gesehen.‹
Und auch das konnte niemand beantworten. So ging er nach Rayba und sah dort das große Haus stehen, und als er es anschaute, sagte er: ›Dies hat sicherlich mein Bruder Harold errichtet, sei er nun lebendig oder tot.‹ Und dort weilten er und seine Dame und seine Söhne bis auf den heutigen Tag; deshalb ist das Haus erbarmungslos und ohne Gnade. Darum geht die Sage, dass auf alle, die dort leben, ein gottloser Wahnsinn und eine wollüstige Pein fällt und dass sie vermittelst der Ohren den Kelch der Raserei des ohrenlosen Harold trinken, bis die Zeit des Hauses beendet sein wird.«
Nachdem ich die Erzählung halblaut gelesen hatte, lächelte ich und sagte: »Das hier, Harfager, ist ein respektables Märchen vonseiten des guten Gascoigne, aber es hat das Aussehen einer unwesentlichen geschichtlichen Begebenheit.«
»Trotz allem ist es eine geschichtliche Begebenheit«, erwiderte er.
»Du glaubst das?«
»Das Haus steht fest gebaut auf Rayba.«
»Aber glaubst du wirklich, dass mittelalterliche Geister den Bau ihres Familienwohnsitzes überwacht haben?«
»Das sagt Gascoigne an keiner Stelle«, antwortete er, »denn ›mit einem Pfeile verwundet‹ zu werden, heißt nicht unbedingt zu sterben, und wenn er es damit sagen sollte, so weiß ich nichts davon.«
»Und was, Harfager, ist das für ein ›gottloser Wahnsinn‹, für eine ›wollüstige Pein‹, von der Gascoigne spricht?«
»Was fragst du mich?«, – er breitete seine Arme aus – »Was weiß ich? Ich weiß gar nichts! Ich bin im Alter von fünf Jahren von diesem Ort verbannt worden. Und doch klingt mir noch sein Schrei im Kopf. Und habe ich dir nicht von den Ängsten ererbten Verlangens und Widerwillens – auch in mir selbst – erzählt …?«
Wie auch immer, ich musste gerade damals nach Heidelberg gehen, und so versprach ich, ich würde als Kompromiss meine Abwesenheit kurz machen und mich ihm in wenigen Wochen wieder anschließen. Ich nahm sein niedergeschlagenes Schweigen als Zustimmung und verließ ihn bald danach.
Aber ich wurde in Heidelberg aufgehalten, und als ich zu unserem alten Haus zurückkehrte, fand ich es leer. Harfager war fortgegangen.
Es war zwölf Jahre später, dass mir ein Brief – ein ziemlich wilder Brief und ein schrecklich langer – in der Handschrift meines Freundes nachgeschickt wurde. Er war in Rayba abgestempelt. Der Handschrift zufolge war er in rasender Eile abgefasst worden, sodass ich nur umso mehr über die triviale Natur seines Inhalts erstaunt war. Auf der ersten halben Seite redete er von unserer alten Freundschaft und fragte, ob ich seine Mutter besuchen wolle, die im Sterben lag; der Rest des Briefes bestand aus einer Analyse des Stammbaums seiner Mutter, deren scheinbares Ziel es war, zu zeigen, dass sie eine echte Harfager und eine entfernte Cousine seines Vaters war. Dann fuhr er damit fort, dass er Stellung zu der großen Fruchtbarkeit seines Geschlechts nahm und behauptete, dass seit dem 14. Jahrhundert mehr als vier Millionen seiner Mitglieder gelebt hätten, von denen – wie er glaubte – nur noch drei übrig geblieben waren. Mit dieser Erklärung endete der Brief.
Davon beeinflusst reiste ich nordwärts, erreichte Caithness, ließ die stürmischen Orkneys hinter mir, erreichte Lerwick, und von Unst aus, der kahlsten und nördlichsten Insel Zetlands, brachte ich es mittels Bestechungsgeldern fertig, die Wettertauglichkeit eines ›Sechser‹-Seglers (identisch mit den ›Langschiffen‹ der Wikinger) gegen eine rollende See und einen hässlichen Himmel auszuspielen. Mir wurde gesagt, dass diese Reise zu einer solchen Jahreszeit ein gewisses Risiko bedeute. Es war der typische düstere Dezember jenes Meeres, und sie sagten, das Wetter sei – obwohl niemals kalt – kaum je anders als stürmisch. Ein Nebel lag nun über den Wellen und schloss unser Boot in eine Kuppel aus trübseliger Dämmerung ein, und es lag etwas Geisterhaftes in dem Anblick der schweigenden See und des brütenden Himmels, der in mir die Stimmung einer Reise aus der Natur hinaus hervorrief, einer Kreuzfahrt hinter die Welt. Bisweilen aber kamen wir an einer jener ›Skerries‹ vorbei, jener Schären, deren schroffe Felswände, die durch die Kämpfe des Golfstroms mit der Nordsee zersetzt wurden, das Aussehen schrecklicher Ruinen und Verwüstungen hatten. Doch ich bemerkte nur drei von ihnen, denn bevor der graue Tag auch nur seinen halben Lauf genommen hatte, überfiel uns eine plötzliche Dunkelheit und mit ihr einer jener Stürme, aus deren ununterbrochener Abfolge der Winter dieser beinahe arktischen See besteht. Während der flüchtigen, wilden Ausblicke des nächsten Tages hörte der Regen nicht auf, doch bevor die Dunkelheit ganz herabgekommen war, hielt mein Kapitän inne (er redete unablässig mit einer Anzahl von Wassernixen, Wasserpferden und grülies) und wies auf eine Erhebung düstereren Graus an der Bugseite. Dies sollte Rayba sein.
Er sagte, Rayba sei der Mittelpunkt eines ziemlichen Nestes solcher rösts (Strudel) und Widerströmungen, welche die Flut mit verschlungenen Wirbelungen zwischen all die Inseln schleudert; doch vor Rayba tobten sie mit mehr als üblicher Wut, was sie der Reihe von Felsspitzen verdankten, die das Land rings wie eine Garnison umstanden. Daher war es zu jeder Zeit schwierig, sich Rayba zu nähern, und bei Nacht war es schlicht tollkühn. Mit einer günstigen Meeresströmung aber gelangten wir genügend nahe heran, um die Gischtmähne zu sehen, die den Küstenwall umgab. Ihr Anprall, so sagte der Kapitän, war oft wirksamer als eine ganze Artillerie, denn sie schleuderte Steinbrocken mehr als 200 Meter weit über das Eiland.
Als die Sonne das nächste Mal über den Horizont spähte, waren wir nahe an die Küste herangekommen, und es war zu diesem Zeitpunkt, dass mich zum ersten Mal der Eindruck einer Drehbewegung der Insel befiel – wahrscheinlich hervorgerufen durch die Wirbelungen des Wassers. Wir schafften eine Landung an einem voe, oder Meeresarm, an der Westküste – die Ostküste war, obwohl sie meinen Zielpunkt darstellte, wegen der Dünung außerhalb jeglicher Erwägung. Hier fand ich in zwei binsengedeckten skeos (oder Hütten) fünf oder sechs Seeleute, die sich ihren Lebensunterhalt mit dem Lebensmittelhandel für das große Haus im Osten verdienten. Ich nahm mir einen von ihnen als Führer und begann die Insel zu erklettern.
Nun hatte ich während der Nacht in dem Boot ein Dröhnen in den Ohren verspürt, für das selbst das Grollen der See rund um die Küste eine ungenügende Begründung zu geben schien, und nun, als wir vorangingen, verstärkte es sich erheblich – und mit ihm noch einmal meine innerliche Überzeugung drehender Bewegungen. Ich stellte fest, dass Rayba ein Land aus Granitklippen und Gneis war. Etwa in seiner Mitte aber erreichten wir eine Hochebene, die sich von West nach Ost neigte und von vielen Seen bedeckt war, die träge ineinanderflossen. Östlich von dieser Seenkette konnte ich keinen Strand erkennen, und mittels eines Gebrülls zu meinem Führer hinüber und einem Drehen des Ohrs in die Richtung seines Antwortbrüllens erfuhr ich, dass es keinen solchen Strand gab – ich sage Brüllen, denn nichts Leiseres konnte durch das ständige Gedonner wie von 10.000 Bisons dringen, das nun von allen Seiten widerhallte. Auch machte sich ein gewisses Zittern der Erde bemerkbar. Währenddessen suchte das Auge im trostlosen Überblick vergeblich nach einem Baum oder Busch, denn keine Art von Vegetation außer Torf konnte auch nur einen Tag dem ewigen Sturm auf diesem umnachteten Eiland trotzen. Eine halbe Stunde nach der Mittagszeit begann die Dunkelheit auf uns zu fallen, und kurz danach zeigte mein Führer hinab auf einen Hohlweg nahe der Ostküste und machte sich geschwind auf den Rückweg. Ich schrie ihm eine Frage hinterher, als er ging, doch nun hatten die Stimmen der Sterblichen aufgehört, auch nur im Geringsten hörbar zu sein.
Diesen Hohlweg ging ich mit sinkendem Herzen und einem einzigartigen Anfall von Schwindel hinunter, und als ich sein Ende erreicht hatte, trat ich auf einen Felsvorsprung hinaus, der unter den unmittelbaren Angriffen der See erzitterte; doch übrigens war dieser ganze Landesteil im Griff eines Fiebers, das nicht allein von den großen Kanonen des Meeres herrührte. Während ich zu meiner Standfestigkeit gegenüber den Windstößen vom Meer her eine Kliffspitze umarmte, starrte ich auf eine Landschaft, die nicht weniger schrecklich war als irgendein furchtbarer Bereich aus den Träumen Dantes. Drei ›Skerries‹, die von fantastischen und wie Hexenfinger verdrehten Felsen flankiert waren und Horden von Fischadlern, Robben und Walrossen als Zuflucht dienten, lagen in einigen Faden Entfernung; und von dem Gebraus in ihnen tobte die See in bleichem, aufgerührtem und doch unhörbarem Zorn gegen das Land. Ich ließ meine Felsspitze los und taumelte einige Schritte nach links.
Nun öffnete sich plötzlich ein Amphitheater vor mir, und meinem Blick erschloss sich ein Panorama von solch entsetzlicher Majestät, wie ich es mir nie hätte vorstellen können.
Ich sagte: »Ein Amphitheater«, doch was ich sah, besaß eher die Form einer normannischen Tür. Stellen Sie sich eine solche Tür vor, 800 Meter breit, flach am Boden, der gerundete Teil am weitesten vom Meer entfernt, und lassen Sie darum eine senkrechte Felsmauer sich etwa 40 Meter hoch auftürmen; und nun lassen Sie über diese gerundete Türform – und über ihre gesamte Ausdehnung – eine brüllende See ihre Tonnage in weißlicher Raserei rollen, und die Erstarrung, mit der ich daraufstarrte, und mein Zurückschrecken und dann mein Fluchtinstinkt werden Verständnis finden.
So ergossen sich die Lochs von Rayba ineinander.
Und innerhalb der Rundung dieses normannischen Kataraktes, gekleidet in die Welt seines Rauchs und seiner weit ausholenden Brandung, stand ein Gebilde aus Messing.
Die letzten Strahlen des Tages waren nun beinahe vergangen, doch durch den Nebel, der es wie in einen trüben Nimbus aus Tränen tauchte, konnte ich sehen, dass das Gebäude im Vergleich zu der Größe seines Umfangs niedrig war, dass es mit einer Kuppel gekrönt war und dass in ihm zwei Reihen normannischer Fenster umliefen, die oberen kleiner als die unteren. Gewisse Anzeichen ließen mich darauf schließen, dass das Haus auf einem Felsbett errichtet worden war, das rund und allein stehend innerhalb der Krümmung des Kataraktes lag, doch nirgendwo erhob sich dieses Bett über die Flut, denn der gesamte Boden, den ich vor mir hatte, war von einem tiefen dampfenden Fluss überflutet, der sich in das strandlose Meer ergoss. Der Zugang zu dem Gebäude war nur über eine massive erhöhte Bogenbrücke möglich, an der Seetang wie ein Bart hing. Ich stieg von meinem Vorsprung herab, ging über die Brücke und wurde von der Gischt durchnässt. Als ich näher kam, konnte ich sehen, dass auch das Haus bis zu halber Höhe dicker als ein alter Schiffsrumpf mit Kletten und einer Menge hellen Seegrases behangen war; und ich sah – zu meiner großen Überraschung –, dass von vielen Stellen nahe dem Dach der ehernen Wand massige Ketten wie triefende Bärte in Strahlen herabliefen, sodass das Gebäude den Anblick einer viel verankerten Arche besaß. Doch ich hielt nicht inne, um genauer hinzuschauen, sondern warf mich vorwärts und rannte durch den weichen Wasserfall, der vom Dach herunterströmte. Durch eines der vielen Portale betrat ich den Wohnsitz.
Dunkelheit umgab mich nun – und Geräusche. Ich schien im Mittelpunkt eines schreienden Planeten zu stehen; der Krach glich dem Widerhall Tausender Kanonen und wurde nur unterbrochen von seltsam schmetterndem und tosendem Lärm. Traurigkeit stieg auf mich herab; ich war den Tränen nahe. »Hier«, sagte ich, »ist der Ort der Tränen; nirgendwo sonst ist das Tal der Seufzer.« Dennoch ging ich durch eine Hallenflucht voran und fragte mich gerade, wohin ich mich als Nächstes wenden sollte, als mir eine scheußliche Gestalt mit einer Lampe in der Hand entgegenstampfte. Ich wich vor ihr zurück! Zuerst schien es mir das Skelett eines schmächtigen Mannes zu sein, das in ein Leichentuch gehüllt war, bis das Licht eines kleinen Auges und ein Film von Haut über einem Teil des Gesichts mich beruhigten. Indes besaß er keine Anzeichen von Ohren. Wie ich später erfuhr, war sein Name Aith, und seine Erscheinung erklärte er (wahr oder nicht) dadurch, dass er einmal eine Verbrennung erlitt, die beinahe zur Verkohlung geführt hatte, doch irgendwie habe er sich wieder erholt. Mit einem boshaften Ausdruck im Gesicht und aufgeregten Gesten führte er mich zu einem Zimmer im oberen Geschoss, wo er, nachdem er eine Wachskerze angezündet hatte, auf einen gedeckten Tisch wies und mich allein ließ.
Lange Zeit saß ich da in Einsamkeit und war mir bewusst, wie das Gebäude zitterte, obwohl jede Sinneswahrnehmung in dem alles beherrschenden Eindruck des Lärms unterging und von ihm verschluckt wurde. Wasser, Wasser war die Welt – ein Nachtmahr auf meiner Brust, ein Verlangen, nach Luft zu schnappen, ein Erzittern meiner Nerven, ein Gefühl, unendlich tief in grenzenloser Sintflut ertrunken und begraben zu sein; und als auch das Schwindelgefühl sich verstärkte, sprang ich auf und rannte umher – doch plötzlich hielt ich inne, verärgert über mich selbst, warum, wusste ich nicht. Tatsächlich hatte ich mich dabei überrascht, in einer gewissen Eile herumzulaufen, die für mich ungewöhnlich, ja unnatürlich ist. So zwang ich mich, stehen zu bleiben und die Halle zu betrachten. Sie war groß und nebelfeucht, sodass ihre abgerissene, aber reiche Möblierung verloren darin aussah. Ihr Mittelpunkt wurde von einem Grabmal eingenommen, das den Namen eines Harfager aus dem 14. Jahrhundert trug, und ihre Wände bestanden aus alten Eichenpaneelen. Nachdem ich in düsterer Stimmung diese Dinge gesehen hatte, wartete ich in einem unerträglichen Bewusstsein von Einsamkeit. Kurz nach Mitternacht teilte sich der Wandvorhang und Harfager kam in schnellem, steifem Gang herein. In den vergangenen zwölf Jahren war mein Freund alt geworden. Es stimmt, dass er eine Neigung zur Beleibtheit besaß, doch für ein wissendes Auge war er in Wirklichkeit ausgezehrt und unterernährt. Sein Hals stak nach vorn aus seiner Brust heraus, der untere Teil seines Rückens war altersbedingt ziemlich nach vorn gebeugt, und sein Haar umfloss sein Gesicht und seine Schultern in einer Ungezähmtheit schrecklicher Weiße, während ein fahler Kinnbart ihm auf die Brust hing. Seine Kleidung bestand aus einer Robe, die wie aus Seetang wirkte und die, als er ging, seine haarigen und nackten Schienbeine enthüllte. Er trug jene weichen Pantoffeln, die man rivlins nennt.
Zu meinem Erstaunen begann er zu reden. Als ich inbrünstig rief, dass ich nicht einmal den Bruchteil eines Geräusches aus seinem sich bewegenden Mund verstehen konnte, schlug er mit beiden Handflächen an seine Ohren und bestürmte mich dann wieder von Neuem, doch abermals ohne Ergebnis, und dann nahm er mit einer ärgerlichen Handbewegung seine Kerze auf und verließ den Raum.
Es lag etwas auffallend Unnatürliches in seiner Art – etwas, das mich an das Skelett mit dem Namen Aith erinnerte: ein Übereifer, ein Fieber, eine Raserei, eine Lautheit, eine Ungeduld in der Haltung, eine Übertreibung der Gesten. Seine Hand schleuderte beständig Haarsträhnen aus seinem Gesicht, das, obwohl es das Safrangelb des Todes besaß, doch rote Augen hatte – dicklidrige Augen, die in einem Blick nach unten und zur Seite fixiert waren. Als er zu mir zurückkam, hatte er ein elfenbeinernes Täfelchen und ein Grafitstück in der Hand, das an einer um sein Gewand geschlungenen Kordel herabhing. Er schrieb hastig die Bitte auf, ich möge, wenn ich nicht zu müde sei, zusammen mit ihm an dem Begräbnis seiner Mutter teilnehmen.
Ich brüllte ihm meine Zustimmung entgegen.
Erneut schlug er mit seinen Handflächen gegen seine Ohren, dann schrieb er: »Brülle nicht: Nicht einmal ein Flüstern in irgendeinem Teil des Gebäudes ist für mich unhörbar.«
Ich erinnerte mich daran, dass er früher in seinem Leben leicht schwerhörig gewesen war.
Wir gingen zusammen durch viele Zimmer, wobei er die Kerze mit seiner Hand beschirmte – eine notwendige Handlung, denn wie ich schnell herausfand, war die Luft in keinem Winkel des erzitternden Gebäudes im Zustand der Ruhe, sondern sie wurde immerwährend von einer seltsamen Erschütterung in Bewegung gehalten, von schwachen Winden, wie Echos von Stürmen, die den Vorhängen ein allgemeines Zittern bescherten. Überall traf ich denselben vergangenen Glanz an sowie gegenwärtige Verwahrlosung und Fäulnis. In vielen der Räume standen Grabmale, ein Zimmer war ein mit Bronzen bevölkertes Museum; sie waren zerbrochen, von Pilzen überwuchert, und troffen vor Feuchtigkeit – es war, als ob das Haus vor Arbeitseifer schwitzte, und ein Miasma von Zerfall vergiftete die ganze Luft.
Ich folgte Harfager auf seinem labyrinthischen Weg mit einiger Schwierigkeit, denn er ging geradezu überstürzt und hielt nur einmal an. Über dem grellen Glanz des Lichtes wirkte sein Gesicht plump und wild. Er warf seine Finger hoch und gab ein einziges Wort von sich. Aus der Form seiner Lippen schloss ich auf das Wort »Horch!«.
Alsbald betraten wir eine sehr lange Kammer, in der auf Stühlen neben einem Bett ein Sarg aufgebahrt war, welcher von einer Kerzenreihe flankiert wurde. Der Sarg war sehr tief und besaß die folgende Absonderlichkeit: Der Fußteil fehlte, sodass die Sohlen des Leichnams sichtbar wurden, als wir an ihn herantraten. Auch sah ich drei aufrecht stehende Stäbe, die an der Seite des Sarges befestigt waren. Jeder Stab trug an seiner Spitze eine kleine silberne Glocke von der Art, welche morrice genannt wird; sie hingen von einer beweglichen Feder herab. Und am Kopf des Bettes stampfte Aith innerhalb einer engen Fläche jähzornig hin und her.
Harfager stellte die Kerze auf einem Steintisch ab und stand mit einer verrückten Aufmerksamkeit über den Körper gebeugt da. Auch ich stand still und schaute den Tod an, der so erbarmungslos und rau war, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Der Sarg schien drohend voll mit wirren grauen Locken; die Tote war von hohem Alter, knochig und hakennasig, und ihr Gesicht erzitterte in stiller Übereinstimmung mit dem Erbeben des Gebäudes. Ich bemerkte, dass über dem Körper drei Bögen angebracht waren, wie die Bögen einer Geige; ihre Enden passten in Vertiefungen an den Seiten des Sarges; und sie waren so gebogen, dass sie sich der Wölbung der beiden Sargdeckelhälften anschmiegten, wenn diese geschlossen waren. Einer dieser Bögen führte über die Knie der toten Dame, ein anderer überwölbte ihren Bauch, der dritte ihren Hals. In jedem von ihnen befand sich ein Loch, und durch jedes dieser Löcher führte ein Draht von den Silberglocken über ihnen – so wurden die drei Löcher durch die drei gespannten Drähte in sechs Halbkreise unterteilt. Bevor ich die Bedeutung von alldem erraten konnte, schloss Harfager die klappbaren Sargdeckel, die ebenfalls kleine Löcher besaßen, durch welche die drei Drähte liefen. Dann drehte er den Schlüssel im Schloss herum und brachte ein Wort hervor, das ich als »Komm« deutete.
Aith packte nun den Griff am Kopfende des Sarges, und aus den dunklen Gefilden der Halle heraus schritt eine Dame in Schwarz heran. Sie war groß, bleich, von beeindruckendem Anblick; und aus dem Schwung ihrer Nase und ihren runden Ohren erriet ich, dass sie Lady Swertha war, die Tante Harfagers. Ihre Augen waren recht rot – ob es vom Weinen herrührte, konnte ich nicht sagen. Indem Harfager und ich je einen Griff nahe dem Fußende des Sarges packten und die Dame einen der schwarzen Kerzenhalter vor uns hertrug, begannen die Trauerfeierlichkeiten. Als ich zur Tür kam, bemerkte ich dort in einer Ecke zwei weitere Särge, in welche die Namen Harfagers und seiner Tante eingraviert waren. Nun wanden wir uns eine breite Treppe hinab, die zu einem tieferen Geschoss führte, und von dort aus stiegen wir über schmale bronzene Stufen noch weiter hinunter und kamen zu einem Portal aus Metall, an dem die Dame den Leuchter absetzte und uns verließ.
Die Kammer des Todes, in welche wir den Leichnam jetzt trugen, wurde von der bronzenen Außenwand des Gebäudes begrenzt, und zwar an der Stelle, wo diese dem Katarakt am nächsten stand; sicherlich war sie von der Welt der Wellen draußen überschwemmt, weshalb die Erschütterungen hier noch stärker waren. Auf jeder Seite war das Gelass mit Särgen vollgestapelt, die hoch und breit in Regalen aufgereiht standen, und das mächtige Gespringe und Umhergehüpfe, das auf unser Eintreten folgte, erwies es als Paradies für ganze Armeen von Ratten. Da es undenkbar war, dass sie sich einen Weg durch eine Bronzemauer von fünf Metern Dicke gebissen hatten – denn hier war sogar der Boden ehern –, nahm ich an, dass irgendein fruchtbares Pärchen in diesem Haus zur Zeit seiner Erbauung eine archengleiche Zuflucht vor dem Wasser gefunden haben musste. Doch auch diese Vermutung schien unsinnig; und Harfager vertraute mir später seinen Verdacht an, dass sie aus irgendeinem Grund von den ursprünglichen Erbauern dort angesiedelt worden waren.
Wir ließen unsere Last auf einer Steinbank im Mittelpunkt des Raumes nieder, worauf Aith sich beeilte fortzukommen. Dann wanderte Harfager wiederholt von einem Ende des Gelasses zum anderen, wobei er unter häufigem Bücken und Spähen und Strecken die Regale und ihre Verankerungen überprüfte.
Ich fragte mich, ob er irgendwelche Zweifel an ihrer Standfestigkeit hatte. Tatsächlich war alles von Dampf und Fäulnis durchdrungen. Ein Stück Holz, das ich berührte, zerbröselte unter meinem Daumen zu Staub.
Er winkte mich schließlich heran, und mit nur einem einzigen Halt und einem »Horch!« von seinen Lippen liefen wir durch das Haus zu meinem Zimmer, wo ich allein gelassen umherrannte, aufgeregt von vagem Zorn; schließlich taumelte ich in einen qualvollen Schlaf.
Im tiefen Inneren des Hauses erhellte nicht einmal der trübe Tag dieses Landes der Trostlosigkeit unsere Düsternis; doch ich konnte mein morgendliches Aufstehen nach einer Uhr regulieren, die in meinem Zimmer stand; manchmal wurde ich auch von Harfager geweckt, mit dem ich in kurzer Zeit mehr als unsere frühere Freundschaft erneuerte. Dass ich mehr sage, klingt merkwürdig, aber so war es: Und dies wurde durch die Tatsache bewiesen, dass wir uns Freiheiten in unseren Gesprächen und unserem Verhalten herausnahmen und entschuldigten, welche wir als zwei Personen von mehr als üblicher Zurückhaltung niemals untereinander zu begehen gewagt oder auch nur davon geträumt hätten. Während wir uns einmal zum Beispiel in zielloser Hast auf einem Weg durch Korridore befanden, die in Schatten und perspektivisch verzerrten Fernen verschwanden, schrieb er, dass mein Schritt sehr langsam sei. Ich entgegnete, dass es ein Schritt sei, der genau meiner augenblicklichen Stimmung entspreche. Er schrieb: »Du hast eine Neigung zum Verdruss entwickelt.«
Ich war sehr beleidigt und sagte: »Es gibt sicherlich mehr Füße in der Welt als einen, die sich diesen Schuh anziehen können!«
Eines anderen Tages war er regelrecht schroff zu mir, als er von mir den Grund für die unmenschliche Schärfe seiner – und meiner! – Ohren zu erfahren trachtete. Denn zu meinem Entsetzen begann auch ich mit der Zeit, Andeutungen brüllender Laute zu vernehmen. Ich redete mir ein, dass der Grund dafür in einer Entzündung des Hörnervs lag, welche, auch wenn es den Katarakt nicht gegeben hätte, bereits das Grollen des Meeres und das Rollen des ewigen Sturmes um uns hervorzubringen imstande gewesen sei; ich sagte, sein eigenes Ohrinneres müsse im höchsten Grade entzündet sein. Ihm gegenüber nannte ich die Krankheit ›Paracusis Wilisü‹. Als er seine Stirn in Widerspruch runzelte, fuhr ich recht unbeeindruckt fort, indem ich einen Fall aus meiner eigenen Erfahrung berichtete, bei dem eine sehr schwerhörige Frau das Fallen einer Stecknadel in einem Eisenbahnabteil hören konnte.3
Nun gab er zur Antwort: »Unter allen unwissenden Leuten pflege ich den reinen Wissenschaftler als den unwissendsten anzusehen!«
Doch ich für meinen Teil sah es als unglaubhaft an, dass er vorgab, im Hinblick auf den krankhaften Zustand seines Gehörs im Dunkeln zu tappen. Er selbst hingegen erklärte mir, seine eigene Anfälligkeit sowie die von Aith und der Lady Swertha rührten von Schwindelparoxysmen her. Ich war überrascht, denn kurz zuvor war ich selbst durch Gefühle des Schwankens und der Übelkeit aus dem Schlaf geweckt worden; und ich war zunächst sicher gewesen, dass der Raum mit mir in wilder Fahrt umherwirbelte.
Dieser Eindruck verging, und ich schrieb ihn – vielleicht übereilt – einer Störung in den Nervenenden des ›Labyrinths‹, also des inneren Ohres, zu. In Harfager aber hatte die Überzeugung, dass das Haus sich wirbelnd bewegte, einen so schrecklichen Grad an Gewissheit angenommen, dass ihre Auswirkungen manchmal denen des Wahnsinns oder der fanatischen Besessenheit glich. Er sagte, das Gefühl des Schwindels sei niemals in ihm abwesend und selten nur das Gefühl, dem zufolge er mit weit ausgestreckten Armen am Rande von Abgründen stehe, die seine halbwilligen Füße lockten. Einmal wurde er während des Gehens von unirdischen Kräften zu Boden geworfen und lag dort ausgestreckt und in Schweiß gebadet, mit verwirrter Blendung und Verwunderung im Blick, und starrte die wirbelnden Wände an. Überdies marterte ihn beständig das Bewusstsein von Lauten, die so einzigartig in ihrer Art waren, dass ich sie als nichts anderes als die Auswirkungen eines unendlich schlimmen tinnitus ansehen konnte. Er sagte mir, dass ihn durch das Brüllen hindurch manchmal das Schlaflied eines Vogels besuche, und aus der Bürde dieses Liedes erwuchs ihm die Vorstellung, dass der Vogel aus einem sehr fernen Land stammen musste, so weiß wie Schaum war und einen malvenfarbenen Kamm besaß. Oder er wusste von zusammenklingenden menschlichen Tönen, die fern, aber dennoch deutlich waren und eifrig in der Lautstärke miteinander konkurrierten und am Ende zu einem Durcheinander musikalischer Sätze verschmolzen. Und bald erschrak er vor einem unendlich fernen und drohenden Krachen, das wie der monströse Lärm des Zerbrechens eines ganzen Weltalls voller Töpferwaren in seinen Ohren klang.
Ferner erzählte er mir, dass er regelmäßig die bunten Räder einer verschlungenen Sphärenmusik tief, tief in der Dunkelheit des brüllenden Kataraktes eher sehen denn hören konnte. Diese Eindrücke, bei denen ich einwandte, sie müssten rein entotisch sein, besaßen manchmal eine wohltuende Wirkung auf ihn, und er pflegte lange dazustehen und mit erhobener Hand ihren Verführungen zu lauschen; andere wiederum entzündeten in ihm einen wahnsinnigen Zorn. Ich vermutete, dass sie der Grund für jenes »Horch!« waren, das in Abständen von etwa einer Stunde aus ihm hervorbrach. Aber damit lag ich falsch und in zitterndem Entsetzen erfuhr ich bald die Wahrheit.
Denn als wir einmal durch eine eiserne Tür im Erdgeschoss schritten, hielt er inne und horchte einige Minuten lang mit einem höchst scharfen und listigen, argwöhnischen Blick. Sofort entfuhr ihm der Schrei: »Horch!«, und er drehte sich zu mir um und schrieb auf das Täfelchen: »Hast du es nicht gehört?«
Ich hatte nichts als das Brüllen von draußen gehört, und er schrie geradewegs in mein Ohr in Lauten, die jetzt für mich hörbar waren wie die Echos aus fernen Träumen: »Du wirst sehen!«
Er nahm den Kerzenleuchter auf, holte aus einer Tasche seiner Robe einen Schlüssel hervor, entriegelte die eiserne Tür, und wir traten in einen Raum, der im Verhältnis zu seiner Grundfläche sehr hoch und gewölbt war. Mit Ausnahme einer Leiter, die sich an seiner Wand erhob, war er völlig leer, und im Mittelpunkt seines marmornen Fußbodens befand sich ein Wasserbecken, wie ein römisches ›impluvium‹, aber rund wie der Raum selbst – ein Becken, das augenscheinlich unergründlich tief und voll von einer dicken und tintigen Flüssigkeit war. Ich war von seinem gegenwärtigen Anblick sehr verwirrt, denn als die Kerze seine Oberfläche beschien, bemerkte ich, dass diese vor recht kurzer Zeit in Aufruhr gebracht worden war, und zwar in einer Weise, für welche das Erzittern des Hauses nicht verantwortlich sein konnte, denn kleine, schleimige Wellen gingen nun von seiner Mitte zum Rand aus.
Als ich Harfager um eine Erklärung anstarrte, gab er mir ein Zeichen zu warten und lief dann etwa eine Stunde lang mit auf dem Rücken verschränkten Händen in dem Gemach umher; dann hielt er inne und wir standen beide am Rand des Beckens und blickten in das Wasser. Plötzlich griff er meinen Arm fester, und ich sah mit einem Anflug des Entsetzens einen kleinen Ball, möglicherweise aus Blei, doch durch irgendeine Chemikalie blutrot besudelt, von der Decke herabfallen und in der Mitte des Beckens versinken. Es zischte, als er das Wasser berührte, und ein Dunsthauch stieg auf.
»Im Namen aller dunklen Dinge: Was ist das?«, flüsterte ich.
Wieder bedeutete er mir durch ein geschäftiges und Vertrauen heischendes Zeichen, ich solle warten. Er zog die Leiter an das Becken heran und übergab mir den Leuchter. Als ich hochgestiegen war und das Licht weit über mich hielt, erblickte ich eine Kugel aus altem Kupfer, die im Dunst der Kuppel hing und durch ein Halsstück zur Ballonform verlängert war; an seinem Ende konnte ich ein winziges Loch entdecken. Auf die Kugel war kaum sichtbar in roten Druckbuchstaben gemalt:
»HARFAGER-HOUSE: 1389–188 .«
Ich war schneller wieder unten, als ich hochgestiegen war! »Aber was bedeutet das?«, keuchte ich.
»Hast du die Schrift gesehen?«
»Ja. Und ihre Bedeutung?«
Er schrieb: »Durch einen Vergleich von Gascoigne und Thrunster habe ich herausgefunden, dass das Haus um 1389 erbaut wurde.«
»Aber die letzten Zahlen …?«
»Hinter der letzten 8«, entgegnete er, »steht noch eine Zahl, die nicht ganz von einem Grünspanfleck verdeckt ist.«
»Was für eine Zahl?«, fragte ich.
»Man kann sie nicht lesen, sondern nur erraten. Da das Jahr 1888 fast vorüber ist, kann es nur die Zahl 9 sein.«
»Oh, dein Geist ist entartet!«, schrie ich verwirrt. »Du nimmst etwas an – du behauptest etwas – in einer Art, die kein Geist, der gelernt hat, seine Schlussfolgerungen auf Fakten zu gründen, ertragen kann.«
»Und du bist irrational«, schrie er. »Ich unterstelle, dass dir die Formel des Archimedes geläufig ist, wonach das Volumen einer Kugel bekannt ist, wenn man den Durchmesser kennt. Nun, ich weiß, dass der Durchmesser jener Kugel in der Kuppel eineinhalb Meter beträgt, und der Durchmesser der bleiernen Bälle etwa einen Zentimeter. Wenn man nun annimmt, dass 1389 die Kugel voller Bälle war, kannst du schnell überschlagen, dass nicht mehr viele der etwas mehr als vier Millionen vorhanden sind, die seitdem einmal in jeder Stunde herunterfielen. Das Fallen der Bälle kann nicht noch ein Jahr so weitergehen. Daher drängt sich uns die Zahl 9 auf.«
»Das nimmst du nur an!«, schrie ich. »Oh, glaube mir, mein Freund, das ist der Mutwille der Verruchtheit! Durch welche Algebra der Verzweiflung weißt du, dass jeder Ball einen der Sprösslinge deines Geschlechts darstellt, oder dass das letzte Datum mit dem Anhalten der Uhr zusammenfällt? Selbst wenn es so ist, was bedeutet das schon? Es kann keine Bedeutung haben!«
»Willst du mich verrückt machen?«, schrie er. Dann schrieb er rasend schnell: »Ich schwöre dir, dass ich nichts von dieser Bedeutung weiß. Aber ist es für dich nicht deutlich, dass dieses Ding ein großes Stundenglas und dazu da ist, nicht die Stunden eines einzelnen Tages, sondern die eines Zyklus zu zählen, und zwar eines Zyklus von 500 Jahren?«
Ich schrie leidenschaftlich: »Aber der ganze Apparat ist doch nichts als ein böses Trugbild unserer Gehirne! Wie wird der Fall der Bälle gesteuert? Ah, mein Freund, du fantasierst – dein Geist ist in diesem Krawall der Wasser verkommen.«
Er antwortete: »Ich habe nicht feststellen können, durch welche inneren Mechanismen oder klebrigen Mittel oder Spiralwicklungen, die in ihrer Funktionsweise vielleicht von der Vibration des Hauses abhängen, die Bälle in ihrem Fall zurückgehalten werden. Das ist etwas, das durchaus innerhalb des Könnens des mittelalterlichen Mechanikers, des Erfinders dieser Uhr, lag, aber es ist zumindest klar, dass eines der Elemente der Fallverzögerung die Winzigkeit der Öffnung ist, durch welche die Bälle hindurchmüssen, und dass dieses Element nicht länger funktionieren wird, wenn nicht mehr als drei Bälle übrig sind; und das bedeutet folglich, dass die letzten drei beinahe im gleichen Augenblick herunterfallen werden.«
»Um Himmels willen!«, rief ich aus, ohne mich darum zu kümmern, was für einen Unsinn ich da von mir gab. »Aber deine Mutter ist tot, Harfager! Willst du etwa leugnen, dass nur noch du und die Lady Swertha übrig sind?«
Ein Blick voller Verachtung war alles, was er mir darauf zur Antwort gab.
Aber einen Tag später gestand er mir, dass die bleiernen Tropfen eine stetige Pein für seine Ohren waren und dass er von Stunde zu Stunde heiß ihren Fall erwarte, dass er sogar aus seinem kurzen Schlaf bei jedem Niederfallen erwachte; dass, wo immer im Haus er auch war, sie ihn mit einer zerschmetternden Lautstärke fanden, und dass jeder Aufprall ihn mit stechendem Schmerz im Ohr zwickte. Ich war über seine Erklärung entsetzt, dass diese Tropfen nun der ganze Inhalt seines Lebens geworden und so eng mit dem Klang seines Geistes verbunden waren, dass das Ende ihres Fallens für ihn sogar den Zusammenbruch seines Verstandes bedeutet hätte. Bei diesem Geständnis schluchzte er und verbarg sein Gesicht, während er sich gegen eine Säule lehnte. Als der Anfall vorüber war, wollte ich von ihm wissen, ob es denn vollkommen unmöglich sei, dass er ein für alle Mal die Faszination der Uhr abschütteln und mit mir von diesem Ort fliehen könne. Er schrieb als rätselhafte Antwort: »Ein dreifaches Seil kann nicht so schnell reißen.« Ich hub an zu fragen: »Dreifach …?« Er schrieb mit einem bitteren Lächeln: »In den Schmerz verliebt sein – sich nach dem Leid sehnen –, ist das nicht ein gottloser Wahnsinn?« Ich begriff erstaunt, dass er unbewusst Gascoigne zitiert hatte! »Ein gottloser Wahnsinn!«
»Eine wollüstige Pein!«
»Du hast das Gesicht meiner Tante gesehen«, fuhr er fort. »Deine Augen sind schwach, wenn du in ihm nicht eine gottlose Ruhe gesehen hast, die Fröhlichkeit einer blasphemischen Geduld, ein Grinsen hinter ihrem dreisten Lächeln.« Dann sprach er von der Aussicht auf ein Grauen, vor dem seine ganze Seele zittere, und die dennoch manchmal in seinem Herz als Hoffnung lache. Es war die Aussicht auf ein merkliches Anschwellen der Lautstärke aller Geräusche um ihn herum. Wenn dies geschah, sagte er, müsse das Gehirn zusammenbrechen. In der Nacht meiner Ankunft hatten der Krach meiner Schuhe und seitdem meine bisweilen erhobene Stimme heftigen Schmerz in ihm ausgelöst. Ich glaubte ihn sagen zu hören, dass für ein solches Ohr der Genuss einer Tortur, die in einer erheblichen Lautsteigerung um ihn herum bestand, eine Verlockung war, welche keine menschlichen Vorzüge übersteigen könnten, und als ich sagte, dass ich mir eine solche Steigerung nicht einmal vorstellen könne und viel weniger noch die Mittel, durch welche sie bewirkt werden möge, holte er aus den Archiven des Hauses einige Annalen, die von den Oberhäuptern seiner Familie geführt worden waren. Diesen zufolge schien es so, als machten die Stürme, die andauernd die Gegend Raybas zerrissen, in Intervallen von einigen Jahren unweigerlich einem riesigen Wahnsinn Platz, einem Samson unter den lustigen Kerlen, einem Sirius unter den Sonnen. Zu solchen Zeiten fiel der Regen herab – und kamen die Fluten – wie bei der ersten Sintflut. Jene rösts, oder Wasserwirbel, die Rayba auf ewig umkreisten, verschmähten dann die Enge der Seitenarme, in denen sie für gewöhnlich umhertobten, brachen auf in Fontänenwirbel und tanzten über das kleine Eiland, auf dem einige von ihnen ineinanderflossen und ihr Wasser abluden, und jene Wellen, die in den Katarakt strömten, verdoppelten so dessen Masse und brachen sich mit vervielfachtem Brüllen.
Harfager sagte, es sei verwunderlich, dass ein solch großes Ereignis seit 18 Jahren nicht mehr über Rayba hereingebrochen war.
Ich fragte: »Und was ist zusätzlich zu den fallenden Bällen und der Aussicht auf eine Steigerung des Lärms der dritte Strang jenes dreifachen Seils, von dem du gesprochen hast?«
Als Antwort führte er mich zu einer runden Halle, von der er sich, wie er sagte, überzeugt hatte, dass sie den Mittelpunkt des kreisförmigen Gebäudes bildete. Es war eine sehr große Halle – ich glaube, eine so große hatte ich niemals zuvor gesehen. Sie war derart gewaltig, dass jener Teil der Wand, welcher von der Kerze erhellt wurde, nicht gebogen, sondern flach erschien. Beinahe ihr gesamter Raum wurde vom Boden bis zur Decke von einer Säule aus Messing eingenommen; der Raum zwischen der Wand und der Säule war nur so breit wie ein ausgestreckter Arm.
»Diese Säule«, schrieb Harfager, »führt hinauf zur Kuppel und noch darüber hinaus; sie führt zum Erdgeschoss und durch es hindurch und von dort aus zu dem bronzenen Boden der Grüfte und durch sie hindurch in das Steinfundament. Unter jedem Stockwerk dehnt sie sich aus und stützt so den Boden. Von welcher Art genau ist der Eindruck, den ich durch diese Beschreibung in dir hervorgerufen habe?«
»Ich weiß nicht«, antwortete ich und wandte mich von ihm ab, »stelle mir keines deiner Rätsel, Harfager; ich fühle einen Schwindel …«
»Gib mir trotzdem eine Antwort«, sagte er. »Denke an die Seltsamkeit dieses tiefsten bronzenen Bodens. Ich habe entdeckt, dass er etwa zwei Meter dick ist, und ich habe Grund anzunehmen, dass sein Untergrund ein wenig über dem Steinfundament liegt. Erinnere dich, dass der Bau an keiner Stelle an der Säule befestigt ist; denk an die Ketten, die von den Außenwänden herabhängen und anscheinend das Haus im Boden verankern. Sag mir, welchen Eindruck habe ich jetzt erweckt?«
»Ist es das, worauf du wartest?«, brüllte ich. »Es mag aber gar keine böswillige Absicht haben! Du ziehst voreilige Schlüsse! Jedes befestigte Haus in solch einem Land und an solch einem Ort ist der Gefahr ausgesetzt, von einem mächtigen Sturm zerschmettert zu werden. Was ist, wenn es die Absicht des Erbauers war, dass in einem solchen Fall die Ketten brechen sollen und das Haus dadurch, dass es nachgeben kann, gerettet wird?«
»Wenigstens mangelt es dir nicht an gutem Glauben«, erwiderte er, und dann kehrten wir zu dem Buch zurück, das wir gemeinsam lasen. Er hatte noch nicht die alte Gewohnheit des Studierens verloren, obwohl er sich nicht mehr dazu bringen konnte, sich zum Lesen hinzusetzen; deshalb pflegte er mit einem Band (der bisweilen zu Boden geworfen wurde) innerhalb des Scheins der Kerze umherzustapfen, oder ich las ihm vor, obwohl ich meine eigene Stimme nicht hören konnte. Aus einer Laune heraus fand sich im Inhalt der wenigen Bücher, die innerhalb der Grenzen seiner Geduld lagen, immer etwas Pikareskes oder geckenhaft Spekulatives: Quevedos ›Tacaño‹ oder das System des Tycho Brahe, vor allem aber George Hakewills ›Macht und Vorsehung Gottes‹. Eines Tages jedoch, als ich gerade vorlas, unterbrach er mich mit einem Satz, der damit in keinem Zusammenhang stand: »Was ich nicht verstehen kann, ist, dass du, ein Wissenschaftler, glauben solltest, das Leben höre mit dem Ende des Atmens auf«, und von diesem Augenblick an wechselte die Stimmung unserer Lesungen. Denn er führte mich zu den Krypten der Bibliothek im tiefsten Teil des Gebäudes und überwältigte mich Stunde nach Stunde in einem Furor des Triumphs mit Büchern, welche die Dauer des Lebens nach dem ›Tod‹ beweisen sollten. Was, so fragte er, sei meine Ansicht über Baron Verulams Beschreibung des toten Mannes, den man Worte des Gebets sprechen gehört hatte? Oder über das lebendige Innere des toten Gefangenen? Als ich meinen Unglauben ausdrückte, schien er überrascht und erinnerte mich an die Zuckungen toter Kobras, an das lange Schlagen eines Froschherzens nach dem ›Tode‹. »Sie ist nicht tot«, zitierte er, »sondern schlafet.« Die Vorstellung von Bacon und Paracelsus, dass der Urgrund des Lebens in einem Geist oder einer Flüssigkeit wohne, war für ihn der Beweis, dass eine solche Flüssigkeit ihrer Natur nach keiner plötzlichen