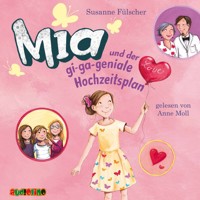Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gerade hat Sylvie ihr Examen bestanden, da konfrontiert ihr Dozent, Sylvies große Liebe, sie mit der knallharten Wahrheit: Es ist aus zwischen ihnen. Die Verletzung geht tief, denn Ablehnung ist etwas, das Sylvie von frühester Kindheit an von ihrem Vater erfahren hat. So nimmt sie sich jetzt vor, sich an den Männern dieser Welt zu rächen. Sie stürzt sich in ein chaotisches Liebesleben, ein Lover nach dem anderen wird belogen, betrogen und abserviert, sobald er mehr als nur »das eine« will. Karl, der dickliche Pornosynchronsprecher, der ewig jugendliche Fotograf Skip und Oskar, modischer Dandy und Hypochonder – sie alle werden zu willenlosen Figuren in Sylvies Rachespiel, das sie mehr und mehr auf die Spitze treibt. Eines Abends lässt sie sich sogar mit dem Liebsten ihrer besten Freundin Toni ein. Es kommt zum Bruch zwischen den beiden Frauen. Als Sylvie schließlich begreift, von welch unschätzbarem Wert die Freundschaft zu Toni war, ist es fast schon zu spät ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susanne Fülscher
Lügen & Liebhaber
Roman
Edel:eBooks
Copyright dieser Ausgabe © 2013 by Edel:eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg.
Copyright © 2000 by Susanne Fülscher
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-113-2
edel.comfacebook.com/edel.ebooks
Inhalt
Cover
Titelseite
Impressum
Das Buch
Lügen & Liebhaber
Das Buch
Gerade hat Sylvie ihr Examen bestanden, da konfrontiert ihr Dozent, Sylvies große Liebe, sie mit der knallharten Wahrheit: Es ist aus zwischen ihnen. Die Verletzung geht tief, denn Ablehnung ist etwas, das Sylvie von frühester Kindheit an von ihrem Vater erfahren hat. So nimmt sie sich jetzt vor, sich an den Männern dieser Welt zu rächen. Sie stürzt sich in ein chaotisches Liebesleben, ein Lover nach dem anderen wird belogen, betrogen und abserviert, sobald er mehr als nur »das eine« will. Karl, der dickliche Pornosynchronsprecher, der ewig jugendliche Fotograf Skip und Oskar, modischer Dandy und Hypochonder – sie alle werden zu willenlosen Figuren in Sylvies Rachespiel, das sie mehr und mehr auf die Spitze treibt. Eines Abends läßt sie sich sogar mit dem Liebsten ihrer besten Freundin Toni ein. Es kommt zum Bruch zwischen den beiden Frauen. Als Sylvie schließlich begreift, von welch unschätzbarem Wert die Freundschaft zu Toni war, ist es fast schon zu spät ...
Ich bin eine verhinderte Diva. Meine Mutter hat mal gesagt: Sylvie, deine Berufung ist es, den lieben langen Tag im Bett zu liegen und hofzuhalten. Das ist wahr. Zum Glück weiß es
Ich hatte gerade den letzten Teil der Frage zur Erotik in Heinrich von Veldekes »Eneide« beantwortet, schlug die Beine umständlich und in Zeitlupe übereinander, als Professor Weickel plötzlich nach Luft schnappte, das Japsen steigerte sich innerhalb von Sekunden zu einem gefährlichen Röcheln, und noch bevor der Prüfungsbeisitzer seine Lesebrille von der Nase nehmen konnte, kippte Weickel vom Stuhl und war tot.
Das war ein harter Schlag, zumal ich fürchtete, meine Prüfung wiederholen zu müssen. Aber ich hatte Glück. Schon ein paar Tage später teilte man mir schriftlich mit, die Prüfung sei anerkannt worden, auch wenn Weickel mich noch exakt viereinhalb Minuten hätte befragen sollen und es eigentlich auch nicht Rechtens sei, daß der Prüfungsbeisitzer allein die Note bestimme. Ich bekam nur eine Drei, was ich wahrscheinlich allein Weickels Ableben zu verdanken hatte. Denn welcher Prüfungsbeisitzer riskiert schon den Vorwurf, er habe die Studentin in Anbetracht eines derartigen Vorfalls bevorzugt? Aber es spielte keine Rolle. In der Endnote kam ich so oder so auf eine Zwei, und außerdem war ich ab sofort frei. Erlöst von spartanischen Seminarräumen, Kaffee aus Plastikbechern und vor allem von Germanistikstudentinnen mit chronischer Logorrhöe.
Abends hatte ich noch eine Idomeneo-Vorstellung hinter mich zu bringen, den Rest der Nacht betrank ich mich mit meiner besten Freundin Toni, Ankleiderin an der Oper, und dem schwulen Requisiteur Bernd im »Abendmahl«. Wie viele andere Abende auch. Nichts Spektakuläres. Nicht mal ein Flirt sprang dabei heraus. Am nächsten Morgen buchte ich genauso kurz entschlossen wie verkatert einen Flug nach Madrid, um mich dort – immerhin begann ein neuer Lebensabschnitt – für rund 20 000 Peseten im »Gran Hotel Reina Victoria« einzuquartieren und schon am Nachmittag meinen Kopf auf der Plaza Mayor einer wunderbar warmen Frühjahrssonne entgegenzurecken. Kurz dachte ich an den armen Schurken Weickel, der quasi gleichzeitig mit mir von all dem Uni-Mief befreit worden war, aber bevor ich noch sentimental wurde, schob ich den Gedanken an meinen Lieblings-Mediavistik-Prof beiseite, denn schließlich bezahlte ich nicht umsonst so ein teures Hotel: Ich hatte Wichtiges zu tun, sprich, die schwierige Aufgabe, den verbleibenden Rest meines Lebens zu organisieren. Manche ließen sich in meinem Zustand einfach M.A. auf ihre Visitenkarten drucken – vielleicht beruhigte sie das –, aber ich fand, so einfach lagen die Dinge nun wirklich nicht.
Als erstes würde ich Adriano die Pistole auf die Brust setzen. Immerhin hatte ich ihm die letzten Monate meines Studentenlebens geopfert. Dozent für Germanistik, beheimatet im vierten Stock des Philosophenturms, den Gang vor der Bibliothek ganz runter, vorletzte Tür auf der rechten Seite. Vor knapp einem halben Jahr hatte er mich in der windgebeutelten Cafeteria im Parterre angesprochen, wo ich gerade einen randvollen Kaffeebecher zu einem der Stehtische balancierte (»Achtung! Da schwappt gleich was über!«), achtundvierzig Stunden später reihte ich mich in die Heerschar seiner Gespielinnen ein, aber schon innerhalb von zwölf Wochen sägte er all meine Konkurrentinnen ab, und ich avancierte zu seinem Augenstern, zum Mittelpunkt seiner manchmal überbordenden Gefühle. Ich auf Platz eins – er nahm sogar das Wort Liebe in den Mund. Das fand ich klasse, zumal ich wegen des Typen einen ziemlichen Aufwand betrieb. Wechselte die Bettwäsche wöchentlich, rasierte mir trotz Reizhaut täglich die Beine und füllte den Kühlschrank mit ekelerregenden Dingen wie Margarine und Halbfettkäse, weil der Herr Dozent auf seine Figur achtete. Adriano, der eigentlich Klaus Arndt hieß.
Blieb nur die Frage, warum es in den letzten Wochen irgendwie mau zwischen uns geworden war. Nicht daß mein Enthusiasmus nachgelassen hatte, keinesfalls, aber wie sollte ich es finden, daß Adriano so wenig Zeit für mich hatte – hier ein Kongreß, da eine Seminarvertretung –, und wenn wir uns doch mal trafen, schien er nicht richtig bei der Sache zu sein, sprach mit mir, indem er durch mich hindurchsah, oder verzichtete gleich aufs Sprechen.
Liebe – Scheiße, ja, es hatte mich erwischt, auch wenn es sonst nicht meine Art war, Hals über Kopf in ernsthafte Liebesgeschichten zu stolpern, bei denen Gefahr drohte, nicht ohne Verletzungen wieder herauszukommen. Aber gut, Adriano war nicht umsonst der schärfste Mann am Institut. Fünf Jahre lang hatte ich ihn angehimmelt, ein Seminar nach dem anderen bei ihm belegt, ohne auch nur im entferntesten zu glauben, er könne an mir, der kleinen Studentin, Interesse haben. Adriano umschwebte eine Aura des Geheimnisvollen, man munkelte, er habe einen ziemlichen Frauenverschleiß, und dann, kurz vor Studienabschluß, plötzlich das …
Natürlich wollte ich mein Glück jetzt auch behalten, und da Adriano sowieso nie zu Hause zu erreichen war, beschloß ich, ihn demnächst in seinem Dozentenzimmer aufzusuchen.
Doch Klaus Arndt alias Adriano war noch das geringere Problem. Viel mehr litt ich darunter, daß ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich nun mit meinem Leben anstellen sollte. Natürlich fühlte ich mich zu Höherem berufen, keine Frage, aber wie sollte dieses Höhere aussehen? Promovieren und mit dreiunddreißig als Spezialistin der Gottfriedschen Minnegrotte ins Leben treten? Oder das Übliche anpeilen, Zeitung, Volkshochschule, Kulturinstitut, Werbung … Ich hatte keinen blassen Schimmer. Die meisten Berufe bedeuteten mir nicht mehr als aneinandergereihte Buchstaben, von denen zudem etwas schrecklich Bedrohliches ausging. Geld verdienen um jeden Preis – nein danke.
Erst trank ich einen frisch gepreßten Orangensaft, dann ein Glas Rotwein, schließlich einen Kaffee, der genauso säuerlich wie in der Opernkantine schmeckte und mich darauf brachte, daß ich nach nunmehr sieben Jahren Statistenkarriere nicht mehr sonderlich erpicht drauf war, als putzige Dirne den Chorsängern den Kopf zu verdrehen oder zum Neutrum verunstaltet und mit Haferflockenbrei im Haar über die Bühne zu kriechen. Aber da die Oper zur Zeit meine einzige Einnahmequelle war – mein Großverdiener-Professoren-Dad hatte seinen monatlichen Zuschuß eingestellt – und ich darüber hinaus mein letztes Gespartes gerade für zwei sündhaft teure Hotelnächte ausgab, würde mir wohl nichts anderes übrigbleiben, als mich weiterhin in Korsetts zu zwängen, mir Glatzen kleben zu lassen und – wenn es die Rolle erforderte – auf der Bühne zu kopulieren.
Am frühen Abend, als die Sonne immer noch die Plaza Mayor erleuchtete, brach ich auf und spazierte auf einem kleinen Umweg ins Hotel, um mich endlos lange unter die Dusche zu stellen. Kaum hatte ich einen Rest Zitruskörpermilch auf Oberkörper und Beinen verteilt und, damit die Cremereste nicht meine Ausgehkleidung besudelten, mein Nacht-T-Shirt übergezogen, klopfte es an die Tür, und ein mißmutig dreinschauender Page überreichte mir ein Fax, auf dem das Wort »Urgent« stand. Ich bedankte mich bei dem muffeligen Kerl und drückte ihm zur Strafe ein Zweipfennigstück in die Hand. Neugierig faltete ich das Fax auseinander.
»Chou-Chou. Wieso bist Du so Hals über Kopf weggefahren? Wir sollten feiern! Tragisch, das mit Weickel. Schampus steht trotzdem kalt. Erwarte Dich. Dein A.«
Woher wußte mein A. überhaupt, in welchem Hotel ich steckte? Mehrfach hatte ich ihn gefragt, ob er nicht nach meinem Examen mit mir nach Madrid fahren wolle, aber immer hatte er abgelehnt. Zuviel Arbeit. Außerdem verreise er nicht gern mit seiner Freundin, denn – so sein Credo – das sei meistens der Anfang vom Ende.
Ohne einen weiteren Blick auf das Fax zu werfen, zerknüllte ich es und warf es in den Abfalleimer zu einem benutzten Tampon und der Duschhaubenverpackung. Dort war es bestens aufgehoben.
In dem Bewußtsein, mit einem ziemlichen Idioten zusammenzusein, ging ich auf den Balkon und schaute runter auf die Plaza Santa Ana, wo die vielen Menschenstimmen zu einem rhythmischen Gemurmel und Summen anschwollen, bevor sie in den Himmel entfleuchten; ab und zu hupte ein Auto. Die Stadt gefiel mir. Sie war quirlig und laut, ein explosives Gemisch ohne jeden provinziellen Touch.
Auf einmal konnte ich es nicht mehr abwarten rauszukommen. Ich zog mich schnell an, band mir die Haare im Nacken zusammen und verließ mit dramatisch rot angemalten Lippen das Hotel. Obwohl die Sonne mittlerweile irgendwo zwischen den zahlreichen Barockbauten untergegangen war, umsäuselte mich die Luft hochsommerwarm.
Im großen Stil essen zu gehen, hatte ich keine Lust. Also schlug ich mich hinter der Plaza Santa Ana links in eine Gasse, passierte ein paar Restaurants, bevor ich in eine weitere Seitenstraße bog und dort eine Tapas-Bar fand, in der eine Geburtstagsrunde lärmte. Am Nebentisch lauter junge, grellgeschminkte Frauen, von denen sich einige fischige Häppchen in den Mund schoben und mit Bier nachspülten.
Das war genau das, was ich jetzt brauchte. Allein unter Menschen sein, ein bißchen essen und trinken, ohne daß Toni über ihre Kinderlosigkeit jammerte oder Bernd von der Hinteransicht seines neuen Schwarms berichtete.
Im Zentrum des Lokals zwischen Geburtstagsrunde und den Frauen war noch einer der ramponierten Holztische frei. Da ich kein Spanisch verstand, erschloß sich mir die Speisekarte nicht ohne weiteres, und weil ich darüber hinaus keine Lust auf komplizierte Diskussionen mit dem Kellner hatte, bestellte ich Calamares, Patatas fritas und einen Ensalada, die drei einzigen Gerichte, die ich kannte, dazu Bier wie die Leute um mich herum.
Zwei Stunden hielt ich mich in der Bar auf, ich aß, schaute neidisch auf die türkisfarbenen Satin-Slingpumps einer Schönheit am Nebentisch und lauschte den hart dahingelispelten Lauten der Spanier, und als ich die Rechnung verlangte, setzte sich ein Typ mit Igelfrisur an meinen Tisch. Erst stierte er mich an, ein wenig meschugge, dann wollte er mir in gestottertem Englisch eine Unterhaltung aufzwingen. Ihn interessierten meine Befindlichkeit (sehr gut), mein Name (ging ihn nichts an), mein Alter (ging ihn ebenfalls nichts an), Hotel (schon gar nicht), und da ich mich weder für seine Befindlichkeit noch für sein Alter, Domizil oder seinen Namen interessierte, marschierte ich, nachdem ich bezahlt hatte, einfach nach draußen. Leider machte der Kerl den Fehler und folgte mir. Ich fauchte ihn auf englisch an, er solle mich in Ruhe lassen, aber da er nicht hören wollte und sogar noch so weit ging, mich am Arm und schließlich an der Hüfte zu packen, drehte ich mich kurzerhand um und schleuderte ihm mit voller Wucht meinen Lederrucksack ins Gesicht, woraufhin er zu taumeln anfing. Die Leute guckten, außer sich beschimpfte mich der Typ in seiner Muttersprache, aber ich ging einfach weiter. Schnellen Schrittes und mit klackenden Absätzen.
Erst als ich im Foyer des Hotels war, bemerkte ich, wie sehr meine Beine zitterten. Der Spanier war einen Kopf größer als ich gewesen, dazu nicht gerade von leptosomer Statur. Gut und gern hätte er über mich herfallen können. Mit einer plötzlich phobischen Angst vor kleinen, geschlossenen Räumen ließ ich den Fahrstuhl links liegen und stiefelte die vier Stockwerke zu Fuß nach oben, und auch als ich mich schon in meinem Zimmer eingeschlossen hatte, fühlte ich mich nicht wirklich sicher. Ohne im Zimmer Licht zu machen, tapste ich auf den Balkon und schielte über die Brüstung auf die Plaza Santa Ana. Die Menschen wuselten immer noch durcheinander, es war albern, was ich tat, bestimmt standen zwanzig Männer mit seiner Physiognomie auf dem Platz, ganz abgesehen davon, daß ich für ihn sowieso nicht zu sehen sein würde.
Einigermaßen beruhigt legte ich mich ins Bett, ließ das Murmeln des Platzes auch in meinen Schlaf, doch als ich am nächsten Morgen aufwachte, merkte ich, wie sehr ich Adriano vermißte. Warum konnte ich nicht wie tausend andere Frauen auch mit meinem Geliebten diese Stadt entdecken? Wieso, zum Teufel, war es mir nicht vergönnt, eine stinknormale Beziehung zu führen?
Das Frühstück im Hotel ließ ich ausfallen, Statt dessen aß ich eine Brioche in einer Bar und trank dazu zwei café con leche. Heute stand der Prado auf dem Plan – Hieronymus Bosch und Konsorten wollte ich einen kleinen Besuch abstatten.
Ich brauchte gerade mal fünf Minuten zu Fuß zum Museum. Da Sonntag war und alle Nationalmuseen freien Eintritt hatten, wurde ich, ohne erst lange anstehen zu müssen, mit einer Gruppe Japaner in den Bau geschoben. Eigentlich mochte ich keine Monumentalmuseen. Man hetzte von Bild zu Bild, drängelte und schubste, und irgendwann verschwammen die Bilder zu einem einzigen Brei aus Farben und Motiven. Also studierte ich erst einmal den Übersichtsplan, schob mich dann an Goya und Velázquez vorbei in den El-Greco-Saal, wo ich mich an dessen übersteigerten Rot-, Grün-, Blau- und Gelbtönen satt sah, um dann mein Endziel, Hieronymus Boschs »Der Garten der Lüste«, anzusteuern. Das Triptychon hatte als Poster in der WG eines meiner Exfreunde gehangen und war eines der bemerkenswertesten Bilder, die ich je gesehen hatte. In natura war dann alles noch viel imposanter. Ich weidete mich bald eine Stunde an dem rechten Außenflügel, der Hölle, entdeckte zum ersten Mal in dem zurückblickenden Gesicht Hieronymus Bosch selbst, und während ich noch überlegte, ob nicht möglicherweise irgendwo ein Schuhgeschäft geöffnet hatte, damit ich mir ein paar nette Slingpumps kaufen konnte, stellte sich ein Mann mittleren Alters neben mich und schielte mich von der Seite an. »Oh yeah, the deep drives of the flesh …«, ließ er verlauten, woraufhin ich mich schnellstens aus dem Staub machte. Ich hatte genug gesehen und wollte keinen Mann, der mir – in welcher Sprache auch immer – ein Gespräch aufzwang.
Draußen war die Luft schon wieder badewannenwasserwarm. Mit dem Stadtplan in der Hand arbeitete ich mich bis zur Fußgängerzone vor, um erst mal in einem Café französischer Prägung einen ziemlich starken Kaffee zu trinken. Den Rest des Tages brachte ich damit zu, die Stadt zu durchwandern, immer auf der Suche nach Inspiration und Schuhen – nichts von alldem fand ich –, und als ich gegen Abend meinen Aperitif auf der Plaza Mayor trank, hielt ich es wirklich für angebracht, endlich mein Leben zu planen. Leicht angeduselt teilte ich eine Serviette in zwei Teile. Auf den einen Teil schrieb ich eine realistische Einschätzung meiner Situation (weiter an der Oper jobben, etwas anderes jobben, Doktorvater suchen, Volontariat anpeilen, mich nicht mehr in unnütze Männergeschichten verstricken …), auf den anderen reizvolle Spinnereien (etwas Großartiges tun, mir und der Menschheit einen Dienst erweisen, eine Erfindung patentieren lassen, Nobelpreis bekommen …). Dann trank ich einen zweiten Aperitif und war um so mehr der Meinung, daß ich den ersten Teil der Serviette einfach vernichten sollte. Was ich dann auch tat. In tausend Stücke reißen und ab damit in den Aschenbecher. Teil zwei zerknüllte ich und stopfte ihn, bevor ich essen ging, in die Hosentasche.
Als ich am nächsten Morgen in aller Herrgottsfrühe auf meinen Flieger wartete und den Zettel wieder hervorkramte, fand ich, daß ich wohl nicht mehr ganz bei Trost war und die Reise zumindest in Hinblick auf meine Lebensplanung rein gar nichts gebracht hatte.
Dann wurde zum Glück schon mein Flug aufgerufen, ich stieg ins Flugzeug, und kaum hatte ich mein Handgepäck verstaut und mich festgeschnallt, quetschte sich ein pausbäckiger Typ neben mich, den ich erst für einen Spanier hielt, der dann aber mit der Stewardeß feinstes Berlinerisch sprach und vermutlich noch nicht mal spanische Vorfahren hatte. Ohne daß ich ihn darum gebeten hatte, reichte er mir seine Hand und stellte sich mir vor. Karl Armknecht. Und ohne daß ich so freundlich war, mich ebenfalls vorzustellen, begann er eine Unterhaltung über die Flugzeugkost, die seiner Ansicht nach erbärmlich war, besonders auf der Strecke Hamburg–Madrid – das einzig vernünftige Menü sei ihm mal auf einem Flug nach Rom serviert worden.
»Fliegen Sie nur, um schlecht zu essen?« fragte ich, weil das Flugzeug startete und ich mich von meiner Angst ablenken wollte.
»Ich will nicht schlecht essen, nur weil ich fliege«, konterte Karl Armknecht, ohne seinen Blick von mir zu lassen.
Das Flugzeug hatte gerade abgehoben und seine Räder eingezogen, ein Moment, der mir grundsätzlich die Sprache verschlug. Man hing in der Luft, konnte nicht mehr zurück, weder aussteigen noch den Piloten dazu bringen, die verdammten Räder wieder auszufahren. Also mußte man sich dem unvorstellbaren Gedanken ergeben, daß es diese Riesenkiste mit Dutzenden von Passagieren, Gepäck und Getränkewagen entgegen aller Wahrscheinlichkeit schaffte, sich weiter in die Luft zu erheben.
Sie schaffte es. Ich schaute nach draußen und fragte mich, warum ich eigentlich so ziemlich die einzige am Institut war, die nicht bereits während ihres Studiums zielstrebig irgendeine Karriere verfolgt hatte, aber da funkte Karl Armknecht schon wieder dazwischen. Was ich denn in Madrid gemacht hätte. Da ihn meine gescheiterte Lebensplanung nichts anging, erzählte ich nur, der Kurztrip sei die Belohnung für mein Germanistikexamen gewesen. Armknecht fand das – aus welchen Gründen auch immer – ganz außerordentlich interessant. Er fragte mich, was ich denn jetzt zu tun gedächte. Ich murmelte irgend etwas von »Weiß noch nicht« und »Mal sehen«, woraufhin Armknecht nichts erwiderte, sich nur durch die vollen schwarzen Haare fuhr, aus denen leider Gottes ein paar Schuppen rieselten.
»Und Sie?« gab ich zurück, bevor er mich weiter ausquetschen konnte. »Was machen Sie?«
»Filmbranche«, kam es leise aus schmalen, fast transparenten Lippen, und er fügte hinzu, er sei eigentlich Maler.
»Was malen Sie denn?«
»Gegenständlich. Auch wenn es nicht dem Trend entspricht.«
»Was genau?«
»Amphibien.«
Beinahe mußte ich laut loslachen, schaffte es aber gerade noch, an Weickels Tod zu denken, womit sich das Thema Lachen für mich schlagartig erledigte. Armknecht sah aus dem Fenster, ich blickte derweil den Gang runter. Gerade begannen die Stewardessen, das vermutlich schlechte Essen zu servieren.
Wir bekamen ein ganz leidliches Omelett in einer ganz leidlichen Tomatensoße mit Speck, zudem noch nicht vollständig aufgetaute Brötchen, und Karl Armknecht haute rein, als sei er in Spanien Opfer einer dramatischen Lebensmittelknappheit geworden. Kauend erzählte er, daß er eigentlich in Berlin wohne, leider aber keinen günstigen Rückflug erstanden habe und jetzt den unangenehmen Weg über Hamburg in Kauf nehmen müsse.
»Wieso ist Hamburg unangenehm?«
»Provinzstadt. Der Hund begraben. Langeweile bis zum Exitus.«
»Ach. Da kennen Sie sich aber gut aus.«
»Sehr gut sogar. Ich habe ganze zwei Jahre in dem Kaff gelebt.«
Eigentlich reizte es mich, ihn zu fragen, warum er denn ganze zwei Jahre seines Lebens für einen Beinahe-Exitus geopfert habe, unterließ es dann aber, weil die Stewardeß netterweise noch einmal vorbeischaute, um uns Kaffee aus Plastikbottichen einzuschenken.
Armknecht schüttete den Kaffeeweißer in seinen Becher, griff wie ein Junkie mit zittrigen Händen nach dem Zucker, und als ob das noch nicht genug wäre, fragte er mich mit devotem Blick, ob ich möglicherweise auf meine Tütchen verzichten könne.
Ich verzichtete gern. Sogleich langte Armknecht zu mir rüber, nahm sich, was er brauchte, und dann lächelte er, wobei sich zuckersüße Grübchen in seinen Wangen abzeichneten. Was für ein Stilbruch.
»Kindchen, wenn Sie möchten, daß etwas aus Ihnen wird, sollten Sie unbedingt nach Berlin gehen«, philosophierte er vor sich hin und schlürfte seinen Kaffee. Leider machte das Flugzeug in diesem Moment einen Hopser, so daß ein Drittel des Kaffees auf seinem Hemd landete und auch ich ein paar Spritzer abbekam.
Und das auf meinem fast neuen und auch noch weißen Hemd.
»O Gott, das tut mir jetzt wirklich leid«, entschuldigte sich Armknecht, während er mit der Flugzeugserviette erst auf meinem, dann auf seinem Hemd herumwischte. Er würde mir ein neues kaufen, falls die Flecken nicht rausgingen, das sei ja selbstverständlich, ich müsse ihn nur benachrichtigen, und vielleicht sollte ich gleich nach Berlin ziehen, dann ließe sich der Lapsus ganz unbürokratisch bereinigen.
»Ich will aber nicht nach Berlin ziehen, und Ihr Kindchen bin ich schon gar nicht«, sagte ich trotzig wie ein Kleinkind.
Armknecht schwieg und sah aus dem Fenster. Nach einer Weile drehte er sich wieder zu mir um.
»Bei dem Kindchen gebe ich Ihnen recht. Bei Berlin nicht. Sie werden schon sehen.«
Damit war unser Gespräch für den Rest des Flugs erstorben.
Armknecht las erst die Süddeutsche, dann Focus und Die Woche, ich stellte meinen Sitz zurück, fuhr meine Beine aus und grübelte darüber nach, ob Armknecht möglicherweise nicht sogar ein kleines bißchen recht hatte. In Berlin würden sich mir etliche Möglichkeiten mehr als in Hamburg bieten, das stand fest. Andererseits war es die Frage, ob ein Angebot von Möglichkeiten überhaupt etwas nützte, wenn man gar nicht wußte, was man denn mit seinem Leben anstellen wollte.
Als das Flugzeug zur vorgesehenen Zeit in Hamburg landete, fragte Armknecht nett bei mir an, ob wir noch gemeinsam einen Kaffee trinken gehen wollten, und weil ich keine große Lust auf meinen Anrufbeantworter und auf Einsamkeit hatte, sagte ich zu. Mit dem Taxi fuhren wir ins Literaturhaus. Armknecht orderte Pfefferminztee, bevor er mir stockend und in Halbsätzen seine halbe Kindheit erzählte. Warum nur, ich verstand das nicht, aber natürlich hatte ich auch nichts dagegen, daß er es tat. Armknecht war unterhaltsam, er lachte viel und hielt mich auf charmante Weise davon ab, daß ich mich dem Leben stellte.
Sohn eines Gastwirts und einer Bandagistin, mit fünfzehn die erste Freundin, mit neunzehn die zweite, gleich bei einem der ersten Male war sie schwanger geworden, Abtreibung, Ende der Beziehung, Banklehre in Berlin, Studium in Bochum, Berlin und Hamburg, kreuz und quer durch die Fachrichtungen, Geschichte, Philosophie und Afrikanistik, ein bißchen Kunstgeschichte und Spanisch, kein Abschluß, aber Menschen, die sich so durchschlugen, waren seiner Ansicht nach sowieso die intelligenteren.
»Dann bin ich also dumm, weil ich einen Abschluß habe?«
»Ziemlich dumm.«
Armknecht zog die Mundwinkel nach oben, ohne im eigentlichen Sinne zu lächeln, und bestellte für uns beide Morchelterrine und Käsekuchen. Der Mann wurde mir immer sympathischer.
Später ließen wir uns zurück zum Hauptbahnhof kutschieren, wo wir unser Gepäck einschlössen, um erst mal in aller Ruhe an der Alster spazierenzugehen. Ich zog ernsthaft in Erwägung, völlig verrückt zu sein. Denn kaum hatten wir die Alster umrundet und standen etwas belemmert vorm Atlantik, als Armknecht mich fragte, ob möglicherweise etwas dagegen spreche, wenn er bei mir übernachte, er habe keine große Lust, heute noch nach Berlin zu fahren. Und ohne nachzudenken, sagte ich, klar, kein Problem, nur müsse er mit dem Gästesofa vorliebnehmen, und Sex sei auch nicht drin. Er wird dir schon nichts tun, dachte ich, auf deinen Instinkt kannst du dich verlassen.
»Ehrensache«, meinte Armknecht und bot mir das Du an.
Also hieß er für mich ab sofort Karl und ich für ihn Sylvie.
Zu Hause schob ich Karl in die Küche. Vertrauensselig beauftragte ich ihn, meine Vorräte zu durchforsten und sich zu überlegen, was man daraus zubereiten könne, während ich es dann doch wagte, mich meinem Anrufbeantworter zu stellen. Onkel Ferdinand gratulierte zum Magister, Toni wollte wissen, ob ich schon aus Madrid zurück sei, Meike, eine Exkommilitonin, fragte nach der letzten Prüfung – kein Adriano. In einem Zustand völliger Emotionslosigkeit löschte ich sämtliche Nachrichten und ging zu Karl in die Küche. Der hatte sich bereits notdürftig ein Geschirrtuch um seine rundlichen Hüften gebunden und war dabei, Unmengen von Knoblauch durch meine Knoblauchpresse zu drücken.
»Riecht gut«, sagte ich, woraufhin Karl meinte, es würde gleich noch viel besser riechen, immerhin hätte ich Nudeln, Olivenöl und Knoblauch im Haus.
»Ein Rest Parmesan müßte auch noch da sein.« Ich entkorkte meine letzte Rotweinflasche, die ich mal nach einer besonderen Liebesnacht von Adriano geschenkt bekommen hatte, einen 95er Sassicaia, der sicherlich über 150 Mark kostete. Merkwürdig, daß ich auf einmal Lust hatte, mir diesen edlen Tropfen mit einem völlig fremden Mann zu genehmigen.
»Wow!« machte Karl, als ich ihm sein Glas hinhielt. »Du bist ja eine richtige Kennerin!«
Ich hob synchron beide Augenbrauen und hütete mich, die Herkunft des Weines preiszugeben.
Karl kredenzte uns wunderbar aromatische Spaghetti, dazu der gute Wein – es war ein perfekter Abend. Einmal klingelte das Telefon, wieder kein Adriano, dafür war es Toni, die ziemlich unverbindlich aufs Band sprach. Zur Strafe ging ich nicht ran, goß statt dessen lächelnd von Adrianos Wein nach.
»Was meintest du eigentlich mit Filmbranche?« fragte ich Karl, als ich die letzten Knoblauch-Parmesan-Reste mit dem Finger vom Teller wischte. Merkwürdig, daß Karls Bekanntschaft so etwas wie eine enthemmende Wirkung auf mich hatte.
Karl grinste. Wieder diese lustigen Grübchen.
»Porno«, sagte er.
»Porno?« fragte ich zurück, woraufhin er sagte: »Ja, Porno.«
Danach war es erst mal still. Ich konnte beim besten Willen nicht glauben, daß Karl Pornofilme drehte. Nicht daß ich der Ansicht war, durch und durch sympathische Menschen täten so etwas nicht, aber Karl war rundlich, etwas kurz geraten und bestimmt nicht der Typ, den deutsche Hausfrauen nackt und mit Ständer sehen wollten. Gut, vielleicht arbeitete er hinter der Kamera, als Regisseur oder so.
»Schockiert?« Karl schien sich wirklich zu amüsieren.
»Überhaupt nicht.« Leider Gottes wurde ich etwas rot. »Ich kann es mir nur nicht so ganz, na ja, sagen wir … vorstellen.«
»Was?« fragte Karl provozierend.
»Bist du Schauspieler?«
Karl schüttelte den Kopf.
»Regisseur?«
»Nein.«
»Was bleibt dann noch?«
»Synchronisation.«
Ich brach in übertriebenes Gelächter aus. »Du meinst also, du kannst besonders gut … stöhnen?«
»Mittlerweile ja.« Karl war jetzt vollkommen ernst.
»Und du glaubst also auch, ich sollte nach Berlin gehen, weil man dort besonders gut im Porno-Synchron-Geschäft rauskommen kann?«
»Zum Beispiel.« Karl trank seinen Sassicaia auf ex, so daß mir doch ein wenig weh ums Herz wurde, aber da ich eine gute Gastgeberin war, schenkte ich ihm, ohne mit der Wimper zu zucken, nach. Außerdem konnte Adriano mich mal. Sich erst ewig lange nicht zu melden, und dann hatte ich zu springen, sobald er ein läppisches Fax schickte. »Ist leichtverdientes Geld. Eine kleine Kostprobe?«
»Nein danke.« Ich schneuzte mich, obwohl es gar nichts auszuschneuzen gab. »Wie kann man so was überhaupt tun?«
»Alles eine Frage der Übung.«
Karl besah sich seine Finger, die fleischig wie bei einem Baby waren.
»Trotzdem. Würde mir sehr schwerfallen.«
»Ach …« Karl machte eine nervöse Bewegung mit der Hand.
»Das einzig wirklich Schwierige ist das exakte Stöhnen auf die Lippenbewegungen. Alles andere …«
Erst in diesem Moment ging mir auf, daß es Karls Job ja mit sich brachte, den lieben langen Tag Pornos zu gucken.
»Konsumierst du solche Filme auch privat?« fragte ich.
»Selten. Um genau zu sein, bin ich eigentlich ein Nichtgucker.«
Was auch immer das heißen mochte.
Als ich später Karls Bett beziehungsweise Matratze klar machte, war Karl plötzlich hinter mir und guckte mir über die Schulter.
»Ich könnte jetzt mit dir schlafen«, sagte er vollkommen nüchtern, »aber es gibt da ein Problem.«
»Ach ja. Und was für eins?«
»Wenn ich mit einer Frau schlafe, verliebe ich mich in sie oder – und das ist weitaus schlimmer – ich bin schon in sie verliebt.«
»Und wie liegen die Dinge bei dir?«
Karl öffnete seine Lippen einen Spalt, und sogleich entschlüpfte ihm ein kleiner, verlegener Lacher.
»Na, dann gute Nacht.« Ich schob Karl zu seiner Matratze, ging nach nebenan und war innerhalb kürzester Zeit eingeschlafen. Mitten in der Nacht wachte ich davon auf, daß jemand in mein Zimmer kam.
Es war verdammt noch mal Karl.
»Was willst du?« fragte ich schlaftrunken und mit kratziger Stimme.
Karl antwortete nicht, und dann sah ich mir dabei zu, wie ich die Hand nach ihm ausstreckte. Ganz plötzlich war mir in den Sinn gekommen, wie weh Adriano mir immer wieder tat.
Karl war der erste dickliche und zudem reichlich behaarte Mann, mit dem ich Sex hatte, und entgegen meiner Erwartung fühlte er sich nicht mal übel an. In seiner Weichheit fest, und es gab keine Knochen, an denen man sich stoßen konnte. Außerdem war Karl ein überraschend guter Liebhaber, nur daß er mich mucksmäuschenstill geliebt hatte, irritierte mich im nach-hinein.
Ich schlief mit diesem völlig fremden Mann Arm in Arm wie ein altes Ehepaar ein, aber am Morgen beim Aufwachen fühlte ich mich durch und durch mies. Was hatte ich da bloß getan?
»Stöhnst du privat nie?« fragte ich Karl, um das Geschehene vor mir selbst ins Lächerliche zu ziehen.
»Arbeitest du deine Uniunterlagen vielleicht im Bett durch?« gab Karl zurück. Offenbar fiel ihm zu dieser frühen Stunde gar nicht auf, daß der Vergleich gewaltig hinkte.
Damit stieg er aus dem Bett und lief trotz weißer Fettwülste oberhalb der Hüftknochen völlig ungeniert und behende aus dem Zimmer. Kurz darauf machte die Dusche ihre vertrauten Knackgeräusche. Im Grunde war Karl auch gar nicht richtig dick, und weil ich ihn auch noch nach dieser Nacht liebenswert fand, bekam er ein leckeres Restefrühstück. Kaffee ohne Milch, angetrocknetes Graubrot, Dazu gab es immerhin ein Ei, frischgepreßten Orangensaft und ein Stück Gouda, von dem ich zunächst eine weißlich fluoreszierende Schimmelschicht entfernen mußte.
Karl wußte es mir zu danken. Er versah sein Ei mit winzigen Butterflocken, die er mit einem Hauch von Salz bestreute, griff dann nach einer zweiten Scheibe Brot, und als er alles in ordnungsgemäßer Reihenfolge verzehrt hatte, fragte er mich, indem er sich Schlaf aus den Augen klaubte, ob wir denn jetzt miteinander gehen würden.
»Ja, zum Bahnhof.« Ich lachte gekünstelt auf,
»Aber es ist so, wie ich es dir gestern gesagt habe.«
»Was?« fragte ich. Aus lauter Verlegenheit nahm ich mir jetzt ebenfalls eine der Graubrotscheiben. Karl wollte doch nicht etwa nach dieser einen Nacht auf große Liebe machen. Ich mochte ihn, fand ihn von mir aus sympathisch und irgendwie auch schrullig, aber das war’s auch schon. Von Verliebtheit keine Spur. Außerdem war da ein reichlich großkotziger bis unverschämter Adriano, an dem ich mich gerade ein bißchen gerächt hatte. Doch das brauchte außer mir ja keiner zu wissen.
Vermutlich hatte Karl auch so begriffen. Er kratzte sich nämlich ausführlich die linke Augenbraue, ging dann zur rechten über, landete mit dem Zeigefinger kurz im Haaransatz, fuhr runter zum Mund und machte ein Gesicht, das heiter erscheinen sollte, aber nur tieftraurig wirkte.
Tat mir ja leid für Karl, aber ich verliebte mich nun mal nicht innerhalb von vierundzwanzig Stunden. Ich brauchte immer ein Vielfaches an Zeit, und auch dann war ich mir selten sicher, ob mein Gefühlsbarometer tatsächlich bei »verliebt« eingerastet war. Adriano war da nur die Ausnahme gewesen, die die Regel bestätigte. Doch bevor Karl Armknecht sich meinetwegen noch vom Balkon stürzte, schlug ich ihm vor, ihn alsbald in Berlin zu besuchen.
»Fein«, sagte er. Und dann machte er mir eine ganze Reihe Komplimente, die in der Tat nur ein komplett Verliebter zustande bringt. Armer Kerl. Als er wenig später ging, war mir klar, daß die Geschichte irgendwie weitergehen würde.
*
Die Kaffeetafel war mit Villeroy & Boch gedeckt, der flämische Apfelkuchen gebacken, Verwandt- und Bekanntschaft eingeladen, mein Kardiologen-Bruder Thomas angereist, die Zweitfamilie meines Vaters ebenfalls – nur der Held meiner Kinderträume selbst hielt mal wieder einen wichtigen Hugo-von-Hofmannsthal-Vortrag in Ankara. Dabei hätte es ihn doch am meisten freuen müssen, daß seine Tochter so folgsam in seine Fußstapfen getreten war und auch noch eine passable Prüfung hingelegt hatte. Na gut. War auch so genug Brimborium um meine Person. Und ich böses Geschöpf dachte nur daran, wie ich mich schnellstmöglich vom Acker machen konnte. Wenn ich nach draußen schaute, war alles wie in meiner Kindheit. Der gelbliche Wohnblock gegenüber, auf dessen Balkons Tag und Nacht sowie Sommer und Winter Wäscheständer und allerlei Gerümpel herumstanden. Kaum ein Baum, nur ein paar mickrige Sträucher, und wenn man die Sackgasse zurück bis zur Bushaltestelle ging, stieg einem der säuerliche Geruch der nahegelegenen Marmeladenfabrik in die Nase.
Ein Armutszeugnis für meinen Vater. Der hatte nämlich nach seiner Scheidung nie dafür gesorgt, daß meine Mutter von seinem beruflichen Aufstieg profitierte und in eine nettere Gegend ziehen konnte. Statt dessen schob er das Geld seinen verwöhnten Techno-Gören Caroli und Senta in den Rachen.
Aber ich wollte nicht mäkeln. Schließlich war heute mein Tag, und ich funktionierte, wie man es von mir erwartete. Mein Lächeln war unecht, als ich von Madrid erzählte, von Weickels tragischem Tod und vom Studium, insbesondere von mittelhochdeutschen Lautverschiebungen. Es lief alles wie geschmiert, nur als mich ein Bekannter meiner Mutter fragte, was ich denn nun zu tun gedächte, mußte ich leider passen.
»Und Sie haben nicht Pädagogik studiert? Sonst könnten Sie immerhin Lehrerin werden.«
»Wie öde«, antwortete ich, obwohl ich wußte, daß es meine Mutter nicht gerade erfreuen würde.
Aber zum Glück war ja mein Bruder anwesend, und dieser berichtete bereitwillig von den neuesten Herzforschungsergebnissen. Wie man mittlerweile annahm, sollten Bakterien für den Infarkt verantwortlich sein, was bei dem Großteil der Gäste Panik auslöste, den dicken Onkel Ferdinand jedoch dazu bewog, sich ungeniert noch zwei Stücke Buttercremetorte auf den Teller zu laden. Herzverfettung gab es demzufolge ja nicht mehr. Im übrigen fand die erlauchte Gesellschaft die Herzinfarktproblematik erheblich interessanter als Lautverschiebungen, und da das Stichwort Bakterien nun schon mal gefallen war, ließ sie es sich nicht nehmen, mit ihren Wehwehchen ganz ohne Hemmungen bei meinem Bruder vorstellig zu werden.
Den Anfang machte Tante Inge. Seit geraumer Zeit litt sie unter nervösen Kopfschmerzen, woraufhin mein Bruder meinte, er sei Kardiologe, und sie solle doch einfach mal ihren Hausarzt konsultieren oder es mit Johanniskraut probieren.
»Johanniskraut?« Tante Inge hatte etwas Hysterisches im Blick.
»Sind das nicht Drogen?«
Mein Bruder dementierte, klärte Tante Inge dann noch über verschiedene neuzeitliche Drogen auf – was niemanden so recht zu interessieren schien –, dann war Herr Mauser, ein Nachbar von gegenüber, an der Reihe. Ihn plagten Quaddeln und Juckreiz am Oberschenkel, außerdem klagte er über eine verstärkte Anfälligkeit für Mückenstiche. Mein Bruder verwies Herrn Mauser an dessen Hautarzt und/oder Apotheker.
In dieser Art ging es noch eine Weile weiter, so daß ich mich fragte, warum ich es nicht als Berufsziel anstrebte, verwirrten Hypochondern ein bißchen Trost zu spenden und sie dann zu Fachärzten zu schicken. Damit konnte man sicher einen Haufen Geld machen.
Irgendwann schaltete ich ab. Die anwesenden Damen und Herren hatten sich jetzt sowieso ganz und gar auf meinen Bruder und dessen spezielle Fähigkeiten eingeschossen. Immer wieder mußte ich an die Nacht mit Karl denken. Das war merkwürdig, denn eigentlich hatte ich die Bettgeschichte von vornherein auf dem Konto für einmalige Vergnügungen und ein bißchen auch als Racheakt an Adriano verbucht, aber nach und nach kamen mir Details in den Sinn, die zumindest einiger weiterer Überlegungen wert waren.
Armknecht hatte mir als erster Mann in meinem Leben das Kopfkissen aufgeschüttelt und hingerückt und sich erst in die Decke gerollt, als ich schon wohlig schnurrend in der für mich bequemsten Haltung lag. Gut, er konnte einen übertriebenen Umsorgungskomplex haben, aber da gab es noch mehr, was mir gefallen hatte. Seine spontane, selbstverständliche Art, mit der er mich gefragt hatte, ob er bei mir übernachten dürfe – wobei ich ihm nicht mal bestimmte Absichten unterstellte –, außerdem kochte er gut und hörte einem zu, ohne permanent besserwisserische oder gar zynische Kommentare in Adriano-Manier abzulassen.
Mein Blick fiel auf Caroli und Senta am Ende der Tafel. Ein Wunder der Natur, daß man so blasiert gucken konnte. Caroli mampfte unentwegt Kuchen, der sich sogleich in Form eines sonnenstudiobraunen Hautröllchens über ihrem silbrigen Hosenbund entlud. Senta machte vermutlich eine Diät oder war bereits der Magersucht verfallen, jedenfalls hing sie spillerig auf ihrem Stuhl und friemelte Nagellackreste von ihren Nägeln, wobei sie abwechselnd an ihnen herumpulte oder mit den Zähnen darauf herumschabte.
Und diese beiden Geschöpfe sollten meine Halbschwestern sein! Es wunderte mich, daß sie überhaupt zu einer derart todlangweiligen Veranstaltung namens Kaffeetrinken mitgekommen waren. Während Caroli sich ein weiteres Stück Kuchen auf ihren Teller lud, holte Senta einen Walkman aus ihrer Plastiktasche mit der Aufschrift IchIchIch, steckte sich die Kopfhörerstöpsel in die Ohren, und fortan ließ ein unbarmherziger Techno-Rhythmus das Villeroy & Boch-Geschirr vibrieren.
Zum Glück wurde die Kaffeetafel bald darauf aufgehoben. Mir tat nur meine Mutter leid, die sich ins Zeug gelegt hatte, um eine perfekte Gastgeberin zu sein, aber kaum waren alle Gäste abgefüllt und hatten meinen Bruder ausgehorcht, suchten sie auch schon das Weite. Ich blieb noch ein wenig, half beim Aufräumen, wobei ich unerwartete Neuigkeiten erfuhr. Zwischen Kuchen-Einfrieren und Geschirr-in-die-Spüle-Stellen gestand mir meine Mutter, daß sie einen Freund habe.
»Einen was?« stieß ich idiotischerweise hervor.
Mutter lächelte nur, erzählte dann, Herr Kichermann sei neunundfünfzig, arbeite als Kustos in der Hamburger Kunsthalle und habe wunderbare silbrige Koteletten.
Ich erkannte meine Mutter nicht wieder. Wunderbare silbrige Koteletten – das war ja phantastisch!
Und weil ich von der neuen Leidenschaft meiner Mutter so begeistert war, blieb ich noch ein Stündchen. Zur Feier des Tages köpften wir eine Flasche Sekt, und ich ließ mir in allen Einzelheiten berichten, wie sie ihren Liebhaber – Witwer und kinderlos – kennengelernt hatte. (Bei einer Führung anläßlich der Menzel-Ausstellung in der Kunsthalle. Blickkontakt. Später eine Tasse Tee im Café Liebermann …)
Es war des Ereignis des Jahrhunderts. Seit mein Vater sie vor genau siebzehn Jahren verlassen hatte, um mit seiner Zweitfrau Caroli und Senta anzusetzen, hatte sie keinen Mann mehr an sich herangelassen, und ich fragte mich allen Ernstes, ob sie denn überhaupt noch wußte, wie das ging. Aber da sie so im Breitwandformat strahlte, war sie anscheinend noch auf dem laufenden, nur als ich von ihr in Erfahrung bringen wollte, wieso Herr Kichermann nicht zu meinem Examenskaffeeklatsch gekommen sei, blockte sie mit den Worten ab: »Du kennst ja die Verwandtschaft.«
Natürlich kannte ich die Verwandtschaft. Nie hatte sie es skandalös gefunden, daß mein Vater uns damals in einer Nacht- und Nebelaktion sitzengelassen hatte, aber wehe, meine Mutter wagte es, wieder auf Männerschau zu gehen!
Gegen zweiundzwanzig Uhr nahm ich den letzten Zug Richtung norddeutsche Hauptstadt und gab meiner Ma noch den klugen Rat: Carpe sexum – was du gehabt hast, hast du gehabt.
*
Das Leben war in der Tat hart. Denn kaum hatte ich meine erste Traumphase zu fassen, riß mich das Telefonklingeln brutal aus dem Gefühl wunderbarer Schwerelosigkeit.
»Adriano«, sagte eine Stimme, die verdammt nach Adriano klang.
»Ach, hallo«, brachte ich schlaftrunken hervor und wurde sogleich mit Vorwürfen bombardiert.
Er stehe gerade in einer Telefonzelle, es sei schrecklich kalt und überhaupt – wieso ich mich denn nicht zurückgemeldet habe, er sei ja noch nicht mal in den Genuß gekommen, wegen meiner bestandenen Prüfung von mir eingeladen worden zu sein – Glückwunsch übrigens – und so weiter und so fort. Ich legte den Hörer neben mich aufs Kissen und schloß die Augen. All die Versprechungen, die er mir gemacht und doch nie eingehalten hatte … Ihn jetzt auflaufen lassen, hieß die Devise. Aber da ich viel zu müde war, um auch nur einen vollständigen Satz zu bilden, hinderte ich Adriano nicht weiter am Herumlamentieren, und auf die Frage, ob ich morgen abend Zeit hätte, murmelte ich ein schwaches »Ja, vielleicht« ins Kopfkissen.
»Gut, dann um acht im ›Arkadasch‹.«
Am nächsten Morgen wachte ich gegen elf auf und konnte mich nur vage an die nächtliche Ruhestörung erinnern. Ich machte mir Frühstück, und da es mich langweilte, ganz allein ohne Zeitung und ohne Examensunterlagen an meinem Käsebrot herumzukauen, rief ich Toni an und berichtete ihr von meinem erbärmlichen Seelenzustand.
»Können wir uns nicht treffen?« jammerte ich. »Dann bin ich wenigstens nicht im Haus und kann auch nicht weiter belästigt werden.«
»Du hast heute abend sowieso Tannhäuser«, sagte Toni mit noch belegter Morgenstimme, und ich erwiderte: »O Gott. Das hätte ich glatt vergessen.« Toni schlug vor, nach der Vorstellung noch einen trinken zu gehen. Ausnahmsweise mal ohne Bernd.
Ich fand die Idee ganz ausgezeichnet.
Den Vormittag brachte ich damit zu, meine Uni-Unterlagen teils zu vernichten, teils abzuheften und alle herumliegenden Mediavistikbücher einzusortieren. Es war ein merkwürdiges Gefühl, die letzten sechs Jahre einfach so im Regal abzustellen. Abgehakt. Als hätte es sie nie gegeben. Und kein Hahn krähte mehr danach, ob ich nun im Philosophenturm meinen Kaffee trank, mir auf dem Campus meine Absätze schieflief oder in der Bibliothek die Unibücher mit dem Saft überreifer Pfirsiche besudelte. Es war ähnlich wie damals nach dem Abi – nur schlimmer. Erst glaubte man, jetzt fange ein Leben in Saus und Braus an, und dann fiel man doch nur wieder in dieses vorhersehbare schwarze Loch, weil man gar nicht genau wußte, was das denn sein sollte – Saus und Braus des Lebens. In der Küche auf einem maroden Holzstuhl sitzen und mit einem Kaffeebecher in der Hand auf die Häuserfront gegenüber starren? Vormittags Talk-Shows im Fernsehen anschauen, weil sie der ideale Kontrast zur höfischen Minne waren? Wie lange konnte man so einen Zustand ertragen? Ehrlich gesagt fühlte ich mich schon jetzt ziemlich miserabel.
Um mich zu betäuben, fuhr ich in die Stadt, jagte von Laden zu Laden und kaufte überflüssige Dinge wie den dritten Salzstreuer, das zwanzigste T-Shirt und eine Blumenvase, die mir eigentlich nicht gefiel. Zu Hause aß ich rasch ein Tomaten-Mayonnaise-Brot, dann war es auch schon Zeit, zur Oper aufzubrechen.
Als ich gegen sieben mit drei Flaschen Sekt im Gepäck die Garderobe betrat, waren erst zwei Statistinnen in Kostüm und Maske. Toni stand mit Katrin einen guten Meter von den Waschbecken entfernt – hier war die Beleuchtung die beste – und nähte ein Stück Tüll an Katrins BH.
»Alkohol!« rief ich in die Runde und öffnete, noch bevor ich meine Jacke ausgezogen hatte, eine der Flaschen.
»Magister in der Tasche?« fragte Sophie. Sie trug einen hautengen schwarzen Catsuit mit integrierten Riesenbrüsten in Fleischrosa; ihre Lippen waren lilaschwarz angemalt.
»Ja, alles bestens«, antwortete ich und hatte im selben Moment ihren Lippenabdruck auf der Wange.
»Note?«
»Zwei.«
»Oh. Gratuliere.« Sophie nahm sich einen der Plastikbecher, die Toni aus dem Schrank geholt hatte, und streckte ihn mir gierig entgegen. Ich goß ihr ein, füllte dann auch die anderen Becher voll, bis die Flasche leer war. »Dann hast du jetzt ja massenhaft Zeit.«
Ich nickte.
»Und was fängst du an?«
»Weiß noch nicht …« Ich sagte ihr nichts von meiner mißratenen Lebensplanung.
»Wirst du bei Aida einsteigen?«
Wieder nickte ich. Gedankenverloren und ein bißchen lethargisch. Im Laufe meiner Studienzeit hatte ich schon so einige Neuinszenierungen erlebt. Tagelang auf Proben herumhängen, die Eifersüchteleien unter Möchtegerntänzerinnen aushalten müssen, junge Frauen, deren Karriere sich – wenn überhaupt – im Tingeln erschöpfen würde, Sektorgien und sinnloses Blabla in der Kantine, Bühnenluft, die ziemlich schal war; wenn man von dem ganzen Chichi absah.
»Was gibt’s für uns zu tun?« fragte ich Sophie.
»Tanzen, stell dir vor.« Ihre Augen wurden beim Lachen schmal, und kleine Fältchen gingen wie Pfauenräder an ihren Augenwinkeln auf.
»Ach, und was?« Natürlich war ich mir der Arroganz in meiner Stimme bewußt, aber immer noch den Traum von der großen Bühnenkarriere zu träumen, fand ich einfach albern. Zumal Sophie tänzerisch schlicht und einfach unbegabt war.
»Cancan. Pas de deux. Soweit ich weiß …«
»Klingt spannend«, sagte ich und dachte nur, o Gott, ein Pas de deux mit einem dieser unmusikalischen Statisten. Im Zweifelsfall würde ich mir gleich unseren Profitänzer Stanislaw schnappen. Der benutzte wenigstens Deo und konnte darüber hinaus einen Fuß vor den anderen setzen.
Ich überließ Sophie wieder ihren Träumereien und ging mit dem Sektbecher an meinen Platz, um mich umzuziehen.
Toni prostete mir aus der anderen Ecke des Raumes zu.
»Auf deine wunderbare, einzigartige Karriere!« rief sie.
Ich nickte und lachte und hoffte, daß dies ein gutes Omen war.
*
Eine halbe Stunde später stand ich auf der Seitenbühne und machte mich für meinen Auftritt warm. Ein paarmal hatte ich darauf verzichtet und mir prompt eine Zerrung am Rücken zugezogen.
Auf einmal schob sich eine rauhe Hand unter meinen kurzen schwarzen Fummel. Schwungvoll drehte ich mich um und scheuerte der Person, zu der die Hand gehörte, eine.
»Aua.« Die schwarze Gestalt, die ich wegen ihrer schnabelförmigen Maske nicht erkennen konnte, hielt sich die Wange. Ohne zu zögern, riß ich ihr die Maske vom Gesicht. Es war Konstantin. Ich starrte ihn an – völlig perplex.
»Da staunst du, was?« Er grinste aus schwarzumränderten Augen.
Ich staunte in der Tat. Obwohl Konstantin immer ein bißchen auf schwul gemacht und damit rumkokettiert hatte, war er jahrelang mein hartnäckigster Verehrer gewesen. Dann hatte er sang- und klanglos das Feld geräumt, um, wie man munkelte, irgendwo in Neuguinea eine dubiose Heilerausbildung zu absolvieren. Nie und nimmer hätte ich es für möglich gehalten, ihn so bald wiederzusehen.
»Ich bin als Ersatz für Andreas eingeteilt.« Konstantins Zähne leuchteten auf schauerliche Weise im Dunkeln.
»Aber du hast doch gar keine Ahnung!« pöbelte ich gegen den Lärm der Bläser an.
»Ach ja?« fragte Konstantin zurück. »Da kennst du mich aber schlecht!«
O doch – ich kannte ihn. Konstantin wieder als Galan ertragen zu müssen, und dann auch noch als miesen Tannhäuser-Partner, war wirklich das letzte, wonach mir der Sinn stand.
Ich setzte meinen Hut auf und ließ den Schleier runter, so daß ich Konstantin nur noch wie durch Nebel wahrnahm. Dann brüllte ich ihm ins Ohr: »Zum Akt treffen wir uns auf der Höhe der zweiten Gasse, Damenseite. Klar?«
Konstantin salutierte, indem er die Hacken ruckartig zusammenzog und die rechte Hand an seine Schläfe legte.
»Und vergiß nicht den Schweinskopf. Bernd gibt ihn dir auf der Herrenseite. Vor der Feuertür.«
»Bin doch nicht blöd«, maulte Konstantin, was ich allerdings nicht bestätigen mochte. Früher hatte er es fertiggebracht, mitten während einer Türandot-Vorstellung ein Butterbrot auszuwickeln, es zu verspeisen und mir maliziös grinsend das Papier in den Ausschnitt zu stecken, aber da er bei der Statistenleiterin Gundi seit jeher Lieblingskind war, hatte es nie Konsequenzen für ihn gehabt.
Ich ging in die dritte Gasse, um dort eine Weile an meinem Unterrock herumzuzupfen. Vielleicht lächerlich, doch vor jeder Vorstellung kam er mir noch kürzer als beim letzten Mal vor. Natürlich ließ sich mein Kostüm auch heute nicht durch ein paar Handgriffe manipulieren. Inspizient Rückert stand schon mit der Partitur in der Hand da, vor mir Ambra, deren penetrantes Parfüm mir fast den Atem raubte. Dann gab Rückert uns das Zeichen für unseren Einsatz: In einer langsamen Welle bewegte sich die Truppe auf die Bühne, vor uns ein dunkles Nichts, aus dem kontinuierlich Kunstnebel aufstieg, der sich nach und nach verdichtete. Durch meinen Schleier eh schon gehandikapt, konnte ich nur noch raten, wo ich mich befand, ich trat Ambra in die Ferse, die schrie auf, fast im selben Moment rammte mir Reni ihren Pfennigabsatz in die Wade, aber da wir uns jetzt alle simultan über den Boden zu wälzen hatten, blieb mir keine Zeit zu jammern. Tangoeinlage mit Stanislaw, wieder wälzen, obszön die Hüften kreisen lassen, rum um den Riesenphallus tänzeln, auf dem Tannhäuser thronte, rasch zur zweiten Gasse, deren Existenz ich nur erahnen konnte …
Zum Glück lag zumindest Konstantin schon an Ort und Stelle, ich warf mich auf ihn, um zum Takt der Musik mit exzessiven Kopulationsbewegungen auf ihm herumzuturnen.
»Wo ist der Schweinskopf?« raunte ich ihm ins Ohr.
»Oh«, sagte Konstantin nur und verbarg sein Gesicht hinter seinen Händen.
»VERDAMMT, DER SCHWEINSKOPF! OHNE DEN VERDAMMTEN SCHWEINSKOPF BIN ICH AUFGESCHMISSEN!«
Tatsächlich war ich einem Tobsuchtsanfall nahe. Bei jeder vorhergegangenen Vorstellung mit Andreas als Partner hatte mir dieser am Ende unseres Aktes den Schweinskopf überreicht, ich war dann aufgestanden, angestrahlt von bläulichen Scheinwerfern, und während sich die ganze Truppe mit schlängelnden Bewegungen auf dem Boden verteilt hatte, war ich in meinen Spangenpumps über die Breitseite der Bühne gestöckelt und in der gegenüberliegenden Gasse abgegangen.
Und jetzt? Die schiere Verzweiflung packte mich, als ich mich ohne Requisite in den Händen erhob, es fiel auch keine aus der Obermaschinerie, aus dem Augenwinkel sah ich Bernd auf der Damenseite in der Gasse stehen und mit dem Schweinskopf herumfuchteln, aber zu spät. Ich war nackt, ausgeliefert, doch noch während ich den ersten Schritt machte, redete ich mir ein, das Publikum wird es ganz anders sehen, niemand weiß von der Existenz eines Schweinskopfes. Mit einem Quentchen mehr an Sicherheit stelzte ich über die Bühne, ich reckte meine Arme entschlossen nach oben, und kurz bevor ich auf der anderen Seite der Bühne angelangt war, baute ich spontan eine Pirouette ein. Kaum war ich für das Publikum außer Sichtweite, fing ich an zu taumeln, ging zu Boden und bekam statt des zu erwartenden Weinkrampfes einen Lachanfall. Sofort waren etliche Menschen um mich herum, Statisten, unser Ballettmeister Diego und meine Chefin, man wollte mich beruhigen und begriff nicht, daß ich gar nicht weinte.
Im Grunde genommen war mir der Vorfall schnurzegal. Einerseits peilte ich keine Bühnenkarriere an, andererseits hatte nicht ich Mist gebaut, sondern vornehmlich Konstantin, in zweiter Linie aber auch Bernd, der ja mal etwas eher auf die Idee hätte kommen können, seinen Schweinskopf an den Mann zu bringen.
»Du mußt dich umziehen.« Diego klopfte mir auf die Schulter und lächelte. Zum ersten Mal fiel mir auf, daß seine Schneidezähne stümperhaft überkront waren. »Hast gut die Kurve gekriegt.«
Ich lächelte dankbar zurück und fragte mich, wieso mich nach meiner Magisterprüfung mit letalem Ausgang so eine Vorstellung überhaupt noch aufregen konnte.
Eilig verzog ich mich hinter den Prospekt. Dort hielt Toni schon meinen Umhang für den nächsten und letzten Auftritt bereit.
»Klasse Vorstellung«, sagte sie und grinste wie die Karikatur ihrer selbst.
»Mistkerl«, schimpfte ich, während ich mich mit Tonis Hilfe aus dem zu engen Unterrock schälte.
»Hättest du ihn damals erhört, wäre das sicher nicht passiert!«
Ich sagte nichts, schnaubte nur in mich hinein.