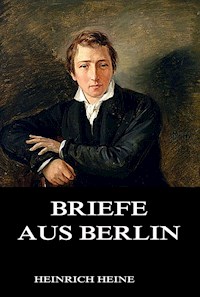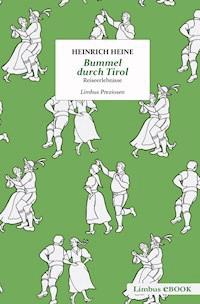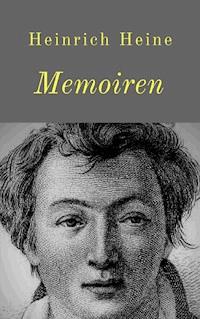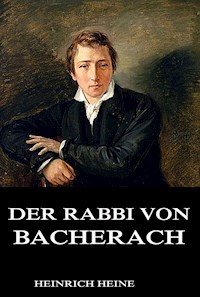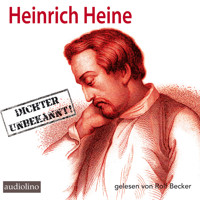0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NEXX
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Werk »Die parlamentarische Periode des Bürgerkönigtums (1840-1841)« ist Heines politisches Vermächtnis, das er im Jahr vor seinem Tod fertig stellte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Heinrich Heine
Lutetia
Impressum
Cover: Gemälde "Heinrich Heine" (1831) von Moritz Daniel Oppenheim (1800-1882)
Covergestaltung: nexx verlag gmbh, 2015
ISBN/EAN: 9783958705371
Rechtschreibung und Schreibweise des Originaltextes wurden behutsam angepasst.
www.nexx-verlag.de
Die parlamentarische Periode des Bürgerkönigtums (1840-1841)
Zueignungsbrief
An seine Durchlaucht, den Fürsten Pückler-Muskau.
Die Reisenden, welche irgendeinen durch Kunst oder historische Erinnerung denkwürdigen Ort besuchen, pflegen Mauern und Wänden ihre respektiven Namen zu inskribieren, mehr oder minder leserlich, je nachdem das Schreibmaterial war, das ihnen zu Gebote stand. Sentimentale Seelen sudeln hinzu auch einige pathetische Zeilen gereimter oder ungereimter Gefühle. In diesem Wust von Inschriften wird unsere Aufmerksamkeit plötzlich in Anspruch genommen von zwei Namen, die nebeneinander eingegraben sind; Jahreszahl und Monatstag steht darunter, und um Namen und Datum schlängelt sich ein ovaler Kreis, der einen Kranz von Eichen- oder Lorbeerblättern vorstellen soll. Sind den spätem Besuchern des Ortes die Personen bekannt, denen jene zwei Namen angehören, so rufen sie ein heiteres: Sieh da! und sie machen dabei die tiefsinnige Bemerkung, dass jene beiden also einander nicht fremd gewesen, dass sie wenigstens einmal auf derselben Stelle einander nahe gestanden, dass sie sich im Raum wie in der Zeit zusammengefunden, sie, die so gut zusammenpassten. – Und nun werden über beide Glossen gemacht, die wir leicht erraten, aber hier nicht mitteilen wollen.
Indem ich, mein hochgefeierter und wahlverwandter Zeitgenosse, durch die Widmung dieses Buches gleichsam auf die Fassade desselben unsere beiden Namen inskribiere, folge ich nur einer heiter gaukelnden Laune des Gemütes, und wenn meinem Sinne irgendein bestimmter Beweggrund vorschwebt, so ist es allenfalls der oberwähnte Brauch der Reisenden. – Ja, Reisende waren wir beide auf diesem Erdball, das war unsere irdische Spezialität, und diejenigen, welche nach uns kommen und in diesem Buch den Kranz sehen, womit ich unsere beiden Namen umschlugen, gewinnen wenigstens ein authentisches Datum unseres zeitlichen Zusammentreffens, und sie mögen nach Belieben darüber glossieren, in wie weit der Verfasser der »Briefe eines Verstorbenen« und der Berichterstatter der Lutetia zusammen passten.
Der Meister, dem ich dieses Buch zueigne, versteht das Handwerk, und kennt die ungünstigen Umstände, unter welchen der Autor schrieb. Er kennt das Bett, in welchem meine Geisteskinder das Licht erblickten, das Augsburgische Prokrustes-Bett, wo man ihnen manchmal die allzu langen Beine und nicht selten sogar den Kopf abschnitt. Um unbildlich zu sprechen, das vorliegende Buch besteht zum größten Teil aus Tagesberichten, welche ich vor geraumer Zeit in der Augsburgischen Allgemeinen Zeitung drucken ließ. Von vielen hatte ich Brouillons zurückbehalten, wonach ich jetzt bei dem neuen Abdruck die unterdrückten oder veränderten Stellen restaurierte. Leider erlaubt mir nicht der Zustand meiner Augen, mich mit vielen solcher Restaurationen zu befassen; ich konnte mich aus dem verwitterten Papierwust nicht mehr herausfinden. Hier nun sowie auch bei Berichten, die ich ohne vorläufigen Entwurf abgeschickt hatte, ersetzte ich die Lakunen und verbesserte ich die Alterationen so viel als möglich aus dem Gedächtnis, und bei Stellen, wo mir der Stil fremdartig und der Sinn noch fremdartiger vorkam, suchte ich wenigstens die artistische Ehre, die schöne Form, zu retten, indem ich jene verdächtigen Stellen gänzlich vertilgte. Aber dieses Ausmerzen an Orten, wo der wahnwitzige Rotstift allzu sehr gerast zu haben schien, traf nur Unwesentliches, keineswegs die Urteile über Dinge und Menschen, die oft irrig sein mochten, aber immer treu wiedergegeben werden mussten, damit die ursprüngliche Zeitfarbe nicht verloren ging. Indem ich eine gute Anzahl von ungedruckt gebliebenen Berichten, die keine Zensur passiert hatten, ohne die geringste Veränderung hinzufügte, lieferte ich durch eine künstlerische Zusammenstellung aller dieser Monographien ein Ganzes, welches das getreue Gemälde einer Periode bildet, die ebenso wichtig wie interessant war.
Ich spreche von jener Periode, welche man zur Zeit der Regierung Ludwig Philipps die »parlamentarische« nannte, ein Name, der sehr bezeichnend war und dessen Bedeutsamkeit mir gleich im Beginn auffiel. Wie im ersten Teil dieses Buches zu lesen, schrieb ich am 9. April 1840 folgende Worte: »Es ist sehr charakteristisch, dass seit einiger Zeit die französische Staatsregierung nicht mehr ein konstitutionelles, sondern ein parlamentarisches Gouvernement genannt wird. Das Ministerium vom ersten März erhielt gleich in der Taufe diesen Namen.« – Das Parlament, nämlich die Kammer, hatte damals schon die bedeutendsten Prärogative der Krone an sich gerissen, und die ganze Staatsmacht fiel allmählich in seine Hände. Seinerseits war der König, es ist nicht zu leugnen, ebenfalls von usurpatorischen Begierden gestachelt, er wollte selbst regieren, unabhängig von Kammer- und Ministerlaune, und in diesem Streben nach unbeschränkter Souveränität suchte er immer die legale Form zu bewahren. Ludwig Philipp kann daher mit Fug behaupten, dass er nie die Legalität verletzt, und vor den Assisen der Geschichte wird man ihn gewiss von jedem Vorwurf, eine ungesetzliche Handlung begangen zu haben, ganz freigesprochen, und ihn allenfalls nur der allzu großen Schlauheit schuldig erklären können. Die Kammer, welche ihre Eingriffe in die königlichen Vorrechte weniger klug durch legale Form bemäntelte, träfe gewiss ein weit herberes Verdikt, wenn nicht etwa als Milderungsgrund angeführt werden dürfte, dass sie provoziert worden sei durch die absoluten Gewaltsgelüste des Königs; sie kann sagen, sie habe denselben befehdet, um ihn zu entwaffnen und selber die Diktatur zu übernehmen, die in seinen Händen staats- und freiheitsverderblich werden konnte. Der Zweikampf zwischen dem König und der Kammer bildet den Inhalt der parlamentarischen Periode, und beide Parteien hatten sich zu Ende derselben so sehr abgemüdet und geschwächt, dass sie kraftlos zu Boden sanken, als ein neuer Prätendent auf dem Schauplatz erschien. Am 24. Februar 1848 fielen sie fast gleichzeitig zu Boden, das Königtum in den Tuilerien und einige Stunden später das Parlament in dem nachbarlichen Palais-Bourbon. Die Sieger, das glorreiche Lumpengesindel jener Februartage, brauchten wahrhaftig keinen Aufwand von Heldenmut zu machen, und sie können sich kaum rühmen, ihrer Feinde ansichtig geworden zu sein. Sie haben das alte Regiment nicht getötet, sondern sie haben nur seinem Scheinleben ein Ende gemacht – König und Kammer starben, weil sie längst tot waren. Diese beiden Kämpen der parlamentarischen Periode mahnen mich an ein Bildwerk, das ich einst zu Münster in dem großen Saal des Rathauses sah, wo der westfälische Frieden geschlossen worden war. Dort stehen nämlich längs den Wänden, wie Chorstühle, eine Reihe hölzerner Sitze, auf deren Lehne allerlei humoristische Skulpturen zu schauen sind. Auf einem dieser Holzstühle sind zwei Figuren dargestellt, welche in einem Zweikampf begriffen; sie sind ritterlich geharnischt und haben eben ihre ungeheuer großen Schwerter erhoben, um auf einander einzuhauen – doch sonderbar! Jedem von ihnen fehlt die Hauptsache, nämlich der Kopf, und es scheint, dass sie sich in der Hitze des Kampfes einander die Köpfe abgeschlagen haben und jetzt, ohne ihre beiderseitige Kopflosigkeit zu bemerken, weiter fechten.
Die Blütezeit der parlamentarischen Periode waren das Ministerium vom 1. März 1840 und die ersten Jahre des Ministeriums vom 29. November 1840. Ersteres mag für den Deutschen noch ein besonderes Interesse bewahren, weil damals Thiers unser Vaterland in die große Bewegung hineintrommelte, welche das politische Leben Deutschlands weckte; Thiers brachte uns wieder als Volk auf die Beine, und dieses Verdienst wird ihm die deutsche Geschichte hoch anrechnen. Auch der Eisapfel der orientalischen Frage kommt unter jenem Ministerium bereits zum Vorschein, und wir sehen im grellsten Licht den Egoismus jener britischen Oligarchie, die uns damals gegen die Franzosen verhetzte. Ihre Agenten schlichten sich ein in die deutsche Presse, um die politische Unerfahrenheit meiner Landsleute auszubeuten, die sich alles Ernstes einbildeten, die Franzosen trachteten nicht allein nach den Kronen der deutschen Duodezfürsten, sondern auch nach den Erdäpfeln ihrer Untertanen, und es gelüste sie nach dem Besitz der Rheinprovinzen, um unsern lieben guten Rheinwein zu trinken. Oh, nicht doch! Die Franzosen werden uns gern unsere Erdäpfel lassen, sie, welche die Trüffeln von Perigord besitzen, und sie können wohl unseres Rheinweins entbehren, da sie den Champagner haben. Frankreich braucht uns um nichts zu beneiden, und die kriegerischen Gelüste, von denen wir uns bedroht glaubten, waren Erfindungen von englischer Fabrik. Dass das aufrichtige und großmütige, bis zur Fanfaronade großmütige Frankreich unserer natürlicher und wahrhaft sicherster Alliierter ist, war die Überzeugung meines ganzen Lebens, und das patriotische Bedürfnis, meine verblendeten Landsleute über den treulosen Blödsinn der Franzosen-Fresser und Rheinliedbarden aufzuklären, hat vielleicht meinen Berichten über das Ministerium Thiers manchmal, namentlich in Bezug auf die Engländer, ein allzu leidenschaftliches Kolorit erteilt; aber die Zeit war eine höchst gefährliche, und Schweigen war ein halber Verrat. Meine Animosität gegen das »perfide Albion«, wie man sich ehemals ausdrückte, existiert nicht mehr heut, wo sich so vieles verändert hat. Ich bin nichts weniger als ein Feind jenes großen englischen Volkes, das seitdem meine herzlichsten Sympathien, wenn auch nicht mein Vertrauen, zu gewinnen gewusst. Aber so sehr die Engländer als Individuen zuverlässige Freunde sind, so sehr muss man ihnen als Nation, oder, besser gesagt, als Regierung misstrauen. Ich will hier gerne eine »Apologie« im englischen Sinne des Worts vorbringen und, sozusagen, Abbitte tun für alle herben Ausfälle, mit denen ich das englische Volk regaliert habe, als ich diese Berichte schrieb; aber ich wage sie heute nicht zu unterdrücken, denn die leidenschaftlichen Stellen, welche ich in ihrem ursprünglichen Ungestüm wieder zum Abdruck bringe, dienen dazu, vor den Augen des Lesers die Leidenschaften heraufzubeschwören, von denen er sich nach den großen Umwälzungen, die selbst bis auf unsere Erinnerung erstickt und erloschen sind, keine Vorstellung zu machen müsste.
Bis zur Katastrophe vom 24. Februar gehen nicht meine Pariser Berichte, aber man sieht schon auf jeder Seite ihre Notwendigkeit, und sie wird beständig vorausgesagt mit jenem prophetischen Schmerz, den wir in dem alten Heldenliede finden, wo Trojas Brand nicht den Schluss bildet, aber in jedem Verse geheimnisvoll knistert. Ich habe nicht das Gewitter, sondern die Wetterwolken beschrieben, die es in ihrem Schoße trugen und schauerlich düster heranzogen. Ich berichtete oft und bestimmt über die Dämonen, welche in den unteren Schichten der Gesellschaft lauerten und aus ihrer Dunkelheit heraufbrechen würden, wenn der rechte Tag gekommen. Diese Ungetüme, denen die Zukunft gehört, betrachtete man damals nur durch ein Verkleinerungsglas, und da sahen sie wirklich aus wie wahnsinnige Flöhe – aber ich zeigte sie in ihrer wahren Lebensgröße, und da glichen sie vielmehr den furchtbarsten Krokodilen, welche jemals aus dem Schlamm gestiegen.
Um die betrübsamen Berichterstattungen zu erheitern, verwob ich sie mit Schilderungen aus dem Gebiete der Kunst und der Wissenschaft, aus den Tanzsälen der guten und der schlechten Sozietät, und wenn ich unter solchen Arabesken manche allzu närrische Virtuosenfratze gezeichnet, so geschah es nicht, um irgendeinem längst verschollenen Biedermann des Pianoforte oder der Maultrommel ein Herzeleid zuzufügen, sondern um das Bild der Zeit selbst in seinen kleinsten Nuancen zu liefern. Ein ehrliches Daguerreotyp muss eine Fliege ebenso gut wie das stolzeste Pferd treu wiedergeben, und meine Berichte sind ein daguerreotypisches Geschichtsbuch, worin jeder Tag sich selbst abkonterfeite, und durch die Zusammenstellung solcher Bilder hat der ordnende Geist des Künstlers ein Werk geliefert, worin das Dargestellte seine Treue authentisch durch sich selbst dokumentiert. Mein Buch ist daher zugleich ein Produkt der Natur und der Kunst, und während es jetzt vielleicht den populären Bedürfnissen der Leserwelt genügt, kann es auf jeden Fall dem späteren Historiographen als eine Geschichtsquelle dienen, die, wie gesagt, die Bürgschaft ihrer Tageswahrheit in sich trägt. Man hat in solcher Beziehung bereits meinen »Französischen Zuständen«, welche denselben Charakter tragen, die größte Anerkennung gezollt, und die französische Übersetzung wurde von historienschreibenden Franzosen vielfach benutzt. Ich erwähne dieses alles, damit ich für mein Werk ein solides Verdiensts vindiziere, und der Leser umso nachsichtiger sein möge, wenn er darin wieder jenen frivolen Esprit bemerkt, den unsere kerndeutschen, ich möchte sagen eicheldeutschen Landsleute auch dem Verfasser der »Briefe eines Verstorbenen« vorgeworfen haben. Indem ich demselben mein Buch zueigne, kann ich wohl, in Bezug auf den darin enthaltenen Esprit heute von mir sagen, dass ich Eulen nach Athen bringe.
Aber wo befindet sich in diesem Augenblick der viel verehrte und vielteure Verstorbene? Wohin adressiere ich mein Buch? Wo ist er? Wo weilt er, oder vielmehr wo galoppiert er, wo frottiert er? Er, der romantische Anacharsis, der mondänste aller Sonderlinge, Diogenes zu Pferde, dem ein eleganter Groom die Laterne vorträgt, womit er einen Menschen sucht. – Sucht er ihn in Sandomir, oder in Sandomich, wo ihm der große Wind, der durch das Brandenburger Tor weht, die Laterne ausbläst? Oder trabt er jetzt auf dem höckerigen Rücken eines Kamels durch die arabische Sandwüste, wo der langbeinige Hut-Hut, den die deutschen Dragomanen den Legationssekretär von Wiederhopf nennen, an ihm vorüberläuft, um seiner Gebieterin, der Königin von Saba, die Ankunft des hohen Gastes zu verkünden? – denn die alte fabelhafte Person erwartet den weltberühmten Touristen auf einer schönen Oase in Äthiopien, wo sie mit ihm unter wehenden Fächerpalmen und plätschernden Springbrunnen frühstücken und kokettieren will, wie einst auch die verstorbene Lady Esther Stanhope getan, die ebenfalls viele kluge Rätselsprüche wusste. – Apropos, aus den Memoiren, welche ein Engländer nach dem Tod dieser berühmten Sultanin der Wüste herausgegeben, habe ich nicht ohne Verwunderung gelesen, dass die hohe Dame, als Eure Durchlaucht sie auf dem Libanon besuchten, auch von mir sprach, und der Meinung gewesen, ich sei der Stifter einer neuen Religion. Du lieber Himmel! ich der Stifter einer neuen Religion! ich, dem die vorhandenen Religionen immer genug, mehr als genug gewesen! Da sehe ich, wie schlecht man in Asien über mich unterrichtet ist!
Ja, wo ist jetzt der wandersüchtige Überall und Nirgends? Korrespondenten einer mongolischen Zeitung behaupten, er sei auf dem Wege nach China, um die Chinesen zu sehen, ehe es zu spät ist und dieses Volk von Porzellan in den plumpen Händen der rothaarigen Barbaren ganz zerbricht – ach! seinem armen wackelköpfigen Porzellan-Kaiser ist schon vor Gram das Herz gebrochen! Der Calcutta Advertiser scheint der oben erwähnten mongolischen Zeitungsnachricht keinen Glauben zu schenken und behauptet vielmehr, dass Engländer, welche jüngst den Himalaja bestiegen, den Fürsten Pückler-Muskau auf den Flügeln eines Greifen durch die Lüfte fliegen sahen. Jenes Journal bemerkt, dass der erlauchte Reisende sich wahrscheinlich zum Berg Kaf begab, um dem Vogel Simurgh, der dort haust, seinen Besuch abzustatten und mit ihm über antediluvianische Politik zu plaudern. – Aber der alte Simurgh, der Dekan der Diplomaten, der Ex-Vesier so vieler präadamitischen Sultane, die alle weiße Röcke und rote Hosen getragen, residiert er nicht während den Sommermonaten auf seinem Schloss Johannisberg am Rhein? Ich habe den Wein, der dort wächst, immer für den besten gehalten, und für einen gar klugen Vogel hielt ich immer den Herrn des Johannisbergs; aber mein Respekt hat sich noch vermehrt, seitdem ich weiß, in welchem hohen Grade er meine Gedichte liebt, und dass er einst Eurer Durchlaucht erzählte, wie er bei der Lektüre derselben zuweilen Tränen vergossen habe. Ich wollte, er läse auch einmal zur Abwechslung die Gedichte meiner Parnass-Genossen, der heutigen Gesinnungspoeten; er wird freilich bei dieser Lektüre nicht weinen, aber desto herzlicher lachen.
Jedoch noch immer weiß ich nicht ganz bestimmt den Aufenthaltsort des Verstorbenen, des lebendigsten aller Verstorbenen, der so viel Titularlebendige überlebt hat. – Wo ist er jetzt? Im Abendland oder im Morgenland? In China oder in England? In Hosen von Nanking oder von Manchester? In Vorderasien oder in Hinterpommern? Muss ich mein Buch nach Kyritz adressieren oder nach Timbuktu, poste restante? – Gleichwohl, wo er auch sei, überall verfolgen ihn die heiter treuherzigsten und wehmütig tollsten Grüße seines ergebenen
Paris, den 23. August 1854
Heinrich Heine
[Der Schluss dieses Zueignungsbriefes lautet in der französischen Ausgabe, wie folgt: »Ja, das himmlische Reich zerfällt in Trümmer, und seine silbernen Glöcklein, die so lustig klingelten, ertönen heut wie ein Totengeläute. Bald wird es keine Chinesen und chinesischen Kunstspielereien mehr geben als auf unsern Teetassen, Ofenschirmen, Fächern und Nippsgestellen: die langzöpfigen Mandarinen, die unsere Kamingesimse zierten und so vergnüglich ihren dicken Bauch wiegten, wobei sie manchmal ein spitzig-rotes Zünglein aus dem lachenden Mund hervorbleckten, diese armen Porzellanfiguren scheinen das Unglück ihres Vaterlandes zu kennen, sie sehen trübsinnig aus, als wollte ihr Herz vor Kummer zerbrechen. Diese Todesangst des Porzellans ist etwas Erschreckliches. Aber es sind nicht die Wackelfiguren von China allein, welche aussterben. Die ganze alte Welt liegt im Verenden und hat Eile, sich begraben zu lassen. Die Könige scheiden, die Götter scheiden, und, ach! auch die wackelnden Porzellanmännchen scheiden dahin!
»Indem ich ernstlich über die Mittel und Wege nachsinne, mein Fürst, dies Buch in Ihre Hände zu befördern, kommt mir der Gedanke, es poste restante nach Timbuktu zu adressieren. Man hat mir gesagt, dass Sie sich oft nach dieser Stadt begeben, die eine Art schwarzes Berlin sein muss; da sie noch nicht ganz entdeckt ist, begreife ich sehr wohl, dass sie Ihnen alle Annehmlichkeiten eines vollständigen Inkognitos gewährt, und dass Sie sich dort nach Belieben die Langeweile vertreiben können, wenn Sie jenes weißen Timbuktus müde sind, das sich Berlin nennt.
Aber, mögen Sie im Morgenland oder im Abendland, an den Ufern des Senegal oder der Spree, in Peking oder in der Lausitz sein, gleichviel! wo Sie auch trotten oder galoppieren, überall werden meine Gedanken hinter Ihnen her trotten und galoppieren und Ihnen Dinge ins Ohr flüstern, über die Sie lachen müssen. Sie werden Ihnen auch sagen, wie sehr ich Sie liebe und bewundere, und wie viele herzliche Wünsche ich für Sie hege, an welchem Ort Sie auch weilen! Und damit, mein Fürst, bete ich zu Gott, dass er Sie in seine heilige und erhabene Hut nehme.
Heinrich Heine«]
I.
Paris, den 25. Februar 1840
Je näher man der Person des Königs steht und mit eigenen Augen das Treiben desselben beobachtet, desto leichter wird man getäuscht über die Motive seiner Handlungen, über seine geheimen Absichten, über sein Wollen und Streben. In der Schule der Revolutionsmänner hat er jene moderne Schlauheit erlernt, jenen politischen Jesuitismus, worin die Jakobiner manchmal die Jünger Loyolas übertrafen. Zu diesen Errungenschaften kommt noch ein Schatz geerbter Verstellungskunst, die Tradition seiner Vorfahren, der französischen Könige, jener ältesten Söhne der Kirche, die immer weit mehr als andere Fürsten durch das heilige Öl von Rheims geschmiert wurden, immer mehr Fuchs als Löwe waren, und einen mehr oder minder priesterlichen Charakter offenbarten. Zu der angelernten und überlieferten simulatio und dissimulatio gesellt sich noch eine natürliche Anlage bei Ludwig Philipp, so dass es fast unmöglich ist, durch die wohlwollende dicke Hülle, durch das lächelnde Fleisch, die geheimen Gedanken zu erspähen. Aber gelänge es auch, bis in die Tiefe des königlichen Herzens einen Blick zu werfen, so sind wir dadurch noch nicht weit gefördert, denn am Ende ist eine Antipathie oder Sympathie in Bezug auf Personen nie der bestimmende Grund der Handlungen Ludwig Philipps, er gehorcht nur der Macht der Dinge (la force des choses), der Notwendigkeit. Alle subjektive Anregung weist er fast grausam zurück, er ist hart gegen sich selbst, und ist er auch kein Selbstherrscher, so ist er doch ein Beherrscher seiner selbst; er ist ein sehr objektiver König. Es hat daher wenig politische Bedeutung, ob er etwa den Guizot mehr liebt oder weniger, als den Thiers; er wird sich des einen oder des andern bedienen, je nachdem er den einen oder den ändern nötig hat, nicht früher, nicht später. Ich kann daher wirklich nicht mit Gewissheit sagen, wer von diesen zwei Männern dem König am angenehmsten oder am unangenehmsten sei. Ich glaube, ihm missfallen sie alle beide, und zwar aus Metierneid, weil er ebenfalls Minister ist, in ihnen seine beständigen Nebenbuhler sieht, und am Ende fürchtet, man könnte ihnen eine größere politische Kapazität zutrauen als ihm selber. Man sagt, Guizot sage ihm mehr zu als Thiers, weil jener eine gewisse Unpopularität genießt, die dem König gefällt. Aber der puritanische Zuschnitt, der lauernde Hochmut, der doktrinäre Belehrungston, das eckig-calvinistische Wesen Guizots kann nicht anziehend auf den König wirken. Bei Thiers stößt er auf die entgegengesetzten Eigenschaften, auf einen ungezügelten Leichtsinn, auf eine kecke Laune, auf eine Freimütigkeit, die mit seinem eigenen versteckten, krummlinigen, eingeschachtelten Charakter fast beleidigend kontrastiert und ihm also ebenfalls wenig behagen kann. Hinzu kommt, dass der König gern spricht, ja sogar sich gern in ein unendliches Schwatzen verliert, was sehr merkwürdig, da verstellungssüchtige Naturen gewöhnlich wortkarg sind. Gar bedeutend muss ihm deshalb ein Guizot missfallen, der nie diskutiert, sondern immer doziert und endlich, wenn er seine Thesis bewiesen hat, die Gegenrede des Königs mit Strenge anhört und wohl gar dem König Beifall nickt, als habe er einen Schulknaben vor sich, der seine Lektion gut hersagt. Bei Thiers geht's dem König noch schlimmer. Der lässt ihn gar nicht zu Wort kommen, verloren in die Strömung seiner eigenen Rede. Das rieselt unaufhörlich wie ein Fass, dessen Hahn ohne Zapfen, aber immer kostbarer Wein. Kein anderer kommt da zu Wort, und nur während er sich rasiert, ist man imstande, bei Herrn Thiers ruhiges Gehör zu finden. Nur solange ihm das Messer an der Kehle ist, schweigt er und schenkt fremder Rede Gehör.
Es ist keinem Zweifel unterworfen, dass der König sich endlich entschließt, den Begehrlichkeiten der Kammer nachgebend, Herrn Thiers mit der Bildung eines neuen Ministeriums zu beauftragen und ihm als Präsidenten des Konzils auch das Portefeuille der äußern Angelegenheiten anzuvertrauen. Das ist leicht vorauszusehen. Man dürfte aber mit großer Gewissheit prophezeien, dass das neue Ministerium nicht von langer Dauer sein wird, und dass Herr Thiers selber eines frühen Morgens dem König eine gute Gelegenheit gibt, ihn wieder zu entfernen und Herrn Guizot an seine Stelle zu berufen. Herrn Thiers, bei seiner Behändigkeit und Geschmeidigkeit, zeigt immer ein großes Talent, wenn es gilt, den mât de Cocagne der Herrschaft zu erklettern, hinauf zu rutschen, aber er bekundet ein noch größeres Talent des Wiederheruntergleitens, und wenn wir ihn ganz sicher auf dem Gipfel seiner Macht glauben, glitscht er unversehens wieder herab, so geschickt, so artig, so lächelnd, so genial, dass wir diesem neuen Kunststück schier applaudieren möchten. Herr Guizot ist nicht so geschickt im Erklimmen des glatten Mastes. Mit schwerfälliger Mühe zottelt er sich hinauf, aber wenn er oben einmal angelangt, klammert er sich fest mit der gewaltigen Tatze; er wird auf der Höhe der Gewalt immer länger verweilen, als sein gelenkiger Nebenbuhler, ja wir möchten sagen, dass er aus Unbeholfenheit nicht mehr herunterkommen kann und ein starkes Schütteln nötig sein wird, ihm das Herabpurzeln zu erleichtern. In diesem Augenblick sind vielleicht schon die Depeschen unterwegs, worin Ludwig Philipp den auswärtigen Kabinetten auseinandersetzt, wie er, durch die Gewalt der Dinge gezwungen, den ihm fatalen Thiers zum Minister nehmen muss, anstatt des Guizot, der ihm viel angenehmer gewesen wäre.
Der König wird jetzt seine große Not haben, die Antipathie, welche die fremden Mächte gegen Thiers hegen, zu beschwichtigen. Dieses Buhlen um den Beifall der letzteren ist eine törichte Idiosynkrasie. Er meint, dass von dem äußeren Frieden auch die Ruhe seines Inlands abhänge, und er schenkt diesem nur geringe Aufmerksamkeit. Er, vor dessen Augenzwinkern alle Trajane, Titusse, Marc-Aurele und Antonine dieser Erde, den Großmogul mit eingerechnet, zittern müssten, er demütigt sich vor ihnen wie ein Schulbub und jammert: »Schonet meiner! verzeiht mir, dass ich, sozusagen, den französischen Thron bestiegen, dass das tapferste und intelligenteste Volk, ich will sagen: 36 Millionen Unruhestifter und Gottesleugner mich zu ihrem König gewählt haben. – Verzeiht mir, dass ich mich verleiten ließ, aus den verruchten Händen der Rebellen die Krone und die dazu gehörigen Kronjuwelen in Empfang zu nehmen – ich war ein unerfahrenes Gemüt, ich hatte eine schlechte Erziehung genossen von Kind ein, wo Frau von Genlis mich die Menschenrechte buchstabieren ließ – bei den Jakobinern, die mir den Ehrenposten eines Türstehers anvertrauten, habe ich auch nicht viel Gutes lernen können – ich wurde durch schlechte Gesellschaft verführt, besonders durch den Marquis de Lafayette, der aus mir die beste Republik machen wollte – ich habe mich aber seitdem gebessert, ich bereue meine jugendlichen Verirrungen, und ich bitte euch, verzeiht mir aus christlicher Barmherzigkeit – und schenket mir den Frieden!« Nein, so hat sich Ludwig Philipp nicht ausgedrückt, denn er ist stolz und edel und klug, aber das war doch immer der kurze Sinn seiner langen Reden und noch längeren Briefe, deren Schriftzüge, als ich sie jüngst sah, mir höchst originell erschienen. Wie man gewisse Schriftzüge »Fliegenpfötchen« (pattes de mouche) nennt, so könnte man die Handschrift Ludwig Philipps »Spinnenbeine« nennen; sie ähneln nämlich den hagerdünnen und schattenartig langen Beinen der sogenannten Schneiderspinnen, und die hochgesteckten und zugleich äußerst magern Buchstaben machen einen fabelhaft drolligen Eindruck.