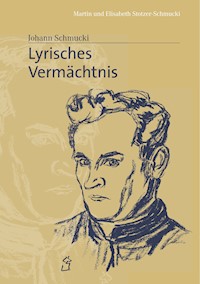
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Im Nachlass des Theologen, Kunsthistorikers und Kunstmalers Dr. Johann Schmucki fand sich - vor Kurzen erst und bisher unbekannt - eine aussergewöhnlich reichhaltige Sammlung an lyrischen Werken. Eine signifikante Auswahl aus den gegen eintausend Gedichten verschiedensten Inhalts wird hier erstmals vorgestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 69
Ähnliche
INHALT
Vorwort
Naturerleben
Vom Wesen der Bäume
Blütenzauber
Heimat und Ferne
Arm und reich
Die Grossmutter
Werden und vergehen
Schicksalsfragen, hoffen und bangen
Einsamkeit
Priestertum
Gebete
Weihnacht
Symbolisches, Mystisches
Der erwachende Dichter
Zuneigung
Scherz und Spass
Vermischtes
Gedicht in Original-Handschrift des Johann Schmucki
VORWORT
Es war keine geringe Überraschung, als sich beim Ordnen des schriftlichen Nachlasses unseres Vaters und Schwiegervaters in seinen zahlreichen, sorgfältig geführten Tagebüchern eingestreute lyrische Texte fanden. Es öffnete sich schliesslich eine unglaubliche Palette von sage und schreibe 956 Einzelgedichten, verfasst in den Jahren 1920 bis 1927 und gefolgt von einem abrupten Ende … ein immenses lyrisches Vermächtnis, für dessen Wiederauftauchen wir dankbar sein wollen.
Bei vertiefter Beschäftigung mit den formalen Gegebenheiten der Dichtungen wurde bald einmal ersichtlich, dass Johann Schmucki eine fortschreitende Befreiung vom herkömmlichen, festgefügten Reim- und Rhythmusschema anstrebte, ganz im Sinne der literarischen Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts, in deren Lyrik die äussere Form – Vers, Versmass und Strophenbau – zunehmend an Bedeutung einbüsste.
Die ausgewählten 126 Gedichte aus der 8-jährigen lyrischen Schaffensperiode des Johann Schmucki werden nachstehend einzelnen Sachgebieten zugeordnet; sie sind innerhalb derselben nicht in chronologischer Reihenfolge aufgeführt.
NATURERLEBEN
Die Sonne
Die Sonne kam.
Hoch und feierlich ging sie über das Land.
Voll Liebe
schaute sie zu den armen Erdengeschöpfen nieder,
die am kalten Boden kauerten
und ihre Tage in feuchtem Nebelgrau vertrauerten.
Mitleidig schaute die Sonne jedes an
und hauchte es an
und senkte ein paar Tropfen ihres eigenen Blutes überall hinein.
Da erholte sich alles neu zum Leben
und erhob sich bebend;
und ein Lächeln begann die alte, müde Welt zu durchwittern.
Abschied
Herbstsonnenschein
schimmert verloren durch Nebel herein
auf die Weiden der Berge.
Mit Schellenklang
und Jodelsang
zieht talwärts die Herde.
Wohin sie zieht? Wohin sie zieht?
Der Sonne nach, die den Bergen entflieht.
Herbstsonnenschein
rinnt verloren durch die Nebel herein
auf Wiesen und Dörfchen.
Es kreisen und fliegen
und stürzen sich, wiegen
Zugvögelschwärme im lichten Duft.
Sie üben sich, üben
in jauchzendem Strich und Zug
zum grossen herbstlichen Flug.
Wohin sie ziehen? Wohin sie ziehen?
Der Sonne nach, die dem Nordland entflieht!
Sphinx
Schau die hohe Felsenstirne,
vom Morgensonnenschein beschienen,
wie sie leuchtet,
wie sie thront in königlicher Grösse
und, ob lächelnd,
doch mit unbewegter starrer Miene
wegschaut über Tal und See und Berge,
unverwandt hinüber
nach den hohen, schimmernd hellen Firnen.
Unzähl’ge Menschlein steh’n ihr tief zu Füssen,
schau’n empor zu ihrer Stirn,
erschauernd;
schau’n nach ihrem lichten Lächeln,
jauchzend,
und in ihrem Schatten bauen
Haus und Hütte sie,
der Fürstin Schutz vertrauend.
Ist es nicht, als ob sie winke:
Klimmt empor an meinem Busen.
Ist es nicht, als ob sie locke:
Kommt und holt euch himmlisch schöne Blumen
aus meinem Felsgelocke.
Ist es nicht, als ob sie rufe:
Jäger, klimm‘ herauf die Felsenstufen,
herauf, herauf zu mir;
ich habe für dich manches schöne Tier.
Herauf, herauf, ihr armen Leute;
ich berge in des Mantels dunklen Falten
für euch alle lockend schöne Beute.
Seht die Menschlein emsig klimmen;
hört sie von den Felsenzinnen singen!
Seht die Burschen, seht die Mannen
die Arme um die Riffe spannen!
Hört vom höchsten Stirnenriff den Schuss
des Jägers knallen!
Hört des frohen Jauchzers Gruss
aus sonnenvoller, hochbeglückter Brust
ins Tal hernieder hallen!
Doch sieh!
Das Sonnenschimmern flieht.
Schaut, schaut,
wie ob der Felsenstirne
das Wolkendüster graut!
Bebt ihr Herzen, bebt!
Ein grabesdunkler Schatten legt
sich um die Felsenfürstin her.
Es droht die Not.
Das Felsenantlitz lächelt,
lächelt immerfort,
lächelt starr und regungslos und kalt.
Sahst lächeln du den Tod?
Seht!
Schwarze Grabesschleier legt
die Fürstin um ihr Haupt.
Horcht, horcht,
wie aus dem Düster
die Donnerstimmen droh’n!
Weh, weh,
wie aus der schwarzen Wolkennacht
die Blitze nach dem Frasse züngelnd loh’n!
Dem Armen weh,
der dem Felsensturz
sein Haus vertraut zu Schirm und Schutz!
Dem in Nebelnacht Verirrten,
den das Lichterlächeln lockte
in das Felsgebirge!
Den Jägern, die in Todesbangen
an den Klippen hangen!
Wehe, weh,
wie finster ist die Nacht.
Wehe, weh,
wie’s Felsgebein erkracht.
Wehe, weh,
wie’s tost in den Schründen.
Wehe, Menschen, weh,
bereuet eure Sünden!
Wer weiss, wie lange
sich diese Schreckensstunde trug?
Wer weiss, wie bange
das Herz den Todgeweihten schlug?
Schliesst euch, ihr Augen,
seht nicht der Verzweiflung Grausen!
Die Nacht entflieht;
die Donnerstimmen sich verzieh’n.
Die Felsenfürstin schlägt den schwarzen Schleier
von ihrem Angesicht zurück.
Es lächelt,
lächelt starr und regungslos und kalt,
blickt stolz hinweg,
ob See und Tal und Trümmerfall,
hinüber zu den fernen
leuchtend kalten Firnen.
Das Mysterium
Es steht im violetten Düster
Stamm an Stamm im Waldesrund.
Wie still! Kein Lüftchen flüstert
aus dem geheimnisdunklen Grund.
Ein Sonnenstrahl! Wie Gold
es flammt von Ort zu Ort.
Mag’s schimmern noch so hold,
mich schauert ob dem Dunkel dort.
Der Sturm
Was sind das für Schatten, die sich werfen
in die siedende Luft,
aufs glühende Pflaster?
Dunkle Wolken rennend und hastend
am Himmel hin stürmen.
Wer treibt sie an, wer peitscht sie fort?
Sie türmen
sich in die Sonnenbahn.
Finster der Himmel.
Das Volk auf den Strassen läuft und wimmelt
ameisengleich von seinen Geschäften
um Ecken, durch Gassen und Gänge,
sich schiebend und drängend,
das heimische Nest zu erreichen.
Papierwische rascheln,
gleich Kobolden springend und zappelnd
die Strassen dahin
und kehren um,
im tollen Tanz sich zu drehen und zu schwingen
in närrischer Lust, als gingen
irre Geister in ihnen um.
Lauf, lauf, lauf!
Schau dich nicht um.
Dort hinter den Türmen steht
eine düstere, graue, unheimliche Wand;
sie geht, sie weht
und kommt heran!
Nur schnell nach Haus,
es bleibt nichts aus.
Schon wirbelt Staub;
das Windross tobt und schnaubt.
Hörst du es klatschen?
Grosse, schwere Tropfen platzen
auf dem Pflaster.
Dann alsbald eins, zwei, drei:
Ein Trommeln und Prasseln auf dem Hut.
Ja, ja! Das wäscht den Staub dir gut
von dem versengten Nacken!
Herbststurm
Sieh!
Am Horizont stehen
blutende Alpenspitzen;
entschleiert im Lichte sie blitzen.
Ihr Hohen,
wer hat euch den hüllenden Schleier geraubt?
Weh, weh!
Es drohen
finst’re Gestalten, eh man es geglaubt!
Flieht!
Es leuchtet zwischen den Wolken das Blau
wie ein Schimmern im angsterregten Aug‘.
Schau, sie weh’n.
Schon stürmen heran
verheerender Mächte finstere Knechte
auf Wolkenrossen!
Fühlst, wie die Erde zittert?
Hörst du das ferne Tosen?
Es fällt über uns, wie Nacht,
des Sturmes Macht
mit zermalmendem Stosse.
Schon hat sie in rasender Hast
die entlaubten Wipfel erfasst
und zerrt sie hin und her.
Wer will sich setzen zur Wehr?
Ast und Wipfel knackt
und fliegt zur Erde und kracht,
was das Leben morsch und krank gemacht.
Staubwolken fliegen.
Blätter in irrer Wucht zerstieben.
Am Fenster klatscht’s.
Wild rüttelt’s an Toren und Gittern
und kommt herein.
Die Menschen schlüpfen zitternd
in die Ecken hinein
und horchen, wie’s tobt und kracht,
und fühlen des Todes Macht,
die naht in den Wettern
furchtbar zerschmetternd
was alt und krank und siech.
Einst trifft sie auch dich!
Es stillt,
es lichtet
Des Sturmes Werk ist verrichtet.
Noch zittern die Bäume, wimmern.
Sieh im fahlen Schimmern
die unholde Macht dort zieh’n,
von dannen flieh’n!
Gefegt
ist Garten und Flur und Weg.
Komm, Winter, und decke mit deinem Tuch
jetzt alles zur Ruh‘.
Bedroht
Wasser wirbeln und quirlen und wallen
wie Schlangenleiber, die sich umschlingen, ringeln und ballen
und fauchen und stöhnen in Wut und Angst und zischen,
wenn ihre Ungestalten mit weissem Schaum
an einem Stein verspritzen.
Geheuer ist’s nicht an diesem Ort;
ich will fleih’n!
Felsen stellen sich vor,
wie ein feindliches Knie
am Weg, wo im Abgrund die Wasser toben.
Felsen bäumen sich beiderseits zu steilen Wänden.
Vom Himmel seh’ ich hoch oben nur
ein schmales, graues Gelände.
Felsen dräuen droben,
von unsichtbaren Händen gehalten,
um sich daran zu letzen,
wenn sie die Wasser voll Entsetzen
auseinander spritzen
oder sie loszulassen auf mich,
mich zermalmend zu einem elenden Brei?
Es klettert die halbe Wand empor mein Schrei
und kollert wieder
mir vor die Füsse nieder.
Die Quelle
Ein Wässerlein entquoll dem Grunde
in eines Haselstrauches Dunkel.
Man hörte in der stillen Runde
sein geheimnisvoll Gemunkel.
So hört‘ auch einst ich es verwundert
bei meinem knabenhaften Streifen
und staunte zu dem Grund hinunter,
das dunkle Rätsel zu begreifen.





























