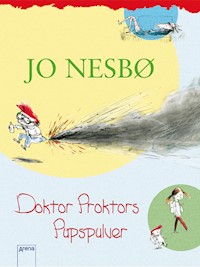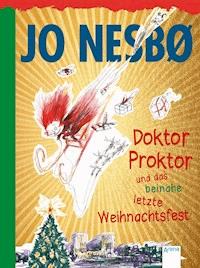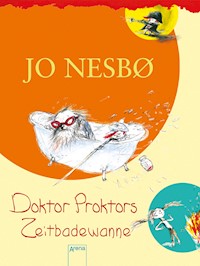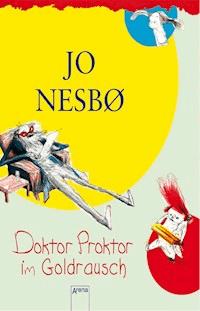5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Nesbøs bestes Buch.« FAS
Die Straßen sind voller Blut, Banden liefern sich unerbittliche Kämpfe, und Drogen überfluten die Stadt – Inspector Macbeth kennt seine Gegner nur allzu gut. Doch er ist unbestechlich, gerissen und klug. Er lässt einen Deal nach dem anderen hochgehen, die Drogenbosse beißen sich an ihm die Zähne aus. Aber irgendwann ist auch für ihn die Verlockung von Geld und Respekt zu stark, und sein größter Feind wird die erwachende Gier nach Macht. Doch er weiß, dass einer wie er niemals ganz nach oben gelassen wird. Außer – er tötet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 798
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Blut wird mit Blut bezahlt
Inspector Macbeth kennt seine Feinde nur allzu gut. Die Straßen sind voller Blut in der maroden Industriestadt im Norden. Die Norse Riders und die Männer von Hecate liefern sich unerbittliche Kämpfe um die Vormachtstellung, und Drogen überfluten die Stadt. Es gab Zeiten, da hat auch Macbeth sich täglich mit Brew abgeschossen, nun hat er nur noch ein Ziel vor Augen: die Banden zu zerschlagen. Irgendwann jedoch befriedigen ihn die Blutbäder nicht mehr. Angestachelt von seiner Geliebten, der früheren Prostituierten Lady, will er mehr: mehr Geld, Respekt, Macht. Aber ihm ist klar, dass sie einen wie ihn, der schon einmal ganz unten war, niemals nach oben kommen lassen – außer er schafft sie sich alle vom Hals …
»Weltklasse – Macbeth ist das Beste seiner Bücher!« Fædrelandsvennen
»Macbeth ist ein echter hard-boiled Nesbø, im Gewand eines Shakespeare-Dramas – Nesbøs Fans werden diesen Thriller lieben.« Bok 365
»Dieser Thriller zeigt aufs Neue: Jo Nesbø ist einfach der Beste!« The Independent
»Was Spannung und überraschende Volten angeht, ist Jo Nesbø zurzeit die unumstrittene Nummer eins - nicht nur im Norden.« Rheinische Post
Jo Nesbø, 1960 geboren, ist Ökonom, Journalist, Musiker und lebt in Oslo. Er zählt zu den renommiertesten und innovativsten Krimiautoren seiner Generation. Seine Bücher sind in über 50 Sprachen übersetzt, werden verfilmt, und von seinen Harry-Hole-Thrillern wurden allein im deutschsprachigen Raum über 5 Millionen Exemplare verkauft. Macbeth ist sein neuestes Buch, das in den skandinavischen Ländern, den USA und Großbritannien auf der Bestsellerliste steht.
JO NESBØ
MACBETH
THRILLER
Deutsch von André Mumot
Die englische Ausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Macbeth« bei Hogarth, einem Imprint der Penguin Random House Group, London.
Der Roman ist Teil der Reihe Hogarth Shakespeare.
Die deutsche Übersetzung von André Mumot folgt der englischen Übersetzung, die von Don Bartlett aus dem Norwegischen erstellt wurde.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen
von Penguin Books Limited und werden
hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © der Originalausgabe by Jo Nesbø 2018
Copyright © der englischen Übersetzung by Don Bartlett
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Diese Buch wurde vermittelt durch: Salomonsson Agency, Stockholm
Umschlag: Sabine Kwauka
Umschlagabbildung: plainpicture/Millenium/Maritz Verwey und shutterstock/Liderina
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-22080-8V005
www.penguin-verlag.de
I
1
Ein Regentropfen fiel schimmernd vom Himmel, durch die Dunkelheit und hinab auf die flackernden Lichter des Hafens. Kalte Nordwestböen trieben ihn über das ausgetrocknete Flussbett, das die Stadt der Länge nach teilte, und über die stillgelegte Bahnstrecke, die die Stadt diagonal durchschnitt. Die vier Quadranten der Stadt wurden im Uhrzeigersinn nummeriert; alles, was dahinter lag, hatte keinen Namen. Zumindest keinen, an den sich die Einwohner erinnert hätten. Und wenn man sie weit entfernt von zu Hause traf und sie fragte, woher sie kamen, behaupteten sie gern, sie könnten sich nicht einmal an den Namen ihrer Stadt erinnern.
Grau sah der schimmernde Regentropfen aus, als er in den Ruß und die giftigen Ausdünstungen eindrang, die wie ewiger Nebel über der Stadt hingen. Und das, obwohl die einheimischen Fabriken in den vergangenen Jahren nach und nach geschlossen worden waren und es sich die Arbeitslosen nicht mehr leisten konnten, ihre Öfen zu befeuern, obwohl der launenhafte Sturmwind keine Ruhe gab und es ununterbrochen regnete, angeblich seit jene zwei Atombomben den Zweiten Weltkrieg beendet hatten. Oder, anders gesagt: seit Kenneth zum Police Commissioner ernannt worden war. Von seinem Büro im obersten Stock des Polizeihauptquartiers hatte Chief Commissioner Kenneth die Stadt fünfundzwanzig Jahre lang mit eiserner Faust regiert, ohne sich darum zu kümmern, was der jeweilige Bürgermeister tat oder nicht tat oder was die jeweilige Regierung in Capitol sagte oder nicht sagte, sodass das zweitgrößte und wichtigste Industriezentrum des Landes in einem Morast aus Korruption, Bankrotten, Kriminalität und Chaos versank. Vor sechs Monaten hatte Chief Commissioner Kenneth in seinem Sommerhaus einen Schlaganfall erlitten und war drei Wochen später gestorben. Die Kosten für die Beerdigung hatte die Stadt übernommen – ein Ratsbeschluss, der vor langer Zeit von Kenneth persönlich angeregt worden war. Nach der Trauerfeier, die einem Diktator alle Ehre gemacht hätte, war von Stadtrat und Bürgermeister ein neuer Chief Commissioner berufen worden: Duncan, ein Bischofssohn mit breiter Stirn, der bislang in Capitol das Dezernat für Organisierte Kriminalität geleitet hatte. Die Bewohner der Stadt begannen zu hoffen. Es war eine überraschende Ernennung, schließlich gehörte Duncan nicht zu jenen Polizei-Urgesteinen, die wussten, wie man mit der Politik gemeinsame Sache macht, sondern zur neuen Generation gut ausgebildeter Beamter, die sich für Reformen, mehr Transparenz, Modernisierungen und den Kampf gegen Korruption einsetzten – was keineswegs auf die Mehrheit der Politiker im Stadtrat zutraf, denen es vor allem darum ging, schnell reich zu werden.
Die Hoffnung der Bürger, dass sie nun einen aufrechten, ehrlichen und visionären Chief Commissioner im Amt hatten, der die Stadt aus dem Sumpf ziehen konnte, wurde zusätzlich verstärkt, da Duncan die alte Garde der ranghöchsten Führungskräfte gegen seine eigene handverlesene Auswahl von Beamten ausgetauscht hatte. Junge, noch unbescholtene Idealisten, die tatsächlich alles daransetzten, dass man in dieser Stadt ein besseres Leben führen konnte.
Der Wind trug den Regentropfen über den Westteil von Distrikt 4 und über das höchste Gebäude der Stadt, den Funkturm auf dem Radiogebäude, in dem die einsame, stets empörte Stimme von Walt Kite kein R ungerollt ließ, während sie hoffnungsvoll verkündete, dass sie nun endlich einen Retter gefunden hatten. Zu Kenneths Lebzeiten war ausschließlich Kite mutig genug gewesen, den Chief Commissioner offen zu kritisieren und ihm einige seiner Verbrechen anzukreiden. An diesem Abend ließ Kite sich darüber aus, dass der Stadtrat derzeit alles tat, um die gewaltigen Befugnisse zurückzunehmen, mit denen Kenneth sich selbst ausgestattet hatte, um aus dem Police Commissioner den wahren Machthaber der Stadt zu machen. Paradoxerweise bedeutete das, dass sein Nachfolger – Duncan, der gute Demokrat – bei der Durchsetzung seiner überfälligen Reformen nun auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen würde. Kite fügte hinzu, dass bei der bevorstehenden Bürgermeisterwahl niemand gegen den Amtsinhaber Tourtell antreten wollte, »der auf seinem Stuhl klebt und nicht ohne Grund der fetteste Bürgermeister des Landes ist. Niemand! Denn wer könnte es schon mit unserer alten Schildkröte Tourtell aufnehmen? Von seinem Panzer aus volksnaher Jovialität und unbefleckter Moral prallt doch jede Kritik ab.«
Im östlichen Teil von Distrikt 4 trieb der Regentropfen über den Obelisken hinweg, ein Zwanzig-Stockwerke-Hotel aus Glas mitsamt Casino, das wie ein erhobener Zeigefinger aus dem bräunlichen Vier-Stockwerke-Elend hervorragte, aus dem die Stadt ansonsten bestand. Es schien vielen ein Widerspruch zu sein, aber je weniger Industrie und je mehr Arbeitslose es gab, desto beliebter war es unter den Einwohnern geworden, das Geld, das sie nicht hatten, in den zwei Casinos der Stadt zu verspielen.
»Die Stadt, die nichts mehr gibt, dafür umso lieber abkassiert«, ätzte Kite über den Äther. »Zuerst haben wir die Industrie stillgelegt, dann die Bahnstrecke, damit nur ja keiner mehr hier wegkommt. Dann haben wir angefangen, unseren Bürgern Drogen zu verkaufen – genau dort, wo sie früher ihre Bahnfahrkarten gekauft haben, damit wir sie ganz bequem abzocken können. Ich hätte nie geglaubt, dass ich das mal sagen würde, aber ich vermisse die profitgierigen Industriebosse. Die waren wenigstens in respektablen Branchen unterwegs. Heute dagegen gibt es nur drei Geschäftszweige, in denen man bei uns noch reich werden kann: die Casinos, die Drogen und die Politik.«
In Distrikt 3 wehte der regennasse Wind über das Polizeihauptquartier, das Inverness-Casino und die Straßen, in denen der Regen die meisten Leute in die Häuser getrieben hatte, auch wenn einige noch immer eilig nach Schutz suchten oder auf der Flucht zu sein schienen. Weiter wehte er über den Hauptbahnhof, an dem keine Züge mehr hielten oder abfuhren und der nur noch von Geistern und zwielichtigen Gestalten bevölkert wurde. Von den Geistern der Gründerväter und ihrer Nachfolger, die diese Stadt einst voller Selbstvertrauen errichtet hatten, im Glauben an den Wert harter Arbeit, an Gott und an ihre Technologie. Sowie von den Besuchern des Drogenmarktes, auf dem man sich rund um die Uhr seinen Stoff kaufen konnte, eine Fahrkarte zum Himmel und ganz sicher auch zur Hölle.
In Distrikt 2 heulte der Wind in den Schornsteinen der größten Fabriken der Stadt, die erst kürzlich hatten dichtmachen müssen, Graven und Estex. In beiden war eine Metalllegierung hergestellt worden, aber woraus sie eigentlich bestand, konnten nicht mal diejenigen sagen, die an den Brennöfen gearbeitet hatten. Man wusste nur, dass die Koreaner inzwischen in der Lage waren, dieselbe Legierung weit billiger zu produzieren. Vielleicht lag es am Klima, dass der Verfall der Stadt so offensichtlich war, vielleicht bildete man es sich nur ein; vielleicht schienen Bankrott und Ruin derart unausweichlich, dass Kite die stummen, toten Fabriken als »ausgeplünderte Kathedralen des Kapitalismus in einer Stadt der Verlierer und des Unglaubens« bezeichnete.
Der Wind wehte in den Südosten, über Straßen mit zerschlagenen Laternen, in denen sich wachsame Schakale zum Schutz vor dem endlosen Niederschlag gegen Hauswände drückten, während ihre Beute ins Licht und damit in trügerische Sicherheit huschte. Erst kürzlich hatte Kite Chief Commissioner Duncan in einem Interview gefragt, warum das Risiko, überfallen und ausgeraubt zu werden, hier sechsmal höher war als in Capitol. Er sei froh, endlich mal eine einfache Frage gestellt zu bekommen, hatte Duncan erwidert. Es liege daran, dass die Zahl der Arbeitslosen sechsmal und die der Drogenkonsumenten zehnmal höher sei.
An den Docks standen mit Graffiti beschmierte Container, und die Kapitäne der heruntergekommenen Frachter steckten den korrupten Hafenbeamten an verlassenen Orten braune Umschläge zu, um sich einen Liegeplatz und raschere Abwicklung zu sichern. Summen, die die Reedereien unter »Sonstige Ausgaben« abrechneten, während sie sich schworen, nie wieder in dieser Stadt Geschäfte zu machen.
Eines dieser Schiffe war die MS Leningrad, ein sowjetischer Frachter, dessen Rumpf derart verrostet war, dass er im Regen aussah, als blute er ins Hafenbecken.
Der Regentropfen fiel in den Lichtkegel einer Lampe auf dem Dach eines zweistöckigen Holzgebäudes, das ein Lager, ein Büro und einen geschlossenen Boxclub beherbergte. Noch tiefer fiel der Tropfen zwischen der Hauswand und dem rostigen Schiffsrumpf und landete schließlich auf dem Horn eines Stiers. Er rann an dem Horn hinab auf den dazugehörigen Motorradhelm, den Helm hinunter und über den Rücken einer Lederjacke, auf die in gotischen Buchstaben die Worte NORSE RIDERS gestickt waren. Bis hinunter auf den Sitz eines roten Indian-Chief-Motorrads und schließlich in die Nabe seines sich langsam drehenden Hinterrads. Hier hörte er auf, ein Regentropfen zu sein, wurde wieder ausgespien und Teil des Schmutzwassers, das die gesamte Stadt bedeckte.
Hinter dem roten Motorrad folgten elf weitere. Sie fuhren unter einer der Lampen vorbei, die an der Wand eines zweistöckigen Hafengebäudes angebracht waren.
Das Licht der Lampe fiel durch das Fenster eines Handelsbüros im ersten Stock auf eine Hand, die auf einem Plakat ruhte: MS GLAMIS SUCHT KOMBÜSENPERSONAL. Die Finger waren lang und dünn, wie die eines Konzertpianisten, und die Nägel sauber manikürt. Auch wenn das Gesicht des Mannes im Schatten lag und man die intensiven blauen Augen nicht sehen konnte, stach das resolute Kinn hervor, die dünnen, verbissenen Lippen und die Nase, die aussah wie ein aggressiver Schnabel. Die Narbe, die vom Kiefer diagonal bis zur Stirn hinaufwanderte, leuchtete hell wie eine Sternschnuppe.
»Sie sind da«, sagte Inspector Duff, Leiter des Rauschgiftdezernats, in der Hoffnung, dass seine Leute das unwillkürliche Vibrato seiner Stimme überhören würden. Er war davon ausgegangen, dass die Norse Riders drei bis vier Männer schicken würden, maximal fünf, um den Stoff zu holen. Aber in der Prozession, die langsam aus der Dunkelheit auftauchte, zählte er zwölf Motorräder. Die beiden hintersten verfügten auch noch über einen Soziussitz. Vierzehn Männer gegen seine neun. Außerdem konnte man davon ausgehen, dass die Norse Riders bewaffnet waren. Schwer bewaffnet. Trotzdem war es nicht die Überzahl, die das Zittern seiner Stimmbänder verursacht hatte. Es war die Tatsache, dass Duffs sehnlichster Wunsch in Erfüllung ging. Die Tatsache, dass er den Konvoi anführte; endlich war er zum Greifen nahe.
Der Mann hatte sich seit Monaten nicht blicken lassen, aber es gab nur einen, der diesen Helm trug und das rote Indian-Chief-Motorrad fuhr. Gerüchten zufolge gehörte es zu den fünfzig Maschinen, die das New York Police Department 1955 unter strenger Geheimhaltung hatte anfertigen lassen. Der Stahl der geschwungenen Säbelscheide, die an der Seite des Motorrads angebracht war, blitzte auf.
Sweno.
Manche behaupteten, er sei längst tot, andere, er sei außer Landes geflohen, habe seine Identität geändert, die blonden Zöpfe abgeschnitten und sitze auf einer terrazza in Argentinien, um seine alten Tage und bleistiftdünne Zigarillos zu genießen.
Aber hier war er. Der Anführer der Gang, der Polizistenmörder, der, zusammen mit seinem Sozius, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg die Norse Riders gegründet hatte. Damals hatten sie entwurzelte junge Männer rekrutiert, von denen die meisten aus den baufälligen Häusern der Fabrikarbeiter stammten, die an den Ufern des von Abwässern vergifteten Flusses standen. Sie hatten sie ausgebildet, diszipliniert und ihr Gehirn gewaschen, bis sie zu einer Armee furchtloser Soldaten geworden waren, die Sweno nach Belieben für seine Zwecke einsetzen konnte. Um die Kontrolle nicht nur über die Stadt, sondern auch über den wachsenden Drogenmarkt zu gewinnen. Eine Weile hatte es tatsächlich ausgesehen, als hätte Sweno Erfolg. Von Kenneth und dem Polizeihauptquartier waren ihm jedenfalls keine Steine in den Weg gelegt worden, eher im Gegenteil: Sweno hatte sich all die Hilfe erkauft, die er brauchen konnte. Die Probleme kamen mit der Konkurrenz. Hecates hausgemachter Stoff, das sogenannte Brew, war viel besser, billiger und jederzeit auf dem Markt verfügbar.
Wenn man dem anonymen Tipp, den Duff bekommen hatte, Glauben schenken konnte, war die heutige Lieferung allerdings groß genug, um die Nachschubprobleme der Norse Riders für lange Zeit zu lösen. Duff hatte es gehofft, aber nicht wirklich geglaubt, dass in dem Brief, den er erhalten hatte, die Wahrheit stand. Es war als Geschenk zu schön, um wahr zu sein. Ein Geschenk, das – wenn man sich geschickt anstellte – den Chef des Rauschgiftdezernats die Karriereleiter ein gutes Stück hinaufbefördern konnte. Chief Commissioner Duncan hatte immer noch nicht alle wichtigen Posten im Hauptquartier besetzt. Im Bandendezernat zum Beispiel klebte immer noch Inspector Cawdor, einer von Kenneths alten Schergen, auf seinem Stuhl, da es nach wie vor keine eindeutigen Beweise für seine Bestechlichkeit gab. Aber das war nur eine Frage der Zeit. Und Duff gehörte zu Duncans Männern. Als erste Stimmen laut geworden waren, dass Duncan womöglich Chief Commissioner werden würde, hatte Duff ihn sofort in Capitol angerufen. Vielleicht hatte es sich etwas wichtigtuerisch angehört, aber er hatte ihm versichert, dass er kündigen werde, sollte der Stadtrat nicht Duncan, sondern einen von Kenneths alten Handlangern zum neuen Commissioner bestimmen. Es war durchaus denkbar, dass Duncan hinter der uneingeschränkten Loyalitätsbekundung eigennützige Motive erkannt hatte – aber na und? Duff hatte wirklich das Bedürfnis, Duncan beim Aufbau einer vertrauenswürdigen Polizei zu unterstützen, die den Bürgern diente, ganz im Ernst. Aber er wünschte sich auch ein Büro im Hauptquartier, dem Himmel so nah wie möglich. Wer konnte es ihm verübeln? Außerdem wollte er unbedingt den Mann da draußen einen Kopf kürzer machen.
Sweno.
Er war das Mittel und der Zweck.
Duff schaute auf seine Uhr. Der Zeitpunkt stimmte mit dem aus dem Brief auf die Minute überein. Er legte sich die Fingerspitzen aufs Handgelenk, fühlte seinen Puls. Er hoffte nicht mehr, jetzt glaubte er es selbst.
»Sind es viele, Duff?«, flüsterte eine Stimme.
»Mehr als genug für eine große Ehrung, Seyton. Und einer von ihnen ist so groß – man wird’s im ganzen Land hören, wenn er umfällt.«
Duff wischte die beschlagene Scheibe frei. Zehn nervöse, schwitzende Polizeibeamte in einem kleinen Raum. Männer, die solche Einsätze normalerweise nicht bestritten. Als Leiter des Rauschgiftdezernats hatte Duff eigenmächtig entschieden, den Brief keinem der anderen Dienstgruppenleiter zu zeigen. Für diesen Einsatz benutzte er ausschließlich Männer seiner eigenen Einheit. Sie hatten einfach zu viele schlechte Erfahrungen mit korrupten Beamten und undichten Stellen gemacht, um das Risiko einzugehen. Das zumindest hätte er Duncan auf Nachfrage gesagt. Aber er würde sich am Ende keine großen Ausreden einfallen lassen müssen. Nicht, wenn sie die Drogen beschlagnahmen und dreizehn Norse Riders auf frischer Tat ertappen konnten.
Dreizehn, ja. Nicht vierzehn. Einer würde auf dem Schlachtfeld fallen. Wenn sich die Chance ergab.
Duff biss die Zähne zusammen.
»Sie haben doch gesagt, es wären nur vier oder fünf«, sagte Seyton, der sich neben ihn ans Fenster gestellt hatte.
»Besorgt, Seyton?«
»Nein, aber Sie sollten es sein, Duff. Sie haben neun Männer hier im Raum. Und ich bin der Einzige, der sich mit Observierungen auskennt.« Er sprach, ohne die Stimme zu heben. Er war ein schlanker, sehniger, glatzköpfiger Mann. Duff war sich nicht sicher, wie lange er schon im Polizeidienst war, nur dass er schon zur Truppe gehört hatte, als Kenneth noch Chief Commissioner gewesen war. Duff hatte versucht, Seyton loszuwerden. Nicht, weil er etwas Konkretes vorbringen konnte, der Mann hatte bloß irgendwas an sich. Duff konnte es nicht klar benennen, es löste aber eine starke Antipathie bei ihm aus.
»Warum haben Sie das SWAT-Team nicht herbeordert, Duff?«
»Je weniger beteiligt sind, desto besser.«
»Desto weniger, die Ihnen den Ruhm streitig machen. Denn wenn ich mich nicht sehr irre, ist das entweder Swenos Geist da draußen oder Sweno höchstpersönlich.« Seyton nickte in Richtung des Indian-Chief-Motorrads, das vor der Gangway der MS Leningrad gehalten hatte.
»Haben Sie Sweno gesagt?«, fragte eine nervöse Stimme aus der Dunkelheit hinter ihnen.
»Ja, und da sind mindestens ein Dutzend Männer«, erwiderte Seyton lauter und ohne den Blick von Duff abzuwenden. »Mindestens.«
»Ach du Scheiße«, murmelte eine zweite Stimme.
»Sollten wir nicht Macbeth verständigen?«, fragte eine dritte.
»Hören Sie?«, sagte Seyton. »Selbst Ihre eigenen Männer wollen, dass das SWAT-Team übernimmt.«
»Halten Sie die Klappe!«, zischte Duff. Er drehte sich um und zeigte auf das Poster an der Wand. »Hier steht’s: Die MS Glamis legt am Freitag um 0600 nach Capitol ab, und in der Kombüse werden noch Leute gesucht. Ihr habt euch freiwillig für diesen Einsatz gemeldet. Aber ich gebe euch meinen Segen – meinetwegen könnt ihr gerne auf dem Kahn anheuern. Die Bezahlung und das Essen sollen sowieso besser sein. Gebt einfach ein Handzeichen, wer möchte?«
Duff spähte zu den gesichtslosen, unbeweglichen Gestalten in der Dunkelheit hinüber. Er bereute bereits, sie herausgefordert zu haben. Was, wenn jetzt tatsächlich einer die Hand hob? Normalerweise vermied er Situationen, in denen er von anderen abhängig war, aber jetzt brauchte er jeden einzelnen von ihnen. Seine Frau sagte, dass er deshalb am liebsten allein arbeitete, weil er Menschen nicht mochte. Womöglich stimmte das zum Teil, aber in Wahrheit war es wohl eher umgekehrt. Die Menschen mochten ihn nicht. Nicht, dass alle ihn bewusst nicht leiden konnten (auch wenn das auf manche zutraf), es lag nur etwas in seiner Persönlichkeit, das die Leute abschreckte. Er wusste allerdings nicht, was. Immerhin war ihm bewusst, dass sein Äußeres und sein Selbstbewusstsein einen bestimmten Typ Frau durchaus anzog. Außerdem war er höflich, gebildet und intelligenter als die meisten Männer, die er kannte.
»Niemand? Wirklich? Gut, dann setzen wir jetzt den Plan um wie abgesprochen, mit nur einigen kleinen Anpassungen. Seyton hält sich mit seinen drei Männern rechts, wenn wir rauskommen, und nimmt ihre Nachhut ins Visier. Ich gehe mit meinen drei Leuten nach links. Siwart, Sie sprinten nach links, raus aus dem Licht, und schlagen im Dunkeln einen Bogen, bis Sie hinter den Norse Riders sind. Sie stellen sich auf der Gangway auf, sodass niemand auf das Schiff flüchten kann. Alles verstanden?«
Seyton räusperte sich. »Siwart ist der Jüngste von uns und …«
»… der Schnellste«, unterbrach ihn Duff. »Ich habe nicht um Einwände gebeten. Ich habe gefragt, ob meine Anweisungen verstanden wurden.« Er ließ seinen Blick über die ausdruckslosen Gesichter schweifen. »Das nehme ich mal als Ja.« Er wandte sich wieder dem Fenster zu.
Ein kleiner, o-beiniger Mann mit weißer Kapitänsmütze kam im strömenden Regen die Gangway heruntergeschlurft und blieb vor dem Mann auf dem roten Motorrad stehen. Der Fahrer hatte seinen Helm nicht abgenommen, bloß das Visier hochgeklappt. Auch den Motor hatte er nicht abgestellt. Er saß mit obszön gespreizten Beinen auf dem Sattel und hörte dem Kapitän zu. Unter dem Helm waren zwei blonde Zöpfe zu sehen, die über das Norse-Rider-Logo hingen.
Duff atmete tief ein. Überprüfte seine Waffe.
Das Schlimmste war, dass Macbeth ihn tatsächlich angerufen hatte. Er hatte ebenfalls einen anonymen Anruf erhalten mit demselben Tipp und Duff sein SWAT-Team angeboten. Doch Duff hatte abgelehnt. Sie müssten ja bloß einen Lastwagen abholen, hatte er erwidert und Macbeth gebeten, den Tipp geheim zu halten.
Auf ein Signal des Mannes mit dem Wikingerhelm trat einer der anderen Motorradfahrer nach vorn. Duff sah die Sergeant-Streifen auf dem Oberarm seiner Lederjacke, als der Motorradfahrer vor dem Schiffskapitän eine Aktentasche öffnete. Der Kapitän nickte, hob einen Arm, und eine Sekunde später war das Kreischen von Eisen zu hören. In dem Kran, der nun seinen Arm vom Kai herüberschwang, tauchte ein Licht auf.
»Gleich ist es so weit«, sagte Duff. Seine Stimme klang jetzt fester. »Wir warten, bis der Stoff und das Geld die Besitzer gewechselt haben, dann schlagen wir zu.«
Stummes Nicken im Halbdunkel. Sie hatten den Plan minutiös durchgesprochen, waren aber von maximal fünf Kurieren ausgegangen. War es möglich, dass Sweno einen Hinweis bekommen hatte, dass er vor einem möglichen Zugriff gewarnt worden war? Waren die Norse Riders deshalb in so hoher Zahl hier aufgetaucht? Nein. In dem Fall hätten sie die Sache einfach abgeblasen.
»Können Sie’s riechen?«, flüsterte Seyton neben ihm.
»Was riechen?«
»Ihre Angst.« Seyton hatte die Augen geschlossen, seine Nasenflügel zitterten. Duff starrte in die Regennacht hinaus. Ob er Macbeths Angebot, das SWAT-Team zu schicken, jetzt doch angenommen hätte? Duff fuhr sich mit seinen langen Fingern übers Gesicht, die diagonale Narbe hinab. Es nützte nichts mehr, sich darüber Gedanken zu machen, er musste handeln. Sweno war jetzt hier, und Macbeth und seine SWAT-Leute schliefen tief und fest in ihren Betten.
Macbeth lag auf dem Rücken und gähnte. Er lauschte auf den prasselnden Regen. Fühlte sich steif und drehte sich auf die Seite.
Ein weißhaariger Mann hob die Plane an und kroch herein. Zitternd und fluchend kauerte er sich in der Dunkelheit zusammen.
»Nass geworden, Banquo?«, fragte Macbeth und stützte seine Handflächen auf die raue Dachpappe unter sich.
»In diesem Pissloch von Stadt zu leben, ist wirklich das Letzte für einen gichtgeplagten alten Mann wie mich. Ich sollte meine Pension einkassieren und aufs Land ziehen. Mir ein kleines Haus in Fife zulegen oder auf einer Veranda sitzen, irgendwo da draußen, wo die Sonne scheint, die Bienen summen und die Vögel singen.«
»Statt mitten in der Nacht auf einem Dach im Containerhafen zu hocken? Das kann doch nicht dein Ernst sein?«
Sie lachten leise.
Banquo schaltete eine Stiftleuchte ein. »Das hier wollte ich dir zeigen.«
Macbeth nahm die Leuchte und hielt sie über die Zeichnung, die Banquo ihm reichte.
»Das ist das Gatling-Maschinengewehr. Eine echte Schönheit, oder?«
»Nicht das Aussehen ist das Problem, Banquo.«
»Zeig es Duncan. Erklär ihm, dass das SWAT-Team diese Waffe braucht. Und zwar jetzt.«
Macbeth seufzte. »Er will es nicht.«
»Sag ihm, dass wir immer die Verlierer sein werden, solange Hecate und die Norse Riders schwerere Waffen haben als wir. Erklär ihm, was ein Gatling-Gewehr kann. Erklär ihm, was zwei können!«
»Duncan wird keinerlei Aufrüstung zustimmen, Banquo. Und ich glaube, er hat recht. Seit er Commissioner ist, hat es tatsächlich weniger Schießereien gegeben.«
»Die Einwohnerzahl dieser Stadt wird immer noch von der Kriminalität dezimiert.«
»Es ist ein Anfang. Duncan hat einen Plan. Und was er vorhat, ist richtig.«
»Ja, ja, dagegen sag ich ja gar nichts. Duncan ist ein guter Mann.« Banquo stöhnte auf. »Aber naiv ist er. Mit so einer Waffe könnten wir endlich aufräumen und …«
Sie wurden von einem Klopfen an der Plane unterbrochen. »Sie haben mit dem Abladen begonnen, Sir.« Leichtes Lispeln. Es war der junge neue Scharfschütze im SWAT-Team, Olafson. Außer ihm war noch der ebenso junge Angus anwesend, sie waren also nur zu viert vor Ort. Doch Macbeth wusste, alle fünfundzwanzig SWAT-Beamten hätten sich, ohne zu zögern, bereit erklärt, hier mit ihnen zu sitzen und zu frieren.
Macbeth schaltete die Leuchte aus, gab sie Banquo zurück und schob die Zeichnung in die Innentasche seiner schwarzen SWAT-Lederjacke. Dann zog er die Plane beiseite und robbte auf dem Bauch bis zur Dachkante vor.
Banquo kroch an seine Seite.
Vor ihnen, über dem Deck der MS Leningrad, schwebte am Haken des Krans ein vorsintflutlich aussehender militärgrüner Lastwagen im Flutlicht, über dessen Ladefläche eine Plane gebreitet war.
»Ein ZIS-5«, flüsterte Banquo.
»Aus dem Krieg?«
»Ja. Das S steht für Stalin. Was denkst du?«
»Ich denke, die Norse Riders haben mehr Männer hier, als Duff erwartet hat. Sweno scheint sich Sorgen zu machen.«
»Glaubst du, er ahnt, dass die Polizei einen Tipp bekommen hat?«
»Nein, dann wäre er nicht selbst hergekommen. Er hat Angst vor Hecate. Er weiß, dass Hecate größere Ohren und Augen hat als wir.«
»Und was machen wir jetzt?«
»Wir warten ab und beobachten. Vielleicht schafft Duff es ja, die Sache selbst durchzuziehen. In dem Fall greifen wir nicht ein.«
»Soll das heißen, du hast die Jungs mitten in der Nacht hergeschleift, damit sie hier bloß rumsitzen und beobachten?«
Macbeth gluckste leise. »Sie haben sich freiwillig gemeldet. Ich hab ihnen gleich gesagt, dass es langweilig werden könnte.«
Banquo schüttelte den Kopf. »Du hast zu viel Freizeit, Macbeth. Du solltest dir mal ’ne Familie zulegen.«
Macbeth hob die Hände. Sein Lächeln erhellte sein breites Gesicht mit dem dunklen Bart. »Du und die Jungs, ihr seid meine Familie, Banquo. Was brauch ich denn sonst noch?«
Olafson und Angus kicherten fröhlich hinter ihnen.
»Wann wird dieser Junge bloß endlich erwachsen?«, murmelte Banquo verzweifelt und wischte den Regen vom Visier seines Remington-700-Gewehrs.
Bonus lag die Stadt zu Füßen. Die Fensterscheibe vor ihm reichte vom Boden bis zur Decke, und hätte die Wolkendecke nicht so tief gehangen, er wäre imstande gewesen, die gesamte Stadt zu überblicken. Er streckte seine Hand mit dem Champagnerglas aus, und sofort eilte einer der zwei Jungen in Reiterhosen und weißen Handschuhen herbei und schenkte nach. Er sollte weniger trinken, das wusste er. Der Champagner war teuer, doch er musste ihn ja nicht bezahlen. Der Arzt hatte ihm gesagt, ein Mann in seinem Alter sollte so langsam seine Lebensweise überdenken. Aber der Champagner war zu gut. Ja, so einfach war das. Er war zu gut. Genau wie die Austern und die Krebsschwänze. Der weiche, tiefe Sessel. Und die Jungs. Nicht, dass sie ihm zur Verfügung gestanden hätten. Andererseits hatte er nicht gefragt.
Er war am Empfang des Obelisken abgeholt und hinauf in die Penthouse-Suite im obersten Stock gebracht worden. Hier hatte er freie Sicht auf den Hafen und den Hauptbahnhof auf der einen Seite sowie auf den Worker’s Square und das Inverness auf der anderen. Begrüßt hatte ihn der große Mann mit den weichen Wangen, dem freundlichen Lächeln, dem dunklen welligen Haar und den kalten Augen. Der Mann, den man Hecate nannte. Oder die Unsichtbare Hand.Unsichtbar, weil nur wenige Menschen ihn je zu Gesicht bekommen hatten. Und Hand, weil in den vergangenen zehn Jahren die meisten Menschen in dieser Stadt auf die ein oder andere Weise von seinen Aktivitäten berührt worden waren. Oder besser gesagt, von seinem Produkt. Einer synthetischen Droge, die er selbst herstellte und Brew nannte. Und die, nach Bonus’ grober Schätzung, Hecate wohl zu einem der vier reichsten Männer der Stadt gemacht hatte.
Hecate wandte sich von dem Teleskop ab, das vor dem Fenster aufgebaut war. »Bei dem Regen kann man nicht viel erkennen«, sagte er, rückte die Träger seiner Jagdhosen zurecht und zog eine Pfeife aus dem Tweedjackett, das über der Lehne seines Stuhls hing. Wenn ich gewusst hätte, dass hier heute Abend alle im Stil einer englischen Jagdgesellschaft herumlaufen, hätte ich mir gewiss nicht meinen langweiligen Alltagsanzug angezogen, dachte Bonus.
»Aber der Kran bewegt sich, das bedeutet, dass sie abladen. Ist das Essen zu Ihrer Zufriedenheit, Bonus?«
»Alles ist ausgezeichnet«, sagte Bonus und nippte am Champagner. »Aber ich muss gestehen, ich bin mir ein wenig unsicher, was wir eigentlich feiern. Und womit ich die Einladung verdient habe.«
Hecate lachte, hob seinen Spazierstock und wies damit zum Fenster. »Wir feiern die gute Aussicht, meine liebe Flunder. Da Sie sich nur auf dem Meeresgrund herumtreiben, kennen Sie die Welt doch nur von unten.«
Bonus lächelte. Ihm wäre niemals in den Sinn gekommen, sich so eine Bezeichnung zu verbitten. Der große Mann hatte zu viel Macht, konnte zu viel Gutes für ihn tun. Und weniger Gutes.
»Die Welt ist schöner von hier oben«, fuhr Hecate fort. »Nicht realer, aber schöner. Und dann feiern wir natürlich dies.« Der Stock zeigte auf den Hafen.
»Und das wäre?«
»Die größte Lieferung, die je illegal bei uns gelandet ist, lieber Bonus. Viereinhalb Tonnen reines Amphetamin. Sweno hat alles investiert, was sein Club aufbringen kann, und noch ein wenig mehr. Dort unten sehen Sie einen Mann, der alles auf eine Karte setzt.«
»Warum sollte er das tun?«
»Weil er verzweifelt ist natürlich. Er weiß genau, dass die mittelmäßige türkische Ware der Riders von meinem Brew völlig in den Schatten gestellt wird. Aber mit einer solchen Menge von erstklassigem sowjetischem Speed, dem entsprechenden Mengenrabatt und den verminderten Transportkosten wird sein Stoff im Preis und der Qualität endlich wettbewerbsfähig werden.« Hecate ließ den Stock auf dem dicken Teppich ruhen, mit dem der gesamte Boden ausgelegt war, und strich liebevoll über den vergoldeten Griff. »Das hat Sweno gut kalkuliert. Wenn er Erfolg hat, wird er die Machtverhältnisse dieser Stadt aus dem Gleichgewicht bringen. Also, stoßen wir an auf unseren ehrenwerten Konkurrenten.«
Er hob das Glas, und Bonus folgte gehorsam seinem Beispiel. Aber gerade als er es an seine Lippen setzen wollte, musterte Hecate das Glas mit einer gehobenen Braue, zeigte auf etwas und reichte es zurück an einen der Jungs, der es sofort mit seinem Handschuh säuberte.
»Es ist nur Swenos Pech«, fuhr Hecate fort, »dass es so schwer ist, eine derartig große Lieferung von einer völlig neuen Quelle zu beziehen, ohne dass ein Mitbewerber davon Wind bekommt. Und leider sieht es so aus, als hätte jemand der Polizei einen anonymen, aber sehr glaubwürdigen Tipp gegeben, wann und wo die Sache über die Bühne gehen soll.«
»Jemand wie Sie?«
Hecate grinste. Nahm das Glas, wandte Bonus seinen breiten Hintern zu und beugte sich zum Teleskop hinunter. »Jetzt senken sie den Laster ab.«
Bonus erhob sich und trat ans Fenster. »Sagen Sie, warum haben Sie keinen Überfall auf Sweno angeordnet, statt nur aus der Ferne zuzusehen? Dann wären Sie Ihren einzigen Konkurrenten losgeworden und hätten sich mit einem Schlag auch noch viereinhalb Tonnen bestes Amphetamin unter den Nagel gerissen. Das hätten Sie schließlich auch selbst für viele Millionen auf der Straße absetzen können.«
Hecate nippte an seinem Glas, ohne das Auge vom Teleskop abzuwenden. »Krug«, sagte er. »Soll der beste Champagner sein. Deshalb trinke ich ausschließlich diesen. Aber wer weiß? Hätte man mir irgendwann einen anderen serviert, vielleicht wäre ich auf den Geschmack gekommen und hätte die Marke gewechselt.«
»Sie wollen nicht, dass die Konsumenten irgendetwas anderes als Brew ausprobieren?«
»Meine Religion heißt Kapitalismus, und der freie Markt ist mein Glaubensbekenntnis. Aber jeder hat das Recht, seiner Natur zu folgen und um ein Monopol und die Vormachtstellung zu kämpfen. Und die Gesellschaft hat die Pflicht, sich uns entgegenzustellen. Wir spielen alle bloß unsere Rollen, Bonus.«
»Amen.«
»Schh! Jetzt übergeben sie das Geld.« Hecate rieb sich die Hände. »Showtime …«
Duff stand an der Vordertür, hatte die Finger bereits auf den Türgriff gelegt und lauschte auf seinen eigenen Atem, während er versuchte, Blickkontakt zu seinen Männern herzustellen. Sie standen aufgereiht hintereinander auf der engen Treppe unmittelbar in seinem Rücken. Allesamt hoch konzentriert, entsicherten sie ihre Waffen. Flüsterten ihrem Nebenmann noch einen letzten Rat zu. Sprachen ein letztes Gebet.
»Der Koffer ist übergeben worden«, rief Seyton vom ersten Stock.
»Jetzt!«, brüllte Duff, stieß die Tür auf und presste sich gegen die Mauer.
Die Männer stürmten an ihm vorbei in die Dunkelheit. Duff folgte ihnen. Spürte den Regen auf seinem Kopf. Sah die sich bewegenden Gestalten. Zwei Motorräder, die davonbrausten. Hob das Megafon an seine Lippen.
»Polizei! Bleiben Sie, wo Sie sind, und heben Sie die Hände über den Kopf! Ich wiederhole, hier spricht die Polizei! Bleiben Sie, wo …«
Der erste Schuss zerschmetterte die Glasscheibe in der Tür hinter ihm, der zweite sauste spürbar an seinem Hosenbein vorbei. Was er dann hörte, klang wie das Popcorn, das seine Kinder manchmal samstagabends im Topf knallen ließen. Automatische Waffen. Verdammt.
»Feuer!«, brüllte Duff und schleuderte das Megafon zu Boden. Er ließ sich auf den Bauch fallen, versuchte, seine Waffe zu heben und bemerkte erst jetzt, dass er in einer Pfütze gelandet war.
»Nicht«, flüsterte eine Stimme neben ihm. Duff schaute auf. Es war Seyton. Er stand unbeweglich da und hatte sein Gewehr nicht mal erhoben. Sabotierte er den Einsatz? War er …?
»Sie haben Siwart«, flüsterte Seyton.
Duff blinzelte, um das Dreckwasser aus seinen Augen zu bekommen, und sah, dass einer der Norse Riders noch immer auf ihn zielte. Aber der Mann saß seelenruhig auf seinem Motorrad und feuerte keinen Schuss ab. Was zur Hölle ging hier vor?
»Keiner rührt einen Finger, dann wird auch nichts passieren.«
Die tiefe Stimme kam von jenseits des Lichtkegels und brauchte kein Megafon. Duff bemerkte das verlassene Indian-Chief-Motorrad und sah erst dann zwei Gestalten, die in der Dunkelheit zu einer verschmolzen. Vom Helm der größeren ragten die beiden Hörner auf. Die Gestalt, die der Mann vor sich herschob, war einen Kopf kleiner – und hatte beste Aussichten, demnächst noch einen weiteren Kopf kürzer gemacht zu werden. Die Klinge des Säbels blitzte auf, als Sweno sie dem jungen Siwart an die Kehle presste.
Duff rappelte sich auf, versuchte, auf die Füße zu kommen.
»An Ihrer Stelle würde ich in der Pfütze bleiben, Duff«, flüsterte Seyton. »Sie haben uns schon tief genug in die Scheiße geritten.«
Duff atmete ein. Und wieder aus. Wieder ein. Scheiße, Scheiße, Scheiße.
»Und jetzt?«, fragte Banquo und hielt das Fernglas auf die Protagonisten unten am Kai gerichtet.
»Wie’s aussieht, müssen wir unseren Nachwuchs doch noch in Gang setzen«, sagte Macbeth. »Aber noch nicht sofort. Wir lassen Sweno und seine Leute erst mal einen Abgang machen.«
»Was? Wir lassen sie mit dem Laster und dem ganzen Stoff davonkommen?«
»Das hab ich nicht gesagt, lieber Banquo. Aber wenn wir jetzt eingreifen, haben wir ein Blutbad da unten. Angus?«
»Sir?« Die Reaktion kam unverzüglich. Dem jungen Mann mit den tiefblauen Augen und dem langen blonden Haar, das ihm außer Macbeth wohl kein Vorgesetzter gestattet hätte, standen seine Gefühle überdeutlich ins Gesicht geschrieben. Angus und Olafson hatten die entsprechende Ausbildung, ihnen fehlte jedoch die Erfahrung. Insbesondere Angus musste noch abgehärtet werden. Während des Bewerbungsgesprächs hatte er berichtet, dass er eine Ausbildung zum Priester abgebrochen hatte, als ihm klar geworden war, dass es keinen Gott gab; die Menschen konnten sich nur selber retten, also hatte er sich dazu entschieden, Polizist zu werden. Macbeth hatte dieser Grund genügt. Ihm gefiel die furchtlose Haltung, ihm gefiel der Junge, der aus seinen Überzeugungen Konsequenzen zog. Aber Angus musste noch lernen, seine Gefühle zu beherrschen und zu begreifen, dass es im SWAT-Team um den praktischen Einsatz ging, dass sie der lange und zuweilen grobe Arm des Gesetzes waren. Um tiefgründige Reflexionen mussten sich andere kümmern.
»Gehen Sie hinten runter, holen Sie den Wagen und halten Sie sich an der Tür bereit.«
»Jawohl«, sagte Angus, stand auf und verschwand.
»Olafson?«
»Ja?«
Macbeth warf ihm einen Blick zu. Als Olafson damals zu ihm gekommen war und ihn förmlich bekniet hatte, ins Team aufgenommen zu werden, hatten das schlaffe Kinn, das Lispeln, die halb geschlossenen Augen und seine Noten auf der Polizeischule Macbeth zweifeln lassen. Aber der Junge hatte die Versetzung unbedingt gewollt, also hatte Macbeth sich entschlossen, ihm eine Chance zu geben. So wie man ihm selbst seinerzeit auch eine Chance gegeben hatte. Macbeth brauchte einen Scharfschützen, und wenn Olafson auch in der Theorie kein Ass war, war er doch überaus treffsicher.
»Bei der letzten Schießübung haben Sie den zwanzig Jahre alten Rekord gebrochen, den der Kollege da drüben aufgestellt hatte.« Macbeth nickte in Banquos Richtung. »Gratulation, eine verdammt beeindruckende Leistung. Sie wissen, was das hier und jetzt bedeutet?«
»Ähm … nein, Sir.«
»Gut, es bedeutet nämlich gar nichts. Hier müssen Sie lediglich die Augen aufhalten, Inspector Banquo gut zuhören und lernen. Sie werden hier heute nicht den Helden spielen. Dafür ist später Zeit. Verstanden?«
Olafsons schlaffes Kinn und seine Unterlippe arbeiteten, aber seine Stimme gehorchte ihm offensichtlich nicht. Also nickte er bloß.
Macbeth legte dem jungen Mann eine Hand auf die Schulter. »Bisschen nervös?«
»Bisschen, Sir.«
»Das ist normal. Versuchen Sie sich zu entspannen. Und noch eins, Olafson.«
»Ja?«
»Bauen Sie keine Scheiße.«
»Was passiert da?«, fragte Bonus.
»Ich weiß, was passieren wird«, sagte Hecate, richtete sich auf und schwenkte das Teleskop weg vom Kai. »Deshalb brauche ich das hier auch nicht.« Er setzte sich direkt neben ihn. Bonus war aufgefallen, dass Hecate sich oft neben jemanden setzte, statt ihm gegenüber. Als ob er es nicht mochte, wenn man ihn direkt ansah.
»Sie haben Sweno und das Amphetamin?«
»Im Gegenteil. Sweno hat einen von Duffs Männern in seine Gewalt gebracht.«
»Was? Beunruhigt Sie das nicht?«
»Ich setze niemals nur auf ein Pferd, Bonus. Mich beunruhigt immer nur das große Ganze. Was halten Sie von Chief Commissioner Duncan?«
»Sie meinen, weil er öffentlich geschworen hat, Sie zu verhaften?«
»Das macht mir gar nichts. Aber er hat viele meiner Vertrauten aus dem Polizeidienst entlassen, und das hat auf den Märkten bereits für Probleme gesorgt. Kommen Sie schon, Sie haben doch eine gute Menschenkenntnis. Sie haben ihn gesehen, ihn gehört. Ist er so unbestechlich, wie man sagt?«
Bonus zuckte mit den Schultern. »Jeder hat seinen Preis.«
»Da haben Sie recht, aber der Preis ist nicht immer Geld. Nicht jeder ist so schlicht wie Sie.«
Bonus ignorierte die Beleidigung, indem er sie nicht als solche verstand. »Um herauszufinden, womit Duncan bestochen werden kann, müssen Sie herausfinden, was er haben will.«
»Duncan will der Herde dienen«, sagte Hecate. »Die Herzen der Stadt erobern. Er will, dass man ihm ein Denkmal baut, das er nicht selbst in Auftrag geben muss.«
»Knifflig. Es ist leichter, gierige Aasgeier wie uns zu bestechen als Stützen der Gesellschaft wie Duncan.«
»Was die Bestechung anbelangt, haben Sie recht«, sagte Hecate. »Aber wenn es um die Stützen der Gesellschaft und die Aasgeier geht, stimme ich Ihnen nicht zu.«
»Ach nein?«
»Das Fundament des Kapitalismus, lieber Bonus. Dass der Einzelne danach strebt, reich zu werden, macht die Gesellschaft reich. Eine ganz einfache Rechnung ist das, und es läuft ganz von selbst. Sie und ich, wir sind die Stützen der Gesellschaft, nicht verblendete Idealisten wie Duncan.«
»Glauben Sie?«
»Der Philosoph Adam Hand hat das geglaubt.«
»Drogen herzustellen und zu verkaufen, dient der Gesellschaft?«
»Jeder, der einen Bedarf deckt, hilft dabei, die Gesellschaft aufzubauen. Leute wie Duncan, die regulieren und begrenzen wollen, sind unnatürlich und stellen langfristig eine Gefahr für uns dar. Wie können wir also, zum Wohle unserer Stadt, Duncan unschädlich machen? Was ist seine Schwäche? Was können wir gegen ihn verwenden? Sex, Drogen, Familiengeheimnisse?«
»Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, Hecate, aber ich weiß es wirklich nicht.«
»Das ist zu schade.« Hecate tippte sachte mit seinem Stock auf den Boden, während er beobachtete, wie einer der Jungs den Draht vom Korken einer neuen Champagnerflasche löste. »Wissen Sie, ich hege so langsam den Verdacht, dass Duncan nur einen einzigen Schwachpunkt besitzt.«
»Und der wäre?«
»Die Länge seines Lebens.«
Bonus zuckte in seinem Sessel zurück. »Ich hoffe, Sie haben mich nicht hierher eingeladen, um mich darum zu bitten, dass ich …«
»Keineswegs, meine liebe Flunder. Sie dürfen ganz still im Schlamm liegen bleiben.«
Bonus stieß einen erleichterten Seufzer aus, während er zusah, wie der Junge mit dem Korken kämpfte.
»Aber«, sagte Hecate, »Sie sind rücksichtslos, illoyal und einflussreich, und diese Gaben verleihen Ihnen Macht über die Menschen, deren Unterstützung ich brauche. Ich hoffe, mich auf Sie verlassen zu können, wenn Ihre Hilfe benötigt wird. Ich hoffe, Sie können meine unsichtbare Hand sein.«
Ein lauter Knall ertönte.
»Na also!« Bonus lachte und klopfte dem Jungen auf die Schulter, der versuchte, so viel wie möglich von dem zügellos hervorsprudelnden Champagner in die Gläser zu befördern.
Duff lag reglos auf dem Asphalt. Neben ihm standen seine Männer ebenso still und beobachteten die Norse Riders, die sich, weniger als zehn Meter entfernt, zum Aufbruch bereit machten. Siwart und Sweno standen in der Dunkelheit, außerhalb des Lichtkegels, aber Duff konnte den jungen Beamten zittern sehen, während Swenos Säbelklinge an seiner Kehle ruhte. Schon der kleinste Druck, die kleinste Bewegung würden genügen, um die Haut aufzuritzen, die Arterie zu öffnen und den Mann in Sekunden verbluten zu lassen. Und wenn er daran dachte, was das für Konsequenzen haben würde, spürte Duff Panik in sich aufsteigen. Nicht nur weil er dann das Blut eines seiner Männer an den Händen hätte – und in seiner Akte –, sondern weil ein von ihm im Alleingang anberaumter Einsatz so kläglich gescheitert war. Und das ausgerechnet jetzt, da der Chief Commissioner vorhatte, einen neuen Leiter des Dezernats für Organisierte Kriminalität zu berufen. Sweno nickte einem der Norse Riders zu, der daraufhin von seinem Motorrad abstieg, sich hinter Siwart stellte und ihm eine Waffe an den Kopf hielt. Sweno klappte sein Visier herunter, trat ins Licht, sprach mit dem Mann, auf dessen Jacke die Sergeant-Streifen zu sehen waren, und setzte sich rittlings auf seine Maschine. Salutierend führte er zwei Finger an den Helm und brauste den Kai hinunter. Duff musste hart mit sich kämpfen, um keinen Schuss auf ihn abzufeuern. Der Sergeant gab einige Befehle aus, und Sekunden später verschwanden die Motorräder heulend in der Nacht. Nur zwei unbemannte Maschinen blieben zurück, nachdem die anderen Sweno und dem Sergeant gefolgt waren.
Duff schärfte sich ein, der Panik nicht nachzugeben, zwang sich nachzudenken. Atme und denk nach. Vier Männer in Norse-Rider-Kluft waren am Kai zurückgeblieben. Einer stand hinter Siwart in der Dunkelheit. Einer hatte sich mitten im Licht aufgebaut und hielt die Polizisten mit einem Sturmfeuergewehr in Schach, einer AK-47. Zwei Männer, vermutlich diejenigen, die im Sozius hergekommen waren, stiegen in den Laster. Duff hörte das unausgesetzte, angestrengte Heulen, als der Zündschlüssel umgedreht wurde. Eine Sekunde lang hoffte er, das alte eiserne Monster würde nicht anspringen. Aber als das erste tiefe Brummen sich in ein laut dröhnendes Rumpeln verwandelte, fluchte er stumm vor sich hin. Der Laster fuhr davon.
»Wir geben ihnen einen Vorsprung von zehn Minuten«, brüllte der Mann mit der AK-47. »Denkt einfach so lange an was Schönes.«
Duff starrte den Rücklichtern des Lasters hinterher, die sich langsam in der Dunkelheit auflösten. An was Schönes? Viereinhalb Tonnen Drogen fuhren ihm vor der Nase davon, und mit ihnen verschwand die Chance auf den größten Fahndungserfolg seit dem Krieg. Es half nichts, dass sie wussten, dass Sweno und seine Leute direkt vor ihnen gestanden hatten, wenn sie dem Richter und den Geschworenen sagen mussten, dass sie ihre Gesichter nicht gesehen hatten, sondern bloß vierzehn beschissene Helme. Etwas Schönes? Duff schloss die Augen.
Sweno.
Er hatte ihn hier zum Greifen nahe gehabt. Scheiße, Scheiße, Scheiße!
Duff spitzte die Ohren. Lauschte auf etwas, irgendwas. Aber das Einzige, was er hören konnte, war das sinnlose Flüstern des Regens.
»Banquo hat den Typen, der den Jungen festhält, im Visier«, sagte Macbeth. »Haben Sie den andern, Olafson?«
»Ja, Sir.«
»Ihr müsst gleichzeitig schießen, okay? Feuert auf drei. Banquo?«
»Ich brauche mehr Licht auf der Zielperson. Oder jüngere Augen. So treff ich vielleicht den Jungen.«
»Meiner steht voll im Licht«, flüsterte Olafson. »Wir können tauschen.«
»Wenn wir nicht treffen und unser Mann draufgeht, wäre es uns lieber, wenn es Banquo war, der nicht getroffen hat. Banquo, wie schnell ist so ein voll beladener Stalin-Laster maximal, was meinst du?«
»Hm. Sechzig pro Stunde vielleicht.«
»Gut, aber langsam wird es eng, wenn wir heute noch alles schaffen wollen. Ich würde vorschlagen, wir improvisieren ein bisschen.«
»Willst du deine Dolche ausprobieren?«, fragte Banquo Macbeth.
»Aus dieser Entfernung? Danke für dein Vertrauen. Nein, du wirst es gleich sehen, alter Mann. Wenn du die Augen aufmachst!«
Banquo blickte von seinem Fernglas auf und stellte fest, dass Macbeth sich erhoben und den Mast ergriffen hatte, an dem der Dachscheinwerfer des Hauses befestigt war. Die Adern in Macbeths kräftigem Hals traten hervor, und seine Zähne blitzten auf. Ob er eine Grimasse schnitt oder grinste, konnte Banquo nicht erkennen. Der Mast war fest genug verschraubt, um den wilden Nordwestwinden zu trotzen, die in acht von zwölf Monaten hier wehten, aber Banquo hatte Macbeth schon eigenhändig Autos aus Schneeverwehungen ziehen sehen.
»Drei«, ächzte Macbeth.
Die ersten Schrauben sprangen aus den Fassungen.
»Zwei.«
Der Mast löste sich, und mit einem weiteren Ruck riss er das Kabel von der unter ihnen liegenden Mauer.
»Eins.«
Macbeth richtete die Lampe auf die Gangway.
»Jetzt.«
Es klang wie zwei Peitschenhiebe. Duff öffnete die Augen gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie der Mann mit der Automatikwaffe nach vorn fiel und mit dem Helm voran zu Boden sackte. Wo Siwart stand, war jetzt Licht, und Duff konnte ihn ebenso deutlich erkennen wie den Mann hinter ihm. Er drückte seine Waffe nicht länger gegen Siwarts Kopf, sondern hatte sein Kinn auf Siwarts Schulter gestützt. Im Licht sah Duff nun auch das Loch in seinem Visier. Dann glitt er wie eine Qualle an Siwarts Rücken herab und fiel zu Boden.
Duff drehte sich um.
»Hier oben, Duff!«
Er beschattete seine Augen. Ein dröhnendes Gelächter brach hinter dem blendenden Licht hervor, und der Schatten eines riesigen Mannes fiel über den Kai.
Aber das Gelächter genügte.
Es war Macbeth. Natürlich war es Macbeth.
2
Eine Möwe ließ sich im wolkenlosen Himmel über Fife durch die Stille und das Mondlicht treiben. Unter ihr glitzerte der Fluss wie Silber. Am westlichen Ufer erhob sich – wie eine gigantische Festungsmauer – ein steiler schwarzer Berg. Kurz vor dem Gipfel hatte ein Mönchsorden einst ein großes Kreuz errichtet. Da es aber auf der nach Fife zeigenden Seite stand, erschien es den meisten Einwohnern der Stadt, als stünde es auf dem Kopf. Aus dem Berghang ragte eine beeindruckende Eisenbrücke hervor, wie die Zugbrücke über einem Burggraben. Dreihundertsechzig Meter lang und neunzig Meter hoch an ihrem höchsten Punkt: die Kenneth-Brücke, oder, wie die meisten sie schlicht nannten, die neue Brücke. Im Vergleich dazu war die alte Brücke ein weit bescheideneres, dafür ästhetisch umso angenehmeres Bauwerk, das ein Stück weiter den Fluss hinunter stand und einen Umweg bedeutete. Inmitten der neuen Brücke erhob sich ein unschönes Marmordenkmal, das den früheren Chief Commissioner Kenneth darstellen sollte und das er selbst in Auftrag gegeben hatte. Die Statue stand ganz knapp noch innerhalb der Stadtgrenzen, denn nirgendwo sonst war man bereit gewesen, dem Nachruhm des alten Ganoven auch nur einen Fingerbreit Land zu opfern. Der Bildhauer hatte sich durchaus an Kenneths Anweisung gehalten und seinen visionären Charakter betont, indem er die typische Pose eines den Horizont absuchenden Mannes gewählt hatte – doch kein noch so wohlwollender Künstler hätte es geschafft, von dem auffallend dicken Nacken und der breiten Kinnpartie abzulenken.
Die Möwe schlug mit den Flügeln, um an Höhe zu gewinnen. Sie hoffte auf bessere Fischfangaussichten an der Küste hinter dem Berg, auch wenn das bedeutete, die Wettergrenze passieren zu müssen – von gut zu schlecht. Für alle, die denselben Weg einschlagen wollten, gab es einen zwei Kilometer langen Durchbruch, einen engen, schwarzen Tunnel, der von der neuen Brücke aus durch den Berg führte. Dabei wussten viele die Trennwand zu schätzen, die der Berg darstellte – die angrenzenden Landesbezirke bezeichneten den Tunnel gern als Rektum samt Anus am anderen Ende. Und tatsächlich, kaum hatte die Möwe Fife hinter sich gelassen und die Bergspitze überflogen, geriet sie von einer Welt harmonischer Ruhe in einen eiskalten schmutzigen Regenschauer, der auf die stinkende Stadt herabstürzte. Wie um ihre Verachtung zu zeigen, schiss die Möwe in die Tiefe und ließ sich weiter zwischen den einzelnen Windböen dahintreiben.
Der Möwenschiss landete auf dem Dach eines Unterstandes, unter dem ein ausgemergelter Junge sich auf einer Bank zusammenkauerte. Auch wenn das Schild neben dem Unterstand darauf hindeutete, dass es sich um eine Bushaltestelle handelte, war sich der Junge nicht so sicher. So viele Buslinien waren im Laufe der letzten Jahre stillgelegt worden. Wegen der abnehmenden Einwohnerzahl, wie der Bürgermeister, der alte Hohlkopf, behauptete. Aber der Junge musste zum Hauptbahnhof, um seine Dosis Brew zu bekommen. Das Speed, das er bei den Bikern gekauft hatte, war der letzte Dreck, eher Puderzucker und Kartoffelmehl als Amphetamin.
Der ölig nasse Asphalt glitzerte unter den wenigen Straßenlaternen, die noch funktionierten, und der Regen sammelte sich in Pfützen auf der von Schlaglöchern übersäten Straße, die aus der Stadt hinausführte. Es war schon eine ganze Weile alles ruhig, kein Wagen zu sehen, nur Regen. Doch jetzt hörte er etwas, das wie ein tiefes Gurgeln klang.
Er hob den Kopf. Zog am Band seiner Augenklappe, die von seiner leeren Augenhöhle herübergerutscht war und sein verbliebenes Auge bedeckte. Vielleicht konnte er per Anhalter ins Zentrum kommen?
Aber nein, das Geräusch kam aus der falschen Richtung.
Wieder zog er die Knie hoch.
Aus dem Gurgeln wurde ein Brüllen. Er konnte sich unmöglich bewegen, außerdem war er sowieso schon pitschnass, also schützte er bloß seinen Kopf mit den Armen. Der Lastwagen raste an ihm vorbei und spritzte einen gewaltigen Schwall Dreckwasser in den Busunterstand.
Er lag da und dachte über das Leben nach, bis ihm bewusst wurde, dass er das besser lassen sollte.
Das Geräusch eines weiteren Fahrzeugs. Hatte er diesmal Glück?
Er kämpfte sich in eine aufrechte Position und hielt Ausschau. Aber nein, auch diesmal kam es aus Richtung Stadt. Und ebenfalls mit hoher Geschwindigkeit. Er starrte in die sich nähernden Scheinwerferlichter. Der Gedanke schoss ihm ganz plötzlich durch den Kopf: Ein Schritt auf die Straße, und all seine Probleme wären gelöst.
Der Van raste an ihm vorbei, ohne eins der Schlaglöcher zu treffen. Schwarzer Ford Transit. Cops, gleich drei. Na toll. Von denen wollte man nun wirklich nicht mitgenommen werden.
»Da ist er, direkt vor uns«, sagte Banquo. »Geben Sie Gas, Angus!«
»Woher wissen Sie, dass sie es sind?«, fragte Olafson und lehnte sich zwischen die beiden Vordersitze des SWAT-Transits.
»Dieselrauch«, sagte Banquo. »Mein Gott, kein Wunder, dass die in Russland eine Ölkrise haben. Fahren Sie dicht auf, Angus, damit die uns im Rückspiegel sehen.«
Angus behielt seine Geschwindigkeit bei, bis sie den schwarzen Auspuff unmittelbar vor sich hatten. Banquo ließ seine Scheibe herunter und stützte das Gewehr am Außenspiegel ab. Hustete. »Jetzt seitlich aufschließen, Angus!«
Angus scherte aus und beschleunigte. Der Transit schoss auf eine Höhe mit dem ächzenden, dröhnenden Laster.
Eine Rauchwolke quoll aus dem Fenster des Lasters. Der Spiegel unter Banquos Gewehrlauf zerbarst knackend.
»Ja, sie haben uns gesehen«, sagte Banquo. »Ziehen Sie wieder hinter ihn.«
Der Regen hörte plötzlich auf, und alles um sie herum wurde noch dunkler. Sie waren im Tunnel. Der Asphalt und die grob behauenen Wände schienen alles Licht der Scheinwerfer zu verschlucken. Außer den Rücklichtern des Lasters konnten sie nichts mehr sehen.
»Was sollen wir tun?«, fragte Angus. »Am andern Ende kommt die Brücke. Und wenn sie es bis über die Mitte schaffen …«
»Ich weiß«, sagte Banquo und hob sein Gewehr. Die Stadt endete beim Denkmal und damit zugleich auch ihre Gerichtsbarkeit und diese Verfolgung. Theoretisch hätten sie natürlich weiterfahren können, das war schon vorgekommen: Hoch motivierte Beamte, die allerdings selten zum Rauschgiftdezernat gehörten, hatten Dealer auf der falschen Seite der Grenze verhaftet. Und jedes Mal hatten sie einen schönen, saftigen Fall, der vor Gericht abgewiesen wurde, und selbst ein Verfahren wegen Amtsmissbrauchs am Hals. Banquo spürte den Rückstoß seiner Remington 700.
»Volltreffer«, sagte er.
Der Laster begann im Tunnel zu schlingern; vom Hinterreifen flogen Gummifetzen auf.
»Jetzt seht ihr, was so ein schweres Lenkrad wirklich taugt«, sagte Banquo und zielte auf den anderen Hinterreifen. »Bisschen mehr Abstand, Angus, falls sie direkt in die Tunnelwand krachen.«
»Banquo!«, rief jemand vom Rücksitz.
»Olafson?«, sagte Banquo und drückte langsam den Abzug.
»Gegenverkehr.«
»Ups.«
Banquo nahm seine Wange vom Gewehr, als Angus bremste.
Vor ihnen schlingerte der ZIS-5 von einer Seite zur anderen, sodass er die Scheinwerfer des entgegenkommenden Wagens immer abwechselnd verdeckte und freilegte. Banquo hörte das verzweifelte Hupen eines Limousinenfahrers, der einen Lkw auf sich zurasen sieht und weiß, dass es zu spät ist, um irgendwas zu tun.
»Jesus …«, lispelte Olafson leise.
Die Hupe ertönte immer lauter und in schnellerem Abstand.
Dann ein helles Aufblitzen von Licht.
Banquo schaute automatisch beiseite.
Erhaschte noch einen kurzen Blick auf den Rücksitz des Wagens, die Wange eines Kindes, an die Scheibe gelehnt.
Dann war er weg, und das ersterbende Geräusch der Hupe klang wie das enttäuschte Stöhnen von Zuschauern, die man um das große Spektakel gebracht hat.
»Schneller«, sagte Banquo. »Jeden Moment sind wir auf der Brücke.«
Angus trat mit dem Fuß aufs Gas, und schon steckten sie erneut in der Wolke, die der Auspuff ausstieß.
»Ruhig halten«, sagte Banquo. »Ruhig …«
In diesem Augenblick wurde die Plane auf der Ladefläche des Lasters zur Seite gerissen, und die Scheinwerfer des Transit strahlten die aufgestapelten Plastikbeutel an, die offenkundig eine weiße Substanz enthielten. Das Rückfenster der Fahrerkabine war zerschlagen worden. Und aus einer Lücke zwischen den Kilobeuteln zielte ein Gewehr auf sie.
»Angus …«
Eine kurze Explosion. Banquo nahm den Blitz eines Mündungsfeuers wahr, dann wurde ihre Windschutzscheibe weiß, zerbarst und stürzte auf sie herunter.
»Angus!«
Angus hatte sofort reagiert und das Lenkrad scharf nach rechts gerissen. Und dann nach links. Die Reifen kreischten, und die Kugeln schossen pfeifend durch die Luft, während die Mündung der Waffe vor ihnen versuchte, mit ihren Manövern Schritt zu halten.
»Herrgott!«, kreischte Banquo und feuerte auf den anderen Reifen, aber die Kugeln ließen nur Funken vom Kotflügel abprallen.
Und plötzlich war der Regen wieder da. Sie waren auf der Brücke.
»Nehmen Sie die Schrotflinte, Olafson«, brüllte Banquo. »Jetzt!«
Der Regen prasselte durch das Loch, das eben noch eine Windschutzscheibe gewesen war, und Banquo rutschte so weit zur Seite, dass Olafson die doppelläufige Waffe auf der Rücklehne seines Sitzes abstützen konnte. Sie ragte über Banquos Schulter, aber dann ertönte ein dumpfer Schlag, wie wenn ein Hammer auf Fleisch prallt, und im nächsten Augenblick war die Waffe verschwunden. Banquo drehte sich um und sah, dass Olafson auf seinem Sitz zusammengesackt war. Sein Kopf war nach vorn gesunken, und auf Brusthöhe klaffte ein Loch in seiner Jacke. Graue Polsterfüllung stieb auf, als die nächste Kugel direkt durch Banquos Sitz schlug und den Platz neben Olafson traf. Der Typ auf dem Laster hatte sich jetzt warmgeschossen. Banquo nahm Olafson die Schrotflinte aus der Hand, riss sie in einer fließenden Bewegung nach vorn und feuerte. Auf der Ladefläche des Lasters gab es eine weiße Explosion. Banquo ließ die Schrotflinte los und griff nach seinem Gewehr. Durch die dicke weiße Pulverwolke hindurch konnte der Typ auf dem Laster unmöglich etwas sehen, aber aus der Dunkelheit erhob sich, wie ein unerwünschter Geist, die von Flutern angestrahlte weiße marmorne Kenneth-Statue. Banquo zielte auf den Hinterreifen und drückte den Abzug. Volltreffer.
Der Laster raste von einer Seite zur anderen, ein Vorderreifen schob sich auf die Randerhebung, ein Hinterreifen traf die Kante, und die Seite des ZIS-5 schleifte am stahlverstärkten Brückenzaun entlang. Das Kreischen von Metall auf Metall übertönte das Motorgeheul des Wagens. Unglaublicherweise schaffte es der Fahrer jedoch, den schweren Laster wieder auf die Fahrbahn zu bekommen.
»Fahr bloß nicht über die verdammte Grenze!«, brüllte Banquo.
Die letzten Gummireste hatten sich von den Hinterreifen des Lasters gelöst, und eine Funkenfontäne stob in den Nachthimmel. Der ZIS-5 geriet neuerlich ins Schlingern. Der Fahrer versuchte verzweifelt, gegenzusteuern, aber diesmal hatte er keine Chance. Der Wagen brach aus, schoss über den Asphalt. Er war so gut wie an der Grenze angelangt, als die Reifen wieder Halt fanden und den Laster von der Straße trugen. Zwölf Tonnen sowjetischen Militärgeräts trafen Chief Commissioner Kenneth direkt unter der Gürtellinie, rissen ihn von seinem Sockel und schleiften die Statue sowie zehn Meter Stahlzaun mit sich, bevor sie über die Kante flogen. Angus hatte es geschafft, den Transit anzuhalten, und in der plötzlichen Stille beobachtete Banquo, wie sich der mondbeschienene Kenneth im Sturz langsam um sein eigenes Kinn drehte. Hinter ihm folgte der ZIS-5, Motorhaube voran, mit einem Schweif aus weißem Puder, wie ein verfluchter Amphetamin-Komet.
»Mein Gott …«, flüsterte der Polizist.
Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis Statue und Wagen ins Wasser eintauchten und es für einen Augenblick weiß färbten. Auch das Geräusch des Aufpralls erreichte Banquo mit Verzögerung.
Dann kehrte die Stille zurück.
Sean stand vor dem Clubhaus, trat von einem Fuß auf den anderen und starrte durch das Tor.
Kratzte sich am NORSE RIDER BIS ZUM TOD-Tattoo auf seiner Stirn. Das letzte Mal war er im Kreißsaal so nervös gewesen. War es nicht mal wieder typisch, dass Colin und er die kürzeren Strohhalme gezogen hatten und ausgerechnet in der Nacht Wache halten mussten, in der es wirklich zur Sache ging? Man hatte es ihnen nicht erlaubt, mitzufahren und den Stoff abzuholen, und bei der Party durften sie auch nicht mitfeiern.
»Meine Alte will das Kind nach mir benennen«, sagte Sean, hauptsächlich zu sich selbst.
»Glückwunsch«, erwiderte Colin tonlos und zupfte an seinem Walross-Schnurrbart. Der Regen perlte von seiner leuchtenden Glatze ab.
»Danke«, sagte Sean. Eigentlich hatte er beides nicht gewollt. Weder das Tattoo, das er ein Leben lang nicht mehr loswerden würde, noch ein Kind, für das dasselbe galt. Freiheit. Das war es doch, was so ein Leben auf dem Motorrad versprach, oder? Aber erst hatte der Club seine Vorstellung von Freiheit verändert, dann Betty. Wirklich frei kann man nur sein, wenn man irgendwohin gehört, wenn man wahre Solidarität empfindet.
»Da sind sie«, sagte Sean. »Scheint alles gut gelaufen zu sein, was?«
»Zwei fehlen«, entgegnete Colin, spuckte seine Zigarette aus und öffnete das hohe, mit Stacheldraht bewehrte Tor.
Das erste Motorrad hielt vor ihnen an. Hinter dem gehörnten Helm ertönte ein dröhnender Bass. »Die Cops haben uns in einen Hinterhalt gelockt, die Zwillinge kommen deshalb ein bisschen später.«
»Okay, Boss!«, sagte Colin.
Die Motorräder knatterten eins nach dem anderen durchs Tor. Einer der Jungs reckte den Daumen hoch. Gut, der Stoff war in Sicherheit, der Club gerettet. Sean atmete erleichtert auf. Die Maschinen rollten über den Hof, vorbei an dem schuppenartigen kleinen Holzhaus, auf dem das Norse-Riders-Logo prangte, und verschwanden in der großen Garage. Im Schuppen war bereits der Tisch gedeckt. Sweno hatte entschieden, den Deal mit einem Besäufnis zu feiern, und nach einigen Minuten hörte Sean, wie im Haus die Musik angestellt wurde und das erste Triumphgebrüll losbrach.
»Wir sind reich.« Sean lachte. »Weißt du, wo sie den Stoff hinbringen?«
Colin antwortete nichts, verdrehte bloß die Augen.
Er wusste es nicht. Niemand wusste es. Nur Sweno. Und die im Laster natürlich. So war es am besten.
»Da kommen die Zwillinge«, sagte Sean und öffnete wieder das Tor.
Die Motorräder passierten langsam, beinahe zögerlich, die Hügelkuppe und näherten sich ihnen.
»Hi, João, was ist denn pass…«, begann Sean, aber die Maschinen fuhren ohne anzuhalten an ihnen vorbei durchs Tor.
Schließlich hielten die Zwillinge mitten im Hof, als hätten sie vor, ihre Maschinen dort stehen zu lassen. Dann nickte einer von ihnen der offenen Garagentür zu, und sie fuhren hinein.
»Hast du Joãos Visier gesehen?«, fragte Sean. »Da war ein Loch drin.«
Colin seufzte schwer.
»Im Ernst, Mann!«, sagte Sean. »Direkt in der Mitte. Ich will wissen, was da unten am Hafen wirklich passiert ist.«
»Hey, Sean …«
Aber Sean war schon weg, lief über den Hof und betrat die Garage. Die Zwillinge waren abgestiegen. Beide standen mit dem Rücken zu ihm, trugen immer noch ihre Helme. Einer von ihnen hielt die Tür, die von der Garage direkt ins Clubhaus führte, einen Spaltbreit offen. Als wolle er selbst nicht gesehen werden, aber schon mal schauen, wie die Party lief. João, Seans bester Kumpel, stand neben seinem Motorrad. Er hatte das Magazin aus seiner AK-47 entfernt und schien zu zählen, wie viele Kugeln noch übrig waren. Sean klopfte ihm auf den Rücken. Das musste ihn ziemlich erschreckt haben, denn er wirbelte herum.