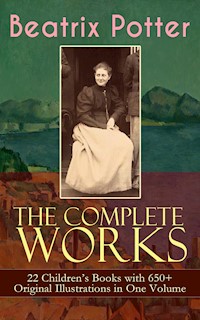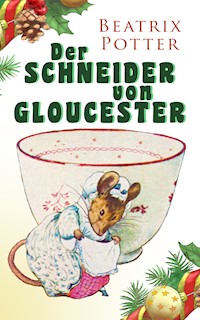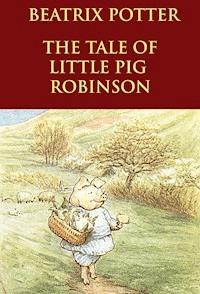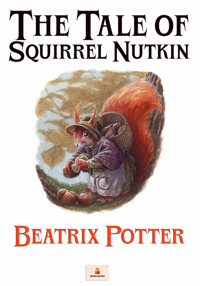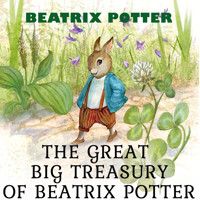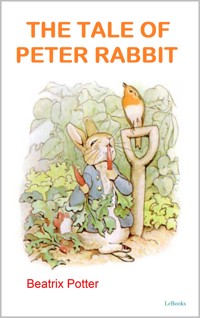Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Steigen Sie ein in die magische Welt der traumhaften Weihnachtsmärchen und schenken Sie Ihrem Kind in diesem Jahr Phantasie und Abenteuer. Inhalt: Die Schneekönigin (Hans Christian Andersen) Der Schneider von Gloucester (Beatrix Potter) Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern (Hans Christian Andersen) Der Tannenbaum (Hans Christian Andersen) Der standhafte Zinnsoldat (Hans Christian Andersen) Weihnachtslied (Charles Dickens) Der kleine Lord (Frances Hodgson Burnett) Nußknacker und Mausekönig (E.T.A Hoffman) Die Heilige Nacht (Selma Lagerlöf) Ein Weihnachtsgast (Selma Lagerlöf) Der selbstsüchtige Riese (Oscar Wilde) Der Schneemann (Manfred Kyber) Der kleine Tannenbaum (Manfred Kyber) Das Weihnachtsland (Heinrich Seidel) Eine Weihnachtsgeschichte (Heinrich Seidel) Die Geschichte von der Frau Holle (Luise Büchner) Die Geschichte vom Knecht Nikolaus (Luise Büchner) Die Geschichte vom Christkind und vom Nikolaus (Luise Büchner) Die Geschichte vom Christkind-Vogel (Luise Büchner) Die Geschichte vom Kräutchen Eigensinn (Luise Büchner) Die Geschichte vom Tannenbäumchen (Luise Büchner) Die Geschichte von dem kleinen naseweisen Mädchen (Luise Büchner) Die Geschichte vom Weihnachtsmarkt (Luise Büchner) Die Sternthaler (Brüder Grimm) Frau Holle (Brüder Grimm) Sneewittchen (Brüder Grimm) Der allererste Weihnachtsbaum (Hermann Löns)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 793
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Magisches Weihnachten - Die schönsten Weihnachtsmärchen für Kinder
Inhaltsverzeichnis
Der Schneider von GloucesterBeatrix Potter
Zur Zeit der Schwerter und Perücken; als die Herren noch Mantelröcke mit geblümten Zipfeln und Rüschen und goldverzierte Westen trugen – da lebte ein Schneider in Gloucester.
Er saß in einem Schaufenster eines kleinen Geschäfts in der Westgate Straße, im Schneidersitz auf einem Tisch – von morgens bis abends.
Solang es draußen hell war, nähte und schnipste er, schnitt Stoffe und Schnüre und Dinge mit komischen Namen, die zu jener Zeit sehr teuer waren.
Aber obwohl er die feinste Seide für seine Nachbarn nähte, war er selbst sehr arm – ein kleiner alter Mann mit Brille, mit verkniffenem Gesicht, krummen Fingern und abgenutzten, zusammengeflickten Klamotten.
Er schnitt seine Mäntel sehr sorgfältig um nichts zu verschwenden, gemäß seiner bestickten Klamotten waren es nur kleine Schnipsel, die übrig blieben – „Die Schnipsel sind zu klein um sie für etwas zu gebrauchen – außer vielleicht für Müsewesten,” sagte der Schneider.
Eines kalten Tages in der Weihnachtszeit machte sich der Schneider an einem Mantel – einen Mantel mit kirschfarbener Seide, bestickt mit Stiefmütterchen und Rosen und einer cremefarbenen Seidenweste – edel verarbeitet für den Bürgermeister von Gloucester.
Der Schneider arbeitete und arbeitete und sprach dabei zu sich selbst. Er maß die Seide, drehte sie hin und her und trimmte sie mit seiner Schere in die richtige Form bis der Tisch mit kirschfarbenen Schnipseln übersäht war.
„Die ganzen Schnipsel, zu klein um damit etwas anzufangen. Gerade groß genug für Mäuse!” sagte der Schneider von Gloucester.
Als die Schneeflocken langsam anfingen sich vor die Fensterscheiben zu legen und das Licht daran hinderten hinein zu kommen, hatte der Schneider seine Arbeit für den Tag erledigt. All die Seiden- und Satinausschnitte lagen ausgebreitet auf dem Tisch.
Zwölf Stücke für den Mantel und vier Stücke für die Weste und auch die Manschetten und Knöpfe lagen ordentlich aufgereiht dort. Für das Mantelfutter gab es feinsten gelben Taft und für die Knopflöcher der Weste gab es kirschfarbenen Garn. Alles war bereit am nächsten Morgen zusammengenäht zu werden, alles fertig ausgemessen und nur darauf wartend vernäht zu werden.
Als es schon dunkel war, trat der Schneider aus seinem Geschäft, denn die Nacht verbrachte er dort nicht. Er schloss das Fenster und verschloss die Tür und nahm den Schlüssel mit sich. Niemand war in der Nacht im Geschäft außer ein paar kleiner brauner Mäuse – denn die kamen auch ohne Schlüssel rein und raus!
Hinter all den hölzernen Wandverkleidungen der alten Häuser in Gloucester lagen Treppenaufgänge und Geheimtüren der Mäuse. Und die Mäuse laufen durch diese kleinen Gänge von Haus zu Haus – durch die ganze Stadt – und das ohne auch nur einmal auf die Straße treten zu müssen.
Der Schneider kam aus seinem Geschäft und schlurfte durch den Schnee nach Hause. Er lebte gleich um die Ecke seines Geschäfts und obwohl es kein großes Haus war, konnte der Schneider nur die Küche mieten. Für mehr reichte sein Geld nicht aus.
Er lebte dort alleine mit seinem Kater Simpkin.
Während der Schneider bei der Arbeit war, hatte Simpkin das ganze Haus für sich alleine. Auch er war ganz angetan von den Mäusen, wenn auch er anderes im Kopf hatte als ihnen Satin für Mäntel zu überlassen.
„Miau?“ sagte der Kater als der Schneider die Tür öffnete, „miau?”
Der Schneider antwortete: „Simpkin, wir werden schon zu Geld kommen aber nun bin ich erschöpft. Nimm diesen Groschen (unser letztes Geld) und besorge uns Brot, Milch und Wurst. Ach, und Simpkin, besorg´ mir bitte auch noch etwas kirschfarbene Seide. Aber verlier ja nichts, Simpkin, sonst bin ich verloren, den ICH HABE KEINEN GARN MEHR.“
Dann sagte Simpkin wieder „Miau?” und nahm den Groschen, bevor er in die Nacht hinaus ging.
Der Schneider war sehr müde und fing auch noch an krank zu werden. Er setzte sich an den Kamin und redete zu sich selbst über den bezaubernden Mantel.
„Ich werde schon zu Geld kommen – und sei es ein schräger Schnitt – der Bürgermeister von Gloucester wird am Morgen des Weihnachtstages heiraten und hat einen Mantel und eine bestickte Weste bestellt – gefüttert mit gelben Taft – aber es reicht nicht aus; gerade noch genügend Schnipsel für die Mäuse –”
Doch plötzlich wurde der Schneider von Geräuschen unterbrochen. Von der anderen Seite der Küche machte es —
Tip tap, tip tap, tip tap tip!
„Was mag das sein?” sagte der Schneider von Gloucester und sprang von seinem Stuhl auf. Die Anrichte war voll von Geschirr und Tontöpfen, Porzellan sowie Teetassen und Becher.
Der Schneider ging hinüber und stand ganz still neben der Anrichte, aufmerksam lauschend und durch seine Brille starrend. Und da war es wieder, von unter einer umgedrehten Teetasse kam das witzige Geräusch—
Tip tap, tip tap, tip tap tip!
„Sehr merkwürdig,” sagte der Schneider und drehte die Teetasse um.
Zum Vorschein kam eine kleine Mäusedame, die sich sogleich vor dem Schneider verbeugte. Dann machte sie einen Sprung von der Anrichte und verschwand hinter der hölzernen Wandverkleidung.
Der Schneider nahm wieder vor dem Feuer Platz, seine kalten Hände daran wärmend und murmelte in sich hinein: „Die Weste wurde aus pfirsichfarbenen Satin gemacht – mit Rahmenstickerei und Rosenknospen in ungezwirnter Seide! War es schlau von mir Simpkin meinen letzten Groschen anzuvertrauen? Einundzwanzig Knopflöcher von kirschfarbenen Garn!“
Aber plötzlich kamen wieder ein Geräusch von der Anrichte —
Tip tap, tip tap, tip tap tip!
„Das ist mehr als ungewöhnlich!” sagte der Schneider von Gloucester und drehte noch eine Teetasse um, die falschherum stand.
Zum Vorschein kam ein kleiner Mäusemann und machte eine Verbeugung vor dem Schneider!
Und dann kamen die kleinen Klopfgeräusche aus jedem Winkel der Anrichte, mal im Takt klopfend und mal als ob sie miteinander sprechen würden —
Tip tap, tip tap, tip tap tip!
Und von unter den Teetassen und von unter den Schüsseln und Schalen kamen noch mehr kleine Mäuse hervor, die eine nach der anderen die Anrichte hinuntersprangen und hinter der Wandverkleidung verschwanden.
Der Schneider setzte sich ganz nah an das Feuer und sagte klagend: „Einundzwanzig Knopflöcher von kirschfarbenen Garn! Fertig zu sein am Samstagmittag und heute ist schon Donnerstagabend. War es richtig die Mäuse einfach laufen zu lassen, Simpkin hatte sie ja anscheinend gefangen? Ach, ich bin am Ende, ich habe keinen Garn mehr!“
Die kleinen Mäuse kamen wieder hervor und lauschten dem Schneider. Ihnen fiel das Muster des bezaubernden Mantels auf. Sie flüsterten sich gegenseitig zu, was das für ein schönes Taft-Futter sei.
Und dann, ganz plötzlich, rannten alle gemeinsam die Gänge hinter der Wandverkleidung entlang, piepsend und sich gegenseitig rufend, während sie von Haus zu Haus liefen. Und als Simpkin mit der Milch zurückkam, war keine einzige Maus mehr in der Küche des Schneiders!
Simpkin öffnete die Tür und trat mit einem grimmigen „G-r-r-miau!” hinein, wie eine verärgerte Katze, die keinen Schnee mag und doch mit Schnee bedeckt ist. Er legte den Brotlaib und die Wurst auf die Anrichte und schnüffelte.
„Simpkin,” sagte der Schneider, „wo ist mein Garn?”
Aber Simpkin stellte nur die Milch ab und schaute misstrauisch auf die Teetassen. Zum Abendbrot wünschte er sich eine kleine fette Maus!
„Simpkin,“ sagte der Schneider, „wo ist mein GARN?“
Simpkin verstecke heimlich ein kleines Päckchen in der Teekanne und fauchte den Schneider an. Wenn er sprechen könnte, hätte er wohl gesagt: „Wo ist meine MAUS?“
„Ach, ich bin geliefert!” sagte der Schneider von Gloucester und ging traurig ins Bett.
Die ganze Nacht lang jagte Simpkin durch die Küche, schaute in die Schränke, unter die Holzverkleidung und in die Teekanne, in der er den Garn versteckt hatte – aber er fand keine Maus!
Und als der Schneider im Schlaf murmelte und redete, sagte Simpkin „Miau-ger-r-w-s-s-ch!” und machte ganz merkwürdige Geräusche, so wie Katzen das nun mal nachts machen.
Da der Schneider sehr krank war und sogar Fieber hatte, schlief er sehr unruhig. Trotz alledem murmelte er in seinem Schlaf: „Kein Garn! Kein Garn!“
Den ganzen nächsten Tag lag er krank im Bett und so auch am nächsten und übernächsten Tag. Was sollte jetzt aus dem kirschfarbenen Mantel werden? Im Geschäft des Schneiders in der Westgate Straße lagen die ausgeschnittenen Teile aus Seide und Satin auf dem Tisch mit ihren einundzwanzig Knopflöchern. Aber wer sollte schon kommen und sie zusammennähen, wenn die Fenster verriegelt und die Türe feste verschlossen war?
Aber das ist kein Hindernis für die kleinen braunen Mäuse, die laufen rein und raus in jedes Haus in Gloucester – und das ohne irgendeinen Schlüssel.
Auf den Straßen des Marktes tummelten sich indes die Menschen, die ihre Truthähne und Gänse für ihr Weihnachtsessen schleppten. Für Simpkin und den armen alten Schneider jedoch, würde es kein Weihnachtsessen geben.
Der Schneider lag für drei Tage und Nächte krank in seinem Bett bis es bereits spät am Weihnachtsabend war. Der Mond kletterte über die Dächer der Stadt und blickte von oben hinab. In den Fenstern brannte kein Licht mehr und in den Häusern hörte man keinen Mucks. Die Einwohner des schneebedeckten Gloucesters schliefen tief und fest.
Simpkin sehnte sich immernoch nach seinen Mäusen und er miaute während er neben dem Bett des Schneiders stand.
Aber wie es schon in den alten Büchern steht, können Tiere in der Weihnachtsnacht sprechen (obwohl nur wenige Leute das wissen und sie hören können).
Als die Kirchenuhr Mitternacht schlug, ertönte eine Antwort - so als ob die Glocken ein Echo schlugen – Simpkin hörte es und ging hinaus in den Schnee.
Aus allen Ecken der Stadt ertönten tausende fröhliche Stimmen, die Weihnachtslieder sangen, darunter viele bekannte Lieder, aber auch einige unbekannte.
Als erstes und auch am lautesten sang der Hahn — „Fräulein, steh auf und backe Kuchen!”
Simpkin stöhnte auf.
Nun brannte Licht in einigen Dachböden und man hörte das Geräusch von Tanzen, und die Katzen der Stadt kamen auf die Straße.
„Alle Katzen außer mir,” sagte Simpkin.
Unter den Dachsimsen sangen die Spatzen und Stare von Weihnachtskuchen, auch die Dohlen im Kirchenturm wachten auf und obwohl es mitten in der Nacht war, sangen auch die Drosseln und Rotkehlchen, bis die Nacht von Gezwitscher erfüllt war.
All das ärgerte den armen hungrigen Simpkin!
Besonders einige schrille Stimmen, die hinter einem Holzgitter hervordröhnten ärgerten ihn. Ich glaube es waren Fledermäuse, da diese besonders helle Stimmen haben – gerade wenn sie im Schlaf reden, so wie der Schneider von Gloucester.
Sie sagten etwas merkwürdiges, das sich anhörte wie —
„Bss, sprach die blaue Fliege; summ, sprach die Biene;
Bss und summ sprachen sie, und so machen wir es auch!“
Und Simpkin ging davon und schüttelte dabei seine Ohren als hätte er eine Biene darin sitzen.
In dem Geschäft des Schneiders brannte Licht und als Simpkin sich anschlich um durch das Fenster zu schauen, sah er drinnen Kerzen brennen.
Da war ein Scherenschnipsen und ein Fadenknipsen und eine kleine Mäusestimme laut und munter—
„Vierundzwanzig Schneider,
wollten eine Schnecke fangen,
der beste Mann unter ihnen,
traute sich nicht sie anzulangen;
Sie stellte ihre Fühler auf
wie ein junges Kalb,
Lauft, ihr Schneider, lauft,
oder sie spießt euch damit auf!“
Dann, ohne Pause, fuhren die kleinen Mäusestimmen fort—
„Siebe der Dame´s Haferbrei,
Mahle ihr Mehl,
Geb noch eine Marone hinzu,
und lass es eine Stund´ in Ruh´—“
„Miau! Miau!” unterbrach Simpkin und kratzte an der Tür.
Aber der Schlüssel lag unter dem Kopfkissen des Schneiders und er kam nicht hinein.
Die kleinen Mäuse lachten bloß und versuchten sich an einem anderen Lied —
„Drei kleine Mäuse wollten etwas spinnen,
Mieze kam vorbei und blickte verdutzt nach drinnen.
Was hast du vor, mein kleiner Mann?
Mäntel nähen für den Ehrenmann.
Soll ich kommen und euch helfen mit den Knöpfen?
Oh nein, Miezekatze, du willst uns doch nur köpfen!“
„Miau, Miau!“ schluchzte Simpkin. „Hey Kitty-Tatze?” antworteten die kleinen Mäuse —
„Hey kitty Tatze, du kleine Hauskatze!
Die Händler tragen scharlachrot,
Seide am Kragen und gold am Saum;
So stolzieren sie, man glaubt es kaum!“
Sie klicken dabei mit ihren Fingerhütten im Takt, aber auch das ließ Simpkin unbeeindruckt. Er schnüffelte an der Tür des Geschäfts und Miaute dabei bitterlich.
„Und dann kaufte ich
einen Topf voll Milch,
und einen Laib Brot,
und für einen Groschen —
und auf der Küchenanrichte.” fügte eine freche Maus noch hinzu.
„Miau! Kratz! Kratz!” schlurfte Simpkin auf der Fensterbank, während die kleinen Mäuse drinnen alle auf einmal aufsprangen und mit ihren quietschenden Stimmen schrien – „Kein Garn mehr! Kein Garn mehr.” Sie schlugen die Fensterläden zu und schlossen Simpkin damit aus.
Aber durch die feinen Spalte der Fensterläden konnte er das Klicken der Fingerhütte und den Gesang der kleinen Mäuse immer noch hören —
„Kein Garn mehr! Kein Garn mehr!“
Simpkin gab schlussendlich auf und machte sich auf den Heimweg. Der arme alte Schneider schlief friedlich in seinem Bett, sein Fieber war weg.
Auf Zehenspitzen schlich sich Simpkin zur Anrichte und nahm ein kleines Päckchen aus Seide aus der Teekanne. Er schaute es sich im Licht des Mondes an und schämte sich für seine Bösartigkeit, verglichen mit der Güte und Hilfsbereitschaft der kleinen Mäuse!
Als der Schneider am nächsten Morgen aufwachte, war das erste was er auf der geflickten Decke sah ein Strang kirschfarbener, gedrehter Seide und daneben stand der reumütige Simpkin!
„Ach, ich bin erschöpft,“ sagte der Schneider von Gloucester, „aber ich habe meinen Garn!“
Die Sonne schien schon auf den Schnee, als der Schneider aufstand und sich anzog. Er ging hinaus auf die Straße, während Simpkin vorauslief.
Die Stare zwitscherten von den Schornsteinen und die Drosseln und Rotkehlchen sangen – aber sie sangen in ihren eigenen Stimmen, nicht wie in jener Weihnachtsnacht.
„Nun,” sagte der Schneider „ich habe meinen Garn aber keine Kraft mehr – noch habe ich mehr Zeit als für ein einziges Knopfloch. Heute ist die Hochzeit des Bürgermeisters und wo ist nun der kirschfarbene Mantel?“
Er schloss die Tür seines kleinen Geschäfts in der Westgate Straße auf und Simpkin rannte hinein - wie eine Katze, die etwas erwartet.
Aber Niemand war da! Nicht einmal eine einzige kleine braune Maus!
Die Regale waren abgewischt und sauber, die kleinen Fäden und die Seidenschnipsel waren alle ordentlich weggeräumt und lagen nicht mehr auf dem Boden verstreut.
Aber auf dem Tisch – welch eine Freude! – dem Schneider entfuhr ein kleiner Jauchzer – dort, wo er die Seidenausschnitte hatte liegen lassen – dort lagen der wohl schönste Mantel und eine bestickte Seidenweste, die jemals von einem Bürgermeister Gloucesters getragen wurden!
Dort waren Rosen und Stiefmütterchen auf dem Mantel und die Weste war bestickt mit Mohnblumen und Kornblumen.
Alles war fertig – bis auf ein einziges kischfarbenes Knopfloch. Und genau dort, wo das Knopfloch fehlte war ein kleines Stück Papier angebracht, wodrauf in klitzekleiner Schrift geschrieben stand —
KEIN GARN MEHR.
Und ab da an war das Glück auf der Seite des Schneiders von Gloucester - er hatte immer etwas zu Essen auf dem Tisch und mehr als genug Geld.
Er nähte die schönsten Westen für all die reichen Händler Gloucesters und für all die feinen Herren des Landes.
Solche Rüschen und bestickten Manschetten fand man sonst nirgends! Aber die Knopflöcher waren des Schneiders größter Triumph.
Die Nähte der Knopflöcher waren so sorgfältig gearbeitet –so sorgfältig, - dass man sich wundern muss, wie ein alter Mann mit Brille, mit krummen alten Fingern und Fingerhut so sticken kann.
Die Nähte dieser Knopflöcher waren so klein – so klein, - sie sahen aus, als wären sie von kleinen Mäusen gemacht.
Ende
Die Schneekönigin(Hans Christian Andersen)
Inhaltsverzeichnis
Erste Geschichte.
welche von dem Spiegel und den Scherben handelt. Seht! nun fangen wir an. Wenn wir am Ende der Geschichte sind, wissen wir mehr, als jetzt, denn es war ein böser Kobold! Er war einer der allerärgsten, er war der Teufel! Eines Tags war er recht bei Laune, denn er hatte einen Spiegel gemacht, welcher die Eigenschaft besaß, daß alles Gute und Schöne, was sich darin spiegelte, fast zu Nichts zusammenschwand, aber Das, was nichts taugte und sich schlecht ausnahm, hervortrat und noch ärger wurde. Die herrlichsten Landschaften sahen wie gekochter Spinat darin aus, und die besten Menschen wurden widerlich oder standen auf dem Kopfe ohne Rumpf; die Gesichter wurden so verdreht, daß sie nicht zu erkennen waren, und hatte man eine Sommersprosse, so konnte man überzeugt sein, daß sie sich über Nase und Mund ausbreitete. Das sei äußerst belustigend, sagte der Teufel. Fuhr nun ein guter frommer Gedanke durch einen Menschen, dann zeigte sich ein Grinsen im Spiegel, sodaß der Teufel über seine künstliche Erfindung lachen mußte. Die, welche die Koboldschule besuchten, – denn er hielt Koboldschule – erzählten überall, daß ein Wunder geschehen sei; nun könnte man erst sehen, meinten sie, wie die Welt und die Menschen wirklich aussähen. Sie liefen mit dem Spiegel umher, und zuletzt gab es kein Land und keinen Menschen mehr, welcher nicht verdreht darin gesehen wäre. Nun wollten sie auch zum Himmel selbst auffliegen, um sich über die Engel und den lieben Gott lustig zu machen. Je höher sie mit dem Spiegel flogen, um so mehr grinste er; sie konnten ihn kaum festhalten; sie flogen höher und höher, Gott und den Engeln näher; da erzitterte der Spiegel so fürchterlich in seinem Grinsen, daß er ihren Händen entfiel und zur Erde fiel, wo er in hundert Millionen, Billionen und noch mehr Stücke zersprang. Und nun gerade verursachte er weit größeres Unglück, als zuvor, denn einige Stücke waren kaum so groß als ein Sandkorn; diese flogen nun in die weite Welt, und wo Jemand sie in das Auge bekam, da blieben sie sitzen, und da sahen die Menschen Alles verkehrt, oder hatten nur Augen für das Verkehrte bei einer Sache; denn jede kleine Spiegelscherbe behielt dieselben Kräfte, welche der ganze Spiegel besessen hatte. Einige Menschen bekamen sogar eine Spiegelscherbe in das Herz, dann aber war es ganz entsetzlich; das Herz wurde einem Klumpen Eis gleich. Einige Spiegelscherben waren so groß, daß sie zu Fensterscheiben verbraucht wurden; aber durch diese Scheiben taugte es nicht, seine Freunde zu betrachten; andere Stücke kamen in Brillen, und dann ging es schlecht, wenn die Leute diese Brillen aufsetzten, um recht zu sehen und gerecht zu sein; der Böse lachte, daß ihm der Bauch wackelte und das kitzelte ihn so angenehm. Aber draußen flogen noch kleine Glasscherben in der Luft umher. Nun, wir werden's hören!
Zweite Geschichte.
Ein kleiner Knabe und ein kleines Mädchen.
Drinnen in der großen Stadt, wo so viele Menschen und Häuser sind, daß dort nicht Platz genug ist, damit alle Leute einen kleinen Garten besitzen können, und wo sich deshalb die Meisten mit Blumen in Blumentöpfen begnügen müssen, waren zwei arme Kinder, die einen etwas größeren Garten, als einen Blumentopf, besaßen. Sie waren nicht Bruder und Schwester, aber sie waren sich eben so gut, als wenn sie es wären. Die Eltern wohnten einander gerade gegenüber in zwei Dachkammern. Da, wo das Dach des einen Nachbarhauses gegen das andere stieß, und die Wasserrinne zwischen den Dächern entlang lief, war in jedem Hause ein kleines Fenster; man brauchte nur über die Rinne zu schreiten, so konnte man von dem einen Fenster zu dem andern gelangen.
Beider Eltern hatten draußen einen großen hölzernen Kasten, und darin wuchsen Küchenkräuter, die sie gebrauchten, und ein kleiner Rosenstock; in jedem Kasten stand einer; die wuchsen herrlich! Nun fiel es den Eltern ein, die Kasten quer über die Rinne zu stellen, sodaß sie fast von dem einen Fenster zum andern reichten und zwei Blumenwällen ganz ähnlich sahen. Erbsenranken hingen über die Kasten herab, und die Rosenstücke schössen lange Zweige, die sich um die Fenster rankten und einander entgegen bogen; es war fast einer Ehrenpforte von Blättern und Blumen gleich. Da die Kasten sehr hoch waren und die Kinder wußten, daß sie nicht hinauf kriechen durften, so erhielten sie oft die Erlaubniß, zu einander hinaus zu steigen und auf ihren kleinen Schemeln unter den Rosen zu sitzen; da spielten sie dann prächtig.
Im Winter hatte dieses Vergnügen ein Ende. Die Fenster waren oft ganz zugefroren; aber dann wärmten sie Kupferschillinge auf dem Ofen und legten den warmen Schilling gegen die gefrorene Scheibe; dadurch entstand ein schönes Guckloch, so rund, so rund; dahinter blitzte ein lieblich mildes Auge, eins vor jedem Fenster; das war der kleine Knabe und das kleine Mädchen. Er hieß Kay und sie hieß Gerda. Im Sommer konnten sie mit einem Sprunge zu einander gelangen, im Winter mußten sie erst die vielen Treppen herunter und die Treppen hinauf; draußen stob der Schnee.
»Das sind die weißen Bienen, die schwärmen,« sagte die alte Großmutter.
»Haben sie auch eine Bienenkönigin?« fragte der kleine Knabe, denn er wußte, daß unter den wirklichen Bienen eine solche ist.
»Die haben sie!« sagte die Großmutter. »Sie fliegt dort, wo sie am dichtesten schwärmen! Es ist die größte von allen, und nie bleibt sie still auf der Erde; sie fliegt wieder in die schwarze Wolke hinauf. Manche Mitternacht fliegt sie durch die Straßen der Stadt und blickt zu den Fenstern hinein, und dann frieren diese so sonderbar und sehen wie Blumen aus.«
»Ja, das haben wir gesehen!« sagten beide Kinder und wußten nun, daß es wahr sei.
»Kann die Schneekönigin hier hereinkommen?« fragte das kleine Mädchen.
»Laß sie nur kommen!« sagte der Knabe; »dann setze ich sie auf den warmen Ofen und sie schmilzt.«
Aber die Großmutter glättete sein Haar und erzählte andere Geschichten.
Am Abend als der kleine Kay zu Hause und halb entkleidet war, kletterte er auf den Stuhl am Fenster und guckte durch das kleine Loch; einige Schneeflocken fielen draußen, und eine derselben, die größte, blieb auf dem Rande des einen Blumenkastens liegen; die Schneeflocke wuchs mehr und mehr und wurde zuletzt wie eine ganze Jungfrau, in den feinsten weißen Flor gekleidet, der aus Millionen sternartigen Flocken zusammengesetzt war. Sie war so schön und fein, aber von Eis, von blendendem, blinkendem Eise. Doch sie war lebendig; die Augen blitzten, wie zwei klare Sterne; aber es war keine Ruhe oder Rast in ihnen. Sie nickte dem Fenster zu und winkte mit der Hand. Der kleine Knabe erschrak und sprang vom Stuhle herunter; da war es, als ob draußen vor dem Fenster ein großer Vogel vorbeiflöge.
Am nächsten Tage wurde es klarer Frost – und dann kam das Frühjahr; die Sonne schien, das Grün keimte hervor, die Schwalben bauten Nester, die Fenster wurden geöffnet, und die kleinen Kinder saßen wieder in ihrem kleinen Garten hoch oben in der Dachrinne über allen Stockwerken.
Wie prachtvoll blühten die Rosen diesen Sommer! Das kleine Mädchen hatte einen Psalm gelernt, in welchem auch von Rosen die Rede war; und bei den Rosen dachte sie an ihre eigenen; und sie sang ihn dem kleinen Knaben vor, und er sang mit:
»Die Rosen, sie verblüh'n und verwehen, Wir werden das Christ-Kindlein sehen!«
Und die Kleinen hielten einander bei den Händen, küßten die Rosen, blickten in Gottes hellen Sonnenschein hinein und sprachen zu demselben, als ob das Jesuskind da wäre. Was waren das für herrliche Sommertage; wie schön war es draußen bei den frischen Rosenstöcken, welche zu blühen nie aufhören zu wollen schienen! Kay und Gerda sahen in das Bilderbuch mit Thieren und Vögeln, da war es – die Uhr schlug gerade Fünf auf dem großen Kirchthurme, – als Kay sagte: »Au! es stach mich in das Herz, und mir flog etwas in das Auge!«
Das kleine Mädchen fiel ihm um den Hals; er blinzelte mit den Augen; nein, es war nichts zu sehen.
»Ich glaube, es ist weg!« sagte er; aber weg war es doch nicht. Es war gerade so eins von jenen Glaskörnern, welche vom Spiegel gesprungen waren, dem Zauberspiegel, – wir entsinnen uns seiner wohl – dem häßlichen Glase, welches alles Große und Gute, das sich darin abspiegelte, klein und häßlich machte; aber das Böse und Schlechte trat recht hervor und jeder Fehler an einer Sache war gleich zu bemerken. Der arme Kay hatte auch ein Körnchen gerade in das Herz hinein bekommen. Das wird nun bald wie ein Eisklumpen werden. Nun that es nicht mehr weh, aber das Körnchen war da.
»Weshalb weinst Du?« fragte er. »So siehst Du häßlich aus!« »Mir fehlt ja nichts!« »Pfui!« rief er auf einmal, »die Rose dort hat einen Wurmstich! Und sieh, diese da ist ganz schief! Im Grunde sind es häßliche Rosen! Sie gleichen dem Kasten, in welchem sie stehen!« Und dann stieß er mit dem Fuße gegen den Kasten und riß die beiden Rosen ab.
» Kay, was machst Du?« rief das kleine Mädchen; und als er ihren Schrecken gewahrte, riß er noch eine Rose ab und sprang dann in sein Fenster hinein von der kleinen, lieblichen Gerda fort.
Wenn sie später mit dem Bilderbuche kam, sagte er, daß das für Wickelkinder wäre; und erzählte die Großmutter Geschichten, so kam er immer mit einem aber: – konnte er dazu gelangen, dann ging er hinter ihr her, setzte eine Brille auf und sprach ebenso, wie sie; das machte er ganz treffend, und die Leute lachten über ihn. Bald konnte er die Sprache und den Gang aller Menschen in der ganzen Straße nachahmen. Alles, was an ihnen eigenthümlich und unschön war, das wußte Kay nachzuahmen; und die Leute sagten: »Das ist sicher ein ausgezeichneter Kopf, den der Knabe hat!« Aber es war das Glas, welches ihm in dem Herzen saß; daher kam es auch, daß er selbst die kleine Gerda neckte, die ihm von ganzem Herzen gut war.
Seine Spiele wurden nun anders, als früher; sie wurden ganz verständig. – An einem Wintertage, wo es schneite, kam er mit einem großen Brennglase, hielt seinen blauen Rockzipfel heraus und ließ die Schneeflocken darauf fallen.
»Sieh nun in das Glas, Gerda!« sagte er; und jede Schneeflocke wurde viel größer und sah aus wie eine prächtige Blume oder ein zehneckiger Stern; es war schön anzusehen. »Siehst Du, wie künstlich!« sagte Kay. »Das ist weit interessanter, als die wirklichen Blumen! Und es ist kein einziger Fehler daran; sie sind ganz regelmäßig. Wenn sie nur nicht schmelzen!«
Bald darauf kam Kay mit großen Handschuhen und seinem Schlitten auf dem Rücken; er rief Gerda in die Ohren: »Ich habe Erlaubniß erhalten, auf dem großen Platze zu fahren, wo die anderen Knaben spielen!« und weg war er.
Dort auf dem Platze banden die kecksten Knaben oft ihre Schlitten an den Wagen der Landleute fest, und dann fuhren sie ein gutes Stück Wegs mit. Das ging recht schön. Als sie im besten Spielen waren, kam ein großer Schlitten; der war ganz weiß angestrichen, und darin saß Jemand, in einen rauhen, weißen Pelz gehüllt und mit einer rauhen, weißen Mütze auf dem Kopfe; der Schlitten fuhr zwei Mal um den Platz herum, und Kay band seinen kleinen Schlitten schnell daran fest, und nun fuhr er mit. Es ging rascher und rascher, gerade hinein in die nächste Straße. Der, welcher fuhr, drehte sich um, nickte dem Kay freundlich zu; es war, als ob sie einander kannten; jedesmal, wenn Kay seinen kleinen Schlitten abbinden wollte, nickte der Fahrende wieder, und dann blieb Kay sitzen; sie fuhren zum Stadtthore hinaus. Da begann der Schnee so dicht niederzufallen, daß der kleine Knabe keine Hand vor sich erblicken konnte; aber er fuhr weiter; nun ließ er schnell die Schnur fahren, um von dem großen Schlitten loszukommen, doch das half nichts, sein kleines Fuhrwerk hing fest, und es ging mit Windeseile vorwärts. Da rief er ganz laut, aber Niemand hörte ihn, und der Schnee stob, und der Schlitten flog von dannen; mitunter gab es einen Sprung; es war, als führe er über Gräben und Hecken. Der Knabe war ganz erschrocken; er wollte sein Vater unser beten, aber er konnte sich nur des großen Ein-Mal-Eins entsinnen.
Die Schneeflocken wurden größer und größer; zuletzt sahen sie aus wie große, weiße Hühner; auf einmal sprangen sie zur Seite, der große Schlitten hielt, und die Person, die ihn fuhr, erhob sich; der Pelz und die Mütze waren ganz und gar von Schnee; es war eine Dame, hoch und schlank, glänzend weiß; es war die Schneekönigin. »Wir sind gut gefahren!« sagte sie; »aber wer wird wohl frieren! Krieche in meinen Pelz!« Und sie setzte ihn neben sich in den Schlitten und schlug den Pelz um ihn; es war als versänke er in einem Schneetreiben.
»Friert Dich noch?« fragte sie und küßte ihn auf die Stirn. O! das war kälter, als Eis; das ging ihm gerade hinein bis ins Herz, welches ja schon zur Hälfte ein Eisklumpen war; es war als sollte er sterben; aber nur einen Augenblick, dann that es ihm recht wohl; er spürte nichts mehr von der Kälte rings umher.
»Meinen Schlitten! Vergiß nicht meinen Schlitten!« Daran dachte er zuerst, und der wurde an einem der weißen Hühnchen festgebunden, und dieses flog hinterher mit dem Schlitten auf dem Rücken. Die Schneekönigin küßte Kay nochmals, und da hatte er die kleine Gerda, die Großmutter und Alle daheim vergessen.
»Nun bekommst Du keine Küsse mehr!« sagte sie; »denn sonst küßte ich Dich todt!«
Kay sah sie an; sie war so schön! ein klügeres, lieblicheres Antlitz konnte er sich nicht denken; nun erschien sie ihm nicht von Eis, wie damals, als sie draußen vor dem Fenster saß und ihm winkte; in seinen Augen war sie vollkommen; er fühlte gar keine Furcht. Er erzählte ihr, daß er kopfrechnen könne, und zwar mit Brüchen; er wisse des Landes Quadratmeilen und die Einwohnerzahl; und sie lächelte immer. Da kam es ihm vor, als wäre es doch nicht genug, was er wisse; und er blickte hinauf in den großen Luftraum; und sie flog mit ihm hoch hinauf auf die schwarze Wolke, und der Sturm sauste und brauste; es war, als sänge er alte Lieder. Sie flogen über Wälder und Seen, über Meer und Länder; unter ihnen sauste der kalte Wind, die Wölfe heulten, der Schnee knisterte; über ihnen flogen die schwarzen, schreienden Krähen; aber hoch oben schien der Mond groß und klar, und dort betrachtete Kay die lange, lange Winternacht; am Tage schlief er zu den Füßen der Schneekönigin.
Dritte Geschichte.
Der Blumengarten bei der Frau, welche zaubern konnte.
Aber wie erging es der kleinen Gerda, als Kay nicht zurückkehrte? Wo war er geblieben? – Niemand wußte es, Niemand konnte Bescheid geben. Die Knaben erzählten nur, daß sie ihn seinen Schlitten an einen andern großen hätten binden sehen, der in die Straße hinein und aus dem Stadtthore gefahren wäre. Niemand wußte, wo er geblieben; viele Thränen flossen, und besonders die kleine Gerda weinte sehr viel und lange; – dann sagte sie, er sei todt; er wäre im Fluß ertrunken, der nahe bei der Schule vorbei floß; o, das waren recht lange, finstere Wintertage!
Nun kam der Frühling mit wärmerem Sonnenschein.
» Kay ist todt und fort!« sagte die kleine Gerda.
»Das glaube ich nicht!« antwortete der Sonnenschein.
»Er ist todt und fort!« sagte sie zu den Schwalben.
»Das glauben wir nicht!« erwiderten diese, und am Ende glaubte die kleine Gerda auch nicht.
»Ich will meine neuen, rothen Schuhe anziehen,« sagte sie eines Morgens, »die, welche Kay nie gesehen hat, und dann will ich zum Flusse hinunter gehen und den nach ihm fragen!«
Und es war noch sehr früh; sie küßte die alte Großmutter, die noch schlief, zog die rothen Schuhe an und ging ganz allein aus dem Stadtthore nach dem Flusse.
»Ist es wahr, daß Du mir meinen kleinen Spielkameraden genommen hast? Ich will Dir meine rothen Schuhe schenken, wenn Du ihn mir wiedergeben willst!«
Und es war ihr, als nickten die Wellen ganz sonderbar; da nahm sie ihre rothen Schuhe, die sie am liebsten hatte, und warf sie beide in den Fluß hinein; aber sie fielen dicht an das Ufer, und die kleinen Wellen trugen sie ihr wieder an das Land; es war gerade als wollte der Fluß das Liebste, was sie hatte, nicht, weil er den kleinen Kay nicht hatte; aber sie glaubte nun, daß sie die Schuhe nicht weit genug hinausgeworfen habe; und so kroch sie in ein Boot, welches im Schilfe lag; sie ging bis an das äußerste Ende desselben und warf die Schuhe von da in das Wasser; aber das Boot war nicht festgebunden, und bei der Bewegung, welche sie verursachte, glitt es vom Lande ab; sie bemerkte es und beeilte sich, herauszukommen; doch ehe sie zurückkam, war das Boot über eine Elle vom Lande, und nun trieb es schneller von dannen.
Da erschrak die kleine Gerda sehr und sing an zu weinen; allein Niemand außer den Sperlingen hörte sie, und die konnten sie nicht an das Land tragen; aber sie flogen längs des Ufers und sangen, gleichsam um sie zu trösten: »Hier sind wir, hier sind wir!« Das Boot trieb mit dem Strome; die kleine Gerda saß ganz still, nur mit Strümpfen an den Füßen; ihre kleinen rothen Schuhe trieben hinter ihr her; aber sie konnten das Boot nicht erreichen; das hatte schnellere Fahrt.
Hübsch war es an beiden Ufern; schöne Blumen, alte Bäume und Abhänge mit Schafen und Kühen; aber nicht ein Mensch war zu erblicken.
»Vielleicht trägt mich der Fluß zu dem kleinen Kay hin,« dachte Gerda, und da wurde sie heiterer, erhob sich und betrachtete viele Stunden die grünen, schönen Ufer; dann gelangte sie zu einem großen Kirschgarten, in welchem ein kleines Haus mit sonderbaren, rothen und blauen Fenstern war übrigens hatte es ein Strohdach, und draußen waren zwei hölzerne Soldaten, die vor der Vorbeisegelnden das Gewehr schulterten.
Gerda rief nach ihnen; sie glaubte, daß sie lebendig wären; aber sie antworteten natürlich nicht; sie kam ihnen ganz nahe; der Fluß trieb das Boot gerade auf das Land zu.
Gerda rief noch lauter, und da kam eine alte, alte Frau aus dem Hause, die sich auf einen Krückstock stützte; sie hatte einen großen Sonnenhut auf, und der war mit den schönsten Blumen bemalt.
»Du armes, kleines Kind!« sagte die alte Frau; »wie bist Du doch auf den großen, reißenden Strom gekommen, und weit in die Welt hinausgetrieben!« Und dann ging die alte Frau in das Wasser hinein, erfaßte mit ihrem Krückstucke das Boot, zog es an das Land und hob die kleine Gerda heraus.
Und Gerda war froh, wieder auf das Trockene zu gelangen, obgleich sie sich vor der fremden alten Frau ein wenig fürchtete.
»Komm doch und erzähle mir, wer Du bist, und wie Du hierher kommst!« sagte sie.
Und Gerda erzählte ihr Alles; und die Alte schüttelte mit dem Kopfe und sagte: »Hm! Hm!« Und als ihr Gerda Alles gesagt und sie gefragt hatte, ob sie nicht den kleinen Kay gesehen, habe, sagte die Frau, daß er nicht vorbeigekommen sei; aber er komme wohl noch; sie solle nur nicht betrübt sein, sondern ihre Kirschen kosten und ihre Blumen betrachten; die wären schöner, als irgend ein Bilderbuch; eine jede könne eine Geschichte erzählen. Dann nahm sie Gerda bei der Hand, führte sie in das kleine Haus hinein und schloß die Thüre zu.
Die Fenster lagen sehr hoch, und die Scheiben waren roth, blau und gelb; das Tageslicht schien mit allen Farben gar sonderbar herein; auf dem Tische standen die schönsten Kirschen, und Gerda aß davon, so viel sie wollte, denn das war ihr erlaubt. Wahrend sie aß, kämmte die alte Frau ihr das Haar mit einem goldenen Kamme, und das Haar ringelte sich und glänzte herrlich gelb rings um das kleine, freundliche Antlitz, welches so rund war und wie eine Rose aussah.
»Nach einem so lieben, kleinen Mädchen habe ich mich schon lange gesehnt,« sagte die Alte. »Nun wirst Du sehen, wie gut wir mit einander leben werden!« Und so wie sie der kleinen Gerda Haar kämmte, vergaß Gerda mehr und mehr ihren Pflegebruder Kay; denn die alte Frau konnte zaubern; aber eine böse Zauberin war sie nicht; sie zauberte nur ein Wenig zu ihrem Vergnügen und wollte gern die kleine Gerda behalten. Deshalb ging sie in den Garten, streckte ihren Krückstock gegen alle Rosensträuche aus, und wie schön sie auch blühten, so sanken sie doch alle in die schwarze Erde hinunter, und man konnte nicht sehen, wo sie gestanden hatten. Die Alte fürchtete, wenn Gerda die Rosen erblickte, möchte sie an ihre eigenen denken, sich dann des kleinen Kay erinnern und davonlaufen.
Nun führte sie Gerda hinaus in den Blumengarten. Was war da für ein Duft und eine Herrlichkeit! Alle nur denkbaren Blumen, und zwar für jede Jahreszeit, standen hier im prächtigsten Flor; kein Bilderbuch, konnte bunter und schöner sein. Gerda sprang vor Freuden Hochauf und spielte, bis die Sonne hinter den hohen Kirschbäumen unterging; da bekam sie ein schönes Bett mit rothen Seidenkissen, die waren mit Veilchen gestopft; und sie schlief und träumte da so herrlich, wie nur eine Königin an ihrem Hochzeitstage.
Am nächsten Tage konnte sie wieder mit den Blumen im warmen Sonnenscheine spielen, und so verflossen viele Tage. Gerda kannte jede Blume; aber wie viele deren auch waren, so war es ihr doch, als ob eine fehlte, allein welche, das wußte sie nicht. Da sitzt sie eines Tages und betrachtet den Sonnenhut der alten Frau mit den gemalten Blumen, und gerade die schönste war eine Rose. Die Alte hatte vergessen, diese vom Hute wegzuwischen, als sie die andern in die Erde zauberte. Aber so ist es, wenn man die Gedanken nicht beisammen hat! »Was! sind hier keine Rosen?« sagte Gerda und sprang zwischen die Beete, suchte und suchte; ach, da war keine zu finden. Da setzte sie sich hin und weinte, aber ihre Thränen fielen gerade auf eine Stelle, wo ein Rosenstrauch versunken war, und als die warmen Thränen die Erde benetzten, schoß der Strauch auf einmal empor, so blühend, wie er versunken war, und Gerda umarmte ihn, küßte die Rosen und gedachte der herrlichen Rosen daheim und mit ihnen auch des kleinen Kay.
»O, wie bin ich aufgehalten worden!« sagte das kleine Mädchen. »Ich wollte ja den kleinen Kay suchen! – Wißt Ihr nicht, wo er ist?« fragte sie die Rosen. »Glaubt Ihr, er sei todt?«
»Todt ist er nicht,« antworteten die Rosen. »Wir sind ja in der Erde gewesen; dort sind alle Todten, aber Kay war nicht da.«
»Ich danke Euch!« sagte die kleine Gerda und ging zu den andern Blumen hin, sah in deren Kelch hinein und fragte: »Wißt Ihr nicht, wo der kleine Kay ist?«
Aber jede Blume stand in der Sonne und träumte ihr eigenes Märchen oder Geschichtchen; davon hörte Gerda so viele, viele; aber keine wußte etwas von Kay.
Und was sagte denn die Feuerlilie?
»Hörst Du die Trommel: bum! dum! Es sind nur zwei Töne; immer: bum! bum! Höre der Frauen Trauergesang, höre den Ruf der Priester. – In ihrem langen rothen Mantel steht das Hinduweib auf dem Scheiterhaufen; die Flammen lodern um sie und ihren todten Mann empor; aber das Hinduweib denkt an den Lebenden hier im Kreise, an ihn, dessen Augen heißer als die Flammen brennen, an ihn, dessen Augenfeuer ihr Herz stärker berührt, als die Flammen, welche bald ihren Körper zu Asche verbrennen. Kann die Flamme des Herzens in der Flamme des Scheiterhaufens ersterben?«
»Das verstehe ich durchaus nicht,« sagte die kleine Gerda.
»Das ist mein Märchen!« sagte die Feuerlilie.
Was sagt die Winde?
»Ueber den schmalen Fußweg herüber hängt eine alte Ritterburg; das dichte Immergrün wächst um die morschen, rothen Mauern empor, Blatt an Blatt, um den Altan herum, und da steht ein schönes Mädchen; sie beugt sich über das Geländer hinaus und sieht den Weg entlang. Keine Rose hängt frischer an den Zweigen, als sie; keine Apfelblüthe, wenn der Wind sie dem Baume entführt, schwebt leichter dahin, als sie; wie rauschte das prächtige Seidengewand! »»Kommt er noch nicht?««
»Ist es Kay, den Du meinst?« fragte die kleine Gerda.
»Ich spreche nur von meinem Märchen, meinem Traume,« erwiderte die Winde.
Was sagt die kleine Schneeblume?
»Zwischen den Bäumen hängt an Seilen das lange Brett; das ist eine Schaukel; zwei niedliche, kleine Mädchen – die Kleider sind weiß wie der Schnee; lange grüne Seidenbänder flatterten von den Hüten – sitzen darauf und schaukeln sich; der Bruder, welcher größer ist, als sie, steht in der Schaukel; er hat den Arm um das Seil geschlungen, um sich zu halten, denn in der einen Hand hat er eine kleine Schale, in der andern eine Thonpfeife; er bläst Seifenblasen; die Schaukel stiegt, und die Blasen steigen mit schönen, wechselnden Farben; die letzte hängt noch am Pfeifenstiele und wiegt sich im Winde. Die Schaukel schwebt; der kleine schwarze Hund, leicht wie die Blasen, erhebt sich auf den Hinterfüßen und will mit in die Schaukel; sie stiegt; der Hund fällt, bellt, und ist böse; er wird geneckt, die Blasen platzen. – Ein schaukelndes Brett, ein zerspringendes Schaumbild ist mein Gesang!«
»Es ist möglich, daß es hübsch ist, was Du erzählst; aber Du sagst es so traurig und erwähnst den kleinen Kay nicht.«
Was sagen die Hyacinthen?
»Es waren drei schöne Schwestern, durchsichtig und fein; der Einen Kleid war roth, der Andern Kleid blau, der Dritten Kleid weiß; Hand in Hand tanzten sie beim stillen See im hellen Mondscheine. Es waren keine Elfen, es waren Menschenkinder. Dort duftete es so süß, und die Mädchen verschwanden im Walde; der Duft wurde stärker; drei Särge, dann lagen die schönen Mädchen, glitten von des Waldes Dickicht über den See dahin; die Johanniswürmchen flogen leuchtend rings umher, wie kleine schwebende Lichter. Schlafen die tanzenden Mädchen oder sind sie todt? – Der Blumenduft sagt, sie sind Leichen; die Abendglocke läutet den Grabgesang!«
»Du machst mich ganz betrübt,« sagte die kleine Gerda. »Du duftest so stark; ich muß an die todten Mädchen denken! Ach, ist denn der kleine Kay wirklich todt? Die Rosen sind unten in der Erde gewesen und sagen: »Nein!«
»Kling, Klang!« läuteten die Hyacinthenglocken. »Wir läuten nicht für den kleinen Kay, wir kennen ihn nicht; wir singen nur unser Lied, das einzige, welches wir wissen.«
Und Gerda ging zur Butterblume, die aus den glänzenden, grünen Blättern hervorschien.
»Du bist eine kleine, helle Sonne!« sagte Gerda. Sage mir, weißt Du, wo ich meinen Gespielen finden kann?«
Und die Butterblume glänzte so schön und sah wieder auf Gerda. Welches Lied konnte wohl die Butterblume singen!« Es handelte auch nicht von Kay.
»In einem kleinen Hofe schien die liebe Gottessonne am ersten Frühlingstage so warm; die Strahlen glitten an des Nachbarhauses weißen Wänden herab; dicht dabei wuchs die erste gelbe Blume und glänzte golden in den warmen Sonnenstrahlen; die alte Großmutter saß draußen in ihrem Stuhle; die Enkelin, ein armes, schönes Dienstmädchen, kehrte von einem kurzen Besuche heim: sie küßte die Großmutter; es war Gold, Herzensgold in dem gesegneten Kusse. Gold im Munde, Gold im Grunde, Gold in der Morgenstunde! Sieh, das ist meine kleine Geschichte!« sagte die Butterblume.
»Meine arme, alte Großmutter!« seufzte Gerda. »Ja, sie sehnt sich gewiß nach mir und grämt sich um mich, ebenso wie sie es um den kleinen Kay that. Aber ich komme bald wieder nach Hause, und dann bringe ich Kay mit. – Es nützt nichts, daß ich die Blumen frage, die wissen nur ihr eigenes Lied; sie geben mir keinen Bescheid!« Und dann band sie ihr kleines Kleid auf, damit sie rascher laufen könne; aber die Pfingstlilie schlug an ihr Bein, indem sie darüber hinsprang; da blieb sie stehen, betrachtete die lange gelbe Blume und fragte: »Weißt Du vielleicht etwas?« Und sie bog sich ganz zur Pfingstlilie hinab; und was sagte die?
»Ich kann mich selbst erblicken! Ich kann mich selbst sehen!« sagte die Pfingstlilie, »O, o, wie ich rieche! – Oben in dem kleinen Erkerzimmer steht, halb angekleidet, eine kleine Tänzerin; sie steht bald auf einem Beine, bald auf beiden; sie tritt die ganze Welt mit Füßen; sie ist nichts als Augentäuschung. Sie gießt Wasser aus dem Theetopfe auf ein Stück Zeug aus, welches sie halt; es ist der Schnürleib; – Reinlichkeit ist eine schöne Sache; das weiße Kleid hängt am Haken; das ist auch im Theetopf gewaschen und auf dem Dache getrocknet; sie zieht es an und schlägt das safrangelbe Tuch um den Hals; nun scheint das Kleid noch weißer. Das Bein ausgestreckt! Sieh, wie sie auf einem Stiele prangt! Ich kann mich selbst erblicken! Ich kann mich selbst sehen!«
»Darum kümmere ich mich gar nicht!« sagte Gerda. »Das brauchst Du mir nicht zu erzählen;« und dann lief sie bis an das Ende des Gartens.
Die Thüre war verschlossen, aber sie drückte auf die verrostete Klinke, sodaß diese losbrach; die Thüre ging auf und die kleine Gerda sprang mit nackten Füßen in die weite Welt hinaus. Sie blickte dreimal zurück, aber Niemand war da, der sie verfolgte; zuletzt konnte sie nicht mehr laufen und setzte sich auf einen großen Stein; und als sie sich umsah, war es mit dem Sommer vorbei; es war Spätherbst; das konnte man in dem schönen Garten gar nicht bemerken, wo immer Sonnenschein und Blumen aller Jahreszeiten waren.
»Gott, wie habe ich mich verspätet!« sagte die kleine Gerda. »Es ist ja Herbst geworden! Da darf ich nicht ruhen!« Und sie erhob sich, um zu gehen.
O, wie waren ihre kleinen Füße so wund und müde! Rings umher sah es kalt und rauh aus; die langen Weidenblätter waren ganz gelb, und der Thau tröpfelte als Wasser nieder; ein Blatt fiel nach dem andern ab; nur der Schlehendorn trug noch Früchte, die waren aber herbe und zogen den Mund zusammen. O, wie war es grau und schwer in der weiten Welt!
Vierte Geschichte.
Prinz und Prinzessin.
Gerda mußte wieder ausruhen; da hüpfte dort auf dem Schnee, der Stelle, wo sie saß, gerade gegenüber, eine große Krähe; die hatte lange gesessen, sie betrachtet und mit dem Kopfe gewackelt; nun sagte sie: »Krah! Krah! – Gu'Tag! Gu'Tag!« Besser konnte sie es nicht herausbringen, aber sie meinte es gut mit dem kleinen Mädchen und fragte, wohin sie so allein in die weite Welt hinausginge. Das Wort allein verstand Gerda sehr wohl und fühlte recht, wie viel darin lag; und sie erzählte der Krähe ihr ganzes Leben und Schicksal und fragte, ob sie Kay nicht gesehen habe.
Und die Krähe nickte ganz bedächtig und sagte: »Das könnte sein! Das könnte sein!«
»Wie? Glaubst Du?« rief das kleine Mädchen und hätte fast die Krähe todt gedrückt, so küßte sie diese.
»Vernünftig, vernünftig!« sagte die Krähe. »Ich glaube, ich weiß; – ich glaube; es kann sein; der kleine Kay – aber nun hat er Dich sicher über der Prinzessin vergessen!«
»Wohnt er bei einer Prinzessin?« fragte Gerda.
»Ja, höre!« sagte die Krähe. »Aber es fällt mir so schwer, Deine Sprache zu sprechen. Verstehst Du die Krähensprache? dann will ich besser erzählen.«
»Nein, die habe ich nicht gelernt,« sagte Gerda, »aber die Großmutter verstand sie, und auch sprechen konnte sie diese Sprache. Hätte ich sie nur gelernt!«
»Thut gar nichts!« sagte die Krähe. »Ich werde erzählen, so gut ich kann; aber schlecht wird es gehen.« Dann erzählte sie, was sie wußte.
»In dem Königreiche, in welchem wir jetzt sitzen, wohnt eine Prinzessin, die ist ganz unbändig klug; aber sie hat auch alle Zeitungen, die es in der Welt giebt, gelesen und wieder vergessen, so klug ist sie. Neulich saß sie auf dem Throne, und das ist doch nicht so angenehm, wie man sagt; da fing sie an, ein Lied zu singen, und das war dieses: »Weshalb sollt' ich mich nicht verheirathen?« »Höre, da ist etwas daran,« sagte die Krähe, »und so wollte sie sich verheirathen; aber sie wollte einen Mann haben, der zu antworten verstehe, wenn man mit ihm spreche; einen, der nicht blos da stehe und vornehm aussehe, denn das sei zu langweilig. Nun ließ sie alle Hofdamen zusammentrommeln, und als diese hörten, was sie wollte, wurden sie sehr vergnügt. »Das mag ich leiden!« sagte sie; »daran dachte ich neulich auch!« – »Du kannst glauben, daß jedes Wort, was ich sage, wahr ist!« fügte die Krähe hinzu. »Ich habe eine zahme Geliebte, die geht frei im Schlosse umher, und die hat mir Alles erzählt!«
Die Geliebte war natürlich auch eine Krähe. Denn eine Krähe sucht die andere, und es bleibt immer eine Krähe.
»Die Zeitungen kamen sogleich mit einem Rande von Herzen und der Prinzessin Namenszug heraus; man konnte darin lesen, daß es einem jeden jungen Manne, der gut aussehe, freistehe, auf das Schloß zu kommen und mit der Prinzessin zu sprechen; und Derjenige, welcher so spreche, daß man hören könne, er sei dort zu Hause, und der am Besten spräche, den wolle die Prinzessin zum Manne nehmen. – Ja, ja,« sprach die Krähe, »Du kannst mir es glauben; es ist so gewiß wahr, als ich hier sitze. Junge Männer strömten herzu; es war ein Gedränge und ein Laufen; aber es glückte weder am ersten, noch am zweiten Tage. Sie konnten alle gut sprechen, wenn sie auf der Straße waren, aber wenn sie in das Schloßthor traten und die Gardisten in Silber sahen und die Treppen hinauf die Lakaien in Gold und die großen erleuchteten Säle – dann wurden sie verwirrt. Und standen sie gar vor dem Throne, wo die Prinzessin saß, dann wußten sie nichts zu sagen, als das letzte Wort, was sie gesprochen hatte; und das noch einmal zu hören, dazu hatte sie keine Lust. Es war als ob die Leute drinnen Schnupftabak auf den Magen bekommen hätten und in den Schlaf gefallen wären, bis sie wieder auf die Straße kamen, dann erst konnten sie wieder sprechen. Da stand eine Reihe vom Stadtthore an bis zum Schlosse. – Ich war selbst drinnen, um es zu sehen!« sagte die Krähe. »Sie wurden hungrig und durstig, aber auf dem Schlosse erhielten sie nicht einmal ein Glas Wasser. Zwar hatten einige der Klügsten Butterbrot mitgenommen, aber sie theilten nicht mit ihrem Nachbar; sie dachten so: Laß ihn hungrig aussehen, dann nimmt ihn die Prinzessin nicht!«
»Aber Kay, der kleine Kay!« fragte Gerda. »Wann kam der? War er unter der Menge?«
»Warte! warte! Jetzt sind wir bei ihm! Es war am dritten Tage, da kam eine kleine Person, ohne Pferd und Wagen, fröhlich gerade auf das Schloß zu marschirt; seine Augen glänzten wie Deine; er hatte schönes langes Haar, aber sonst ärmliche Kleider.«
»Das war Kay!« jubelte Gerda. »O, dann habe ich ihn gefunden!« und sie klatschte in die Hände. »Er hatte ein kleines Ränzel auf dem Rücken!« sagte die Krähe.
»Nein, das war sicher sein Schlitten!« sagte Gerda; »denn mit dem Schlitten ging er fort!«
»Das kann wohl sein,« sagte die Krähe; »ich sah nicht so genau darnach! Aber das weiß ich von meiner zahmen Geliebten, daß er, als er in das Schloßthor kam und die Leibgardisten in Silber sah und die Treppe hinauf die Lakaien in Gold, nicht im mindesten verlegen wurde; er nickte und sagte zu ihnen: »Das muß langweilig sein, auf der Treppe zu stehen; ich gehe lieber hinein!« Da glänzten die Säle von Lichtern; Geheimräthe und Excellenzen gingen mit entblößten Füßen und trugen Goldgefäße; man konnte wohl andächtig werden! Seine Stiefel knarrten gar gewaltig laut, aber ihm wurde doch nicht bange.«
»Das ist ganz gewiß Kay!« sagte Gerda. »Ich weiß, er hat neue Stiefel an; ich habe sie in der Großmutter Stube knarren hören!«
»Ja freilich knarrten sie!« sagte die Krähe. »Und frischen Muths ging er gerade zur Prinzessin hinein, die auf einer großen Perle saß, die so groß wie ein Spinnrad war; und alle Hofdamen mit ihren Jungfern und den Jungfern der Jungfern, und alle Cavaliere mit ihren Dienern und den Dienern der Diener, die wieder einen Burschen hielten, standen rings herum aufgestellt; und je näher sie der Thür standen, desto stolzer sahen sie aus. Des Dieners Burschen, der immer in Pantoffeln geht, darf man kaum anzusehen wagen; so stolz steht er in der Thüre!«
»Das muß gräulich sein!« sagte die kleine Gerda. »Und Kay hat doch die Prinzessin erhalten?«
»Wäre ich nicht eine Krähe gewesen, so hätte ich sie genommen, und dessen ungeachtet daß ich verlobt bin. Er soll eben so gut gesprochen haben, wie ich, wenn ich die Krähensprache spreche: das habe ich von meiner zahmen Geliebten gehört. Er war fröhlich und niedlich; er war nicht gekommen zum Freien, sondern nur, um der Prinzessin Klugheit zu hören; und die fand er gut, und sie fand ihn wieder gut.«
»Ja, sicher! das war Kay!« sagte Gerda. »Er war so klug; er konnte die Kopfrechnung mit Brüchen. – O, willst Du mich nicht auf dem Schlosse einführen?«
»Ja, das ist leicht gesagt!« antwortete die Krähe. »Aber wie machen wir das? Ich werde es mit meiner zahmen Geliebten besprechen; sie kann uns wohl Rath ertheilen; denn das muß ich Dir sagen: so ein kleines Mädchen, wie Du bist, bekommt nie die Erlaubniß, hinein zu kommen!« »Ja, die erhalte ich!« sagte Gerda. »Wenn Kay hört, daß ich da bin, kommt er gleich heraus und holt mich!«
»Erwarte mich dort am Gitter!« sagte die Krähe, wackelte mit dem Kopfe und flog davon.
Erst als es spät am Abend war, kehrte die Krähe wieder zurück. »Rar! Rar!« sagte sie. »Ich soll Dich vielmals von ihr grüßen, und hier ist ein kleines Brot für Dich, sie nahm es aus der Küche, dort ist Brot genug, und Du bist gewiß hungrig. – Es ist nicht möglich, daß Du in das Schloß hineinkommen kannst: Du bist ja barfuß. Die Gardisten in Silber und die Lakaien in Gold würden es nicht erlauben. Aber weine nicht! Du sollst schon hinaufkommen. Meine Geliebte kennt eine schmale Hintertreppe, die zum Schlafgemach führt, und sie weiß, wie sie den Schlüssel erhalten kann.«
Sie gingen in den Garten hinein, in die große Allee, wo ein Blatt nach dem andern abfiel: und als auf dem Schlosse die Lichter ausgelöscht wurden, das eine nach dem andern, führte die Krähe die kleine Gerda zu einer Hinterthür, die nur angelehnt war.
O, wie Gerda's Herz vor Angst und Sehnsucht pochte! Es war als ob sie etwas Böses thun wollte; und sie wollte ja doch nur wissen, ob es der kleine Kay sei. Ja, er mußte es sein; sie gedachte so lebendig seiner klugen Augen, seines langen Haares; sie konnte sehen, wie er lächelte, wie damals, als sie daheim unter den Rosen saßen. Er würde sicher froh sein, sie zu erblicken; zu hören, welchen langen Weg sie um seinetwillen zurückgelegt; zu wissen, wie betrübt sie Alle daheim gewesen, als er nicht wiedergekommen. O, das war eine Furcht und eine Freude!
Nun waren sie auf der Treppe; da brannte eine kleine Lampe auf dem Schranke; mitten auf dem Fußboden stand die zahme Krähe und wendete den Kopf nach allen Seiten und betrachtete Gerda, die sich verneigte, wie die Großmutter sie gelehrt hatte.
»Mein Verlobter hat mir so viel Gutes von Ihnen gesagt, mein kleines Fräulein,« sagte die zahme Krähe; »Ihr Lebenslauf, wie man es nennt, ist auch sehr rührend. – Wollen Sie die Lampe nehmen, dann werde ich vorangehen. Wir gehen hier den geraden Weg, denn da begegnen wir Niemand.«
»Es ist mir, als käme Jemand hinter uns her,« sagte Gerda; und es sauste an ihr vorbei; es war, wie Schatten an der Wand: Pferde mit fliegenden Mähnen und dünnen Beinen, Jägerburschen, Herren und Damen zu Pferde.
»Das sind nur Träume« sagte die Krähe; »die kommen und holen der hohen Herrschaften Gedanken zur Jagd ab. Das ist recht gut, dann können Sie sie besser im Bette betrachten. Aber ich hoffe, wenn Sie zu Ehren und Würden gelangen, werden Sie ein dankbares Herz zeigen.«
»Das versteht sich von selbst!« sagte die Krähe vom Walde.
Nun kamen sie in den ersten Saal; der war von rosenrothem Atlas mit künstlichen Blumen an den Wänden hinauf, hier sausten an ihnen schon die Träume vorbei; aber sie fuhren so schnell, daß Gerda die hohen Herrschaften nicht zu sehen bekam. Ein Saal war immer prächtiger als der andere; ja, man konnte wohl verdutzt werden. Nun waren sie im Schlafgemache. Hier glich die Decke einer großen Palme mit Blättern von kostbarem Glas, und mitten auf dem Fußboden hingen an einem dicken Stengel von Gold zwei Betten, von denen jedes wie eine Lilie aussah; die eine war weiß, in der lag die Prinzessin; die andere war roth, und in dieser sollte Gerda den kleinen Kay suchen. Sie bog eins der rothen Blätter zur Seite, da sah sie einen braunen Nacken. – O, das war Kay! – Sie rief laut seinen Namen, hielt die Lampe nach ihm hin – die Träume sausten zu Pferde wieder in die Stube herein – er erwachte, drehte den Kopf um und – es war nicht der kleine Kay.
Der Prinz glich ihm nur im Nacken; aber jung und hübsch war er. Und aus dem weißen Lilienblatte blinzelte die Prinzessin hervor und fragte, wer da wäre. Da weinte die kleine Gerda und erzählte ihre ganze Geschichte und Alles, was die Krähen für sie gethan hatten.
»Du armes Kind!« sagte der Prinz und die Prinzessin; und sie lobten die Krähen und sagten, daß sie nicht böse auf sie seien; aber sie sollten es ja nicht öfter thun. Uebrigens sollten sie eine Belohnung erhalten.
»Wollt Ihr frei fliegen?« sagte die Prinzessin. »Oder wollt Ihr feste Anstellung als Hofkrähen haben, mit Allem, was in der Küche abfällt?«
Und beide Krähen verneigten sich und baten um feste Anstellung, denn sie gedachten des Alters und sagten: »Es wäre schön, etwas für die alten Tage zu haben,« wie sie es nannten.
Und der Prinz stand aus seinem Bette aus und ließ Gerda darin schlafen, mehr konnte er nicht thun. Sie faltete ihre kleinen Hände und dachte: »Wie gut sind nicht die Menschen und die Thiere!« – Dann schloß sie ihre Augen und schlief sanft. Alle Träume kamen wieder herein geflogen, sie sahen wie Engel Gottes aus und zogen einen kleinen Schlitten, auf welchem Kay saß und nickte; aber das Ganze war nur ein Traum, und deshalb war es auch wieder fort, sobald sie erwachte.
Am folgenden Tage wurde sie vom Kopfe bis zum Fuße in Seide und Sammt gekleidet; es wurde ihr angeboten, auf dem Schlosse zu bleiben und gute Tage zu genießen; aber sie bat nur um einen kleinen Wagen mit einem Pferde und um ein Paar Stiefelchen; dann wollte sie wieder in die weite Welt hinausfahren und Kay suchen.
Und sie erhielt sowohl Stiefelchen als Muff; sie wurde niedlich gekleidet; als sie fort wollte, hielt vor der Thür eine neue Kutsche aus reinem Golde; des Prinzen und der Prinzessin Wappen glänzte an derselben wie ein Stern; Kutscher, Diener und Vorreiter, – denn es waren auch Vorreiter da, – saßen mit Goldkronen auf dem Kopfe zu Pferde. Der Prinz und die Prinzessin halfen ihr selbst in den Wagen und wünschten ihr alles Glück. Die Waldkrähe, welche nun verheirathet war, begleitete sie die ersten drei Meilen; sie saß ihr zur Seite, denn sie konnte nicht vertragen, rückwärts zu fahren; die andere Krähe stand in der Thüre und schlug mit den Flügeln; sie kam nicht mit, denn sie litt an Kopfschmerzen, seitdem sie eine feste Anstellung und zu viel zu essen erhalten hatte. Inwendig war die Kutsche mit Zuckerbrezeln gefüttert, und im Sitze waren Früchte und Pfeffernüsse.