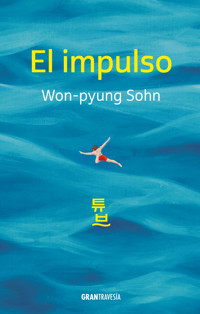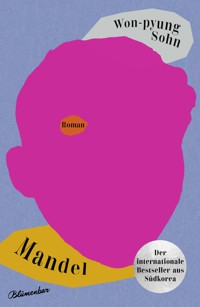
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Überraschungserfolg aus Südkorea! Der Junge Yunjae ist ein Außenseiter. Eine angeborene Erkrankung macht es ihm schwer, Gefühle wie Angst, Freude oder Wut zu empfinden. Als er von einem Tag auf den anderen auf sich allein gestellt ist, wächst er über sich hinaus, schließt überraschend Freundschaft und weckt Kräfte in sich, die er nie für möglich gehalten hätte … Eine ergreifende Geschichte darüber, wie Liebe, Freundschaft und der Mut, sich anderen zu öffnen, ein Leben für immer verändern können. Über 600.000 verkaufte Exemplare in Südkorea: Der Kultroman endlich auf Deutsch! »Ein kühnes, originelles Stück Literatur, das die Tiefen des menschlichen Daseins mit unglaublich viel Humor auslotet.« Entertainment Weekly »Intensiv und bewegend, ein phänomenales Buch.« Wall Street Journal »Dieses Buch hat ein so sanftes Herz.« Salon Ein großartiger Roman für alle Leser:innen von Sayaka Muratas »Die Ladenhüterin« und Mark Haddons »Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Yunjae leidet unter Alexithymie: Von Geburt an ist es ihm fast unmöglich, Gefühle wie Freude, Angst oder Wut zu empfinden. Er hat keine Freunde, aber seine Mutter und Großmutter bieten ihm ein zufriedenes Leben. Ihr kleines Haus über dem Buchladen seiner Mutter ist mit bunten Post-it-Zetteln geschmückt, die ihn daran erinnern, wann er lächeln, Danke sagen oder lachen soll. Aber an Yunjaes 16. Geburtstag ändert sich alles. Ein schockierender Gewaltakt lässt ihn auf sich allein gestellt zurück. Yunjae isoliert sich, bis mit Gon ein neuer Junge an seiner Schule auftaucht und die beiden eine überraschende Verbindung aufbauen. Yunjae bekommt die Chance, aus seiner Komfortzone herauszutreten und vielleicht der Held zu werden, von dem er nie zu träumen gewagt hätte. Ein großartiger Roman für alle Leser:innen von Sayaka Muratas »Die Ladenhüterin« und Mark Haddons »Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Cheistopher Boone«.
»Eine sensible Erkundung dessen, was es heißt, an den emotionalen Polen des Lebens zu leben.« Kirkus Reviews
Über Won-pyung Sohn
Won-pyung Sohn ist eine in Südkorea lebende Autorin, Filmregisseurin und Drehbuchautorin. Sie absolvierte ein Studium in Sozialwissenschaften und Philosophie an der Sogang-Universität sowie ein weiteres in Filmregie an der Korean Academy of Film Arts. »Mandel« ist ihr literarisches Debüt und wurde in Südkorea und international zu einem überragenden Erfolg und erscheint nun in 20 Sprachen.
Sebastian Bring hat Koreanisch, Japanisch und Übersetzungswissenschaft in Bonn studiert. Er arbeitet als Literaturübersetzer und hat aus dem Koreanischen u. a. Romane von Kim Ae-ran, Hwang Sun-won und Bae Suah ins Deutsche übertragen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Won-pyung Sohn
Mandel
Roman
Aus dem Koreanischen von Sebastian Bring
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Anmerkungen zum Buch
Prolog
Erster Teil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Zweiter Teil
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Dritter Teil
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
Vierter Teil
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Epilog
Nachwort der Autorin
Impressum
Für Dan
Anmerkungen zum Buch
Alexithymie bzw. die Unfähigkeit, Gefühle zu erkennen und auszudrücken, ist eine geistige Beeinträchtigung, die erstmals in den 1970er Jahren in der medizinischen Fachpresse erwähnt wird. Ihre bekannten Ursachen sind eine eingeschränkte emotionale Entwicklung während der frühen Kindheit, posttraumatische Belastungsstörungen oder auch eine angeborene Verkleinerung der Amygdala, eines Teils des Gehirns, den man auch Mandelkern nennt. In diesem Fall ist das Empfinden von Furcht ebenso beeinträchtigt. Jedoch kann neueren Studien zufolge die Fähigkeit der Amygdala, Furcht und Angst hervorzubringen, durch gezieltes Training gesteigert werden. Der vorliegende Roman beschreibt Alexithymie auf Grundlage dieser Studien und der Fiktion der Autorin.
Bei P. J. Nolan handelt es sich um eine fiktive Figur.
Die im Roman wiedergegebenen Größenangaben von Dinosauriern basieren auf dem Buch The Littlest Dinosaurs von Bernard Most. Ihre tatsächliche Größe kann je nach wissenschaftlicher Studie variieren.
Prolog
Ich habe Mandeln in meinem Innern.
So, wie Sie auch.
Wie auch jene Menschen, die Sie lieben oder abgrundtief hassen.
Niemand vermag, sie zu fühlen.
Man weiß nur, sie sind da.
Diese Geschichte handelt, kurz gesagt, von einem Monster, das auf ein anderes Monster trifft. Eines dieser Monster bin ich. Aber ich werde Ihnen nicht sagen, ob sie tragisch oder glücklich endet. Erstens wird jede Geschichte langweilig, wenn man ihr Ende verrät. Zweitens können Sie dadurch alles, was geschieht, intensiver miterleben. Drittens und letztens, was wie eine Ausrede klingen mag, können weder Sie noch ich wirklich wissen, ob eine Geschichte glücklich oder tragisch ist.
Erster Teil
1.
Sechs Menschen starben an jenem Tag, einer wurde verwundet. Zuerst Mama und Oma. Dann ein Student, der herbeigerannt kam, um den Mann aufzuhalten. Darauf zwei Männer in den Fünfzigern, die bei der Heilsarmeeparade ganz vorne mitgelaufen waren, außerdem ein Polizist. Und schließlich der Mann selbst. Er hatte entschieden, das letzte Opfer seines blutigen Gemetzels zu sein. Mit seinem Messer stach er sich tief in die Brust und starb, bevor der Krankenwagen kam. So, wie die meisten anderen Opfer.
Ich stand mit ausdrucksloser Miene daneben, wie immer.
2.
Der erste Vorfall ereignete sich, als ich sechs war. Die Symptome waren wesentlich früher da, aber erst zu dieser Zeit kamen sie so deutlich zum Vorschein. Später, als Mama vermutet hatte. An jenem Tag hatte mich Mama nicht aus dem Kindergarten abgeholt. Mama erzählte mir im Nachhinein, sie hätte nach all den Jahren meinen Vater besucht. Sie erklärte ihm, sie werde ihn nun endgültig loslassen, nicht etwa, weil sie einen neuen Mann kennengelernt habe, sondern einfach, um neue Wege zu gehen. All das sagte sie wohl, während sie die verblichenen Wände seines Mausoleums abwischte. In diesem Augenblick, in dem ihre Beziehung für immer und ewig beendet wurde, hatten sie mich, den ungebetenen Gast ihrer jungen Liebe, völlig vergessen.
Nachdem alle Kinder schon nach Hause gegangen waren, trat ich also zögerlich aus dem Kindergarten. Alles, was ich als Sechsjähriger über die Lage meines Zuhauses wusste, war, dass es sich irgendwo jenseits einer Brücke befand. Ich nahm also die Fußgängerbrücke am Kindergarten, ging sie hinauf, blieb stehen und beugte meinen Kopf über das Geländer. Unter mir glitten die Autos dahin. Das erinnerte mich an etwas, das ich irgendwo gesehen hatte, deshalb sammelte ich möglichst viel Spucke in meinem Mund. Ich nahm ein Auto ins Visier und spuckte. Aber meine Spucke verflüchtigte sich in der Luft, bevor sie auf das Auto hätte treffen können. Trotzdem beobachtete ich weiterhin die Straße und spuckte so lange, bis mir schwindlig wurde.
»He, was machst du da? Das ist ja ekelhaft!«
Ich schaute auf und sah eine Frau mittleren Alters, die mich anstarrte, bevor sie weiterging, an mir vorbeigleitend, wie die Autos unter mir, und ich war wieder allein. Die Abgänge von der Fußgängerbrücke erstreckten sich in alle Himmelsrichtungen. Ich hatte die Orientierung verloren. Unterhalb der Brücke sah es rechts wie links vollkommen gleich aus, alles war in kaltes Grau getaucht. Einige Tauben flatterten gurrend über meinen Kopf hinweg. Ich entschied mich, ihnen zu folgen.
Als mir bewusst wurde, dass ich in die falsche Richtung gegangen war, war es zu spät zum Umkehren. Im Kindergarten hatten wir damals das Lied »Die Erde ist rund, geh, geh voran« gelernt. So dachte ich, ich käme schon irgendwann zu Hause an, wenn ich nur immer weiterliefe. Also ging ich mit meinen kleinen, unbeholfenen Schritten stur geradeaus.
Die Hauptstraße mündete in eine Gasse, die an beiden Seiten von alten Häusern gesäumt war. An den bröckelnden Wänden prangten sonderbare, mit roter Farbe aufgemalte Zahlen, wie zufällig, und das Wort »unbewohnt«. Plötzlich hörte ich unterdrückte Schreie. Ich bin mir nicht sicher, ob es »Ah« oder »Uh« war. Vielleicht war es auch »Argh«. Es waren jedenfalls kurze, unterdrückte Rufe. Ich ging in die Richtung, in der ich die Geräusche vermutete, und sie wurden deutlicher, je näher ich einer Straßenecke kam. Ohne zu zögern, lenkte ich meine Schritte dorthin.
Ein Junge lag auf dem Boden. Ein kleiner Junge, sein Alter konnte ich nicht schätzen. Über ihn warfen sich schwarze Schatten, wieder und wieder. Der Junge wurde geschlagen. Die kurzen Schreie stammten nicht von ihm, sondern von den Schatten, die sich auf ihn stürzten, es waren unterdrückte Schreie der Anstrengung. Sie traten und spuckten auf ihn. Später erfuhr ich, dass es bloß Mittelschüler waren, damals kamen sie mir viel größer und mächtiger vor, wie Erwachsene.
Der Junge wehrte sich nicht, er gab keinen Laut von sich, als sei er es gewohnt, geschlagen zu werden. Wie eine Stoffpuppe wurde er hin- und hergeworfen. In einer finalen Bewegung trat ihn einer der Schatten in die Seite. Dann verschwanden sie. Der Junge war über und über mit Blut bedeckt, als hätte er einen roten Mantel an. Ich trat näher an ihn heran. Er sah aus der Nähe älter als ich aus. Vielleicht zehn oder elf, also ungefähr doppelt so alt wie ich. Trotzdem kam er mir jünger vor, als ich es war. Seine Brust hob und senkte sich schnell, sein Atem ging kurz und flach, wie bei einem neugeborenen Welpen. Es war offensichtlich, dass er in Lebensgefahr schwebte.
Ich ging zurück in die Gasse. Sie war immer noch menschenleer, die roten Zeichen auf den grauen Mauern irritierten meine Augen. Nachdem ich eine Weile herumgeirrt war, entdeckte ich schließlich einen kleinen Laden. Ich öffnete die Schiebetür und trat ein.
»Ähm, Entschuldigung.«
Im Fernsehen lief Family Game. Der Ladenbesitzer lachte so laut, dass er mich wohl nicht gehört hatte. Die Kandidaten der Show spielten ein Spiel, bei dem eine Person Kopfhörer trug und Worte erraten musste, die die anderen Teilnehmer mit dem Mund formten. Das gesuchte Wort lautete »Beklommenheit«. Warum ich mich bis heute an dieses Wort erinnere, weiß ich nicht. Ich wusste nicht mal, was es bedeutet. Eine junge Frau nannte andauernd falsche Begriffe, womit sie für Gelächter beim Publikum und dem Ladenbesitzer sorgte. Schließlich lief die Zeit ab, und das Team der jungen Frau hatte verloren. Der Ladenbesitzer schnalzte mit der Zunge, als täte sie ihm leid.
»Entschuldigung«, sprach ich ihn nochmals an.
»Ja?« Der Ladenbesitzer wandte sich um.
»Da liegt jemand am Boden, in der Gasse.«
»Ach ja?«, gab er gleichgültig zurück und setzte sich auf.
Im Fernsehen waren beide Teams bereit für eine neue Runde, die viele Punkte versprach und das Blatt wenden könnte.
»Er sieht aus, als würde er sterben«, sagte ich, an den auf dem Verkaufsständer ordentlich aneinandergereihten Karamellbonbons nestelnd.
»Ist das so?«
»Ja.« Erst in diesem Moment blickte er mir in die Augen.
»Wieso sagst du so was Unheimliches? Man soll nicht lügen, Kleiner.«
Ich schwieg eine Weile, um nach Worten zu suchen, die ihn überzeugen würden. Aber ich war zu jung, um einen großen Wortschatz zu haben, und mir fiel nichts Wahrhaftigeres ein als das, was ich schon gesagt hatte.
»Er könnte sterben.«
Alles, was ich konnte, war, mich selbst zu wiederholen.
3.
Ich wartete auf das Ende der Show, während der Ladenbesitzer dann doch die Polizei verständigte.
Als er mich wieder an den Karamellbonbons herumspielen sah, raunzte er mich an, ich solle gehen, wenn ich nichts kaufen wolle. Die Polizei ließ sich Zeit, bis sie am Tatort erschien. Ich musste ständig an den Jungen denken, wie er so auf dem kalten Boden lag. Zu dem Zeitpunkt war er schon tot.
Und die Sache war die: Er war der Sohn des Ladenbesitzers.
Ich saß auf einer Bank in der Polizeiwache und zappelte mit den Beinen. Ihre Bewegung erzeugte einen kühlen Luftstrom. Es war schon dunkel, und ich wurde immer müder. Ich war schon fast eingeschlafen, als die Tür aufschwang und meine Mutter hereinstürzte. Als sie mich sah, schluchzte sie laut auf, lief zu mir und streichelte mir so fest über den Kopf, dass es wehtat. Bevor sie die Freude des Wiedersehens richtig genießen konnte, schwang die Tür erneut auf. Der Ladenbesitzer stolperte herein, gestützt von zwei Polizisten. Er weinte, das Gesicht war tränenüberströmt. Seine Mimik war nun völlig anders als vorhin im Laden. Er konnte sich nicht mehr halten, fiel auf die Knie, und schlug, am ganzen Körper zitternd, auf den Boden ein. Dann stand er wieder auf, zeigte mit dem Finger auf mich und schrie etwas. Ich konnte ihn nicht richtig verstehen, aber es klang nach so was wie: »Du hättest mir das mit mehr Ernst sagen müssen, dann würde mein Sohn noch leben!«
Der Polizist neben mir wandte ein: »Was weiß schon so ein Kindergartenkind«, und konnte den Ladenbesitzer gerade noch davor bewahren, wieder in sich zusammenzusacken. Es fiel mir schwer, dem Ladenbesitzer recht zu geben. Ich war ständig ernst. Niemals lachte ich oder geriet in Wut. Ich konnte nicht verstehen, warum er mich deswegen anschrie. Weil ich aber als Sechsjähriger über nicht genug Worte verfügte, um meine Zweifel auszudrücken, schwieg ich einfach. Stattdessen ergriff meine Mutter das Wort. Dadurch brach in der Polizeiwache das Chaos aus, in Gestalt eines Vaters, der sein Kind verloren, und einer Mutter, die ihr Kind wiedergefunden hatte.
An jenem Abend spielte ich mit Bausteinen, wie ich es immer tat. Sie hatten die Form einer Giraffe, doch wenn ich ihren Hals verdrehte, wurden sie zu Elefanten. Ich spürte den Blick meiner Mutter, der auf mir ruhte, jeden Teil meines Körpers abtastend.
»Hattest du keine Angst?«, fragte sie.
»Nein«, gab ich zurück.
Die Gerüchte über diesen Vorfall, insbesondere der Teil, in dem ich, ohne mit der Wimper zu zucken, zugesehen hatte, wie ein Junge zu Tode geprügelt wurde, verbreiteten sich schnell. Von nun an wurden die bisher nicht recht greifbaren Sorgen meiner Mutter mehr und mehr real.
Als ich in die Grundschule kam, verschlimmerte sich das Problem. Eines Tages stolperte auf dem Heimweg von der Schule vor mir ein Mädchen über einen Stein und stürzte zu Boden. Sie lag direkt vor meinen Füßen. Mir fiel ihre Micky-Maus-Haarspange auf, mit der ihr Haar am Hinterkopf zusammengehalten war, während ich darauf wartete, dass sie wieder aufstand. Aber sie blieb einfach liegen und weinte nur. Schließlich tauchte ihre Mutter auf und half ihr auf die Beine. Sie sah mich verächtlich an und schnalzte mit der Zunge.
»Du siehst, dass sie stürzt, und fragst sie nicht einmal, ob sie verletzt ist?! Dann stimmen die Gerüchte, du bist wirklich nicht normal!«
Darauf fiel mir nichts ein, also schwieg ich. Die anderen Kinder bemerkten den Vorfall und versammelten sich um mich herum, ihr Geflüster stach mir in den Ohren. Ich hörte nur Bruchstücke, die aber klangen wie ein Echo dessen, was die Mutter des Mädchens gesagt hatte. Diesmal war es Oma, die mich rettete. Wie Wonder Woman tauchte sie aus dem Nichts auf und schloss mich fest in ihre Arme.
»Passen Sie auf, was Sie sagen! Es war Pech, dass Ihre Tochter gestürzt ist. Was fällt Ihnen ein, meinen Jungen so anzugehen?«, schimpfte sie mit ihrer rauen Stimme. Auch die anderen Kinder bekamen eine Ansage: »Was gibt’s da zu glotzen, ihr Kröten?!«
Als wir uns ein Stück von der Gruppe entfernt hatten, schaute ich zu Oma auf, die ihre Lippen aufeinanderpresste.
»Oma, warum sagen die Leute, ich sei seltsam?«
Ihren Lippen entspannten sich.
»Vielleicht, weil du etwas Besonderes bist. Die Menschen können es nicht ertragen, wenn jemand anders ist als sie. Ach, mein bezauberndes kleines Monster.«
Sie umarmte mich so fest, dass meine Rippen schmerzten. Sie nannte mich immer Monster. Für sie war das nichts Schlechtes.
4.
Ehrlich gesagt dauerte es eine Weile, bis ich Omas liebevoll gemeinten Kosenamen akzeptieren konnte. Die Monster in Büchern waren nicht bezaubernd. Nein, Monster waren alles andere und das genaue Gegenteil von bezaubernd. Ich verstand nicht, warum Oma mich dann so nannte. Selbst nachdem ich gelernt hatte, was das Wort »paradox« bedeutet, nämlich gegensätzliche Begriffe zu vereinen, war ich immer noch verwirrt. Legte Oma die Betonung auf bezaubernd oder auf Monster? Jedenfalls beteuerte sie, mich aus Liebe so zu nennen, also entschied ich, ihr zu glauben.
Tränen stiegen in Mamas Augen, als Oma ihr vom MickyMaus-Mädchen erzählte.
»Ich wusste, dass es eines Tages passiert … aber doch nicht so bald …«
»Ach, hör doch auf! Wenn du rumheulen willst, tu das in deinem Zimmer, und mach die Tür zu!«
Das ließ Mamas Tränen für einen Augenblick versiegen. Sie blinzelte zu Oma hinüber, ein wenig erschrocken von ihrem Ausbruch. Dann begann sie umso heftiger zu weinen. Oma schnalzte mit der Zunge und schüttelte den Kopf, ihren Blick auf eine Ecke der Zimmerdecke gerichtet.
So ging das oft zwischen den beiden.
Es stimmt, Mama hatte sich schon länger Sorgen um mich gemacht. Weil ich anders war als die anderen Kinder – seit meiner Geburt war ich anders. Denn:
Ich lächelte nie.
Anfangs dachte Mama, meine Entwicklung wäre einfach verzögert. Aber in Büchern über Kindererziehung las sie, dass Babys drei Tage nach der Geburt zu lächeln beginnen. Sie zählte die Tage. Es waren schon fast hundert.
Wie eine Märchenprinzessin, die verflucht war, niemals zu lächeln, verzog ich keine Miene. Und wie der Prinz aus dem fernen Land, der das Herz der Prinzessin erobern wollte, versuchte Mama alles. Sie klatschte in die Hände, kaufte Rasseln in verschiedenen Farben und führte sogar alberne Tänze zu Kinderliedern auf. Wenn sie davon erschöpft war, trat sie hinaus auf den Balkon und zündete sich eine Zigarette an, eine Gewohnheit, die sie sich nur mit Müh und Not hatte abgewöhnen können, solange sie mit mir schwanger war. Einmal sah ich ein Video, das Mama zu jener Zeit zeigte. Mama mühte sich so verzweifelt ab, während ich sie nur ausdruckslos anblickte. Meine Augen waren zu starr und ernst für die eines Kindes. Was auch immer sie tat, meine Mama konnte mich nicht zum Lächeln bringen.
Der Arzt im Krankenhaus konnte nichts Ungewöhnliches feststellen. Abgesehen von meinem fehlenden Lächeln zeigten die Untersuchungsergebnisse keine Auffälligkeiten hinsichtlich meiner Größe, meines Gewichts und meiner Verhaltensentwicklung. Alles war normal für mein Alter. Auch der Kinderarzt in unserem Viertel spielte Mamas Sorgen herunter, alles sei in Ordnung, denn ich wäre ja gesund und würde rasch wachsen. So versuchte sich Mama mit dem Gedanken zu trösten, ich sei einfach stiller als andere Kinder.
Dann geschah um meinen ersten Geburtstag herum etwas, das ihre Sorgen bestätigen sollte.
An jenem Tag stellte Mama einen roten Topf mit heißem Wasser auf den Tisch. Sie drehte sich um, um das Milchpulver aus dem Regal zu holen. Ich griff nach dem Topf, und er fiel zu Boden, das heiße Wasser spritzte in alle Richtungen. Wie ein Orden sieht das schwache Brandmal aus, das ich bis heute trage. Ich schrie und weinte. Mama dachte, ich hätte von nun an Angst vor roten Töpfen oder heißem Wasser, wie es ein normales Kind hätte. Aber ich nicht. Ich fürchtete weder Wasser noch Töpfe. Sobald ich ihn sah, griff ich weiterhin nach dem roten Topf, ob nun kaltes oder warmes Wasser darin war.
Doch dabei blieb es nicht.
Da war dieser alte Mann, der im unteren Stockwerk wohnte. Er hatte einen großen schwarzen Hund, den er im Hof festband. Ohne Angst blickte ich in die milchweißen Pupillen des alten Mannes, und als Mama kurz nicht hinsah, streckte ich meine Hand nach seinem Hund aus, der seine scharfen Zähne bleckte und laut knurrte. Auch als ich das Kind von nebenan sah, blutig gebissen, nachdem es genau dasselbe wie ich getan hatte, hörte ich nicht damit auf. Mama musste oft eingreifen.
Nach mehreren Vorfällen dieser Art begann Mama zu fürchten, meine Intelligenz könne unterdurchschnittlich sein. Aber mein sonstiges Verhalten gab keinen Anlass zu dieser Sorge. Schließlich versuchte sie, wie jede Mutter es tun würde, ihre Befürchtungen in positivem Licht zu ertränken.
Er ist einfach furchtloser und gelassener als andere Kinder.
So beschrieb sie mich in ihrem Tagebuch.
Doch auch wenn sie sich das einzureden versuchte, würden die Sorgen einer jeden Mutter dramatische Ausmaße annehmen, wenn ihr Kind bis zu seinem vierten Geburtstag immer noch nicht gelächelt hatte. Also nahm Mama mich an die Hand und ging mit mir in ein größeres Krankenhaus. Dieser Tag brannte sich als erste Erinnerung in mein Gedächtnis ein. Sie ist verschwommen, als wäre ich unter Wasser, doch von Zeit zu Zeit klärt sie sich auf …
Ein Mann im weißen Laborkittel sitzt vor mir. Übertrieben lächelnd zeigt er mir nacheinander verschiedene Spielzeuge. Einige von ihnen schüttelt er. Dann schlägt er mit einem kleinen Hammer auf mein Knie. Mein Bein schnellt hoch, höher als ich es mir hatte vorstellen können. Dann greift er mit seinen Fingern unter meine Achseln. Es kitzelt und ich kichere leise. Schließlich holt er einige Fotos hervor und stellt mir ein paar Fragen. An eines dieser Fotos erinnere ich mich noch deutlich.
»Das Kind auf dem Foto weint, weil es seine Mutter verloren hat. Was, meinst du, fühlt es?«
Ich weiß keine Antwort und schaue zu Mama auf, die neben mir sitzt. Sie lächelt mich an und streichelt mir über den Kopf. Dann beißt sie sich auf die Unterlippe.
Einige Tage später bringt mich Mama an einen anderen Ort, sie erklärt, ich dürfte in einem Raumschiff fliegen. Wir gehen in ein anderes Krankenhaus, was mir seltsam vorkommt. Ich frage sie, warum sie mich hierherbringe, denn ich sei ja gar nicht krank, aber sie antwortet nicht.
Im Krankenhaus legt man mich auf etwas sehr Kaltes. Ich werde in eine Art weißen Tank gesogen. Ich höre merkwürdige Geräusche, piep, piep, piep. Mit dem Herausfahren aus der Röhre endet meine enttäuschende Weltraumreise.
Dann ändert sich die Szenerie. Plötzlich sehe ich noch mehr Männer in weißen Kitteln. Der älteste von ihnen zeigt mir ein verschwommenes Schwarzweißfoto und sagt mir, dies sei das Innere meines Kopfes. Was für eine dreiste Lüge. Das ist ganz eindeutig nicht mein Kopf. Doch Mama nickt, als würde sie diese offensichtliche Lüge einfach glauben. Jedes Mal, wenn der alte Mann den Mund öffnet, machen sich die um ihn herumstehenden jüngeren Männer Notizen. Mir wird langweilig, und ich zappele mit den Beinen, dabei trete ich gegen den Schreibtisch des alten Mannes. Als mir Mama die Hand auf die Schulter legt und mir bedeutet, damit aufzuhören, blicke ich zu ihr auf. Tränen rinnen über ihre Wangen.
Der Rest des Tages ist geprägt von Mamas Tränen, an etwas anderes erinnere ich mich nicht. Sie weint und weint und weint. Auch als wir zurück ins Wartezimmer gehen, weint sie. Im Fernsehen läuft ein Anime, aber wegen Mama kann ich mich nicht darauf konzentrieren. Der Retter des Universums schlägt den Bösewicht in die Flucht, doch Mama weint. Schließlich wacht ein Mann, der neben mir döst, auf und blafft sie an: »Hören Sie endlich auf so theatralisch zu flennen, mir reicht’s jetzt!« Erst dann hört Mama auf zu weinen, macht einen Schmollmund wie ein gescholtener Teenager und zittert lautlos.
5.
Mama ließ mich viele Mandeln essen. Ich habe Mandeln aus Amerika, Australien, China und Russland probiert. Das sind alle Länder, die sie nach Südkorea exportieren. Die chinesischen schmeckten ekelhaft bitter, während die australischen irgendwie eher säuerlich und erdig waren. Es gibt auch koreanische, aber meine Lieblingsmandeln waren die amerikanischen, besonders die aus Kalifornien. Verwöhnt von der Sonne, haben sie einen hellbraunen Farbton.
Ich werde Ihnen nun mein Geheimnis verraten, wie man sie richtig isst.
Zunächst nimmt man die Packung in die Hand und befühlt von außen die Form der Mandeln. Sie sind hart und widerspenstig, das müssen die Finger fühlen. Dann reißt man langsam den oberen Teil der Packung auf und zieht den Zipper auf. Als Nächstes schließt man die Augen, steckt die Nase in die Packung und atmet ein. Sie müssen achtsam einatmen und dabei kurz innehalten, um dem Duft so viel Zeit wie möglich zu geben, damit er tief in Ihr Inneres strömen kann. Wenn schließlich der Duft den ganzen Körper erfüllt, stecken Sie sich eine halbe Handvoll Mandeln in den Mund. Rollen Sie sie mit der Zunge eine Weile hin und her und spüren ihre Textur, ihre scharfen Kanten, ihre Rillen auf der Oberfläche. Aber das dürfen Sie auch nicht zu lange machen, denn wenn die Mandeln durch den Speichel aufweichen, verlieren sie ihren Geschmack. Diese Schritte sind nur das Vorspiel vor dem großen Finale. Ist es zu kurz, ist der Genuss fad. Ist es zu lang, bleibt der Effekt aus. Sie selbst müssen das richtige Timing finden. Stellen Sie sich vor, wie die Mandel langsam anschwillt, von der Größe eines Fingernagels auf die einer Weintraube, einer Kiwi, einer Orange, bis auf die einer Wassermelone. Schließlich bis auf die Größe eines Rugby-Balls. Dann ist es so weit. Sie zerbeißen die Mandel mit einem Knacken. Beim Kauen werden Sie die Sonne Kaliforniens schmecken, wie sie sich in Ihrem Mund ausbreitet.
Der Grund, warum ich dieses Ritual betreibe und Ihnen so ausführlich vorstellen muss, liegt nicht etwa in einer besonderen Vorliebe für Mandeln. Bei jeder Mahlzeit lagen Mandeln auf dem Tisch. Ich konnte ihnen nicht entkommen. Also musste ich mir eine Methode einfallen lassen, sie halbwegs genüsslich essen zu können. Denn Mama glaubte, ich müsse nur genug davon essen, damit die Mandeln in meinem Kopf wachsen. Das war eine der wenigen Hoffnungen, die sie hatte.
Jeder Mensch hat zwei Mandeln in seinem Kopf, fest eingebettet irgendwo zwischen dem hinteren Bereich des Ohrs und der Schädelwand. Der Fachbegriff lautet Amygdala, das lateinische Wort für Mandel, weil sie in Größe und Form genauso aussehen wie die Mandeln, die wir essen.
Wenn man von einem äußeren Reiz stimuliert wird, sendet die Mandel Signale an das Gehirn. Abhängig von der Art der Stimulation empfindet man Furcht, Ärger oder Freude.
Aber aus irgendeinem Grund scheinen meine Mandeln nicht richtig zu funktionieren. Sie übertragen keine Signale, wenn sie stimuliert werden. Deswegen weiß ich nicht, warum Menschen lachen oder weinen. Freude, Traurigkeit, Liebe und Angst sind für mich nur vage Begriffe. Die Worte »Gefühl« und »Sympathie« sind mir nichts anderes als bedeutungslose Buchstabenreihen.
6.
Die Diagnose der Ärzte lautete Alexityhmie. Das ist die Unfähigkeit, Gefühle auszudrücken und zu erkennen. Ihrer Ansicht nach sprachen meine Symptome und mein junges Alter gegen das Asperger-Syndrom und meine übrige Entwicklung zeigte keine Anzeichen von Autismus. Es ist nicht unbedingt so, dass ich meine Gefühle nicht ausdrücken kann. Vielmehr kann ich nicht richtig wahrnehmen, dass sie überhaupt da sind. Ich hatte keine Probleme beim Sprechen oder Verstehen von Worten, wie es bei Menschen vorkommt, die an einer Schädigung des Broca- oder Wernicke-Areals, also des Sprechzentrums im Gehirn, leiden. Aber ich konnte bei mir selbst keine Emotionen wahrnehmen, konnte die Gefühle anderer Menschen nicht deuten und war verwirrt, wenn es um die Bezeichnung von Emotionen geht. Die Ärzte waren sich einig, das liege daran, dass die Mandeln, also die Amygdala, in meinem Kopf zu klein seien und außerdem die Verbindung zwischen lymbischem System und Frontallappen nicht so reibungslos funktioniere, wie sie sollte.
Eines der Symptome einer zu kleinen Amygdala besteht darin, nicht zu wissen, wie sich Angst anfühlt. Die Menschen sagen, furchtlos zu sein sei doch eine tolle Sache. Aber sie wissen nicht, wovon sie reden. Furcht ist ein instinktiver Verteidigungsmechanismus, den man zum Überleben braucht. Nicht zu wissen, was Angst ist, bedeutet nicht, dass man mutig ist. Es bedeutet, dass man dumm genug ist, auf der Straße stehen zu bleiben, obwohl ein Auto auf einen zurast. Das war bei mir aber noch nicht alles. Zusätzlich zu meiner Unfähigkeit, Furcht zu empfinden, war ich auch in allen anderen Emotionen eingeschränkt. Der einzige Silberstreif am Horizont, so die Ärzte, war, dass meine Intelligenz trotz der kleinen Amygdala nicht beeinträchtigt war.
Sie rieten also, da jedes menschliche Gehirn sich vom nächsten unterschied, abzuwarten, wie sich alles entwickelte. Einige von ihnen machten vielversprechende Angebote – ich könne etwa eine bedeutende Rolle beim Ergründen des Mysteriums des menschlichen Gehirns spielen. Die Forschungsabteilung des Krankenhauses empfahl, während meines Heranwachsens verschiedene Langzeitexperimente durchzuführen und die Ergebnisse in medizinischen Fachzeitschriften zu veröffentlichen. Für die Teilnahme gäbe es selbstverständlich eine großzügige finanzielle Vergütung, und abhängig von den Forschungsergebnissen könne sogar ein Teil des Gehirns nach mir benannt werden, wie beim Broca- oder Wernicke-Areal. In meinem Fall also das Seon Yunjae-Areal. Doch Mama hatte schon jetzt genug von den Ärzten und lehnte ihr Angebot strikt ab.