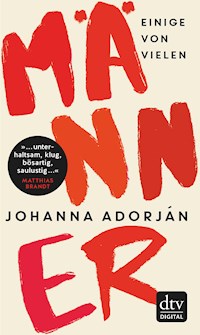
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ich liebe Männer. Natürlich nicht alle.« Johanna Adorján Jochen, Oliver, Harald – fast die Hälfte der Menschheit besteht aus Männern. Immer noch machen sie viel von sich reden – warum eigentlich? Was haben sie, was andere nicht haben, und, natürlich, was haben sie nicht? Mit dem Blick einer Frau geht Johanna Adorján durch die Welt und beschreibt, was ihr auffällt – oder vielmehr wer. Vielen dieser Männer wird man selbst schon begegnet sein, manche sind zum Glück Einzelfälle, und der eine oder andere Prominente ist auch mit dabei. Männer halt, kennt man ja. »Dass man über etwas so Uninteressantes wie Männer so unterhaltsam und klug und mit genau der richtigen Dosis Bösartigkeit schreiben kann, das bewundere ich wirklich sehr. Und dann ist es auch noch saulustig.« Matthias Brandt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Für Amédée
Über dieses Buch
Als ich von der ›Süddeutschen Zeitung‹ (in Person einer Frau, der Redakteurin Tanja Rest) gefragt wurde, ob ich für deren Wochenendausgabe eine Kolumne schreiben wolle, sagte ich sofort Ja. »Ich würde gerne über Männer schreiben«, sagte ich. »Okay«, sagte sie. »Ich hätte gerne, dass die Kolumne ›Männer‹ heißt und dass jeder Text nur mit einem Vornamen überschrieben ist.« »Okay«, sagte sie, verabschiedete sich und legte auf, wie Frauen eben so sind im Beruf, wozu überflüssige Worte machen, war ja alles geklärt. »Weil, es gibt ja wahnsinnig viele Männer«, redete ich noch etwas mit mir selbst weiter, um mich der Genialität meiner Idee zu vergewissern, »und ich kenne auch viele, und man sieht dauernd welche, deshalb glaube ich, es gäbe genug Stoff. Und ich müsste nicht extra viel recherchieren. Und außerdem hat es was, wenn eine Frau über Männer schreibt, oder? Das merkt man ja schon daran, dass es überhaupt nicht gehen würde, wenn umgekehrt ein Mann eine Kolumne über Frauen hätte, deren einzelne Texte jeweils nur mit einem Vornamen überschrieben wären. Kein Mann dürfte über Frauen so schreiben wie eine Frau über Männer, und das muss man doch ausnutzen, solange das noch so ist. Oder?«
Also nutzte ich es aus und schrieb eine Weile lang immer samstags in der Zeitung über Männer. Die einzige Vorgabe war die Textlänge, die immer gleich zu sein hatte. Und einmal bat man mich, für eine Sonderausgabe über Bayern über einen bayerischen Mann zu schreiben, was ich sehr gerne tat, da ich von den vielen bayerischen Männern einige wirklich ganz besonders mag.
Überhaupt kommen in diesen insgesamt siebenundsechzig Texten, von denen elf eigens für dieses Buch geschrieben wurden, überaus großartige Männer vor. Ein Physiotherapeut namens Harald zum Beispiel, dessen magische Fähigkeiten mir schon sehr geholfen haben. Oder Hotti, ein großer Volksschauspieler, der niemals entdeckt wurde und nun monologisierend und ein kariertes Köfferchen hinter sich herziehend durch den Berliner Nahverkehr irrt. Oder auch der Schriftsteller und Dramatiker Ödön von Horváth, von dessen tragischen Todesumständen ich zum ersten Mal während meines Regiestudiums hörte, als wir im Schauspielunterricht seine ›Unbekannte aus der Seine‹ erarbeiteten. Ich fand immer, es klang wie ein besonders missglückter Regieeinfall.
Manch Porträtierter mag Ihnen sehr bekannt vorkommen, etwa Jürgen, der in jedem Zug sitzt und den gesamten Großraumwagen mit laut geführten Geschäftstelefonaten über sein erbärmliches Dasein informiert. Andere, wie Andi, einen Freund, mit dem ich keinen Kontakt mehr habe, kennen Sie wahrscheinlich nicht persönlich. Wenn doch, grüßen Sie ihn ganz herzlich, ich vermisse ihn.
Manche Texte sind aus Wut entstanden (Chris), andere aus Verzweiflung (Keith), Gedächtnisschwierigkeiten (Colin), Verwunderung (Dirk), Abneigung (Rolf), Bewunderung (Günter), Liebe (Adam), Neid (Cato) oder Angst (Theodor). Und offen gestanden handelt der eine oder andere auch insgeheim von einer Frau (Imre).
Um abschließend etwas Allgemeingültiges über Männer sagen zu können, sind sie leider alle zu unterschiedlich. Vielleicht nur dies noch: Diese Textsammlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Volker
Volker Schlöndorff, der berühmte und in Ehren ergraute Filmregisseur, saß einmal auf einer Berliner Bühne. Es war eine Veranstaltung im Rahmen des Literaturfestivals, und seine Aufgabe als Volker Schlöndorff bestand darin, die französische Schriftstellerin Yasmina Reza zu präsentieren.
Volker Schlöndorff trug eine schwarze Lederjacke, was lässig aussah, als sei er mit dem Motorrad vorgefahren. Es war schnell klar, dass er nicht vorhatte, konventionell den Conférencier zu geben und etwa die Leute vorzustellen, die mit ihm die Bühne betreten hatten und nun neben ihm an einem längeren Tisch saßen, insgesamt vier, aber irgendwie war das verzeihlich, hey, immerhin war er Volker Schlöndorff, und dass die blonde Frau neben ihm die Schauspielerin Nina Hoss war, hätte man ja dem Programm entnehmen können, falls man sie nicht von allein erkannte, und wegen der Dunkelhaarigen, die zu seiner Rechten saß und ein wenig scheu wirkte, so als hätte sie gern eine Sonnenbrille auf, war das Publikum schließlich da.
Er selbst war auf jeden Fall Volker Schlöndorff, Regisseur von Filmen wie ›Die Blechtrommel‹, ›Homo Faber‹ oder auch ›Rückkehr nach Montauk‹, als Spezialist für Literaturverfilmungen für die Moderation eines solchen Abends geradezu prädestiniert, und der Mann ganz rechts, ja, der war möglicherweise Rezas Übersetzer oder so was, war ja vielleicht auch gar nicht so wichtig, irgendjemand würde er schon sein. Es saßen jedenfalls vier Menschen auf der Bühne, und Schlöndorff ergriff das Wort.
Mit launiger Kennermiene teilte er dem Publikum mit, dass er wirklich Erstaunliches zutage gefördert habe, als er sich näher mit Yasmina Reza befasste. Und zwar sei sie gar nicht, wie ja alle immer annehmen würden wegen ihres Namens – Reza, Stichwort ›Tausendundeine Nacht‹ – eine exotische Perserin, nein, die Familie ihres Vaters stamme zwar von dort, aber, man höre und staune, ihre Familie sei jüdisch. Ja, Yasmina Reza sei trotz ihres Namens Jüdin. Die unüberraschte Stille im Saal großzügig übergehend, ließ er eine lange Abhandlung über sephardische Juden folgen (beheimatet in Spanien, verfolgt, geflohen usw.), vergaß darüber, dass selbst sephardische Jüdinnen eine Mutter haben, in Rezas Fall auch eine Jüdin, eine aus Ungarn, was natürlich weniger sephardisch gewesen wäre, sondern aschkenasisch, und auch zu weit geführt hätte, insbesondere wenn man bedenkt, dass niemand im Saal angenommen hatte, dass Yasmina Reza eine exotische Perserin ist. Niemand außer Volker Schlöndorff.
Etwas später – der andere Mann hatte sich zwischenzeitlich selbst als Rezas Verleger zu erkennen gegeben und mit einigen klugen Sätzen ihren Roman ›Babylon‹ vorgestellt – setzte Schlöndorff, der insgesamt eher viel redete, und zwar in der Art, wie man Schlangenlinien malt, zu einer sehr langen Frage an, die, zugespitzt, darauf abzielte, warum Reza in der Mitte ihres Buchs die Erzählperspektive gewechselt habe, ganz abrupt, was er, Schlöndorff, irgendwie gut fand, nicht zuletzt vielleicht deshalb, weil ihm dieser Kunstgriff erlaubte, an dieser Stelle die eine oder andere Filmreferenz heranzuziehen. »Mein lieber Volker«, antwortete Yasmina Reza, »ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, dass mein Buch durchgehend in ein und derselben Perspektive geschrieben ist.«
Man muss sagen, dass Volker Schlöndorff, der an diesem Abend vor Publikum ein ihm nahezu unbekanntes Buch präsentierte, es mit Fassung trug.
Harald
Ich kenne wenige Menschen, die mir bessere Laune machen als mein Physiotherapeut. Was ja schon alleine deshalb seltsam ist, weil ich mit Dingen zu ihm komme, die einfach nur nerven. Ich möchte Sie nicht mit meinen Krankheitsgeschichten langweilen, obwohl ich dafür nicht mehr zu jung bin, aber Sie vielleicht. Auf jeden Fall verlasse ich seine Praxis jedes Mal mit einer Bombenlaune, selbst wenn er mir Übungen für zuhause aufgegeben hat, was ich hasse, weil ich natürlich jedes Mal in der Hoffnung zu ihm gehe, dass es bestimmt nur etwas ist, das er einfach einrenken kann und gut ist.
Er ist an die fünfzig, mittelgroß, hat ein freundliches Gesicht mit blondem Bart und den schwarzen Gürtel in irgendeiner Kampfsportart – oder jedenfalls einen sehr dunklen. Als er einmal Gruppenurlaub in Griechenland machte, hat er aus einer Weinlaune heraus einen Aschenbecher aus einer Taverne mitgehen lassen, wofür er sich heute noch schämt, weil ihnen der Wirt, nachdem sie gegangen waren, mit dem Moped nachfuhr, den ganzen Weg bis zum Hafen, um ihm sein Handy zu bringen, das er auf dem Tisch hatte liegen lassen.
Ich habe als Teenager in einem Drogeriemarkt in München-Giesing einen Labello und Filme für den Fotoapparat geklaut, wurde erwischt und von der Polizei nach Hause eskortiert. Meine Eltern fanden es überhaupt nicht halb-so-schlimm, der Jugendrichter schon, da ich ja beteuerte, dass ich so was noch nie gemacht hätte. Noch heute schäme ich mich jedes Mal, wenn ich an diesem Laden vorbeikomme, den es immer noch gibt: Wie konnte ich nur so blöd sein, nicht darauf zu kommen, dass eine verspiegelte Regalwand möglicherweise von hinten durchsehbar ist?
Solche Geschichten erzählen wir uns, während er Teile meines Körpers millimetergenau verschiebt. Oder neulich sprachen wir fast die ganze Stunde lang über den Tod. Er erzählte von einer Freundin, die an Krebs gestorben war und sich gewünscht hatte, dass um ihre Leiche herum Abschied gefeiert würde, und genau so hätten sie es dann auch gemacht. Es wurde gefeiert und sie war dabei, und wie merkwürdig und bewegend und traurig und gut das gewesen sei. Und ich erzählte ihm von meinen Großeltern, deren frei gewählten Tod man tragisch finden kann oder wunderschön. Und währenddessen sortiert er irgendwelche Muskelstränge oder Knochen oder Gelenke, manchmal knackt etwas, manchmal soll ich mich aufsetzen oder auf der Stelle laufen, dann wieder murmelt er Nummern, die wohl Wirbel oder Rippen bezeichnen, oder macht kleine Geräusche, an denen ich erkenne, dass etwas noch nicht perfekt oder aber endlich wieder in allerbester Ordnung ist. Und meistens ist auf einmal etwas wieder in allerbester Ordnung. Es ist fast, als habe er Zauberkräfte. Als könne er einen Menschen bis auf die Knochen spüren. Als wisse er schon, was los ist, wenn man nur vor ihn hintritt, ohne jede Erklärung.
Ich habe noch gar nicht erwähnt, dass er fast blind ist. Und in dem, was er tut, wirklich außergewöhnlich gut. Ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt. Ich weiß nur, dass ich nach jeder Sitzung zwei Zentimeter größer bin als vorher und ganz gerade. Und mindestens vier Kilo fröhlicher.
Rolf
Ich hab mir mal ein Buch gekauft, weil ich den Titel so toll fand, den Bildband eines amerikanischen Fotografen namens Ed Panar. Es heißt ›Animals That Saw Me‹. Auf den Fotografien ist immer ein Tier zu sehen, das direkt in die Kamera guckt. Ob das eine Kuh ist, die an einem Zaun steht, ein Hund, der in der Dämmerstunde gerade zufällig aus einem Fenster blickt, ein kleiner Waschbär, der unter einem Holzverschlag hervorspitzt, sie alle hat Ed Panar genau in dem Moment mit seiner Kamera erwischt, als sie ihn gerade ansahen.
Ich würde gerne einen ähnlichen Bildband machen, mit dem Titel ›Männer, die mir beim Einparken zusahen‹. Seit 1990 tun Männer das, so lange parke ich schon ein. Sie tun es nicht nur bei mir, sie tun es generell bei Frauen, die einparken, was mich eher erleichtert, als mich in meiner Eitelkeit zu kränken. Alle diese Männer eint, dass ich sie nicht persönlich kenne. Weitere Merkmale: Sie sind zwischen zweiundvierzig und fünfundachtzig Jahre alt, haben Haare oder keine mehr, sind eher mittelmäßig angezogen als elegant. Neulich habe ich sogar einen gesehen, der hatte einen Rucksack auf, ordentlich mit beiden Trägern um, wie ein Kind. Diesen möchte ich jetzt mal herausgreifen, vielleicht erkennt er sich ja und meldet sich, was nur zu begrüßen wäre, denn zu gerne würden wir, und ich spreche jetzt ausnahmsweise mal kollektiv für uns Frauen, zu gerne würden wir auch einmal die Gegenseite hören, was sie denkt, was sie umtreibt und bewegt, ihre Hoffnungen, Enttäuschungen, Wünsche.
Der mit dem Rucksack also war eher klein, vielleicht achtundfünfzig Jahre alt, hatte einen grauen Bart und gerötete Gesichtshaut. Er trug eine rote Allwetterjacke und sah aus, als hieße er vielleicht Rolf und arbeite, keine Ahnung, irgendwas mit Locher.
Rolf bog zu Fuß in die ruhige kleine Seitenstraße in Berlin ein, die ich entlanglief und in der gerade jemand einparkte, was ich nicht bemerkt hatte, mein Gott, Autos, aber Rolf sah hin, sah richtig in das Fahrzeug hinein, und während er nun seine Schritte verlangsamte, umspielte ein kleines Lächeln seine Mundwinkel. Und dann sagte er, ganz für sich und gut hörbar: »Ja, ja.« Neugierig geworden sah nun auch ich ins Auto. Darin saß eine Frau, neben ihr auf dem Beifahrersitz sogar noch eine. Die beiden unterhielten sich, während die Fahrerin einparkte, übrigens ganz normal, weder auffallend schnell noch unschön den Bordstein entlangquietschend, ein Malheur, das zum Beispiel mir gerne passiert, wenn ich Zuschauer habe.
Ganz kurz blieb Rolf stehen, doch da zeichnete sich schon ab, dass es der Frau gelingen sollte, das Automobil tatsächlich eigenhändig passgenau in die Lücke zu manövrieren, die sich zwischen zwei bereits parkenden Wagen befand. Als er nun also den Blick von ihr abwandte und seinen Weg fortsetzte, meinte ich leichte Enttäuschung in der Art wahrzunehmen, wie er die Schultern hängen ließ, aber das mag Interpretation sein.
Ich habe wirklich kurz überlegt, ihm hinterherzulaufen und ihn zu fragen, was sein »Ja, ja« zu bedeuten hatte. Aber es waren gerade Chemnitz-Wochen, und ich hatte die Nase voll von deutschen Arschlöchern, und wahrscheinlich hätte er sowieso alles geleugnet und behauptet, er heiße gar nicht Rolf.
Monsieur
Am 28. Januar 1986 explodierte die Raumfähre Challenger. Millionen Menschen sahen live vor ihren Fernsehern, wie sie sich Sekunden nach ihrem Start in einen Feuerball verwandelte und dann in eine Wolke mit zwei Armen. In meiner Erinnerung gehöre ich dazu, obwohl ich bezweifle, dass es so gewesen ist, weil wir, meine Geschwister und ich, nur donnerstags fernsehen durften und der 28. Januar 1986 ein Dienstag war. Wahrscheinlicher ist, dass ich es erst später irgendwann gesehen habe. Alle sieben Astronauten starben. Es war ein Schock.
In jenem Sommer fuhren wir, wie jedes Jahr in den großen Ferien, nach Korsika. Seit Boris Becker im Jahr zuvor Wimbledon gewonnen hatte, wollten wir Geschwister unbedingt Tennisunterricht haben. Mein Vater hatte jedem von uns einen Schläger gekauft. Meiner war leichter als die meiner Brüder und ganz weiß. Ich fand schon das Geräusch aufregend, das es machte, wenn ich nur mit der Handinnenseite gegen die Saiten schlug. Es klang gleich nach Tennis. Ich weiß noch, dass ich zu unserer ersten Stunde türkisfarbene Baumwollshorts trug, die mir mein Vater mal aus Japan mitgebracht hatte, dazu ein ärmelloses türkis-weiß gestreiftes Shirt, das zusammen mit den Shorts in einem Stoffbeutel verpackt gewesen war, der sich als Rucksack benutzen ließ. Der Stoff aller drei Sachen fühlte sich kühl an wie Seide und hatte nie Falten.
Unser Tennislehrer hieß Monsieur Pierquin. Er war klein, braungebrannt, hatte einen spitzen grauen Bart und trug mehrere Goldkettchen. Dafür dass er auf einem in die Jahre gekommenen Sandplatz unterrichtete, dessen Netz genauso müde durchhing wie sein Bauch, war er erstaunlich professionell gekleidet: weiße Shorts und Polohemd, hochgezogene Tennissocken, Schweißbänder.
Mein Bruder Gabriel konnte sofort alles. Sogar Bälle so anschneiden, dass Monsieur Pierquin ganz schön laufen musste, um sie zu erreichen. Monsieur Pierquin war entzückt. Quel grand talent. Für uns war es keine Überraschung. Mein Bruder Gabriel kann alles mit Bällen. Immer schon. Aber er spielt eben auch sehr gut Geige. Irgendwann klingelte eine Delegation des FC Bayern bei uns und wollte meine Eltern überreden, Gabriel die Geige zugunsten des Fußballs aufgeben zu lassen, um das mit dem Fußball ernsthaft zu betreiben. Die Geige gewann.
Mein Bruder David spielte ebenfalls sofort sehr gut. Bei ihm sieht alles immer elegant aus, eine Gabe, die sich durch alle Lebenslagen zieht und heute unter anderem seinen Kindern zugutekommt, die er elegant badet, elegant bekocht. Er spielt auch sehr elegant Cello.
Ich spielte sofort sehr schlecht. Es war augenblicklich klar, dass Monsieur Pierquin an mir keine Freude hatte. Das verbarg er auch nicht. Ich war der Problemfall. Halt das Mädchen, la fille. Bei mir musste er ewig laufen, um Bälle aufzusammeln, die ich verschlagen hatte, wozu er übrigens nicht lässig den Fuß benutzte, wie meine Brüder, sondern faul den Schläger. Einmal schlug ich einen Ball so hoch, dass wir ihm alle lange nachsahen, ohne erahnen zu können, wo in etwa er wieder auf der Erde aufschlagen würde. Monsieur Pierquin fuhr mit dem Finger die Flugbahn nach und sagte: »Challenger.« Alle lachten. Die ganze Rückfahrt im Auto hielt ich meinen blöden Tennisschläger fest umklammert, kämpfte mit Tränen und sagte kein Wort.
Adolf
Ich weiß nicht, wie er ausgesehen hat, welchen Beruf er hatte, ob er jemanden liebte, zurückgeliebt wurde. Ich weiß nicht, was er gerne aß, welche Zeitung er las oder wo er seine Ferien verbrachte. Vielleicht war er ein schrecklicher Griesgram, dem man besser aus dem Weg ging, vielleicht aber auch ein großer Charmeur. Die wenigen Dinge, die ich über ihn weiß: wie er hieß, wann und wo er geboren wurde, seine letzte Adresse, die heute meine ist, und das Datum seiner Deportation. Die Gestapo kam vermutlich mitten in der Nacht, nahm ihn mit, brachte ihn erst in ein Sammellager, von dort aus dann zum Güterbahnhof Putlitzstraße in Berlin-Moabit, wo man ihn in einen Viehwaggon sperrte, der schließlich von Gleis 69 aus in Richtung Osten fuhr, Richtung Tod.
Seit ein paar Jahren erinnert eine kleine, vor meinem Haus ins Kopfsteinpflaster eingelassene Messingplatte an ihn: Adolf Zadek, geboren am 7. April 1889 in Hohensalza (heute Inowrocław), deportiert am 12. März 1943 nach Auschwitz.
Von meinem Wohnzimmer aus hörte ich einmal, es war Sommer, die Fenster standen offen, »Sieg Heil«-Rufe. Es war eine dieser unsäglichen »Merkel muss weg«-Demonstrationen, die mal wieder durch die Berliner Innenstadt führten, und als ich wenige Minuten später vor Ort war, um den Menschen, die heute »Sieg Heil« rufen, ins Gesicht zu sehen, waren alle Straßen um sie herum so felsenfest abgeriegelt, dass ich nur die gleichmütigen Gesichter der Berliner Polizistinnen und Polizisten sah, die die Demonstration schützten wie an anderen Tagen den Marathon der Inlineskater oder das Laternenfest der Kita.
Auch Adolf Zadek wird von seiner Wohnung aus, die vielleicht heute meine ist, vielleicht die eines Nachbarn, »Sieg Heil«-Rufe gehört haben, der Reichstag ist nah. Ob er versucht hatte, das Land zu verlassen, als es noch möglich gewesen war? Vielleicht hatte er nicht genug Geld, vielleicht gab es jemanden, den er pflegen musste, vielleicht war er selbst nicht gesund? 1943 jedenfalls konnte er nicht mehr zu denen gehört haben, die blieben, weil sie glaubten, es sei alles nicht so schlimm. 1943 war es dafür viel zu spät.
Ich gebe zu, dass sein Vorname mich anfangs irritierte. Auf den anderen Stolpersteinen in meiner Straße stehen schönere: Max Mosche, Hermann, Bianka, Minna, Nelly Henriette, Edith und Klara. Die beiden Letzteren wohnten die Straße etwas weiter hinunter in benachbarten Häusern, sie waren gleich alt, vielleicht Freundinnen, beide wurden im Alter von neunzehn Jahren in Riga ermordet. Alle waren sie mir sympathischer als Adolf, allein seines Namens wegen, für den er natürlich nichts konnte, und obwohl ich wusste, wie absurd das war. Adolf hießen damals viele. Und Adolf Hitler hätte sogar eher nach Adolf Zadek heißen können als andersherum, denn der aus meinem Haus war älter, zwar nur dreizehn Tage, aber immerhin. Sie wohnten übrigens nicht weit voneinander entfernt, die beiden gleich alten Adolfs, zur Wilhelmstraße sind es zu Fuß nicht mal fünfzehn Minuten.
Ich sehe aus dem Fenster auf die Kastanie im Hof und frage mich, ob Adolf Zadek auch jeden Herbst bei ihrem kahlen Anblick dachte, wie schrecklich der Berliner Winter ist, und sich auf den Frühling freute.
Will
Wenn man als Journalist viele Interviews gemacht hat, erinnert man sich an die meisten nur noch wie an One-Night-Stands, also nur dem Namen nach, mit einer vagen Vorstellung, ob es angenehm war. Wobei meine Erfahrung, was One-Night-Stands angeht, überschaubar ist. Ich komme auf einen, was auch daran liegt, dass mir das Konzept nie eingeleuchtet hat, nicht mal in den Neunzigerjahren, in denen mir sonst eher viel einleuchtete, sogar Rauchertaxis. Ein One-Night-Stand ist ja nicht einfach so gemacht, sondern muss für alle Zeiten gepflegt werden. Er entsteht im Grunde erst durch die Nachbereitung, da er ja, einmal in der Welt, bis ans Lebensende in seiner Singularität verteidigt werden muss, sonst verlöre er seine ja doch recht eng gefasste Definition. Was also, wenn der One-Night-Stand sich wieder meldet oder, Gott behüte, man sich bei ihm, und dann nämlich doch irgendwie mehr daraus wird? Dann kann man sich wirklich nur vornehmen, es beim nächsten Mal besser zu machen, um die eigene One-Night-Stand-Statistik nicht komplett zu ruinieren.
Außerdem besteht ja bei jedem ersten Sex die Gefahr, dass es ein One-Night-Stand geblieben worden sein wird. Selbst wenn innige Zuneigung im Spiel ist und man sich bereits einig darüber, wie man die gemeinsamen Kinder nennen wird und auf welche Art Schule sie sollen, besteht doch das Risiko, dass einer von beiden noch vor dem zweiten Mal Sex stirbt. Man weiß ja, früher oder später stirbt jeder, was, wenn es zwischen dem ersten und zweiten Mal Sex passiert? Dann wäre auch dies wieder nur ein One-Night-Stand gewesen, woran man doch ganz deutlich sieht, dass diese Definition nichts taugt.
Wie auch immer. Zu den vielen Männern, die ich nur einmal interviewt und dann vergessen habe, was sie ganz grundsätzlich von jenen Männern unterscheidet, die ich trotz eines einzigen Interviews nie vergessen werde, wie zum Beispiel Marcel Reich-Ranicki oder Michael Caine, gehört Will Smith nicht, denn den habe ich drei Mal interviewt. Das erste Mal war 1998 für ›Men in Black‹. Er war sehr schäkerig aufgelegt, aus irgendeinem Grund sollte oder durfte ich ihm an den Po fassen,





























