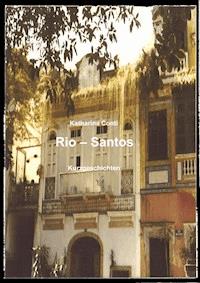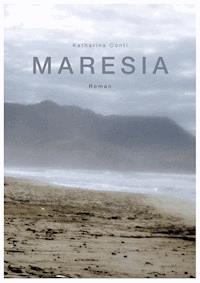
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schon beim ersten Zusammentreffen von Robert und Viktoria an einer Party in Sao Paulo bemerkt er Spannungen, hört erstaunt zu, wie die Frau, die ihm sofort aufgefallen ist, als käuflich dargestellt wird. Voller Neugierde folgt er ihr, besucht sie am Strand, löst Eifersüchteleien und Erwartungen aus, denen sich Viktoria, erst kürzlich verwitwete Mutter zweier kleiner Söhne, die zum ersten Mal alleine Familie und Freunde in Brasilien besucht, durch eiserne Wahrnehmungsverweigerung entzieht. Selbst an einer Beziehung gescheitert bedrängt der feinfühlige Mann sie nicht weiter, durch seine unaufdringliche Art wächst eine lockere Freundschaft und zurück in Europa besucht er sie erneut, lädt sie für ein Wochenende auf seinen Landsitz ein, wobei er verschweigt, dass er seit Kindheit mit dem Prinzen befreundet und Pate eines seiner Söhne ist. Es kommt, wie es muss, Viktoria und der Prinz erkennen augenblicklich ihre Seelenverwandtschaft, Emotionen brodeln hoch, Roberts Gäste versuchen mit allen Mitteln die unerwünschte Aussenseiterin anzugreifen und blosszustellen. Viktoria, die nichts zu verlieren hat, das Leben dieser Leute am nächsten Tag für immer verlassen wird, lässt sich aus der Reserve locken, tritt prompt in den ihr hingeschobenen Fettnapf und beleidigt unbeabsichtigt die ganze Gesellschaft, allen voran den Prinzen, der ihr amüsiert verzeiht. Mit der Gewissheit, dass er der gesichtslose Mann ihrer Träume ist und es eh nur ein paar gemeinsame Tage und Nächte für sie geben kann, nimmt sie seine Einladung in die Berge an und gibt dort schliesslich seinem Drängen nach, willigt ein, seine Frau zu werden. Und damit beginnt ein Drama, in dessen Verlauf Viktoria vor den sich schliessenden Mauern nach Brasilien flüchtet, sich in einem kleinen Fischernest im Nordosten des Landes versteckt, wo sie Monate später von Robert aufgestöbert wird und es zum Showdown kommt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 695
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Katharina Conti
Maresia
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Anmerkung
Zitat
PROLOG
Begegnung
Wiederkehr
Erwartungen
Höhen
Untiefen
Zeit
Maresia
Wasser des Lebens
Bahia de todos os Santos
Sirí
Alzira und die Geister
EPILOG
GLOSSAR
Impressum neobooks
Anmerkung
Zitat
„Jeder von uns ist also Bruchstück eines Menschen, da wir zerschnitten sind wie die Flundern, aus einem zwei; es sucht denn auch ein jeder immerfort sein anderes Stück…
…wenn sie nun ihrer eigenen Hälfte begegnen, dann werden sie wundersam ergriffen von einem Gefühl der Freundschaft und Zusammengehörigkeit und Liebe, und sie wollen sich sozusagen nicht mehr voneinander trennen, auch nicht für eine kurze Zeit.
Platon
PROLOG
Es war einmal ein seltsames Wesen. Klein war es, hatte vier Arme, vier Beine und zwei Köpfe. Der eine Kopf war der eines Mädchens, der andere, der eines Jungen und es lebte glücklich in einem grossen Wald voller Sonne und Regen, in dessen Mitte ein tiefer blauer See lag. Die Tiere im Wald liebten das Wesen, brachten ihm süsse Beeren, zeigten ihm die besten Quellen; auf den Rücken der Hirsche ritt es zu den Plätzen mit den feinsten Kräutern und die Eichhörnchen schenkten ihm Nüsse. Es war immer froh, spielte, sang, schwamm und rannte und war nie allein.
Doch die Götter beobachteten es und wurden eifersüchtig. Wie kam es, dass ein kleines Wesen so glücklich war, zufrieden und von allen geliebt? Und je länger sie ihm zusahen, desto eifersüchtiger wurden sie, befahlen grosse Bären es zu fressen. Doch die Füchse im Wald hörten das Brummen, versteckten das Wesen in ihrem Bau und die Bären konnten es nicht finden. Wölfe schickten die Götter in ihrem Zorn, es zu zerreissen, doch eine sanfte Brise trug den Wolfsgeruch zu den Hirschen und so schnell und zahlreich rannten sie mit dem Wesen durch den Wald, dass die Wölfe im Kreise liefen; und wie Donner grollte das Toben der Götter. Grosse, schwarze Vögel riefen sie herbei, wie ein Sturmwind flogen die heran, stiessen hinab, packten das Wesen und zerrten so lange an ihm, bis es in zwei Hälften fiel. Die eine Hälfte war der Junge, die andere Hälfte war das Mädchen und sie hatten beide nur ein zerbrochenes Herz.
Mit ihren langen, harten Krallen packten die Vögel das Mädchen, flogen weit fort mit ihm ins Schneeland und setzten es auf einen hohen Berg, der über und über mit Eis bedeckt war. Jämmerlich frierend stand das Mädchen auf dem Gipfel, Schnee und Eisregen fiel und ein Blitz schlug in den einzigen Baum auf der Spitze des Berges, zerschmetterte ihn in tausend Stücke. Das Mädchen nahm das grösste Stück von dem zerrissenen Baum und fuhr auf ihm hinunter ins Tal und so schnell fuhr es, dass die Menschen ein Donnern hörten und ein Brausen und sich fürchteten.
„Wer bist du?“, wollten sie wissen, als sie das Mädchen fanden. „Ich bin das Schneemädchen, und ich möchte gerne bei euch bleiben.“ Eine alte Frau nahm es auf, gab ihm zu essen, trockene Kleider; „du kannst bei mir wohnen, mein Kind, aber du musst für mich arbeiten.“ Dem Mädchen war es recht und wann immer es konnte, stieg es auf die Gipfel der Berge, schaute hinaus in die Welt, rief nach dem Jungen, rief und weinte, doch es bekam nie eine Antwort.
Verloren und einsam war der Junge im Wald zurückgeblieben, hauste am See und die Götter liessen es regnen, tagelang, wochenlang, und das Regenland entstand, mit Sümpfen und Mooren, Bächen, Flüssen und vielen Seen. Drachen legten die Götter in die Seen, damit sie den Jungen packen konnten, aber warnend schossen die Fische ans Ufer und er rannte tief hinein in den Wald, um sich zu verstecken. Und dort, in einer verborgenen Höhle, wuchs er auf, Wald und Tiere seine Lehrer, und mit jedem Ring der Bäume wuchsen seine Kraft und sein Mut und als er ein grosser Jäger geworden war, schmiedete er sich ein Schwert und beschloss die Drachen zu töten, die Angst und Schrecken im Regenland verbreiteten.
Aus den Seen kamen sie gekrochen, erschlugen Männer, raubten die Frauen; aber wohin der Junge auch kam, fassten die Menschen wieder Mut, floss neue Kraft durch angstgelähmte Glieder und nach langen, harten Kämpfen waren die Drachen alle besiegt. Sehr froh waren die Menschen, baten den Jungen bei ihnen zu bleiben, machten ihn zu ihrem König und immer wieder ritt er auf seinem grossen Pferd durch den Wald zum See, rief nach dem Mädchen, rief und weinte, doch er bekam nie eine Antwort.
Langsam verging die Zeit damals, viele Jahre verflossen und das Mädchen wurde eine Frau und der Junge wurde ein grosser Mann und König. Und eines Tages, als er auf seinem Pferd zum See geritten war, um nach der anderen Hälfte seines Herzens zu rufen, hörte er einen seltsamen Schrei und fand einen wundersamen Vogel, einen, wie er ihn noch nie gesehen hatte. Gross und weiss war er, hatte kleine schwarze Punkte auf seinem Gefieder. „Wer bist du?“, fragte ihn der König, „wo kommst du her?“ „Ich komme aus dem Schneeland“, sagte der Vogel, „ein Sturm hat mich fort getragen und mein Flügel tut so weh.“ Er weinte ein wenig, flatterte hilflos auf und ab, und der König stieg vom Pferd und nahm ihn auf seine Faust. „Komm mit mir, ich werde dich heilen, aber du musst mir vom Schneeland erzählen. Wo liegt es? Wie ist es da?“
Sehr froh war der Vogel, dass er mit dem König gehen durfte und während sein Flügel langsam genas, erzählte er ihm von den Bergen, den mit Schnee bedeckten Gipfeln, von den Tälern, in denen die Menschen wohnen, den kalten Bächen, die über die Felsen springen, und der König wurde von einer solchen Sehnsucht gepackt, dass er sogleich sein Pferd satteln liess, als der Vogel wieder gesund war, und zusammen machten sie sich auf den Weg.
Es war ein langer Ritt. Sie kamen durch Wüsten und Steppen, durchquerten wilde Wälder und reissende Flüsse und dann, eines Morgens, sahen sie hinter schneebedeckten Gipfeln die Sonne aufgehen. „Wir sind da“, sagte der Vogel, „da vorne liegt das Schneeland“, und vom höchsten Gipfel herab erklang eine Stimme. Sie rief nach dem Jungen, den sie vor langer Zeit verloren hatte, bat, ihr gebrochenes Herz zu heilen, und der König hörte die Stimme. „Vogel“, sagte er, „hilf mir! Trage mich auf den Gipfel, ich bitte dich darum.“
Der Vogel flog auf, kreiste über dem König, packte ihn fest mit seinen starken Klauen, trug ihn höher und immer höher, liess ihn dann sachte in den Schnee auf dem Gipfel fallen und dort fand er die Frau, die die andere Hälfte seines Herzens trug und sie fand den Mann, der einmal Teil von ihr gewesen. So froh waren sie, umarmten sich, schworen, sich niemals mehr zu trennen; aber die Götter sahen es und wurden fuchsteufelswild.
Sie riefen das Feuer unter den Gipfeln, beschworen es zu kochen und die Erde erbebte, krachend zerbarst der Berg, Feuer strömte aus ihm heraus und furchtlos stiess der Vogel vom Himmel, packte die umschlungenen Gestalten, hob sie hoch und trug sie weit fort in ein verstecktes grünes Tal, in dem die Nebel wohnten. Sie waren Freunde des Königs und stiegen schützend hoch, wann immer die bösen Augen der Götter suchend über das Tal schweiften. Und dort leben sie heute noch, der König und die Frau, getrennt und doch vereint, und sie bekamen viele Kinder.
Begegnung
Er:
Ich reise nicht um die Weihnachtszeit, verziehe mich regelmässig aufs Land in den Wochen kollektiver Hysterie; doch die Hartnäckigkeit eines einflussreichen Geschäftsmannes, die wilden Gerüchte, die über ihn kursierten, vielleicht auch das Reissen in meinen Knochen, liessen mich seinem Drängen nachgeben, ich flog nach São Paulo, fand mich wieder umgeben von devoten Kellnern, jungen, hübschen und bildhübschen Mädchen, alten Männern; an der Weihnachtsparty einer Modellagentur und umgeben von seinen Leibwächtern sprach Motta über St. Moritz.
Ich mag den Ort nicht besonders, beobachtete interessiert den jungen Mann an Mottas Seite, Sohn und Erbe, der es kaum erwarten konnte, sich in das glitzernde Getümmel zu stürzen. Wie ein junger Hund auf seinen Ball wartete er vergebens auf eine Lücke in Mottas Rede, der ihn streng an seiner Seite hielt, aus Furcht wahrscheinlich, dass ihm die schönsten Mädchen abhanden kommen könnten. Gelangweilt plötzlich liess ich meine Augen schweifen, erblickte eine Frau in der schillernden Menge, die eben erst gekommen schien. Zögernd stand sie an der Tür, schaute sich um und ich wartete, wollte sehen wie sie sich in Bewegung setzte; „und es wäre mir eine grosse Ehre, Sir, Sie im Februar in St. Moritz begrüssen zu dürfen.“ „Februar ist unmöglich, Mr. Motta, ganz unmöglich.“
Ein kurzer, höflicher Blick und sie war fort, verschluckt von der Menge, bedauerlicherweise, sie hatte mir gefallen; und dann hörte ich ganz in meiner Nähe Ausrufe, laute Fragen, sah diskret nach der Antwort und keine drei Schritte von mir entfernt wurde sie vom Gastgeber begeistert begrüsst. „Viktoria Tavares, sieh einmal an, Vitória!“ Motta erhob die Stimme und augenblicklich liess Carlos, so glaube ich wenigstens war sein Name, ihre Schultern los, trat zurück, Motta ging auf sie zu, nahm sie am Arm und widerwillig, als würde sie abgeführt, liess sie sich mitziehen.
„Viktoria, darf ich vorstellen?“ Er tat es, mit Glanz und Gloria, und sie schien nicht im mindesten interessiert wer ich war, woher ich kam, vage in meine Richtung nickend schob sie sich behutsam rückwärts, als müsse sie rennen, wäre auf Vorsprung aus, und Motta nahm erneut ihren Arm. „Ich habe gehört, was mit Henrique passiert ist, Viktoria, es tut mir aufrichtig leid. Brauchst du etwas? Kann ich dir helfen?“ „Nein. Hallo Rô.“ Sie machte sich los, tat einen Schritt in Richtung des jungen Mannes, wechselte ein paar Worte, machte Anstalten sich umzudrehen, wegzugehen; „dein Witwenstand steht dir gut, Viktoria, du siehst toll aus. Lunch, morgen um eins. Abgemacht?“ „Morgen um eins bin ich am Strand.“ „Komm, sei nicht kompliziert, mein Chauffeur fährt dich später, plus Zweitausend für deine Anwesenheit.“ Verblüfft musterte ich die Frau, von oben bis unten sozusagen, „zweitausend was, Fernando?“, und verwundert sah ich sie lächeln. „Tut mir leid, nicht für eine Million was immer. Frohe Weihnachten.“ Sie drehte sich um, bahnte sich stur einen Weg durch die Menge und ich bin ihr einfach nachgegangen.
„Verzeihen Sie, Mrs. Tavares, ich möchte nicht ungehörig sein, aber könnten Sie mich mitnehmen? Ich wohne im Sheraton. Falls das auf Ihrem Weg liegt, natürlich.“ Sie blieb stehen, schien diesmal etwas genauer wissen zu wollen, wer ich war, wo meine Unverschämtheit herkam, dann zuckte sie die Achseln, ging weiter, öffnete mit einem Stoss die Tür und wir traten ins Freie. „War das ein Ja oder ein Nein?“ Sie beachtete mich nicht, rief einen der herumlungernden Jungen herbei, gab ihm einen Zettel in die Hand, ein paar Münzen; „wenn Sie mitkommen wollen, es liegt auf meinem Weg“, und schweigend warteten wir, bis uns der Junge den Wagen brachte.
„Halten Sie niemals, wenn die Ampeln auf Rot stehen?“ „Nur an den grossen Kreuzungen“, angestrengt betrachtete sie die Strassenschluchten, schien nach Orientierung zu suchen, „und Sie wohnen hier in der Nähe?“ „Ah ja, diese ist es; meine Schwiegermutter, ich wohne in Zürich.“ Entschlossen bog sie ab, und wieder war ich verblüfft. Auch wenn sie nicht aussah wie eine Brasilianerin hatte sie doch wie eine gesprochen, während des Geplänkels mit Motta hatte ich nicht den leisesten Akzent bemerkt; „sind Sie jetzt eine Brasilianerin, die in der Schweiz lebt oder eine Zürcherin, die in São Paulo gelebt hat?“ „Eine Zürcherin. Unsere Polizei hatte viel Verständnis für meine Angewohnheit, im Dunkeln nicht an Ampeln zu halten. Die haben überall Blitzgeräte, und ich musste es ihnen erklären. Macht der Gewohnheit und so. Die Bussen hätten mich ruiniert. Sind Sie ein Freund von Fernando Motta?“
„Ein möglicher Geschäftspartner.“ „Aha; beeindruckend wie er mit Geld um sich wirft, finden Sie nicht? Vielleicht hätte ich feilschen sollen. Was meinen Sie? Vielleicht hätte er erhöht. So, wir sind da.“ Sie hielt vor dem Hotel, ein Page öffnete meine Tür, doch ich wollte nicht aussteigen, sie einfach so gehen lassen; „danke fürs Mitnehmen. Darf ich mich mit einem Nachttrunk revanchieren?“ Das Wort schien ihr zu gefallen, als schmecke sie es auf der Zunge wiederholte sie es, musterte mich dabei von oben bis unten, zuckte die Schultern und stellte den Motor ab. „Auf einen Nachttrunk.“ Wir stiegen aus, sie nahm den Parkschein in Empfang und ich führte sie in die Bar.
„Wie lange bleiben Sie noch hier?“ „Ich fliege am Weihnachtstag.“ „Am Weihnachtstag? Wie traurig an diesem Tag im Flieger zu sitzen.“ „Finden Sie?“ „Ja, ausser man hat keine Kinder und ob Motta erhöht hätte, haben Sie mir auch noch nicht gesagt.“ „Auf eine Million?“ „Wohl kaum, nicht wahr?“ Ich hatte das Gespräch also verstanden, hatte mich eben verraten, augenblicklich ging sie auf Distanz, lehnte sich zurück und ihr Gesicht verschwamm im Schatten; „Sie sprechen Portugiesisch.“ „Das, was die Portugiesen so nennen, ja, hier zweifle ich gelegentlich. Woher kennen Sie Motta?“ „Was meinen Sie? Sie scheinen ein guter Beobachter zu sein. Auf was schliessen Sie nach diesem netten Zusammentreffen?“ Spielerisch fast warf sie mir den Ball zurück, stachelte nebenbei meine Eitelkeit etwas an, ich halte mich tatsächlich für einen guten Beobachter, beugte sich vor und ihre Augen tauchten auf, musterten mich voll neugieriger Erwartung.
„Ein grober Scherz, Mrs. Tavares, unter Bekannten.“ „Ja, genau, das war es. Ich muss gehen. Hat mich gefreut, Sie kennen zu lernen.“ Vertrieben hatte ich sie mit meiner unverbindlichen Antwort, so unverbindlich wie möglich eben, hatte er sie mir doch vorgeführt, um zu beleidigen, nicht um sie mir anzubieten. Sie war keine Professionelle, ich hegte nicht die geringsten Zweifel, und sie gefiel mir, ich wollte nicht, dass sie ging, nahm die Hand, die sie mir entgegenstreckte. „Ich höre immer wieder wie herrlich die Küste hier sein soll. Was meinen Sie? Lohnt es sich für ein paar Tage an den Strand zu fahren?“ „Sie können bleiben oder gehen? Sie müssen nicht zurück?“ Leicht nur hatte ich ihre Hand festgehalten und sie entzog sie mir, setzte sich, bat den vorbeiziehenden Kellner um eine verschlossene Flasche Wasser, und ich war seltsam angerührt von der kindlichen Verwunderung über mein Vermögen zu tun und zu lassen, was ich wollte und auch etwas verwirrt von der Leichtigkeit, mit der sie die Sprache wechselte.
„Also, was würden Sie mir empfehlen?“ „Maresias.“ „Maresias? Gut, das kann ich behalten. Und warum Maresias?“ Kurz nur, als suche sie nach der Bestätigung einiger Gedanken, die sie sich eben über mich gemacht hatte, schaute sie mir direkt in die Augen, schien mich zu durchleuchten, dann hob sie die Hände, „Sie haben um eine Empfehlung gebeten“, und ich entschloss mich zu fahren. Ich wurde nicht zwingend erwartet, habe keine Kinder; „auf Ihre Verantwortung.“ „Nein, das lehne ich ab. Wenn es Ihnen nicht gefällt, sind Sie selber schuld.“ Lachend bat ich um die Wegbeschreibung, umständlich begann sie zu erklären, hielt inne, schüttelte den Kopf, „nein, nein, so geht das nicht“, und fliessend, ohne auch nur Atem zu holen, liess sie die Worte in die andere Sprache übergehen, bat um Papier und Schreiber, zeichnete mir dann akkurat auf, wie aus der Stadt hinauszufinden war.
„Wenn die Autobahn nur für die Bergfahrt offen ist, werden sie automatisch auf die Anchieta umgeleitet.“ „Die Anchieta?“ „Ja, die alte Autobahn, und unten an der Serra müssen sie diesen Schildern folgen. Die Bodenmarkierungen sind falsch.“ „Die Bodenmarkierungen sind falsch?“ „Ja, das ist so. Glauben Sie mir.“ Bestimmt nickte sie mit dem Kopf, zeichnete einen zweiten Plan, der mich eigentümlich an eine Schatzkarte erinnerte, dann machte sie ein Kreuz; „so. Das ist Ihre Ausfahrt, Richtung Rio de Janeiro. Folgen Sie einfach der Strasse bis Sie in Maresias sind. Hotel Maresias, und jetzt muss ich wirklich gehen.“ Mit beiden Händen stemmte sie sich hoch, zögerte, „wir wohnen zwei Buchten weiter, Tóque Tóque. Wenn Sie fahren, kommen Sie uns besuchen. Fragen Sie an der Portária, und bevor ich es vergesse, wir haben sechs Kinder da. Danke für das Wasser und die Caipirinha.“
Lächelnd wünschte sie mir gute Nacht, verliess die Bar und verdutzt war ich stehen geblieben, hatte ihr nachgesehen. War das eine Einladung, die sie Sekunden später bereut hatte? Ich mag Kinder, sehr sogar. Sah ich etwa aus wie ein Kinderfresser oder hatte sie mich eingeladen, mir einfach nur sagen wollen, was mich erwarten würde? Wenn ich wollte? Sechs Kinder, und wer war wir? Hatte Motta nicht von Witwenstand gesprochen? Ich schlenderte zur Rezeption, bat um eine Reservation im Hotel Maresias, um einen Wagen, ging dann auf mein Zimmer und konnte nicht einschlafen. Jedermann hatte mir schon versichert, dass dies einer der heissesten Sommer seit Jahren sei, und obwohl am Nachmittag ein Platzregen niedergegangen war, der die Strassen innert Minuten in reissende Flüsse verwandelt, das Chaos apokalyptische Ausmasse hatte annehmen lassen, konnte die Klimaanlage der Hitze nicht mehr beikommen. Schwitzend lag ich auf dem Bett und dachte an die eigenwillige Frau.
Den nächsten endlos langen Tag verbrachte ich mit Fragen stellen, Antworten übersetzen in mögliche Bedeutungen, Unbedeutsamkeiten, versuchte mit dem Verkehr fertig zu werden, dem Regen, der Hitze, den Gedanken an die Frau, die aufzusuchen ich fest entschlossen war, war nach einer weiteren unruhigen Nacht endlich unterwegs nach Maresias und als ich zu der Abzweigung nach Rio de Janeiro kam, dem Kreuz auf ihrem Plan, und die Autobahn verliess, beschlich mich die merkwürdige Empfindung, einen Zeitsprung getan zu haben. Einsam und verlassen, schwarz flimmernd in der Hitze führte die Strasse schnurgerade durch dichtes Grün, das wir bei uns Dschungel nennen würden, stieg an, in einer einzelnen scharfen Kurve, über die Wipfel der Bäume hinaus, und blaugrün, schaumgekrönt, funkelnd und glitzernd rollte mir der Südatlantik entgegen. Bezaubert fuhr ich vorbei an Bucht um Bucht, kam nach Maresias, fand das Hotel, bezog mein Zimmer, legte mich hin, wollte sie noch etwas auskosten, die pralle Wärme, doch eingelullt vom Rauschen des Meeres schlief ich ein, tief stand die Sonne am Himmel, als ich erwachte und ich trat hinaus in den warmen Sand, blickte über die offene Bucht, die dunkelgrünen Hügel, scharf umrissene Schatten im Licht der sinkenden Sonne, umschäumt von Gischt, ging hinunter zum Wasser, setzte mich in den Sand und wartete, bis die Sonne ihr grandioses Schauspiel beendet hatte.
Heute war Weihnachtstag. Eine plötzliche Wehmut überkam mich, Sehnsucht nach zu Hause, nach meiner Mutter; ich dachte an meine Exfrau, an die Kinder, die wir nicht hatten, stand auf, ging zurück in mein Zimmer, liess meine Gedanken um Viktoria kreisen, um Motta; und erneut schlief ich ein, schlief tief und traumlos, um dann mitten in der Nacht hochzufahren, aufgeweckt vom Donnern der Flut, vermeinend sie würde in mein Zimmer dringen und über mir zusammenschlagen.
Das Haus schien verlassen, verschlafen in der Mittagshitze des nächsten Tages, doch auf mein Rufen und Klatschen kam eine einfache Frau um die Ecke, erklärteDonaViktoria sei am Strand. Dazu war ich nicht bereit, zu brutal brannte die Sonne, und sie erlaubte mir schliesslich auf der Veranda zu warten. Nach einer Weile legte ich mich in eine der Hängematten, und wie eine Glocke stülpte sich die Hitze über die Geräusche. Von weit her hörte ich den Ruf eines Kindes, durch das Flirren der glühenden Luft erklangen scheppernd die ersten Takte von BeethovensFür Elisa, brachen ab, erklangen von neuem;„quem é você!? O que ‘ta fazendo aqui?!“Drohend platzten die Worte in wirre Träume, ich öffnete die Augen, sah einen dicken Mann, der mich ausgesprochen unfreundlich betrachtete. „Sprechen Sie Albionisch?“ Für einen Moment hatte ich nicht gewusst, wo ich mich befand, hätte gestottert in jeder anderen Sprache, und der Mann nickte, entspannte sich sichtlich; schaukelnd richtete ich mich auf, stellte mich vor, erklärte, konnte plötzlich Stimmen hören, die sich langsam näherten.
„Viktoria“, rief der Mann, „hier liegt ein Gringo in deiner Hängematte.“ „Ich bin Albioner“, sagte ich, schwang mich etwas steif aus der Matte, fand mich umringt, fröhlich begrüsst, wurde schnell und unkompliziert vorgestellt, erfuhr, dass Malu und die zwei halbwüchsigen Kinder, die wie Amerikaner sprachen, zu Fábio dem Dicken gehörten, die grosse, blonde Frau mit dem pummeligen Jungen und dem kleinen Mädchen zu José Antonio, der mir auf Anhieb sympathisch war.
„Das ist Sami.“ Misstrauisch schnuppernd, die Augen fest auf mich gerichtet, trat der Junge hinter seiner Mutter hervor, mass mich mit schüchterner Zurückhaltung und flink wie ein Wiesel schlüpfte sein kleiner Bruder an ihm vorbei, Viktoria wie aus dem Gesicht geschnitten, gab mir einen Tritt gegen das Schienbein; „quem és?“ „Ich bin Robert, und du brauchst mich nicht zu treten.“ „Warum?“ „Weil es schmerzt.“ „Was?“ Erneut holte er aus, sie hob ihn hoch, „weil es weh tut, Max, und jetzt kommt, ab unter die Dusche, ich will keinen Sand im Haus. Du auch, Bruno. Machen Sie es sich bequem“, rief sie mir noch zu, die Schar vor sich her ums Haus treibend, und grinsend hob Fábio seine dicken Schultern, fing an, sich mit dem aus Backsteinen an die Hausmauer angebauten Grill zu beschäftigen.
„Sie sprechen Portugiesisch.“ „Nicht beim Aufwachen.“ Er lachte, entschuldigte wortreich seine Grobheit von vorhin und ich beschwichtigte, fragte mich im Stillen, wie er zu Viktoria stand, tippte auf Schwägerin, hörte, dass sie zum ersten Mal allein in Brasilien war, man sich besser vorsehe, etwas auf sie aufpasse; „Sie kennen sich aus Europa?“ „Nein, wir haben uns vor zwei Tagen in São Paulo kennen gelernt.“ Er füllte neue Kohle in den Grill, feuerte ein, ich störte mich nicht weiter an seinen ruckartigen Bewegungen und dann brach José Antonio das mir nicht unangenehme Schweigen mit der Frage nach einem Drink. Einer Caipirinha vielleicht? „Mach ihm eine mit Maracujà, Sé, Sie essen doch sicher mit uns?“
Nass noch vom Abduschen war sie, hatte ein bedrucktes Tuch um die Hüften geschlungen; „was ist Maracujà?“ „Maracujà? Warten Sie.“ Eilig ging sie zurück ins Haus, erschien Momente später mit einer dickschaligen, verschrumpelten Frucht von der Grösse einer mittleren Orange. Skeptisch schaute ich auf den gelblichbraunen Ball in ihrer Hand, kleine Hände hatte sie, kleine Füsse; „und Sie sind sicher, dass man das trinken kann?“ Lachend legte sie das faulig aussehende Ding auf den Tisch und so plötzlich drangen gellende Schreie von dem Strässchen zu uns herüber, dass ich erschrocken zusammenfuhr.
„Birà! Das ist Birà!! Birà!!!“ Wie auf Kommando rannten alle Kinder über die Veranda in den Garten, umringten aufgeregt den kleingewachsenen, jungen Mann, der schüchtern eine riesige Styroporbox zu Boden stellte. „Wie viele? Mami!? Wie viele?!“ Sami zählte, konnte sich nicht schlüssig werden, wurde ungeduldig von dem ältesten Mädchen unterbrochen, „zwölf sind wir. Sie nehmen doch sicher auch ein Eis, Onkel?“ Es dauerte, bis ich begriff, dass ich gemeint war und amüsierte trat Viktoria hinaus zu der kleinen Meute, schickte nach Wasser für den jungen Mann, belud die Kinder mit den Eisstängeln; Sami kam mit einer Flasche angerannt, versuchte die Schreie nachzuahmen, alle lachten, schwatzten, bettelten und der Mann liess erneut seine Stimme gellen.
„Er brüllt die Namen der Sorten. Ziemlich laut, nicht wahr?“ Lächelnd überreichte mir Sé Antonios Frau die Caipirinha, setzte sich zu mir, „haben Sie Kinder?“ Ich schaute auf die Bande, die sich um den Eisverkäufer scharte, ignorierte die sich ausbreitende Leere, „nein, leider nicht. Ihr Gatte ist Portugiese?“ „Ja, er ist bei Kriegsbeginn in Moçambique hierher gekommen. Er war gut befreundet mit Viktorias Mann. Sie kennen sich aus Europa?“ Gelassen hatte ich in meiner Caipirinha gerührt, nahm jetzt einen Schluck, schmeckte eine bittere Süsse auf der Zunge, eine weiche Frucht mit kleinen, harten, bittersüssen Kernen; „nein, wir haben uns vor zwei Tagen kennen gelernt. Ich hörte, ihr Mann ist verunglückt.“ „Im Februar, ja“, sie nickte und ich bemerkte, dass ein geschäftiges Hin und Her begonnen hatte.
Der Tisch wurde gedeckt, Viktoria verschwand im Haus, Sé, wie sie ihn nannte, erschien mit den restlichen Caipirinhas, Fábio brachte knusprige Würstchen vom Grill und bekleidet jetzt mit Shorts und T-Shirt, in jeder Hand ein Bastkörbchen, bis an den Rand gefüllt mit seltsam wurzelartig geformten Brötchen, trat Viktoria an den Tisch. „Du hast sie für mich gemacht, Vicky, allerliebste Vicky!“ „Die sind für dich“, Malu erschien mit zwei weiteren Körbchen, „und die sind für uns alle.“ Viktoria setzte Max zurecht, füllte tiefroten Saft in die Gläser der Kinder, „und was ist das?“ „Randen mit Karotten und Orangen. Sehr gesund. Möchten Sie versuchen?“ „Später.“ Ich hob mein Glas, lächelte ihr zu, „erstaunlich“, und mit einem zufriedenen Lachen schnitt sie ein Stück Wassermelone für Max, forderte mich auf zuzugreifen und ich ass die schmackhaftesten Brötchen, die ich je gekostet hatte.
„Kennen Sie Tante Vicky schon lange?“ „Ich bin nicht deine Tante, Bruno, und ich werde mich nie daran gewöhnen, jedermanns Tante zu sein in diesem Land. Macht irgendwie alt, finden Sie nicht?“ Also doch nicht Schwägerin, erneut musste ich sie anlächeln und unbefangen erzählte sie die Geschichte unseres Zusammentreffens. „Du hast ihn mitgenommen, tia? Einen Fremden? Bist du verrückt geworden?!“ „Jû, er ist ein Gentleman. Er ist zwar ein Freund von Fernando Motta, aber zuerst ist er Gentleman, richtig?“
Ich protestierte, ich war kein Freund von Fernando Motta, hatte es ihr schon einmal gesagt, und immer noch ungläubig schüttelte das Mädchen den Kopf. „Du bist verrückt, Vicky.“ „Ganz recht, mein Kind, völlig verdreht. Zweitausend für die Teilnahme an einem Mittagessen, und sie lehnt ab!“ Viktoria stand auf, ging zu Fábio, knuffte ihn gegen die Schulter, „es war zu wenig, viel zu wenig. Bist du soweit? Können wir essen?“, ging hinein, kam mit brasilianischen Bohnen, Bananen und Reis zurück und er tranchierte das Fleisch.
Einstimmig war beschlossen worden, den nächsten Tag in Maresias zu verbringen und ich hatte eben mein Frühstück beendet, als sie ankamen, mich aufluden; wir fuhren bis zum anderen Ende der Bucht, errichteten dort unser Lager und erneut bewunderte ich das leuchtende Grün des Hügels, der sie abschloss, roch das Salz in der Luft, spürte die Hitze auf der Haut; weit draussen, verhüllt von leichtem Dunst, erkannte ich die Umrisse einer klippenartig geformten Insel und wie Pinselstriche hingen ein paar Wolken am Himmel, verschmolzen mit dem glitzernden Schaum der Brandung. Mit allen Sinnen gleichzeitig nahm ich die Schönheit dieses Ortes wahr, schaute auf die Frau neben mir, die in einem Strandstuhl sass und ihre Kinder beobachtete. Ich konnte nicht bleiben, hatte bereits alles versucht, mein Zimmer für ein paar weitere Tage zu behalten, aber das Hotel war ausgebucht, die Zimmer bezahlt, sehr wenig Hoffnung hatte man mir gelassen, anderswo etwas zu finden und übermorgen würde ich wohl abreisen müssen.
„Ich habe mich noch gar nicht bedankt für Ihre Empfehlung.“ Kurz nur streifte mich ein Lächeln, „bald kommt São Paulo, bleibt bis Neu Jahr. Landeinwärts werden Sie den Ort nicht wieder erkennen.“ Erneut das Lächeln, „erstaunlich, dass Sie noch ein Zimmer bekommen haben.“ Eben nicht, und ich sagte es ihr. „Kommen Sie zu uns, wenn Sie bleiben wollen. Die Kinder können bei mir schlafen.“ Kaum hatte sie zu Ende gesprochen, sprang sie hoch, rannte über den Sand und fischte Max aus dem Wasser. Irritiert schüttelte sich der Dreikäsehoch, trat wütend nach den Wellen, trotzig wagte er sich wieder hinein, wurde erneut umgeworfen; ich sah orangefarbene Schwimmflügel, kleine Arme und Beine durchs Wasser wirbeln, unsanft setzte ihn die Welle auf den Sand und er brüllte. Viktoria, die ruhig zugesehen hatte wie er den Ozean herausforderte, stellte ihn jetzt tröstend auf die Beine, wischte ihm das Wasser aus den Augen und ich fragte mich, ob es so einfach sein konnte. Sie war gerne hier, konnte verstehen, dass man noch etwas bleiben wollte, und die Kinder würden in ihrem Zimmer schlafen.
„Er verliert immer mehr die Angst vor den Wellen. War Zeit, dass ihn eine wieder mal so richtig schüttelt.“ Sie hatte sich in ihren Stuhl fallen lassen, ihre Strandwache wieder aufgenommen, „wo ist Sami?“ „Er ist im Wasser, dort drüben, mit Sé; Viktoria, ich möchte Ihnen keine Ungelegenheiten bereiten.“ Glucksend lachte sie auf, „in den Ferien? Ich würde keinen Moment zögern und Ihnen bedauernd mitteilen, dass die Rezeption einen Fehler gemacht hat, wir ab sofort komplett ausgebucht sind.“ Ein kleiner, blauer Gummiball prallte gegen ihre Schulter und plumpste in den Sand. Sie hob ihn auf, drehte sich zu Bruno, der mit zwei Holzrackets in den Händen dastand und sie angrinste. „Ich habe geübt, tia Vicky.“
„Hoffentlich“; und ich schaute zu, wie sie den Ball schlug, rannte und lachte, dann hatte sie genug, warf das Racket in den Sand, tauchte ein und schwamm Richtung Brandung. Hoch türmte sich eine Welle über ihrem Kopf, mit kräftigen Zügen schwamm sie weiter, erwischte den Kamm der nächsten Welle und liess sich mittragen. Lange blieb sie im Wasser, spielte mit den Kindern, schwamm, tauchte in dem weissen Schaum, und dann stieg sie aus dem Meer, angespült von einer Welle, kam mit festen Schritten auf mich zu, wiegend in dem Sand, und ihr Lächeln traf mich wie eine Breitseite. „Die Seele waschen nennt man das.“ Ich nahm an. Am selben Tag noch zog ich um, wurde Gast in ihrem Haus, genoss den formlosen Umgang der Brasilianer, die lärmende Lebendigkeit der Kinder, verbrachte viel Zeit, mir ein Bild von Viktoria zu machen, sie festzulegen und einzuordnen.
Zwei weitere Tage blieben die beiden Familien und auch am Vorabend ihrer Abreise sassen wir auf der Veranda, tranken Caipirinhas, Sé erzählte von seiner abenteuerlichen Flucht aus Moçambique, dann kam das Gespräch auf die Regierung, die Krise und Viktoria gähnte. Immer die gleiche Geschichte, nur die Währung, die sich ändert, die Namen der Abzocker; allgemeines Stimmengewirr hob an und mehr oder minder sachlich versicherte man uns Ausländern, es sei noch nie so schlimm gewesen, erzählte Geschichten von skandalösen Machenschaften in Brasília, den unvorstellbarsten Gewalttätigkeiten auf den Strassen von Rio und São Paulo, und Viktoria zog die Beine an, zog sich zurück in ihren Stuhl als fürchte sie, der Schrecken könne bis an diesen friedlichen Ort vordringen.
„Das war schon immer so.“ „Ah, das Wort der Expertin, die seit fast zehn Jahren nicht mehr hier lebt.“ „Ja, ja, bla,bla, und warum es hätte denn besser werden sollen? Wegen dem nächsten, der verspricht, dass der Riese aus seinem Koma erwacht, der Traum von Grösse endlich wahr wird? Fábio, die Militärs sind abgezogen und“, „du würdest natürlich zum bewaffneten Widerstand aufrufen, sie alle erschiessen. Auch Ché ist vor langer Zeit zu Staub geworden, meu bem.“ „Erschiessen lassen, sicher, die gehören an die Wand gestellt. Stell dir vor, die gehen sonst alle in Pension und du musst bezahlen.“ Ich verstand nur teilweise, warum sie alle lachten, gefangen wie ich war vom schnellen Wechsel der Gefühle auf Viktorias Gesicht; sprühend vor mutwilligem Spott forderte sie Fábio für die zweite Runde und als er seine mächtigen Arme auf den Tisch stützte, bemerkte ich den bösartig glitzernden Blick des Angetrunkenen.
„Wie kommt es, dass du Schweizerin bist, Vic? Da stimmt doch etwas nicht.“ Überrascht drehte sie den Kopf zu mir, hob lachend die Hände, „also gut, ich gebe es zu, ich bin ein Mischlingskind. Mein Vater war Italiener, ja, und darum werde ich bei der nächsten Abstimmung gegen die EU stimmen. Ich hab ja einen europäischen Pass.“ Das allerdings war sehr schweizerisch, aber ich kam nicht mehr dazu, es ihr zu sagen. „Ha governo, sou contra, das ist dein Motto, nicht wahr? So hast du immer was zu meckern, und Henrique hat das auch zu spüren bekommen. Bist du eigentlich froh, dass er tot ist?“ Wie vor einem Schlag zuckte sie zurück und Fábio legte seine schwere Hand auf ihren Arm. „Es hat dir eine Scheidung erspart; und du benimmst dich wirklich nicht wie eine trauernde Witwe, die erst vor kurzem ihren geliebten Mann verloren hat. Sitzt hier, hast Spass, lädst fremde Männer in dein Haus und“, „lass los!“ Mit aller Kraft riss sie sich los und sprang auf.
„Was fällt dir ein, meine Gastfreundschaft zu kritisieren? Hm?! Und wer hat schon keine Probleme nach sechzehn Jahren Ehe? Du vielleicht?!“ Unaufhörlich knetete sie ihre Hände, als wolle sie verhindern, dass sie ihm an die Gurgel fahren, und Fábio wurde es sichtlich unbehaglich. „Ich war euer Trauzeuge, ich fühle mich verantwortlich.“ „Ach! Verantwortlich? Und für wen denn? Ich habe dich angerufen, Trauzeuge, weisst du noch? Und später, was war da, Fábio? Anscheinend übersteigt der Preis eines Flugtickets dein Verantwortungsgefühl. Ha!“ Böse lachte sie auf, und der klägliche Rest krampfhafter Zurückhaltung brach einfach ein. „Er ist tot! Ô babaca! Aber ich lebe noch und ich habe nur ein Leben, so wie du! Und darum würde ich schleunigst aufhören zu fressen und zu saufen, weil sonst Malu auch bald in meine Lage kommt und fremde Männer in ihr Haus einlädt! Ah, vergiss es!!“ Kochend vor Wut drehte sie sich um und rannte ins Haus.
Immer wieder hatte er gestichelt, provoziert, und dass sie meistens darauf einging, schien zu den Beiden zu gehören, was auch den Gleichmut der anderen erklärte, wenn sie sich in die Haare gerieten; aber die Heftigkeit, mit der sie jetzt aufeinander losgefahren waren, hatte uns alle überrumpelt. Verärgert, sich über unhöfliche Besoffene auslassend, nahm Sé das Glas aus Fábios Hand und Malu versetzte ihm einen harten Schlag auf den Bauch. „Geschieht dir recht.“ „Ja. Ja, ich bin ein Arschloch, und ich fresse und saufe zu viel. Geschieht mir recht, jawohl! Tut mir leid, Robert, ich wollte dich nicht beleidigen.“ Ich war nicht beleidigt, seine Eifersucht schmeichelte mir und ich freute mich insgeheim, dass sie wegfuhren, auch wenn Viktoria neue Gäste erwartete, freute mich auf die Stunden, die ich mit ihr allein sein würde.
Halb begraben unter Fábios überschwänglichen Entschuldigungen sass sie am nächsten Morgen am Frühstückstisch, den Kopf in die Hand gestützt; „Saufkopf.“ „Was immer du willst, Vicky, du hast recht, und es tut mir wirklich aufrichtig leid.“ Unwillig schüttelte sie seinen Arm ab, „ich hasse dich.“ „Für immer?“ „Bis zum nächsten Sündenzahltag.“ „Für nicht sehr lange in dem Fall“, und sie lachten, versöhnten sich, verabredeten sich für dieselbe Zeit im nächsten Jahr, nahmen Abschied; ich schlug vor den Tag in Maresias zu verbringen und sofort war sie einverstanden, war sehr beschäftigt alles einzupacken und schweigend beluden wir das Auto. Sie zweifelte, ich spürte es. Es war ihr nicht gleichgültig, was ich dachte, wie ich dachte, auch mochte sie mich mehr, als den alten, halbvergessenen Bekannten, als den sie mich behandelte; und sie wich mir aus, gab sich lange nur mit ihren Kindern ab, spielte in Wasser und Sand und als sie sich dann zu mir setzte, sprachen wir über Belangloses, sie meinte, dass es heute regnen würde, dann fing sie einfach zu erzählen an.
„Ich war dreizehn als mein Vater starb. Es war an einem Samstag, das letzte Wochenende der Winterferien, und ich war bei meiner Grossmutter. Sie hatten mich strafversetzt, weil meine Nonna bei uns war; er war doch so krank und ich so unausstehlich zu meiner Nonna.“ Sie hielt inne, liess die Augen suchend über den Strand gleiten, liess sie liegen auf ihren Kindern, dann schaute sie hinaus aufs Meer. „Am Montag bin ich zur Schule gegangen. Wir wohnten in einem Dorf, alle wussten schon, was geschehen war, liessen mich in Ruhe; alle, bis auf eine, und ich hätte sie erwürgen können, hätte schreien wollen und toben.“ Nervös hatte sie mit den Füssen tiefe Furchen in den Sand gegraben, sprang jetzt auf, „verstehst du, Robin? Was kann man denn tun?“, rannte, stürzte sich kopfüber ins Meer, schwamm, tauchte, schwamm weiter hinaus, liess sich zurücktragen; „man kann nur auch sterben, um der Qual ein Ende zu bereiten oder man lebt. Also lebe ich, so gut es geht.“
Ich schaute auf diese eigenartige Frau, deren Wesen mich berührte, mein Herz mit Wehmut erfüllte und in meinem Geist erschien das Gesicht meines Freundes, starr und bitter, ohne Hoffnung auf einen Weg zu etwas Glück. Ich hob die Hand, wischte einen Tropfen aus ihrem Gesicht, „warum hast du dir hier ein Haus gekauft?“, und ihre Augen schweiften über den weissen Sand, über die schäumende Brandung hinaus zum Horizont, „weil man hier einen Blick auf das Paradies tun kann, und weil ich nicht genug Geld für ein Haus in der Schweiz habe. Komm, gehen wir, es wird gleich regnen.“ „Regnen, Viktoria?“ Sie lachte, zeigte auf die dicht bewaldeten Hügel hinter uns und ich sah, wie dicke, weisse Wolken wie Zuckerwatte über ihre Kämme quollen.
Mit der Ankunft von Ana und Luiz, ihren beiden kleinen Mädchen, das jüngere erst wenige Monate alt, und der von Alzira, einer gemeinsamen Freundin, änderten sich Rhythmus und Stimmung im Haus. Viktoria zog sich zurück in den Schutz der beiden Frauen, umgab sich mit Kindern, und ich schloss mich Luizinho an, wie sie ihn nannte: kleiner Luiz. Er war der Jüngste, ein dänischstämmiger, sportlicher und sehr direkter Brasilianer. Am ersten Tag schon, ich hatte mir Samis Body-Board ausgeliehen und wir waren unterwegs zum Strand, wollte er wissen, ob ich ein Verhältnis mit Viktoria habe, grinsend entschuldigte er sich sogleich wir gingen surfen. Schön erschien sie mir, doch, erregend in ihrer Lebendigkeit, ich fühlte mich zu ihr hingezogen, aber sie war nicht bereit und so hielt ich mich zurück, begnügte mich damit ihr zuzusehen, am Strand, wie sie schwamm und rannte, in der Sonne lag, wie sie ihre Kinder umsorgte, Anas Baby wiegte, ungemein gutes Essen für uns kochte, und ich sass da, am Abend, wenn wir alleine waren, ohne Kinder, hörte ihren Gesprächen zu und immer wieder dachte ich an James, tauchte ungerufen sein Gesicht vor mir auf.
Als wir dann alle einige Tage nach Jahresbeginn in die Stadt zurückgekehrt waren, hatte ich gehofft, Viktoria vor ihrem Flug noch einmal zu sehen. Schwarz vor Menschen war die Abflughalle, eilig schob und drängte ich mich zu ihrem Schalter vor ‚Check-in abgeschlossen‘, rannte fast zur Passkontrolle, fragte mich etwas ausser Atem, was mich wohl trieb, wie ein aufgeschreckter Käfer in dieser Flughafenhalle hin und her zu rennen, inmitten all der Leute, auf der Suche nach einer Frau mit zwei kleinen Kindern, verschob die Antwort auf später, ging meinem Leben nach, checkte ein, bereitete mich auf die Ankunft zu Hause vor, auf all die Dinge, die ich zu tun haben würde; und wieder dachte ich an James, dachte, dass er mich jetzt endlich wissen lassen musste, ob er mitkommt in die Berge, dachte, was für ein egoistischer Mensch er doch war, weil er mit seinem Zögern verhinderte, dass wir Freunde der Jungen einladen konnten und er es wusste; und als dann die Turbinen aufdröhnten, die Maschine sich in Bewegung setzte, schaute ich hinaus auf die Lichter des Flughafens, die aussahen wie alle Lichter auf allen Flughäfen, liess meine Gedanken zu Viktoria wandern, dachte, dass ich sie in der Schweiz besuchen werde, wissen wollte wie sie lebte im Alltag, fernab von Meer und Sandstrand, von der Hitze des brasilianischen Sommers, der die Menschen weich werden lässt und sinnlich, dachte daran, sie nach Albion einzuladen.
Tage nach meiner Rückkehr zehrte ich noch von der Wärme, die ich aufgenommen hatte, aber als ich dann zwei Wochen später in Zürich eintraf, lag die Welt unter einer kalten Nebeldecke begraben und ich verlor etwas den Mut, hatte jedoch Gründe in Zürich zu sein, vorrangige Gründe, Dinge, die zu erledigen ich hierhergekommen war; und dann rief ich sie an, war Minuten später unterwegs in eines der Dörfer am See. Das Taxi hielt vor einem kleinen, etwas windschiefen Haus, in dessen Garten die kläglichen Reste eines überdimensional dicken Schneemannes standen. Unwillkürlich dachte ich an Sami und Max, ertappte mich bei einem einfältigen Grinsen, Viktoria öffnete die Tür, hiess mich willkommen in der Eiszeit und ich fragte nach den Kindern. Max schlief, Sami war noch in der Schule, wollte später Schlittschuhlaufen gehen.
„Kannst du Schlittschuhlaufen?“ Ich hatte das Häuschen besichtigen wollen, wir standen im Untergeschoss, in Samis Bastelraum; er wollte Schreiner werden, einen Kobold bekommen, was ich nicht ganz verstand, beunruhigt wohl durch die Aussicht Schlittschuhlaufen zu müssen; „wo arbeitest du?“ „Ganz oben.“ Wir stiegen die Treppen hoch, vorbei an den Zimmern der Kinder, hinauf bis fast unters Dach, traten in einen grossen, in Schlaf- und Arbeitsplatz unterteilten Raum. Nur sehr schwer fiel es mir, kühle Technik mit dieser Frau in Verbindung zu bringen, neugierig näherte ich mich den hochgerüsteten Maschinen. entdeckte, halb von Büchern und Ordnern verdeckt, das Foto eines schwarzhaarigen Mannes, der mit Sami und Max in einer Hängematte lag.
„Dein Mann? Warst du glücklich?“ „Und du? Die letzten sechzehn Jahre?“ Als stünde mir die Antwort auf der Stirn geschrieben, musterte sie mich, lächelte, „ich war es, immer wieder. Lange waren wir Komplizen, und irgendwann sind wir dann zu Konkurrenten geworden.“ „Warum Konkurrenten?“ „Ich weiss nicht. Vielleicht weil ich immer gearbeitet habe, immer Angst davor hatte, mein Leben in die Hände eines Mannes zu geben, hoffend, dass er nett ist und meine Rechnungen bezahlt; ich muss das noch schnell abschliessen.“ Sie setzte sich vor den Computer, setzte eine Brille auf und in aller Ruhe konnte ich sie betrachten. So ganz anders sah sie aus, eingepackt in lange Hosen, warme Pullover; erwachsen, auch wenn ich mich immer so jung fühlte in ihrer Gegenwart, „und dann?“
„Was?“ „Wie ging es weiter?“ „Grosse Krise.“ „Wer war schuld?“ „Schuld? Es braucht zwei zum Tango tanzen. Ist das jetzt ein argentinisches oder ein Albionisches Sprichwort? Egal, schuld war natürlich er.“ „Natürlich, und dann?“ „Wir trennten uns, für eine Weile, drei Monate oder so, dann kamen wir hierher. Ich wurde sofort schwanger, wir waren wieder sehr glücklich und eines Tages waren wir es nicht mehr.“ „Warum?“ „Ich bin nicht sicher, aber es war so. Er ging für zwei Wochen nach Brasilien, kam vier Monate später zurück, kurz vor Weihnachten.“ Gedankenverloren sass sie da, schaute auf den Monitor, als teile er alle ihre Geheimnisse, dann nahm sie die Brille ab, schaltete aus und blieb sitzen. „Er wollte nicht mehr hier leben, wollte zurück nach São Paulo und ich habe nicht mitgehen können. Nicht nach Sampa, nicht mit zwei Kindern und drei Koffern, nicht noch einmal. Nicht mit ihm.“ Ungestüm schob sie den Stuhl zurück, sprang auf, ging hin und her, und da war sie wieder, diese Leidenschaft, die sie wohl zerreissen würde, wenn sie nicht ständig in Bewegung bliebe, sie abschüttelte.
„Ich hatte plötzlich Zeit, so viel Zeit, so viel Raum, der sich aufgetan hat in diesen vier Monaten. Ich hatte sie doch schon verloren, meine Liebe, noch bevor er zurückkam und wieder fort ging; so viel Leere, die ich füllen konnte.“ Sie blieb stehen, schaute geistesabwesend vor sich hin, schien kaum mehr zu atmen, dann seufzte sie auf, schüttelte sich, als komme sie aus dem Regen; „wir konnten nicht mal zur Beerdigung fahren. Die Toten werden sofort begraben, am nächsten Tag schon, wegen der Hitze wahrscheinlich. Sie werden kaum genug Kühlraum haben für all die Leichen, die jeden Tag so anfallen in São Paulo. Ja, das wird es sein. Hast du Hunger?“ Entgeistert starrte ich sie an, erschrocken schlug sie die Hände vor den Mund, sah so komisch aus in ihrem Entsetzen, dass ich zu lachen anfing, etwas verschämt fiel sie ein und so unverhofft nah war sie mir plötzlich, dass ich sie in die Arme nehmen wollte.
„Das ist Max, er ist wach.“ Horchend hatte sie den Kopf erhoben, leicht lag ihre Hand auf meinem Arm, hielt mich sachte auf Distanz, „lass ihn bloss in Ruhe. Bitte. Er hat eine unglaubliche Laune nach seinem Mittagsschlaf. Hast du jetzt Hunger oder nicht?“, und langsam folgte ich ihr hinunter zu dem quengelnden Bübchen. Geduld brauchte ich, etwas Geduld nur; und dann gingen wir tatsächlich Schlittschuhlaufen.
Ich hatte mich anstacheln lassen von spöttischen Bemerkungen über älterer Herren Knochen, und obwohl ich panische Angst hatte hinzufallen, nahmen wir Max in die Mitte. Schnell hatte er genug, sofort war ich bereit, mich mit ihm in das kleine Café zu setzen; und schwatzend, gestikulierend, zeigte er durch die Fensterscheiben auf seine Mutter, auf Sami, ging hierhin und dorthin, trank eine Cola; leise hatte es zu schneien begonnen und ich schaute hinaus in das schwindende Licht, schaute Sami und Viktoria zu, wie sie inmitten wirbelnder Flocken übers Eis kurvten.
Wieder zu Hause kochte sie Spaghetti für uns und dann dauerte es eine Weile, bis die Kinder im Bett waren, ich meine Einladung anbringen konnte, die rundweg ablehnt wurde. „Viktoria, willst du mich beleidigen? Ich war fast zwei Wochen Gast in deinem Haus und“, „machst du Spass?“ Vielleicht hatte ich eindringlicher gesprochen als beabsichtigt, misstrauisch witterte sie nach dem vermeintlichen Spott, „nein, natürlich nicht, ich“, „Robin, ich will dich nicht beleidigen, wieso auch? Aber du bist doch ein Lord, ein echter meine ich; eben, und ich habe diese Angewohnheit in Fettnäpfchen zu treten und die stehen bei dir sicher in rauen Mengen an den unmöglichsten Orten.“ Weggeräumt sollen sie werden, ausnahmslos, versprochen, „und es werden auch Kinder da sein, Viktoria, mein Patensohn und sein Bruder, und du nimmst natürlich deine Kinder mit.“ Immer noch zögernd bedachte sie mich mit einem seltsam scheuen Lächeln, das ich erwiderte. Es gab nichts zu befürchten.
Sie:
„Aua! Sami, schnell! Schlag mich auf den Rücken, hier, fester, mit den Handkanten!“ Nie mehr werde ich meinen Kopf gerade richten können, nie mehr, und die Vorstellung, wie ich mit nach links geneigtem Kopf durch den Rest meines Lebens gehe, treibt mir die Tränen in die Augen. Ah, wie das schmerzt; „mit den Handkanten, hier.“ Er schlägt, Max weint, weil es mir weh tut, weil Sami mich nicht schlagen soll; die Maschine schüttelt und ich hasse es, hasse fliegen, Flugzeuge, kann nicht mal ausrasten, eingepfercht in dieser Toilette mit Wickeltisch von der Grösse eines Serviertabletts! Tief atmen, noch ein Mal, und was immer ich mir eingeklemmt habe wird locker, die Maschine schüttelt, ich reisse mich zusammen, führe uns torkelnd zurück auf unsere Plätze, setze die Kinder zurecht, schnalle sie an, wundere mich etwas über die Gurte, die eh nichts nützen würden, belehre mich über Luftlöcher und andere unerfreuliche Dinge zwischen Himmel und Erde; und ich decke sie zu, sie schlafen ein, schlafen tief und fest, hängen zusammengekrümmt in ihren Sitzen.
Noch fünf Stunden; Jorge holt uns ab und morgen fahren sie alle an den Strand. Heute eigentlich; Jorge, Tante und Grossmutter. Wird schon gehen, sie bleiben nicht lange, dann kommt Malu mit ihrer Bande, Sé mit der seinen und wenn sie gehen kommen Ana, Luiz und Alzira; und ich versuche meine Ohren zu verschliessen vor dem immerwährenden Dröhnen der Motoren, meinen Bauch unter Kontrolle zu halten, weil es schon wieder schüttelt, versuche mir einzubilden, dass das Schütteln das Wiegen der Wellen ist, das Dröhnen das Rauschen der Brandung, was ich atme Luft, die nach Meer schmeckt, nach Wind, Salz und Wasser, doch es geht nicht so recht.
Ohne mich werden sie fahren, und es wird gut gehen. Natürlich wird es gut gehen! Jorge fährt vorsichtig, nicht so schnell wie Henrique immer gefahren ist, und Sami kennt das Meer, kann auf sich aufpassen. Max! Sie müssen zwei Augen auf ihn haben, er ist so furchtlos, ein Helmkind, ich muss es wiederholen, immer wieder. Die Fenster! Sechster Stock! Zuerst muss ich nach den Fenstern sehen! Hör auf! Schluss! Es wird nichts passieren! Keine Unfälle, Überfälle, keine verirrten Kugeln, Entführungen, gar nichts, die Familie bleibt nur bis zum Weihnachtstag; und es schüttelt, schüttelt immer irgendwo über dem Atlantik. Tief atme ich ein, denke an das Willkommen der Sonne, an die Wärme des Sandes, die Kühle des Meeres, wie ich meine Seele waschen werde in seinen Wellen.
Die Seele; die Indios sagen, dass es ihr zu schnell geht, sie nicht mithalten kann mit einem Flugzeug. Etwas mehr Zeit zwischen Zürich und São Paulo wäre nicht schlecht, doch, ein Stopp in Lissabon, genau, an der Quelle des Chaos warten, bis sie nachkommt; und still lache ich mich aus, suche etwas mehr Platz für meine Beine, versuche zu schlafen; einen Tag und eine Nacht für mich allein. Ich geh einkaufen, jawohl, kaufe mir das schönste Kleid, das ich finden kann, und dann endlich zieht der Frühstücksduft durch die Kabine, Sami wird es schlecht, ich halte die Papiertüten bereit, hasse es, hasse fliegen, wäre gern ein Vogel. Eine Möwe, in Maresias.
„Wo hast du das gekauft?“ „Schön, nicht?“ „Hast du heute Abend etwas Bestimmtes vor?“ Sie lacht und ich drehe mich, wende mich, fange ihr Lächeln im Spiegel auf. Hab ich das? „Ich weiss nicht, ob ich hingehe und mit dem Kleid sowieso nicht“, ziehe es aus, lege es in den Koffer, von wo es wohl für immer in meinem Kleiderschrank verschwinden wird. „Geht es dir gut, Gringinha?“ Sanft ist ihre Stimme und ich setze mich zu ihr, lasse mich halten, wiegen, als wär ich ihre Kleinste. „Ja, es geht mir gut und den Kindern auch.“ „Hast du einen neuen Mann?“ „Fragst du das, weil ich nicht mit dem Kleid an die Party gehen will?“
Aufgebracht plötzlich mache ich mich los, stehe auf, muss hin und her gehen, „ich halte das Trauerjahr ein“, schaue sie an, sehe trotzigen Ärger aufblitzen. Sie sind noch da, die alten Gesetze, schlummern tief in unseren Eingeweiden, können jederzeit geweckt werden; kalt ist mir plötzlich und irritiert schüttelt sie den Kopf. „Wie zynisch du bist, Vicky.“ „Ich bin nicht zynisch, ich bin eine Frau mit Anhang. Ich habe keinen Platz für einen Mann. Die Kinder brauchen mich.“ Immer noch schüttelt sie den Kopf, tadelnd jetzt, und ich weiss genau, was sie sagen wird. Aber sie hat Unrecht. Muss ich denn nicht neben ihnen hergehen, sie begleiten, damit sie so sicher wie möglich wachsen können, bis sie bereit sind alleine weiterzugehen? „Bis zum Tag, an dem sie es nicht mehr tun. Du solltest dich nicht nur auf die Kinder konzentrieren, du brauchst ein eigenes Leben, Vicky, und du wirst irgendwann auch einen Mann brauchen.“ Brauchen? Ich habe doch schon Kinder, ernähren kann ich sie auch. Brauchen; was ich wirklich brauchen könnte, gibt es nicht, ist ausverkauft, hat es vielleicht nie gegeben.
„Ach was, Ana, ich warte auf den Prinzen.“ „In deinem Alter?“ „Ja, er muss ja nicht mehr zwanzig sein“, und ich lache, strecke ihr die Zunge raus; „nein, ernsthaft, darunter mach ich es nicht mehr. Aber er muss auf einem Pferd kommen, einem grossen, weissen Pferd, und dann verlier ich einen Schuh, er wird zum Frosch und wenn ich ihn nicht küsse, bleibt er es auch. Verstehst du? Zuerst muss man den Frosch küssen! Ein Vertrag wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich treffe einen Mann, komme ihm gerade recht und er mir auch, wir machen einen Vertrag, in dem genau festgehalten wird, was er muss und was ich muss und wie viele Male, und dann spielen wir Mann und Frau“, lache, umarme sie, habe sie so lange vermisst. „Ah Ana, ich würde mich noch ein Mal mit einem Mann einlassen, ein einziges Mal nur, und er wäre die Erfüllung aller Träume, die ich schon von ihm geträumt habe.“
Fast gleichzeitig hören wir das Weinen, Ana geht hinaus, und ich? Was soll ich tun? Soll ich jetzt hingehen? Carlos’ Einladung hat echt geklungen, und er ist immer ein Freund gewesen. ‚Vicky, ich weiss, dass du es nicht getan hast, nein, warte, du verstehst nicht. Wir haben herausgefunden, wer es war und ich habe dafür gesorgt, dass das alle zu wissen bekommen.’ Mit dem Kindchen auf dem Arm kommt Ana zurück, setzt sich zum Stillen hin, ich setze mich zu ihr, ganz nah an den Dunst von Muttermilch, und leise sprechen wir über unsere Kinder, unsere Erfahrungen, die Anstrengungen, die sie kosten, beiläufig erwähnt sie Luiz, er ist auch noch da, hat Ansprüche, und dazu habe ich nichts zu sagen.
„Gib sie mir endlich, Ana, sei nicht so gluckig.“ Sie lacht mich aus, von wegen Glucke, legt mir das Menschlein in die Arme; „hallo, mein Mädchen, ich bin deine Schwiegermutter. Du wirst Max heiraten. Sami ist zu alt für dich und er ist schon an deine Schwester versprochen“, wiege sie sanft hin und her, ihr Köpfchen an meinem Gesicht. So lange habe ich kein Baby mehr gehalten, habe vergessen wie klein sie sind, wie gut sie riechen.
„Du bist schon zurück?“ Sie sitzen vor dem Fernseher, Gras liegt in der Luft, ich schlüpfe aus den Schuhen; „ist noch was übrig? Und was schaut ihr da?“ „Unmöglicher Schinken. Warum bist du schon zurück?“ „Motta war dort. Ich bin keine fünf Minuten geblieben.“ „Da hast du aber lange gebraucht. Hast du dich verfahren?“ „Nein“, und ich erzähle von dem Gringo, der gebeten hat, ihn mitzunehmen. „Sag mal, spinnst du?!“„Wieso?“ „Erzähl bloss, du nimmst in der Schweiz fremde Männer in deinem Auto mit.“ „Ja, klar, die ganze Zeit. Komm, ich steige schliesslich auch in ein Taxi.“ Er glaubt nicht recht gehört zu haben, kann sich kaum erholen; ich denke, dass er ein Problem hat, ein rein biologisches, lache ihn aus, weil ich sehr wohl in der Lage bin abzuschätzen, wann ich was riskieren kann, reiche den Joint an Ana weiter und sie legt ihn weg, lächelt. „Was? Er war nett, wirklich, wir haben noch was getrunken.“ „In welchem Hotel wohnt er denn?“ „Im Mofarrej.“ „Im Sheraton? Da bist du aber einen Umweg gefahren.“ „Einen kleinen, Gringos müssen zusammenhalten. Morgen fahr ich übrigens gleich nach dem Frühstück“; und immer wieder unterbrochen von dem unmöglichen Schinken, schwatzen wir von vergangenen Zeiten, alten Bekannten, freuen uns auf gemeinsame Tage.
Nett hat er ausgesehen, sympathisch, doch, hatte etwas von einem alten Baum, und ich lache, denke, dass er das nicht gerne hören würde; seine Ausstrahlung natürlich, das Gesicht eher kantig, nicht unedel. Hat Motta nicht was von Lord gesagt? Ja, ja, der eine heisst Prince, der andere Lord, und durch die Kurven der Anchieta fahre ich dem Meer entgegen, weit über die Ebene von Santos hinaus geht der Blick, lässt einen Schimmer von Blau in Blau erkennen, und ich denke, dass der Gringo kein Amerikaner war.
Ja, ja, konzentrier dich auf die Strasse, auf die Lastwagen, die dreissig fahren, von einem anderen mit fünfunddreissig überholt werden. Ich kenne das, habe das schon gemacht, bin bald unten, da kommen sie von allen Seiten; vergiss die Bodenmarkierungen, die sind falsch, das habe ich ihm noch gesagt, gut; und ich bin eingekreist, eingenebelt, es stinkt atemberaubend, aber ich kann das Steuer jetzt nicht loslassen, das Fenster nicht hochkurbeln, ich muss mich konzentrieren, mir die ekligen Dämpfe reinziehen, kann das, habe das schon überlebt, mehrere Male sogar, vorne rechts ist die Ausfahrt; und ich stelle den Blinker, sehe die Lücke, reduziere, gebe Gas, es reicht, nicht allzu knapp, die richtige Ausfahrt war es auch, Cubatão liegt neben mir, und ich kann endlich das Fenster hochkurbeln, aufatmen, der Verkehr hat nachgelassen, kann nach den Baumskeletten Ausschau halten, nachsehen, ob es mehr geworden sind. Öliggelb fällt der Regen in Cubatão und immer wieder ungläubig staune ich die Pflanzen an, die da trotzdem wachsen, die aufgeworfenen Hügel entlang der Autobahn überziehen, biege endlich ab, öffne das Fenster, atme ein, atme durch, fahre hinein in das Grün, das nur die Paarung von Glut und Regen im Schoss der roten Erde hervorbringen kann.
„Mami, du bist da, ich bin so froh, bist du da“, und ich gehe in die Knie, werde umarmt, küsse, umarme, lasse mich einspinnen in ihre Geschichten vom Käfer im Badezimmer und Max reisst die Augen auf, weil er so riesig war, der Kakerlak; begrüsse die Familie, bedanke mich fürs Kinderhüten und ein Schwall von Ratschlägen, Vorwürfen, Ideen, wie man es besser machen könnte, „diese Schreie, also wenn das mein Kind wäre, und er beisst!“, prasseln augenblicklich auf mich nieder; und ich lasse mich wegzerren, „Mami komm endlich, wir wollen zum Strand, ihr könnt nachher schwatzen“, lasse mich entführen durch das Schattenlicht der Bäume hinunter zum Meer.
„Du lässt dich tyrannisieren von deinen Kindern.“ „Wieso, weil ich ihnen eine Gutenachtgeschichte erzähle?“ Keinen Streit, komm, lass sie reden, wovon sie nichts versteht, es ist unwichtig, und still verlässt meine Schwiegermutter den Raum, schliesst leise die Tür. „Jetzt hat sie schon wieder geheult. Ich finde das unerträglich, sie sollte endlich darüber wegkommen.“ „Sie hat doch ein Kind verloren. Wie soll sie je darüber wegkommen?“ Dumme Kuh, warum versteht sie nicht!? „Bei dir ist es ja ziemlich schnell gegangen, Viktoria. Du siehst gut aus“, und ich möchte sie würgen, ohrfeigen, ihr das Gesicht zerkratzen, dieser miesen, muffigen Grossstadtschlampe, schlucke alles runter, erspare uns den Krieg; „ja, ich hab mich ausgeweint. Gute Nacht.“ Morgen fahren sie weg, graças a Deus, werden ihren Kummer wieder mitnehmen, morgen kommt Malu mit ihrer Bande, Sé mit der seinen.
Er besucht uns, wie nett, scheint sich wohl zu fühlen, mag unsere Mischung. Sé mag er besonders. Sie müssen etwas gemeinsam haben; und ich schaue ihn mir an, wie er da Geschichten erzählt von Löwen, er sich kurzerhand entschloss, den Kampf für Portugal Profis zu überlassen, als er Nachts auf Wache ihr Gebrüll gehört, sich fast in die Hose gemacht hatte. „Nicht ein einziger Baum, auf den man hätte klettern können, queridos, nur Dunkelheit, dieses grausige Brüllen“; und unweigerlich kommen sie auf den brasilianischen Löwen, lassen keine Gelegenheit aus, um über die Krise zu sprechen, die Regierung und ihre Schweinereien. Als ob das jemals anders gewesen wäre; und ich erinnere mich an den ersten Plano économico, den zweiten und dritten, an die Diskussionen, die wir hatten, als sie den Analphabeten das Stimmrecht gaben, es Demokratie nannten; wie sie Henrique als Funktionär im Wahlbüro aufgeboten hatten und der Doutô andauernd gefragt worden war, wo man denn jetzt das Kreuz machen müsse. Stimmen ist Pflicht, und das Nichtbefolgen zieht ernsthafte Scherereien mit einem Departement der Sicherheit nach sich.
Vielleicht war es einmal anders, vor langer Zeit, vor meiner Zeit. Für mich war es immer schon so, nur Fábio, Fábio ist nicht der Selbe, will mir an den Kragen, lauert schon lange; und dann renne ich durch die Küche, stosse die Hintertür auf, renne ums Haus, durch den Garten; hör auf zu rennen, du kannst nicht den ganzen Weg bis zum Strand rennen, hüpfe, ai, filho de uma cadela vadía, marschiere. Selber schuld. Nein! Er ist Gast in meinem Haus und er hat mich blossstellen wollen, weil er eifersüchtig ist, weil ich zu haben bin. Arschloch! Mieses, fettes, gemeines, besoffenes Arschloch! Selber schuld. Ja; und ich setze mich in den Sand, schaue hinein in das sich wiegende Silber des Mondes, schaue hinauf, suche nach dem Kreuz des Südens, finde so viele Kreuze am Himmel. Spielt es denn eine Rolle, was er denkt? Was er nicht denkt? Und ich lasse mich treiben, hinauf zu den Sternen, hinunter bis auf den Grund des Meeres, hinüber, zurück in den Osten, weiss einmal mehr nicht so recht, wo ich hingehöre.
Vielleicht geht er jetzt auch. Vielleicht sollte ich ihn bitten zu gehen. Ach was, der ist alt genug, der kann machen was er will; er will nach Maresias und heute Abend kommen Ana, die Mädchen, Alzira, mit Luiz wird er sich gut verstehen, und ich schaue hinaus aufs Meer, hinüber zur Serra. Es wird regnen, später, wie fast jeden Nachmittag, lehne mich zurück, lasse mich von der Sonne bescheinen, lasse Bilder von meiner Nonna aufsteigen, wie sie morgens ohne Zähne aufwachte, ich mich weigerte, Anweisungen einer zahnlosen Alten zu befolgen; sehe mich Schlittschuhlaufen auf der Eisbahn im Dorf meiner Grossmutter, mich verabreden für den nächsten Tag, Samstag, am Montag fängt die Schule wieder an; und ich höre die Stimme meines Bruders am Telefon, die mich nach Hause befiehlt, höre mich streiten, weil er diesen Ton älterer Brüder drauf hat, weil ich Schlittschuhlaufen will, höre die Schreie meiner Mutter, sehe mich im Zug, auf dem Weg ins Spital und Verzweiflung drückt mir die Luft ab. Was soll ich den Leuten am Empfang denn sagen? Ich weiss doch nicht einmal, wo er liegt, in welchem Zimmer. Was soll ich denn bloss sagen?!
Und ich renne durch den Sand, tauche ein, die Welle rollt über mich hinweg, tauche dem Grund entlang, spüre ihren Sog, tauche auf, und wie kühle Seide, weicher Samt ist das Wasser auf meiner Haut. Warum bist du fort gegangen? Warum hast du mich verlassen, alles mitgenommen, mir nur Angst gelassen? Und ich spüre die Kraft des Wassers, weg vom Strand fliesst es, zurück in den Ozean, doch dann hebt sie mich empor, nimmt mich mit, trägt mich zurück an Land, bringt mich in Sicherheit.