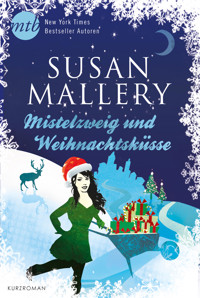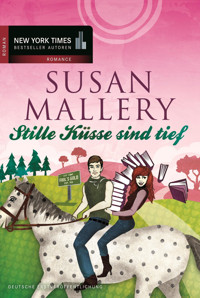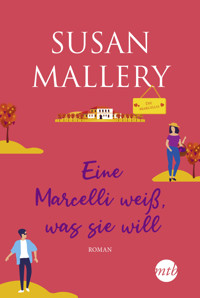8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Blackberry Island
- Sprache: Deutsch
Schon immer war Nina für andere der Fels in der Brandung. Deshalb ist die alleinstehende Arzthelferin auf Blackberry Island gestrandet und arbeitet, wo andere ausspannen - während Mutter und Schwester ihre Träume leben. Nina hat ihrer Familie zuliebe ihre große Liebe und das geplante Medizinstudium aufgegeben. Soll das wirklich alles gewesen sein? Jetzt will Nina endlich Kurs aufs eigene Glück nehmen. Aber sie muss lernen, dass man zuerst loslassen muss, um dem Herzen zu folgen …
"Ein sehr vergnüglicher und einsichtsvoller, witziger und treffender Blick auf Selbstaufopferung."
Booklist
"Susan Mallery ist ein wunderbarer, niemals kitschiger Roman über Freundschaft, Familie und Verzeihen gelungen."
Für Sie über "Wie zwei Inseln im Meer"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
HarperCollins®
Das Zitat von Christopher Marlow stammt aus dem Gedicht »Der verliebte Schäfer an seinen Schatz« in: Englische und amerikanische Dichtung in 4 Bänden (zweisprachig), Bd. 1 Englische Dichtung – Von Chaucer bis Milton, hrsg. v. Friedhelm Kemp und Werner von Koppenfels. C.H. Beck, München 2000.
Copyright © 2018 für die deutsche Ausgabe by HarperCollins in der HarperCollins Germany GmbH, Hamburg
Copyright © 2014 by Susan Macias Redmond Originaltitel: »Evening Stars« erschienen bei: MIRA Books, Toronto
Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./SARL
Covergestaltung: büropecher, Köln Coverabbildung: Phuse Photo, kai keisuke, ronstik, aleksander hunta / shutterstock Lektorat: Carla Felgentreff E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783959677646
www.harpercollins.de
Widmung
1. KAPITEL
Der Kampf zwischen Betty Boop und bunten Herzen endete mit Nina Wentworths Beschluss, dass heute ein Betty-Boop-Tag sein würde. Sie schlüpfte in den kurzärmeligen Schwesternkittel und bewegte sich bereits in Richtung Bad, bevor er über ihre Hüften gerutscht war.
»Sei nicht zu eng, sei nicht zu eng«, sang sie und kam vor dem Spiegel zum Stehen, wo sie nach ihrer Bürste griff.
Der Stoff legte sich, wie er sollte, und ließ noch ein paar Zentimeter Luft übrig. Nina seufzte erleichtert auf. Der Zwischenfall gestern Abend mit den drei Brownies und einem großzügigen Glas Rotwein hatte keinen bleibenden Eindruck auf ihren Hüften hinterlassen. Sie war froh darüber, und sie würde später auf dem Crosstrainer Buße tun. Oder zumindest schwören, nie mehr als einen Brownie auf einmal zu essen.
Zehn Sekunden bürsten, eine Minute flechten, und ihre blonden Haare sahen gepflegt und ordentlich aus. Sie flitzte hinaus in den Flur und in die Küche, wo sie sich ihren Schlüsselbund schnappte und weiter zur Hintertür eilte. Sie streckte bereits ihre Hand nach dem Knauf aus, als das Telefon klingelte.
Sie sah auf die Uhr, dann auf das Telefon. Jeder in ihrem Umfeld – Freunde, Familie, Kollegen – hatte ihre Handynummer. Es rief nur selten jemand auf dem altmodischen Festnetztelefon an, und wenn, dann waren es keine guten Neuigkeiten. Nina machte wieder kehrt und wappnete sich innerlich gegen Unheil.
»Hallo?«
»Hey, Nina. Hier ist Jerry von Zu schön, um wahr zu sein. Ich habe gerade erst aufgemacht, und ich habe hier eine Kundin, die mir eine Kiste mit Plunder, äh, mit Sachen verkaufen will. Ich glaube, die sind aus eurem Laden.«
Nina schloss die Augen und unterdrückte ein Stöhnen. »Lass mich raten: Anfang zwanzig, rote Haare mit lila Strähnen und ein seltsames Vogel-Tattoo auf dem Hals?«
»Das ist die Frau. Sie sieht mich etwas böse an. Denkst du, sie ist bewaffnet?«
»Ich hoffe nicht.«
»Ich auch.« Jerry klang nicht besonders beunruhigt. »Wie heißt sie?«
»Tanya.«
Hätte Nina mehr Zeit gehabt, wäre sie an Ort und Stelle kollabiert. Aber sie hatte einen richtigen Job und musste los. Einen Job, der in keinem Zusammenhang mit dem Desaster stand, das der familieneigene Antiquitätenverkauf war.
»Du hast zugelassen, dass deine Mutter diese Frau einstellt?«, fragte Jerry.
»Ja.«
»Du solltest es besser wissen.«
»Tu ich auch. Ich werde gleich die Polizei anrufen und sie zu dir rausschicken. Kannst du Tanya solange bei dir festhalten?«
»Na klar, mein Mädchen.«
»Super. Ich komme dann nach der Arbeit vorbei und hole die Sachen ab.«
»Ich werde sie für dich verwahren«, versprach Jerry.
»Danke.«
Nina legte den Hörer auf und lief dann hinaus zu ihrem Wagen. Sobald ihr Handy mit der Freisprechanlage verbunden war, wählte sie die Nummer der örtlichen Polizeiwache und erklärte dem Beamten, was passiert war.
»Schon wieder?«, fragte Deputy Sam Payton in belustigtem Ton. »Hat deine Mutter diese Frau eingestellt?«
Nina fuhr vorsichtig rückwärts aus der Einfahrt. Mit Jerrys Spott konnte sie umgehen. Jerry hatte sein ganzes Leben auf der Insel verbracht – er durfte sie hänseln. Aber Sam war relativ neu hier. Er hatte sich noch keine Spottrechte erworben.
»Hey, hier spricht eine Steuerzahlerin, die eine Straftat anzeigt«, sagte sie.
»Ja, ja. Ich schreibe es auf. Was hat die Frau alles mitgenommen?«
»Ich habe nicht gefragt. Sie ist gerade im Pfandhaus. Im Zu schön, um wahr zu sein.«
»Das kenne ich«, sagte Sam. »Ich fahre gleich mal rüber und schaue mir die Sache an.«
»Danke.«
Sie legte auf, bevor er ihr Tipps zu Einstellungskriterien geben konnte, und fuhr den Hügel hinauf. Der Morgenhimmel war klar – ungewöhnlich für den Frühling im Pazifischen Nordwesten. Das schöne Wetter kam normalerweise erst kurz vor dem Sommeranfang. Im Westen glitzerte blaues Wasser. Im Osten lag das Festland von Washington.
Während Nina höher und höher fuhr, wurde die Aussicht immer besser, aber als sie vor den drei Häusern im Queen-Anne-Stil hielt, auf der Spitze des Hügels, war das Letzte, was ihr in den Sinn kam, kurz innezuhalten und die spektakuläre Kombination von Himmel und Meer zu genießen.
Sie eilte die Eingangstreppe zum mittleren Haus hoch, in dem ihre Chefin wohnte und praktizierte. Dr. Andi, wie sie genannt wurde, war eine beliebte Kinderärztin auf der Insel. Besser gesagt, die einzige Kinderärztin. Sie war vor einem Jahr hierhergezogen, und ihre Praxis florierte seit der Eröffnung im September. Dr. Andi war außerdem frisch verheiratet und schwanger.
Nina schloss die Haustür auf und ging hinein. Auf ihrem Weg durch die Praxis schaltete sie das Licht ein, kontrollierte die Temperatur auf dem Thermostat und fuhr die drei Computer am Empfang hoch.
Nachdem sie ihre Tasche in ihrem Spind verstaut hatte, loggte sie sich am Computer ein, öffnete den Terminkalender und sah, dass der erste Patient für heute abgesagt hatte. Andi würde über die zusätzliche Zeit froh sein, um in die Gänge zu kommen. Sie kämpfte immer noch mit Morgenübelkeit.
Nina checkte kurz ihre E-Mails und leitete einige davon an die Buchhalterin und Office-Managerin weiter, dann ging sie in den Pausenraum, um sich einen Kaffee zu machen. Keine fünf Minuten nach ihrer Ankunft stieg sie die Treppe zu den Privaträumen ihrer Chefin hoch.
Sie klopfte einmal, bevor sie eintrat. Andi, eine große, hübsche Brünette mit Locken, saß in der Küche am Tisch, den Kopf in ihre Hände gestützt.
»Immer noch so schlimm?«, fragte Nina und ging an den Küchenschrank.
»Hi, und ja. Es ist nicht so, als müsste ich mich tatsächlich übergeben, aber ich fühle mich ständig so.« Sie hob ihren Kopf und schnupperte in der Luft. »Trinkst du Kaffee?«
»Ja.«
»Ich vermisse das Kaffeetrinken. Ich bin ein Wrack. Ich muss mal mit meinen Eltern über meine Vorfahren reden. Offenbar stamme ich nicht von einer besonders zähen Sippe ab.«
Nina nahm eine Tasse aus dem Schrank, füllte sie mit Wasser und stellte sie in die Mikrowelle. Dann holte sie einen Teebeutel aus der Speisekammer.
»Keinen Ingwertee«, sagte Andi stöhnend. »Bitte nicht. Ich hasse das Zeug.«
»Aber es hilft.«
»Lieber ist mir übel.«
Nina zog die Augenbrauen hoch.
Andi sackte auf ihrem Stuhl zusammen. »Ich bin so eine Versagerin. Sieh mich an. Ich trage ein Kind in der Größe einer Limabohne in mir und kriege jetzt schon eine Krise. Das ist peinlich.«
»Und trotzdem stellt sich das Bedürfnis, sich reif zu verhalten, offenbar nicht ein.«
Andi lächelte. »Schon komisch, wie das funktioniert.«
Die Mikrowelle klingelte. Nina tauchte den Teebeutel in das heiße Wasser und trug die Tasse zum Tisch.
Andis Wohnküche war ein offener Raum mit lackierten Einbauschränken und viel Granit. Das große Fenster, vor dem der Tisch stand, zeigte nach Osten. Das Festland schimmerte nur ein paar Meilen entfernt.
Andi hatte den Altbau aus der Jahrhundertwende gekauft, als sie nach Blackberry Island gezogen war. Unbeeindruckt von den kaputten Fenstern und den uralten Rohrleitungen, ließ sie das Haus von Grund auf sanieren. Während der Umbauphase verliebte sie sich in ihren Bauunternehmer. Was zu ihren derzeitigen Magenproblemen geführt hatte.
»Dein erster Termin hat abgesagt«, bemerkte Nina.
»Gott sei Dank.« Andi schnupperte an ihrem Tee, rümpfte die Nase und nahm dann einen Schluck. »Es ist der Ingwer. Wenn ich Tee ohne Ingwer trinken würde, könnte ich ihn besser hinunterbekommen.«
»Die Sache ist die: Ingwer ist genau der Bestandteil, der deinen Magen beruhigt.«
»Das Leben ist pervers.« Andi nahm wieder einen Schluck, dann lächelte sie. »Dein Kittel gefällt mir.«
Nina sah an sich herunter. »Betty und ich kennen uns schon ziemlich lange.«
Einer der Vorteile, wenn man für eine Kinderärztin arbeitete, war, dass eine fröhliche Aufmachung begrüßt wurde. Nina hatte eine ganze Sammlung von Kitteln mit bunten, lustigen Motiven in ihrem Schrank. Es war keine Haute Couture, aber es half, die Kinder zum Lächeln zu bringen, und allein darauf kam es an.
»Ich muss wieder runter«, sagte sie. »Dein erster Termin ist nun um halb neun.«
»Okay.«
Nina stand auf und wandte sich in Richtung Treppe.
»Hast du nach der Arbeit schon was vor?«, fragte Andi.
Nina dachte daran, dass sie im Pfandhaus vorbeischauen musste, um die Sachen abzuholen, die Tanya zu verhökern versucht hatte. Anschließend musste sie im Laden eine Bestandsaufnahme machen, um herauszufinden, ob noch mehr gestohlen worden war, und danach ihre Mutter über den Vorfall informieren und ihr endlich klarmachen, wie wichtig es war, die Referenzen von Bewerbern tatsächlich zu überprüfen. Wobei sie ihr das schon so lange predigte, wie sie zurückdenken konnte, aber die Lektionen schienen nie zu fruchten. Egal, wie oft Bonnie gelobte, sich zu bessern, es änderte sich nichts. Und Nina durfte hinterher die Scherben auflesen.
»Eigentlich schon. Warum?«
»Ich war seit einer Woche nicht mehr beim Pilates«, antwortete Andi. »Es ist wichtig, dass ich weiter Gymnastik mache. Hast du Lust, mich zu begleiten? Es macht mehr Spaß, wenn du dabei bist.«
»Heute Abend kann ich nicht, aber Montag ginge.«
Andi lächelte. »Danke, Nina. Du bist die Beste.«
»Gib mir eine Medaille, und ich glaube es.«
»Ich werde noch heute eine bestellen.«
Nina zählte die Aufkleber mit den lachenden Obst- und Gemüsemotiven. Sie reichten gerade noch, aber sie würde neue bestellen müssen.
Seit Andi ihre Praxis eröffnet hatte, lud sie regelmäßig Grundschulklassen zu einer Exkursion in ihre Sprechstunde ein. In ungezwungener Atmosphäre lernten die Kinder, wie ein Gesundheits-Check-up funktionierte, sie durften das Stethoskop benutzen und ihr Gewicht und ihre Größe messen. Andis Ziel war es, den Kindern die Angst vor einem Arztbesuch zu nehmen.
Nina kümmerte sich um die Planung und den Ablauf der Touren. Jeder Schüler erhielt zum Abschied eine kleine Wundertüte, die mit Aufklebern, einem kleinen Malheft mit verschiedenen Übungsaufgaben und einer Schachtel Buntstifte gefüllt war.
Sie war gerade dabei, die offenen Tüten auf dem Tisch im Pausenraum aufzureihen, um sie schnell befüllen zu können, als ihr Handy klingelte. Sie zog es aus ihrer Kitteltasche und sah auf das Display, dann schaltete sie den Lautsprecher ein und legte den Hörer auf den Tisch.
»Hi, Mom.«
»Schätzchen! Wie geht es dir? Uns geht es gut, aber du hattest mal wieder recht, wie üblich!«
Nina schnappte sich eine Handvoll Buntstifte aus der großen Tüte auf dem Stuhl. »Womit hatte ich recht?«
»Mit den Reifen. Dass wir vor unserer Abreise neue hätten aufziehen sollen. Gestern Abend hat es geschneit.«
Nina schaute durch das Fenster auf den sonnigen Himmel. Sie entdeckte ein paar Wolken, die sich am Horizont auftürmten. Später wird es regnen, dachte sie. »Wo seid ihr?«
2. KAPITEL
»Nina, steig endlich ein!«
Am liebsten hätte sie ihn ignoriert. Ihn komplett ausgeblendet. Aber sein Ton war hartnäckig, und der Dylan, den sie in Erinnerung hatte, war jemand, der die Dinge gerne selbst in die Hand nahm.
Sie schloss die Augen und wünschte ihn weit fort. Aber das beständige Brummen des Wagens, der neben ihr herkroch, bewies, dass ihr Wunschdenken keine große Chance hatte, sich zu erfüllen.
»Ist dir bewusst, wie lächerlich das hier ist?«, fragte Dylan laut.
Leider war es ihr bewusst. Sie wusste auch, dass sie letzten Endes einsteigen würde, weil sie die Nässe und die Kälte nicht mehr ertragen konnte. Aber warum musste es ausgerechnet Dylan sein? Warum konnte es nicht ein gut gekleideter, stiller Serienmörder sein? Andere Leute wurden erdrosselt, aber nicht sie. Nein. Sie bekam die ehemalige Liebe ihres Lebens.
»Also gut«, sagte sie schließlich und blieb stehen. Die Beifahrertür glitt sanft auf, und Nina ließ ihr nasses Ich in den Ledersitz plumpsen.
Sofort wurde sie von Neuwagengeruch und Wärme eingehüllt, die aus den Lüftungsschlitzen blies. Himmlisch, dachte sie und streifte sich ihre tropfenden Haare aus dem Gesicht. Dann wandte sie den Kopf und sah wieder in Dylans grüne Augen.
Sein Gesicht drückte eine unbehagliche Mischung aus Besorgnis und Belustigung aus. Elender Mist, fluchte sie stumm. Wann immer sie sich in den letzten zehn Jahren ein Wiedersehen vorgestellt hatte, war es ein geplantes Treffen gewesen. Sie hatte sich ausgemalt, sie würde tadellos zurechtgemacht sein und in geschmeidigen, souveränen kurzen Sätzen antworten, sodass er von ihrem Verstand beeindruckt wäre und sich ärgern würde, dass er sie hatte gehen lassen. Sie hatte ganz sicher nicht davon geträumt, ihm pudelnass und mit wund gescheuerten Oberschenkeln zu begegnen.
»Was ist passiert?«, fragte er.
Mit ihnen? Mit ihr?
»Mit deinem Wagen«, fügte er hinzu, als sie nicht antwortete.
»Ich habe keine Ahnung. Plötzlich ging der Motor aus. Ich werde in der Werkstatt anrufen, sobald ich zu Hause bin.«
»Gut, dann bringe ich dich jetzt dorthin.«
Er fragte sie gar nicht erst nach ihrer Adresse. Zweifellos hatten seine Eltern ihn über die Inselbewohner auf dem Laufenden gehalten. Hätte er gefragt, hätte sie ihm sagen müssen, dass sie immer noch bei ihrer Mutter wohnte. Nicht dass sie sich keine eigene Wohnung leisten könnte. Sie konnte schon. Es war nur so, dass es ihr wegen ihrer Mutter und dem Laden und allem anderen, was auf ihren Schultern lastete, irgendwie einfacher erschienen war, an Ort und Stelle zu bleiben.
Sie fuhren schweigend weiter. Nina rutschte unbehaglich auf ihrem Sitz herum, während ihr bewusst war, dass sie das makellose Leder volltropfte.
»Du bist also wieder zurück«, murmelte sie in das peinliche Schweigen hinein. Zumindest empfand sie es als peinlich. Sie hatte keine Ahnung, wie er es empfand.
»Hm. Ich habe vor ein paar Wochen meine Facharztausbildung abgeschlossen. Danach habe ich eine Reise durch Europa gemacht, und nun bin ich wieder hier.«
Eine Reise durch Europa? Nina dachte daran, wie sie die letzten Wochen verbracht hatte – genauso wie die letzten sieben oder acht Jahre: arbeiten, die Debakel beseitigen, die ihre Mutter anrichtete, nach dem Laden schauen. Sie hatte Freunde, mit denen sie sich traf, und vor Kurzem war sie einem Bücherclub beigetreten, aber wenn sie es genauer betrachtete, fehlte ihrem Leben jegliches Maß an Spannung.
Nicht dass es ihr wichtig wäre, Dylan Harrington zu beeindrucken.
»Du hast immer noch vor, in die Praxis deines Vaters einzusteigen?«, fragte sie, obwohl sie die Antwort bereits kannte.
»Ja.«
»Ich dachte, du würdest es dir vielleicht anders überlegen.«
»Dachte ich auch.« Er ließ ein Lächeln aufblitzen. »Aber ich wollte ihm nicht das Herz brechen.«
Weil Dylans Vater zehn Jahre darauf gewartet hatte, sagen zu können: »Mein Sohn, der Arzt.« Und seit er es endlich sagen konnte, wiederholte er es endlos. Er erzählte jedem, der ihm zuhörte, dass Dylan in seiner Praxis arbeiten würde. Nina nahm an, dass die meisten Eltern sich von ihren Kindern wünschten, in den Familienbetrieb einzusteigen. Dr. Harrington senior und junior, dachte sie, während sie sich das Praxisschild am Eingang vorstellte.
»Du hast bei ihm gekündigt«, sagte Dylan.
Sie drehte kurz den Kopf zu ihm und sah dann wieder nach vorn. »Ja.«
Bis letztes Jahr im Herbst hatte sie als Arzthelferin für Dr. Harrington gearbeitet. Hauptsächlich deshalb, weil er früher der einzige Arzt auf der Insel gewesen war und sie keine Lust gehabt hatte, zum Festland zu pendeln. Aber angesichts von Dylans potenzieller Rückkehr hatte sie sich gefragt, wie sicher ihre Stelle dann noch sein würde. Zum Glück war Andi auf die Insel gezogen und hatte ihre eigene Praxis eröffnet, was Nina den perfekten Job verschafft hatte.
»Du arbeitest gerne mit Kindern?«, fragte Dylan, der ihren Werdegang offensichtlich kannte.
»Ja. Hier auf der Insel leben genügend Familien, die uns beschäftigt halten, aber nicht so viele, dass wir überlaufen sind. Andi ist eine tolle Chefin.«
»Hast du wegen mir gekündigt?« Er hielt an der Gabelung und schaute nach links und nach rechts, bevor er abbog.
Eine unverblümte Frage, mit der sie nicht gerechnet hatte. »Mich hat die Gelegenheit mit Andi gereizt«, antwortete sie ausweichend. In Wahrheit hätte sie auch so gekündigt. Es war für sie undenkbar, Tag für Tag mit Dylan zusammenzuarbeiten. Schon seltsam. Dylan war ihr erster Freund gewesen, ihr erster Mann, ihr erster Liebeskummer. Er war attraktiv, zudem ein Arzt, und es war nur eine Frage der Zeit, bis er sich verliebte und heiratete. Nicht dass sie ihn für sich haben wollte, aber sie wollte ganz bestimmt nicht den Eindruck erwecken, dass sie hier auf der Insel versackt war, während sie sich nach ihm verzehrte.
Sie lehnte sich in ihrem Sitz zurück und seufzte. Warum hatte sie nicht besser vorausgeplant? Das hier wäre weitaus weniger peinlich, wenn sie irgendeinen reichen Kerl geheiratet hätte, vorzugsweise mit einer Jacht. Oder wenn sie nach Tibet gegangen wäre, um dort ein Waisenhaus zu eröffnen. Wenn sie etwas Bemerkenswertes und Bedeutsames getan hätte. Sie hätte wenigstens studieren und Neurochirurgin werden können. Stattdessen arbeitete sie als Arzthelferin in einer Kinderpraxis, und ihre romantische Vergangenheit war mehr als bescheiden. Sie war einmal verheiratet gewesen. Fünf Tage lang. Nicht gerade ihr stolzester Moment.
Dabei wollten Dylan und ich ursprünglich zusammen Medizin studieren, dachte sie grimmig. So hatten sie es besprochen. Sie wollten gemeinsam ihre Arztausbildung machen und danach eine Praxis eröffnen. Während Nina sich noch nicht für eine Fachrichtung entschieden hatte, wollte Dylan in die Notfallmedizin.
Aber dann war ihre Beziehung in die Brüche gegangen, und für Nina war es doch unmöglich geworden, das Geld aufzubringen, um ihren Traumberuf zu verwirklichen. Während sie sich um ihre Mutter und ihre Schwester und den Laden und um alles andere gekümmert hatte, war sie vom Weg abgekommen. Die Ausbildung zur Arzthelferin war ihr sehr viel praktischer erschienen, weil die Schule nur zwei Jahre dauerte. Sie konnte sich nicht daran erinnern, dass sie die Entscheidung getroffen hatte – irgendwie war das Leben einfach passiert.
Dylan bog in die Einfahrt ihres Hauses. Der Regen trommelte immer noch laut auf die Windschutzscheibe, und Nina freute sich nicht gerade auf den kurzen Spurt zur Haustür. Nicht wenn ihre nasse Kleidung an jedem Speckröllchen klebte und Dylan ihr dabei zusah. Genauso unglücklich war, dass man aus dieser Entfernung erkennen konnte, in was für einem schlechten Zustand das Haus war. In den letzten zehn Jahren war nichts daran gemacht worden. Es benötigte einen neuen Anstrich und ein neues Dach. Nina hatte sich beides vorgenommen, aber ein schlimmer Rohrbruch im letzten Oktober hatte fast ihre ganzen Ersparnisse verschlungen.
»Danke fürs Mitnehmen«, sagte sie zu Dylan und schenkte ihm ein Lächeln, das hoffentlich freundlich und selbstbewusst wirkte. »Das war ein tolles Timing. Der Marsch nach Hause wäre sehr lange und sehr hässlich geworden. Tut mir leid, dass ich deinen Ledersitz nass gemacht habe.«
»Der hält das schon aus. Na komm, schaffen wir dich ins Trockene.«
Bevor sie etwas erwidern konnte, stieg er aus und ging um den Wagen herum. Was? Er wollte sie hineinbegleiten?
Sie kletterte rasch aus dem BMW und stellte sich vor Dylan. »Lass gut sein. Du brauchst nicht mit reinzukommen. Wirklich nicht. Du kannst ruhig weiterfahren. Du hast mir eine lange Tour durch den Regen erspart. Das sollte für heute reichen.«
Er schenkte ihr ein lässiges Lächeln und legte seine Hand in ihr Kreuz. »Für jemanden, der vollkommen durchnässt und durchgefroren ist, argumentierst du ziemlich viel.«
Er geleitete sie zur Haustür, und Nina schloss auf. Sie ging hinein und streifte in der Diele ihre vollgesogenen Schuhe ab. Dylan marschierte an ihr vorbei. Sie stellte ihre Tasche auf den Fliesenboden und zog auch ihre nassen Socken aus, bevor sie barfuß ins Wohnzimmer ging.
Ihr wurden mehrere Dinge auf einmal bewusst. Erstens sah die fleckige Decke in der Ecke verdächtig feucht aus. Während sie dorthin schaute, löste sich ein einzelner Tropfen und fiel auf den Teppich. Was bedeutete, dass ihre Mutter den Handwerker nicht verständigt hatte. Tim, ihr Fachmann für alle Reparaturen, war im Notfall immer rechtzeitig zur Stelle. Wenn das Dach nach wie vor undicht war, hatte man ihm also nicht gesagt, dass er dringend gebraucht wurde.
Als Zweites wurde Nina bewusst, dass sie sich nicht erinnern konnte, wann das letzte Mal ein Mann ihr Haus betreten hatte. Also ein privater Besucher, kein Handwerker. Dylan wirkte groß und maskulin. Und ziemlich fehl am Platz in einem Zimmer mit zu vielen Möbeln und »Kostbarkeiten« aus dem Laden. Jede Ecke, jedes Regal und jede Oberfläche waren vollgestellt mit kleinen Porzellanfiguren, Kästchen aus Holz oder Glas, Bilderrahmen und Vasen, deren Verkauf ihre Mutter nicht übers Herz brachte. Nach Bonnies Auffassung waren manche Objekte dazu bestimmt, mit der Welt geteilt zu werden, und andere dazu, in der Familie zu bleiben.
Und drittens, vielleicht die beunruhigendste Erkenntnis, wurde ihr durch Dylans Anwesenheit in ihrem Wohnzimmer überhaupt erst bewusst, wie abgenutzt die Einrichtung inzwischen aussah.
Das Sofa war alt und verschlissen, die durchgesessenen Polster waren eingedellt. Der Couchtisch trug zahlreiche Kratzer und Kerben. Die Lampenschirme hatten sich von Cremeweiß in ein schmutziges Gelb verfärbt.
Nina starrte auf die Möbel, als hätte sie sie noch nie zuvor gesehen, schockiert darüber, dass sie irgendwann aufgehört hatte, ihre Umgebung richtig wahrzunehmen. Für einen Moment kam ihr die Erkenntnis, dass ihre Hoffnungen und Träume dieselbe Art von Vernachlässigung erlitten hatten, dass sie infolge von Unaufmerksamkeit unsichtbar geworden waren. Ein Gefühl der Trauer durchströmte sie – der Verlust war so schmerzhaft, dass sie fast aufkeuchte.
»Ich warte hier, während du dich umziehst«, sagte Dylan und steuerte einen Sessel an, als habe er vor, eine Weile zu bleiben.
Sie blinzelte ihn an. Warum tat er das? Dann spürte sie die klamme Kälte ihrer nassen Kleider und die Wassertropfen, die von ihren Haaren über ihren Rücken rannen.
»Sicher«, erwiderte sie und eilte dann aus dem Zimmer, während der nasse Baumwollstoff schmerzhaft auf ihrer Haut scheuerte.
Zehn Minuten später trug sie eine trockene Jeans und ein Sweatshirt. Sie hatte mit ihren Haaren getan, was auf die Schnelle möglich war, und sie zuerst mit einem Handtuch trocken gerieben, dann durchgekämmt. Sie hatte nicht vor, sie zu föhnen. Das würde nämlich implizieren … Sie wusste nicht genau, was, aber so oder so würde sie sich die Mühe sparen. Sie schob ihre Füße in flache Ballerinas und ging dann zurück ins Wohnzimmer.
Dylan saß noch genau dort, wo sie ihn zurückgelassen hatte. Er stand auf, als sie den Raum betrat. »Besser?«
»Viel besser.« Sie schob die Hände in ihre Hosentaschen. »Du hättest nicht bleiben müssen.«
»Ich dachte, wir könnten ein bisschen plaudern. Wir haben uns lange nicht gesehen.«
Einfache Worte, die sie aufrichtig verwirrten. Die naheliegende Frage war: Warum? Warum wollte er mit ihr plaudern? Sie hatten seit Ewigkeiten keinen Kontakt mehr gehabt, und abgesehen davon, dass sie beide auf der Insel lebten, hatten sie nichts gemeinsam. Nicht mehr. Vielleicht noch nie.
Wenn er nur nicht so groß wäre, dachte sie, während sie ihn in Richtung Küche winkte. Auf der Highschool war Dylan das gewesen, was ihre Mutter einen Träumer genannt hatte. Nun war er erfolgreich, höflich und immer noch gut aussehend. Seine grünen Augen und das markante Kinn, ganz zu schweigen von seinen breiten Schultern, garantierten ihm wahrscheinlich eine ständige Schar von Verehrerinnen. Nina fragte sich, warum er keine davon geheiratet hatte.
Mitten in der Küche blieb sie stehen. Sie würde sich unter keinen Umständen für den abgewetzten Linoleumboden oder die uralten Küchenschränke schämen. Für heute hatte sie genügend Demütigungen erfahren.
»Wein?«, fragte sie und steuerte auf den kleinen Ständer auf der Anrichte zu. Sie nahm eine Flasche Rotwein heraus, bevor er antworten konnte. »Ich kann dir auch einen Kaffee machen.«
»Wein klingt gut.«
Sie holte den Korkenzieher aus der Schublade, aber bevor sie mehr tun konnte, als nach der Flasche zu greifen, war Dylan plötzlich an ihrer Seite.
»Du erlaubst.«
Ein echter Gentleman, dachte sie, nicht sicher, ob sie beeindruckt war oder verärgert. Seine Mutter musste furchtbar stolz auf ihn sein.
Er entkorkte die Flasche mit deutlich weniger Anstrengung, als sie gewöhnlich dafür benötigte, dann füllte er zwei Gläser. Ihr kam in den Sinn, dass sie in Zukunft Knabberzeug bereithalten sollte, damit sie Gästen etwas anbieten konnte. Sie hatte noch ein paar Brownies übrig, aber die würde sie nicht teilen. Der Wein musste reichen.
Sie ging mit ihrem Glas voraus ins Wohnzimmer und nahm eine Ecke des Sofas in Beschlag. Sie streifte ihre Schuhe ab und zog die Beine unter sich. Dylan setzte sich in den Sessel gegenüber und erhob sein Glas.
»Auf alte Freunde.«
Sie zog ihre Augenbrauen hoch. »Ich nehme an, das bezieht sich auf Freunde, die du lange nicht gesehen hast, und nicht auf ihr Alter.«
Er grinste. »Genau.« Er trank einen Schluck Wein. »Netter Tropfen.«
»Danke.«
»Also, wie stehen die Dinge?«
Nina dachte an Tanya und den Ladendiebstahl, an das undichte Dach und dass sie noch Mike anrufen musste, um ihren Wagen abschleppen zu lassen. »Bestens.«
»Ich habe gehört, deine Schwester ist weggezogen.«
»Averil lebt in Mischief Bay. Das ist in Kalifornien, südlich von Santa Monica.«
»Richtig. Geht sie aufs College?«
Nina lächelte. »Sie hat schon längst fertig studiert, Dylan. Sie ist verheiratet und schreibt für die Zeitschrift Californian Girl.«
Eine Augenbraue wanderte hoch. »Verheiratet? Die kleine Averil? Ich kann es nicht glauben.«
»Ich weiß, aber so ist es.«
»Kinder?«
»Noch nicht.« Nina sah ihn über ihr Glas hinweg an. »Du hast nicht geheiratet.«
»War das eine Frage oder eine Feststellung?«
»Eine Feststellung.« Sie schenkte ihm ein aufrichtiges Lächeln. »Hast du vergessen, wo wir hier sind? Diese Insel ist die Definition von einem Dorf. Natürlich weiß ich alles über dich.«
Er verzog das Gesicht. »Ich hoffe, nicht alles.«
Wahrscheinlich nicht, dachte sie. Aber es hatte einmal eine Zeit gegeben, in der sie die Hüterin seiner Geheimnisse gewesen war und – theoretisch – seines Herzens.
Sie war fünfzehn gewesen, als sie sich in Dylan verliebt hatte. Sie war noch zur Highschool gegangen. Dylan war zwei Klassen über ihr gewesen. Sie hatte versucht, ihre Schwärmerei zu verbergen, aber einfach nicht wegschauen können, wann immer er in ihrer Nähe gewesen war. Eines Tages, in der Mittagspause, hatte er sie angesprochen.
»Wann hast du Geburtstag?«, hatte er sie gefragt.
»In drei Wochen.«
Um seine grünen Augen hatten sich Lachfältchen gebildet. »Dann wirst du sechzehn?«
»Hm.«
»Ich werde warten.«
»Weil fünfzehn zu jung ist?«, hatte sie erwidert. »Dir ist schon bewusst, dass ich mich in den nächsten drei Wochen nicht verändern werde? Ich werde genau dieselbe sein, die ich jetzt bin.«
Er hatte die Achseln gezuckt. »Ich warte.«
Das hatte er auch getan. Und an ihrem sechzehnten Geburtstag führte er sie aus. Und er küsste sie, wie noch keiner zuvor sie geküsst hatte.
Vor Dylan hatte sie mit ein paar anderen Jungs auf Partys herumgemacht. Linkische, alberne Knutschspiele, die benutzt wurden, um die Unbeholfenheit der Pubertierenden zu verbergen. Diese Küsse waren unbedeutend gewesen. Dylans Küsse dagegen hatten ihre Welt auf den Kopf gestellt.
Von jenem Tag an waren sie ein Paar gewesen. Daran hatte sich auch nichts geändert, als Dylan nach der Highschool aufs College gegangen war. Erst ein paar Monate, nachdem sie selbst mit der Highschool fertig gewesen war, hatten die Probleme begonnen.
»Wann fängst du in der Praxis an?«, fragte sie, während ihr Verstand in die Gegenwart zurückkehrte. Eine höfliche Frage zu einem unverfänglichen Thema.
»Montag.«
»Bist du schon aufgeregt?«
Seine Augenbrauen wanderten wieder nach oben. »Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich als aufgeregt beschreiben würde.«
»Dein Vater ist es bestimmt.«
Denn Dr. Harrington senior wünschte sich nichts mehr, als dass sein Sohn mit ihm zusammen praktizierte. Er hatte schon davon gesprochen, bevor Dylan auf der Welt gewesen war. Jedenfalls lautete so die Überlieferung der Familie Harrington.
»Ich weiß. Das sagt er mir ständig.« Dylan nippte an seinem Wein. »Er hat bereits neue Visitenkarten drucken lassen.«
Etwas an seinem Ton machte Nina stutzig. »Wolltest du gar nicht zurückkommen?«
»Doch, schon.«
Sie musterte ihn, unsicher, ob sie ihm glauben sollte. »Du fühlst dich verpflichtet. Das ist ein Unterschied.«
Dylan ließ seinen Blick durch das Wohnzimmer schweifen. »Wo ist deine Mutter?«
»In Montana, auf einer Shoppingtour.«
Seine Mundwinkel bogen sich nach oben. »Ich erinnere mich an ihre Begeisterung für die Schätze, die sie auf ihren Touren entdeckt hat.«
»Es macht ihr in der Tat Spaß, die Sachen von anderen Leuten zu durchstöbern.«
»Sie führt ein Antiquitätengeschäft.«
Eine gehobene Bezeichnung für das Rar & Selten, aber ihre Mutter hätte ihre Freude daran.
»Sie schleppt inzwischen weniger Plunder an«, gab Nina zu. »Bertie hilft ihr. Sie hat ein gutes Auge für Schnäppchen.«
»Wer ist Bertie?«
Nina hob ihr Kinn. »Die Lebenspartnerin meiner Mutter.«
Dylans Miene änderte sich nicht. »Ich glaube, meine Eltern haben so was mal erwähnt. Ich bin beeindruckt. Wann hatte deine Mutter ihr Coming-out?«
Nina hatte auf ein bisschen mehr Reaktion gehofft. Auf etwas, das ihr half, ihn unsympathisch zu finden. Seine Akzeptanz war enttäuschend. »Vor zehn Jahren. Bertie kam uns oft besuchen. Averil und ich dachten, sie wäre eine ganz normale Freundin von Mom. Dann fing Bertie an, bei uns zu übernachten. Eines Tages nahm sie mich zur Seite und erklärte mir, dass sie gerne bei uns einziehen würde. Sie wollte wissen, ob das für mich okay sei.« Nina lächelte bei der Erinnerung. »Ich habe Bertie richtig gern. Sie ist sehr beständig.«
»Das bedeutet, du musst nicht mehr die einzige Erwachsene im Haus sein?«
Sie nickte. Dylan wusste Bescheid. Er hatte damals gesehen, was sie mitmachte. Manchmal fragte sie sich, ob er ihre Beziehung auch wegen ihrer schwierigen Familie beendet hatte.
»Es hilft auf jeden Fall.« Sie verlagerte ihr Gewicht auf dem Sofa. »Genug von mir. Was ist mit dir? Wohnst du wieder bei deinen Eltern?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich war vor ein paar Monaten hier und habe mir eine Wohnung am Jachthafen angesehen. Letzte Woche habe ich den Kaufvertrag unterschrieben. Ich werde in den nächsten Tagen einziehen.«
Er sprach über den Umzug, aber Nina hörte nicht zu. Eine Wohnung am Jachthafen? Bestimmt eines dieser schicken neuen Lofts. Mit Granittheken und einem 24-Stunden-Portier.
Albern, dachte sie, während ihr Blick auf den braunen Zottelteppich fiel, der schon mindestens fünfzehn Jahre alt war. Dies hier war Blackberry Island. Der UPS-Bote legte die Pakete einfach auf die Veranda.
Ihr war bewusst, dass Dylan sehr gepflegt war und gut roch. Er sah noch besser aus als früher. Dylan war damals fortgegangen und hatte seine Träume verfolgt, und nun war er ein erfolgreicher, glücklicher Arzt. Sie dagegen steckte in ihrem alten Trott fest und konnte beim besten Willen nicht sagen, wie das genau passiert war. Wie hatten zehn Jahre vergehen können? Warum hatte sie nie versucht, auszubrechen? Lag es an den Umständen, oder war sie selbst dafür verantwortlich? Sie hatte das ungute Gefühl, dass Letzteres zutraf.
»Es ist spät«, sagte sie abrupt und stand auf.
Dylan wirkte für einen Augenblick überrascht, dann stellte er sein Weinglas ab und erhob sich ebenfalls. »Sicher. Es war schön, dich wiederzusehen, Nina.«
»Fand ich auch. Danke, dass du mich nach Hause gebracht hast. Ich weiß das sehr zu schätzen.«
»Kein Problem.«
Sie begleitete ihn zur Tür, murmelte ein angemessen höfliches Auf Wiedersehen und schloss dann die Tür hinter ihm. Sie kehrte allein ins Wohnzimmer zurück und ließ sich in das Sofapolster sinken. Mein Leben ist eine Katastrophe, dachte sie bitter. Oder wenn schon keine Katastrophe, dann zumindest bemitleidenswert, was womöglich noch schlimmer war.
3. KAPITEL
Die Kunst, den perfekten ersten Kuss zu erleben. Averil Stanton zögerte und dachte über die Überschrift nach, dann schüttelte sie den Kopf. Auf keinen Fall. Die Californian Girl richtete sich an Mädchen und junge Frauen zwischen dreizehn und fünfundzwanzig Jahren. Das Thema »erster Kuss« war zu beschränkt.
Sie starrte weiter auf den Bildschirm, dann nahm sie den nächsten Anlauf. Jeder erste Kuss ist anders. Schon besser, dachte sie. Denn es gab immer wieder neue erste Küsse. Zumindest für die jungen Frauen und Mädchen. Sobald man verheiratet war, standen die Chancen für einen neuen ersten Kuss schlecht. Genau wie die Chancen für irgendetwas Neues überhaupt. Aber das würde sie ihren Leserinnen nicht auf die Nase binden. Sie waren jung und hoffnungsvoll, wozu sie deprimieren?
Sie machte eine Pause und nippte an ihrem Tee. Nicht dass ich unglücklich verheiratet wäre, dachte sie. Kevin war ein toller Ehemann, und sie liebte ihr gemeinsames Leben. Sie wohnten sechs Gehminuten vom Pazifischen Ozean entfernt, in Mischief Bay, einem bunt gemischten südkalifornischen Strandort. Sie hatte hier ihre Arbeit und ihre Freunde und …
»Hör auf!«, sagte sie laut, dann knallte sie den Laptopdeckel zu und stand auf. Sie ging zum Fenster und starrte hinaus auf die seitliche Grundstücksgrenze, wo es nicht viel mehr zu sehen gab als den Nachbarszaun und die Recyclingtonne, aber offenbar war selbst das faszinierender als ihre Arbeit.
Ich kann mich nicht konzentrieren, dachte sie grimmig. Kann nicht schreiben. Was auch die Ursache dafür war, es passierte immer öfter. In den letzten paar Monaten hatte sie ihre Artikel immer knapper und knapper vor Redaktionsschluss eingereicht. Ihre Chefin hatte nichts gesagt, aber Averil wusste, dass das nur eine Frage der Zeit war. Digitale Inhalte mussten regelmäßig produziert werden, und wenn sie nicht einen Zahn zulegte, standen hundert jüngere Anwärterinnen parat, um ihren Platz einzunehmen. Die gedruckte Ausgabe der Zeitschrift erschien nur einmal im Monat, aber die Online-Präsenz wurde täglich aktualisiert.
Sie ging zu dem abgewetzten Sessel in der Ecke und ließ sich in das eingedrückte Polster plumpsen. Vielleicht sollte sie mal zum Arzt gehen. Eine Vitaminkur könnte helfen. Oder Hypnose. In letzter Zeit fühlte sich nichts richtig an. Sie war fahrig und konnte nicht sagen, warum. Unruhig ohne einen Grund.
Sie sah wieder aus dem Fenster. Vielleicht würde Bewegung ihre Unruhe vertreiben. Sie war bereits heute Morgen gelaufen, aber eine Runde am Strand würde ihr vielleicht einen klaren Kopf verschaffen. Oder sie könnte ins Einkaufszentrum gehen und …
»Averil?«
Sie drehte sich um und sah, dass Kevin im Türrahmen ihres kleinen Arbeitszimmers stand. Nach dem Abendessen hatte sie sich mit der Begründung, dass sie arbeiten müsse, entschuldigt. Das tat sie immer häufiger, wurde ihr bewusst. Sie zog sich in ihre Privatsphäre zurück, nur um festzustellen, dass sie sich trotzdem nicht konzentrieren konnte, nicht nachdenken, dass sie gar nichts tun konnte.
Sie sah, dass sein Gesicht angespannt wirkte, und rappelte sich aus dem Sessel hoch. »Ist alles okay?«
»Ich hatte die Idee, unsere Küchenmesser zu schärfen.«
Ihr Blick fiel auf seine linke Hand, deren Mittelfinger frisch bandagiert war. »Ist der Schnitt sehr tief?«
»Nein. Die Wunde ist nicht weiter schlimm. Aber als ich nach dem Verbandsmaterial gesucht habe, habe ich noch etwas anderes gefunden.« Er machte einen Schritt hinein in ihr Arbeitszimmer und hielt eine kleine runde Plastikdose hoch. »Averil, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir ein Baby haben wollen. Warum nimmst du weiterhin die Pille?«
Averil spürte, dass ihre Wangen schlagartig heiß wurden, während sie sich instinktiv nach einem Versteck umsah. Beziehungsweise nach einem Fluchtweg. Aber da Kevin zwischen ihr und der Tür stand und sie nicht bereit war, aus dem Fenster zu springen, saß sie in der Falle.
»Es ist nicht so, wie du denkst«, sagte sie laut, obwohl es genau so war. »Ein Baby zu bekommen ist eine schwerwiegende Entscheidung. Du kannst nicht von mir erwarten, dass ich mich einfach so von dir schwängern lasse. Das ist nicht fair, beziehungsweise nicht vernünftig.«
Sie versuchte vergeblich, die Worte aufzuhalten, weil sie wusste, dass sie sich als Bumerang erweisen konnten. Kevin war nämlich absolut fair. Sie hatten über ein Kind gesprochen … unzählige Male. Über viele Wochen hinweg. Sie hatten Pro- und Contra-Listen erstellt und waren gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass es Zeit war, eine Familie zu gründen. Nur dass sie offenbar nicht in der Lage war, die Pille abzusetzen. Jeden Morgen sagte sie sich, dass sie bereit war für ein Kind, und jeden Morgen schluckte sie gewissenhaft die nächste kleine Pille.
»Du verhütest immer noch.«
Es war eine Feststellung, aber sie nickte trotzdem. Sie machte sich auf eine Auseinandersetzung gefasst, aber statt fortzufahren, drehte Kevin sich um und ging.
Sie stand in ihrem Arbeitszimmer und versuchte, ihre Atmung zu beruhigen, während sie sich fragte, was nun passieren würde. Schließlich ging sie hinaus in den kleinen Flur und zu dem anderen Zimmer, das Kevin als Arbeitszimmer benutzte.
Er saß an seinem Schreibtisch, die Pillenbox lag neben seiner Tastatur. Er tippte nicht, aber er sah Averil auch nicht an.
Sie hatte Kevin vor sechs Jahren kennengelernt. Damals war sie in ihrem letzten Studienjahr gewesen, Hauptfach Journalismus. Sie sollte über ein Straßenfest in Mischief Bay berichten. Nicht ihr übliches Einsatzgebiet. Als Außenreporterin der Studentenzeitung war sie eigentlich für knallharte Geschichten über kriminelle Machenschaften oder Vertuschungsaktionen zuständig. Aber einer der Nachwuchsreporter hatte blaugemacht, und sie hatte sich bereit erklärt, kurzfristig einzuspringen.
Aufgrund ihres Aussehens war sie viel männliche Aufmerksamkeit gewohnt. Groß, schlank und blond, wie sie war, entsprach sie praktisch einer einheimischen Spezies an einem kalifornischen Strand. Sie hatte sich auf dem Straßenfest Stichworte notiert und Fotos gemacht, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde.
Er war irgendwie süß, ungefähr so groß wie sie, sehr schlank, mit dem ernsthaften Ausdruck eines Menschen, der mehr Intelligenz besaß als der durchschnittliche Mann auf der Straße. Er streckte ihr ihre Kameratasche entgegen und sagte: »Die hast du dort hinten auf der Bank vergessen.«
Sie lächelte ihn an und bedankte sich, dann fragte sie in neckischem Ton: »Ist das ein Versuch, mit mir zu flirten?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, aber ich würde dir empfehlen, bei diesen Lichtverhältnissen nicht den Autofokus zu verwenden. Er lässt zu viel Licht durch, und deine Aufnahmen verlieren an Schärfe.«
Eine ungewöhnliche Antwort. Averil musterte sein Gesicht genauer, nahm die goldenen Sprenkel in seinen braunen Augen und die Form seiner Lippen wahr. Sein Teint hatte nicht die tiefe Bräune eines Surfers – was sie nicht überraschte. Bestimmt ein Ingenieur, dachte sie. Oder ein Informatiker.
»Du stehst aber schon auf Frauen, oder?«, fragte sie ihn.
Er antwortete mit einem Lächeln. Mit einem trägen, verführerischen Lächeln, bei dem sich ihre Zehen in ihren Sneakers krümmten und der Lärm um sie herum in den Hintergrund trat.
»Ich werde fotografieren«, sagte er dann und griff nach ihrer Kamera. »Du machst dir Notizen.«
»Ich berichte für die Daily Bruin.« Sie unterbrach sich kurz. »Das ist die Studentenzeitung der UCLA.«
»Ich weiß.«
»Du hast das College schon hinter dir?«
»Jep. Hab gerade in einer Software-Firma angefangen, hier in Mischief Bay.« Er legte sich den Trageriemen um den Hals und begann, Einstellungen an der Kamera vorzunehmen. »Ich habe am MIT studiert.«
Ein heller Kopf, ein tolles Lächeln und ein fester Job. Die Dinge sahen gleich viel besser aus. »Ich bin Averil«, sagte sie.
»Kevin.«
Er baggerte sie nicht an, aber er ging mit ihr aus. Es brauchte drei Dates, bevor er sie küsste, und fast vier Monate, bevor sie miteinander schliefen. Einen Tag nach ihrem College-Abschluss machte er ihr einen Heiratsantrag. Sie sagte Ja zu Kevin und Ja zu einer Vollzeitstelle bei der Californian Girl.
»Wegen der Pille«, sagte sie nun und betrat sein Zimmer.
»Du hast gesagt, du wärst bereit. Du hast gesagt, du wünschst dir Kinder. Hast du deine Meinung geändert?«
»Nein. Es ist nur so …« Sie machte einen Schritt vorwärts. »Im Moment ist ziemlich viel los.«
»Was ist im Moment schon mehr los als sonst? Wir haben uns im Haus eingelebt, wir haben Geld auf der Bank. Du hast deinen Job und deinen Roman. Worauf wartest du?«
Sie wünschte, sie hätte den Roman nie erwähnt. Den Roman, den sie schreiben wollte. Den Roman, der aus nicht viel mehr als ein paar Notizen und hundertsiebenundvierzig falschen Anfängen bestand. Zu erklären, dass man einen Roman schreiben würde, war einfach. Ihn tatsächlich zu schreiben weniger.
»Ich fühle mich unter Druck gesetzt«, sagte sie und hörte die Abwehr in ihrer Stimme. »Es ist noch so früh.«
»Wir feiern in ein paar Monaten unseren fünften Hochzeitstag. Es war nicht gerade eine Mussehe.«
»Nein, aber …«
Er sah sie nun an, und in seine braunen Augen trat ein Ausdruck, der nur Enttäuschung sein konnte. Er starrte sie an, als hätte sie ihm das Herz aus dem Leib geschnitten.
»Kevin, nein«, wisperte sie, während sie langsam auf ihn zuging. »Ich bin …«
»Du bist was?«
»Es tut mir leid.«
»Nina hat dir empfohlen, zu warten, nicht wahr?«
Averil unterdrückte das überwältigende Bedürfnis, mit dem Fuß aufzustampfen. »Du schiebst immer alles auf Nina. Warum hasst du meine Schwester?«
»Du weißt, dass ich Nina sehr gernhabe. Ich erwähne sie nur, weil sie immer bei uns ist.«
»Das ist lächerlich. Sie ist fast zweitausend Kilometer weit weg.«
»Nein, ist sie nicht. Sie ist die Stimme in deinem Kopf. Du telefonierst täglich mit ihr, bis ihr euch verkracht, und dann beschwerst du dich täglich über sie, bis ihr euch wieder versöhnt. Ihre Meinung ist diejenige, auf die du am meisten Wert legst.« Er richtete seinen Blick wieder auf seinen Bildschirm. »Es sind nie wir beide allein, die eine Entscheidung treffen. Es sind immer wir drei.«
Am liebsten hätte sie erwidert, dass er unrecht hatte, aber das hatte er nicht. Ihr letzter Krach mit Nina war ungefähr drei Wochen her, und seitdem herrschte Funkstille zwischen ihnen. Schon komisch – Averil konnte sich nicht einmal mehr erinnern, worüber sie sich in die Haare gekriegt hatten.
Sie sah Kevin an. Sie konnte seinen Kummer spüren. Er wollte mehr, und sosehr sie es ihm auch geben wollte, sie konnte nicht. Das Problem mit Kevin war, dass er sie für fähiger hielt, als sie es jemals sein würde. Aber wie sollte sie dem Mann ihres Lebens erklären, dass er nicht so viel von ihr erwarten durfte?
»Ich brauche mehr Zeit«, erklärte sie ihm. »Bitte, hör auf, mich unter Druck zu setzen.«
Sie wartete und rechnete damit, dass er ihr sagte, dass er nicht gerade brutale Gewalt anwendete, wenn er sie bat, ihr Wort zu halten, aber er nickte nur.
»Ich liebe dich«, flüsterte sie.
Er sah sie wieder an. »Manchmal bin ich mir da nicht so sicher.«
Am nächsten Morgen wachte Nina ohne Wecker auf. Einer der Vorteile eines Samstagmorgens. Sie hatte eine unruhige Nacht verbracht. Den Brownies, die nach ihr riefen, hatte sie widerstanden, aber dafür dem Wein nachgegeben. Schlimmer noch, sie hatte immer wieder von Dylan geträumt. Wahrscheinlich eine Folge davon, dass sie ihm wiederbegegnet war und sich danach The Day After Tomorrow angesehen hatte.
Sie nahm an, dass die meisten Frauen, die an einen alten Trennungsschmerz erinnert wurden, eher zu einer klassischen Liebeskomödie greifen würden beziehungsweise zu einem Film, der sie zum Weinen brachte. Nina hätte das auch getan, wenn Dylan damals nicht direkt, nachdem sie sich zusammen The Day After Tomorrow angesehen hatten, mit ihr Schluss gemacht hätte. Während sie sich über die Erderwärmung empörte, hatte er ihr eröffnet, dass er an den Wochenenden nicht mehr nach Blackberry Island kommen würde.
Seitdem verband ihr Gedächtnis die Szenen im Eis und im Schnee fest mit ihrem Kummer darüber, den einzigen Mann verloren zu haben, den sie jemals geliebt hatte. In ihrem Pathos hatte sie beobachtet, dass das Ausmaß des Sturms mit dem Ausmaß der Leere in ihrem Herzen übereinstimmte. Dylan hatte so viel von ihrer Welt ausgefüllt, und dann war er auf einmal fort gewesen.
Und nun war er nach all den Jahren zurückgekehrt. Nicht dass das für mich ein Problem wäre, sagte sie sich, während sie sich aufsetzte und sich streckte. Es war ja nicht so, als hätte er sie gesucht. Ihre Begegnung war rein zufällig gewesen. Selbst auf einer so kleinen Insel wie dieser war es unwahrscheinlich, dass er ihr öfter über den Weg lief.
Das ist auch besser so, dachte sie und kletterte aus dem Bett. Sie würde einfach …
»Mist. Mein Auto!«
Sie hatte vergessen, Mike anzurufen. Hatte vergessen, ihn zu bitten, dass er ihren Wagen abschleppte und in seiner Werkstatt wieder flottmachte. Und das alles nur, weil sie von einem attraktiven Mann aus ihrer Vergangenheit abgelenkt gewesen war. Dylan hatte einiges zu verantworten.
Sie warf einen Blick auf die Uhr und sah, dass es kurz vor halb neun war. Mikes Werkstatt hatte seit einer Stunde geöffnet. Samstags hatte er immer viel zu tun, und Nina war sich ziemlich sicher, dass der verbeulte Pick-up, den er als Ersatzfahrzeug bereitstellte, bereits an jemand anderen vergeben sein würde.
Sie ging in die Küche und schnappte sich das Telefon. Mikes Visitenkarte war eine von einem Dutzend am Kühlschrank, festgehalten von kitschigen Magneten, die für die Touristen entworfen worden waren. Nicht verwunderlich, dass Ninas Mutter diese Magneten sammelte.
Mike hob beim dritten Klingeln ab. »Was gibt’s?«
»Hier ist Nina Wentworth.«
»Hey, hör zu, ich bin zwar gut, aber so gut auch wieder nicht. Ich kümmere mich noch heute darum. Ich tippe auf das Einspritzventil, aber das ist nur eine Vermutung. Ich muss es mir erst genauer anschauen.«
Nina zwinkerte mehrmals. »Wie bitte?«
»Dein Wagen. Deswegen rufst du doch an, richtig? Oder willst du mir irgendein verdammtes Zeitschriften-Abo andrehen?«
»Was? Nein.« Sie ging zum Küchentisch und setzte sich. »Mein Wagen ist bei dir in der Werkstatt?«
»Klar. Gestern kurz vor Feierabend hat jemand Bescheid gesagt, dass ich ihn abschleppen soll. Ich habe Benny mit dem Ersatzwagen zu dir geschickt. Willst du mir erzählen, dass du nichts davon weißt?«
Nina stand auf und ging hinüber ins Wohnzimmer. Als sie aus dem Vorderfenster schaute, sah sie den verbeulten Pick-up in ihrer Einfahrt.
Dylan, dachte sie und konnte nicht glauben, dass er sich die Mühe gemacht hatte. Aber es gab keine andere Erklärung.
»Ich, äh … danke, Mike«, sagte sie. »Tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Gib mir Bescheid, wenn mein Wagen fertig ist, dann komme ich ihn abholen.«
»Sicher. Wahrscheinlich Montag. Du kannst in deiner Mittagspause vorbeikommen.«
»Klingt super.«
Sie legte auf, mehr als nur ein bisschen verwirrt über den Verlauf der Dinge. Sie sah wieder aus dem Fenster. Jep, da stand er. Der Ersatzwagen.
Sie legte den Hörer weg und ging zurück in ihr Zimmer. Sie hatte eine ellenlange Liste von Dingen, die sie heute erledigen musste, und auf der stand nichts davon, sich über einen Exfreund den Kopf zu zerbrechen. Dylan war freundlich gewesen. Das sprach für seinen Charakter. Der Umstand, dass sie nicht wollte, dass er freundlich war, war ihr eigenes Problem.
Um halb zehn kam Nina im Laden an. Da heute Samstag war, hängte sie das Geöffnet-Schild an die Tür – nicht dass sie viele Kunden erwartete. Für Touristen war es noch zu früh, und die Einheimischen neigten nicht dazu, am Wochenende in den Läden zu stöbern. Sie drückte auf den Lichtschalter neben der Tür, dann ging sie durch schmale Passagen nach hinten zum Büro. Dort verstaute sie ihre Tasche in einer Schreibtischschublade, drehte die Heizung auf und kochte eine Kanne Kaffee.
In der Theorie sollte der Warenbestand im Computer erfasst sein. In der Realität wanderte mehr als die Hälfte davon in den Laden und wieder hinaus, ohne jemals verbucht zu werden. Bonnie bezahlte auf ihren Einkaufstouren in bar und erhielt hauptsächlich handgeschriebene Quittungen. Nina wusste, dass sie das Problem eines Tages angehen musste, aber bisher hatte sie es immer vor sich hergeschoben. Und so wird es auch bleiben, dachte sie, während sie in den Verkaufsraum zurückkehrte.
Auf der linken Seite bargen alte Holzregale eine beeindruckende Sammlung von Brotbüchsen mit allen möglichen Motiven, von Popeye über den frühen Batman bis zu My Little Pony. Manche davon waren verbeult und verschrammt, andere wiederum sahen aus, als wären sie nie benutzt worden. Ein paar lagen neben der dazugehörigen Thermoskanne.
Bonnie liebte Brotbüchsen, weil Kinder generell glücklich waren. Das war ihre spezielle Logik. Um ihre Freude über diesen Umstand mit anderen zu teilen, kaufte sie immer mehr Dosen, obwohl ihr bewusst war, dass sie längst nicht so viele verkauften.
Drei große Vitrinen enthielten Porzellanfiguren aller Art – von Lladró und Hummel, aber auch von eher unbekannten Künstlern. Schon als Kind hatte Nina die Miniskulpturen nicht gemocht. Sie hatte sich von ihnen immer beobachtet gefühlt. Mit den antiken Puppen war es das Gleiche. Aber dafür machten die alten Vintage-Kleider Spaß. Sie waren verstaubt und rochen komisch, aber sie und Averil hatten es geliebt, sich damit zu verkleiden.
Nina ging zu einem Ständer mit Ballkleidern aus den Vierzigerjahren und berührte eins davon. Sie hatte es genossen, in so einer Robe durch den Laden zu tanzen, mit einem rostigen Diadem auf dem Kopf.
»Du bist die Königin, und ich bin die Prinzessin«, hatte Averil zu ihr gesagt.
Nina hatte widersprochen und argumentiert, dass es auch zwei Prinzessinnen geben konnte. Schon mit neun Jahren hatte sie verstanden, dass Königin zu sein bedeutete, Verantwortung zu tragen. Alles, was sie wollte, war, für ein paar Minuten zu entfliehen. Aber Averil hatte sich stur gestellt.
»Du bist meine Königin, Nini. Du wirst immer die Königin sein.«
Nina berührte ein weiteres Kleid und erinnerte sich, dass ihre Schwester früher immer behauptet hatte, sie könne allein an dem Geruch des Stoffes erkennen, ob die Trägerin glücklich gewesen war. Da für Nina alle Kleider muffig rochen, konnte sie sich nicht entscheiden, ob ihre Schwester die Wahrheit sagte. Aber Averil zog nur abgelegte Sachen von glücklichen Menschen an und inspizierte sorgfältig jede neue Ware.
Nina vermutete, dass wohl jeder seltsame Erinnerungen an seine Kindheit hatte. Sie erinnerte sich an Phasen des Chaos, denen himmlische Phasen der Ruhe folgten. Bonnie verstand sich wunderbar aufs Lieben, aber nicht so sehr aufs Organisieren. Wenn sie niemanden finden konnte, der auf ihre Mädchen aufpasste, dachte sie sich nichts dabei, sie wochenlang aus der Schule zu nehmen und auf ihre Einkaufstouren mitzuschleppen.
Als Nina zwölf wurde, erklärte sie ihrer Mutter, dass sie alt genug sei, um alleine zu Hause zu bleiben. Sie hatte sich eine Reihe von Argumenten zurechtgelegt, warum man ihr vertrauen konnte, aber Bonnie hatte ihr einfach zugestimmt. Im Jahr darauf ließ sie auch Averil zu Hause in Ninas Obhut. Sie sorgte dafür, dass die Lebensmittelvorräte aufgefüllt waren, bevor sie sich davonmachte. In der Schublade lag Geld und auch das Scheckheft. Da Nina seit Jahren die Unterschrift ihrer Mutter gefälscht hatte, war es kein Problem, die Rechnungen zu bezahlen.
Nina blieb vor einer Tischlampe stehen, von der Bonnie schwor, dass es eine echte Tiffany war, und berührte das glatte Buntglas. Erinnerungen lauerten in diesem Laden, versteckten sich in jeder Ecke wie Wollmäuse. Da sie kein Mittel fand, um sie loszuwerden, mied sie diesen Ort für gewöhnlich. Was wahrscheinlich erklärte, warum Tanya zugegriffen hatte. Es war niemand da gewesen, der auf sie aufpasste.
Die Eingangstür wurde geöffnet. Nina verspannte sich, während sie sich fragte, ob es Dylan war. Sie hatte ihn angerufen, um ihm für seine Hilfe zu danken, war aber direkt auf seiner Mailbox gelandet. Sie war sich immer noch nicht sicher, ob sie enttäuscht oder erleichtert sein sollte.
Aber es war nicht Dylan, der hereinkam, sondern eine gut gekleidete Frau mit kurzen dunklen Haaren. Sie war ungefähr Mitte fünfzig und hatte blaue Augen und ein breites Lächeln.
»Sind Sie Nina?«, fragte sie.
»Ja.«
»Gut. Ich heiße Cindy Yoo. Ich bin wegen der Stelle hier. Ich habe gestern Abend Ihre Anzeige gelesen, und ich wäre an dem Job sehr interessiert.«
In Wahrheit wäre es am besten, den Laden für immer zu schließen. Leider lag diese Entscheidung nicht bei Nina. Sie war auf ein Bewerbungsgespräch nicht vorbereitet, aber sie brauchten dringend eine neue Aushilfe.
»Danke, dass Sie sich persönlich vorstellen«, sagte sie. »Ich habe hinten im Büro Bewerbungsformulare.«
Cindy nahm eine Mappe aus ihrer großen Ledertasche. »Ich habe meinen Lebenslauf mitgebracht und mehrere Empfehlungsschreiben.«
Nina ließ sich die Mappe geben. »Das ist sehr professionell von Ihnen«, sagte sie gedehnt. Soweit sie wusste, war bis jetzt noch kein Interessent mit einer Bewerbungsmappe erschienen.
»Ich habe frischen Kaffee gekocht«, sagte sie und deutete auf die offene Bürotür. »Möchten Sie einen?«
»Ja, gerne.«
Cindy folgte ihr ins Büro. Nina räumte einen Stapel Rechnungen vom Besucherstuhl und goss dann den Kaffee ein.
»Für mich bitte schwarz«, sagte Cindy und ließ sich ihre Tasse geben.
Nina schenkte sich ebenfalls eine Tasse ein und nahm dann hinter dem Schreibtisch Platz. »Ich wusste gar nicht, dass die Anzeige schon veröffentlicht ist.«
»Ich war gerade im Online-Stellenportal, als sie frisch hereinkam.« Cindy lächelte sie an. »Ich sage es am besten vorneweg: Ich habe keine Erfahrung im Verkauf, aber ich bin offen dafür, zu lernen.«
»Die Arbeit ist nicht kompliziert«, murmelte Nina, während sie Cindy musterte. Sie hatte nicht besonders viel Ahnung von Mode, aber sie vermutete trotzdem, dass Cindys Aufmachung nicht billig war. Ihre Tasche schien aus echtem Leder zu sein, und ihren Ehering zierte eine Reihe von funkelnden Edelsteinen.
Cindy deutete auf die Mappe. »Ich kann weitere Empfehlungsschreiben vorlegen, falls es nötig ist. Ich finde diese Chance sehr aufregend.«
Vielleicht ein bisschen zu aufregend? Nina schlug die Mappe auf und überflog Cindys Lebenslauf.
Cindy hatte in San Francisco Geschichte studiert, danach als Sekretärin in einer Kanzlei begonnen und war vier Jahre später zur Rechtsassistentin aufgestiegen. Dann war sie nach Seattle umgezogen und hatte weiter in ihrem Beruf gearbeitet.
Dem Lebenslauf war ein halbes Dutzend Empfehlungsschreiben beigefügt. Jedes einzelne davon lobte Cindy in den höchsten Tönen. Jedes einzelne davon enthielt eine Telefonnummer und das Versprechen, Cindy sofort wieder einzustellen, wenn sie Interesse hätte.
»Beeindruckend«, sagte Nina und sah dann ihre Bewerberin an. »Ich suche jemanden, der den Laden managt. Dazu gehört neben dem Verkauf die Inventarpflege. Ich kann mir nicht helfen, aber ich finde, Sie sind überqualifiziert.«
Cindy umklammerte ihre Kaffeetasse mit beiden Händen. »Um ganz offen zu sein, ich brauche diesen Job. Mein Mann ist einige Jahre älter als ich. Ich bin seine zweite Frau. Unsere Kinder haben angefangen zu studieren. Einer am MIT, der andere in Stanford.«
Es ging also um Geld, dachte Nina, was sie nachempfinden konnte.
»Mein Mann ist Koreaner. Meine Schwiegermutter ist zwar eine reizende Frau, aber sie hat ein sehr traditionelles Interesse am Leben ihres einzigen Sohnes. Seine erste Frau war anscheinend auch traditionell. Perfekt, wie meine Schwiegermutter sagt, von der Familie auserwählt. Aber sie starb, und später verliebte mein Mann sich in mich.« Sie unterbrach sich kurz. »Haben Sie schon mal von den Tiger Moms gehört?«
Nina runzelte die Stirn. »Ich glaube, ich habe mal darüber gelesen. Tiger Moms konzentrieren sich ausschließlich darauf, ihre Kinder auf Erfolg zu trimmen.«
»Multiplizieren Sie das mit tausend, und Sie verstehen, womit ich es zu tun habe. Ich bin nie gut genug, und selbst wenn meine Schwiegermutter es nicht offen ausspricht, bin ich mir sicher, dass sie mir in ihren täglichen Gebeten den Tod wünscht.« Cindy ließ ein Lächeln aufblitzen. »Oder zumindest, dass ihr Sohn zur Vernunft kommt und mich rauswirft.«
»Das klingt ziemlich unerfreulich.«
»Ja, das ist es, und nun wird sie auch noch bei uns einziehen.« Cindy schluckte. »Diese Woche schon. Mein Mann hilft ihr gerade beim Packen. Ich möchte ja nett zu ihr sein. Aber um geistig gesund zu bleiben, brauche ich einen Job. Einen Ort, wo ich hingehen und an etwas anderes denken kann. Einen Ort, wo ich meine Energie verströmen kann. Ich schwöre, ich bin hochmotiviert, alles zu lernen, was ich wissen muss.«
Nina spürte, dass ihre Bedenken dahinschmolzen. »Sie sind nicht vorbestraft, oder?«
Cindys Augen wurden groß. »Ich hoffe, Vorstrafen sind keine Grundvoraussetzung für den Job?«
»Nein. Unsere letzte Angestellte hat uns bestohlen. Wir hätten es nicht gemerkt, wäre sie nicht ins Pfandhaus gegangen, um unser Eigentum zu Geld zu machen.«
»In das Pfandhaus auf der Insel?«
»Genau das.«
Cindy lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück. »Ernsthaft, das war ziemlich dumm von ihr. Aber ein Glück für Sie. Was Ihre Frage betrifft, so lautet die Antwort Nein. Ich habe zwei Strafzettel für zu schnelles Fahren bekommen, das war’s. Ich bin ein anständiger Mensch. Da können Sie jeden fragen.«
Nina grinste. »Außer Ihrer Schwiegermutter.«
»Richtig.«
Nina gab Cindy das Bewerbungsformular. »Bitte füllen Sie das hier aus. Ich gehe solange vor in den Verkaufsraum.«
Sie ließ die Frau allein im Büro zurück. Sie würde sie zum Probearbeiten einladen, und wenn Cindys Angaben sich bestätigten, würde Nina sie einstellen und sich glücklich schätzen, sie gefunden zu haben.
4. KAPITEL
Averil war im Pazifischen Nordwesten aufgewachsen, wo die Wassertemperatur selten über fünfzehn Grad stieg, und das galt für den Sommer. In Kalifornien war es nicht viel anders. Direkt am Strand erwärmte sich das Wasser im Juli und August ein wenig, aber nur wenige Hundert Meter weiter draußen fiel der Meeresboden steil ab, und das Wasser war eiskalt. Sie hatte einmal in den Sommersemesterferien eine Freundin in Florida besucht und konnte nicht fassen, wie flach und warm der Golfstrom war, der sanft an den Strand schwappte. Irgendwie kam es ihr verkehrt vor.
Nun, da der Wind stärker wurde, zog sie das Segel straff und sicherte anschließend die Leine. Die Sonne stand hoch am Himmel, das leuchtende Blau spiegelte sich im endlosen Meer. Als das Boot wieder auf Kurs war, sah sie zu Kevin. Er trug eine Sonnenbrille, und wenn sie seine Augen nicht sehen konnte, wusste sie nicht, was er gerade dachte.
Er war in letzter Zeit ziemlich still. Bei jedem anderen würde sie sagen, nachdenklich.
»Kevin«, begann sie. »Bist du sauer auf mich?«
Er drehte den Kopf zu ihr, und seine Sonnenbrille ließ nicht erkennen, was genau er fokussierte. »Nein. Nicht sauer.«
»Was dann?«
»Enttäuscht.«
Das Wort war wie eine Ohrfeige. In ihrer Beziehung war sie stets das Objekt der Begierde gewesen. Diejenige, die gejagt und gefangen wurde. Sie liebte ihren Mann und tat ihr Bestes, um ihn gut zu behandeln, aber er war derjenige, der zu ihr kam. Sie spürte, dass das Fundament ihrer Welt unter ihr ins Wanken geriet.
»Wegen des Babys?«, fragte sie mit leiser Stimme.
»Auch.«
Der Wind peitschte ihr die Haare ins Gesicht. Sie hatte sie zu einem Zopf geflochten, aber ein paar Strähnen hatten sich gelöst. Sie streifte sie aus ihren Augen und starrte ihn an.
»Du bist von mir enttäuscht?«
»Ja.«
Sie spürte, dass die Luft schlagartig aus ihrer Lunge wich, als hätte sie einen Tritt in ihre Eingeweide bekommen. Panik übermannte sie und weckte in ihr das Bedürfnis, das zu sagen, was auch immer er hören musste, um seine Worte zurückzunehmen. Sie konnte es nicht ertragen, dass er sie zurückwies.
»Ich weiß, du bist nicht glücklich«, fuhr er fort. »Ich frage mich, ob ich der Grund dafür bin.«
Die Erleichterung machte das Atmen einfacher. Das hier war nicht ihre Schuld. Okay, damit konnte sie umgehen. »Du bist nicht der Grund«, versicherte sie ihm. »Ich weiß nicht genau, woran es liegt.«
»Liebst du mich noch?«
»Natürlich. Sei nicht albern. Wir sind verheiratet.«
»Was hat das damit zu tun, dass wir verheiratet sind?«
»Ich weiß nicht. Es ist einfach so. Wir sind ein Team.«
Er drehte seinen Kopf weg, und die Panik kehrte zurück. Dieses Mal begleitet von einem unguten Gefühl.
»Ich weiß nicht, was du willst«, sagte er.
»Ich weiß es auch nicht. Es hat nichts mit dir zu tun. Ich fühle mich einfach unwohl und …« Sie unterbrach sich, als ihr die Wahrheit dämmerte. Eine Wahrheit, die sie eine lange Zeit gemieden hatte.
»Ich will nach Hause.«
Sie sagte die Worte, ohne darüber nachzudenken, wie sie klangen. Wie er sie auffassen würde. Seine Miene änderte sich nicht, aber seine Hand griff nach der Leine, und Sekunden später fiel das Focksegel zusammen. Er zog das Großsegel heran und bewahrte es davor, im Meer zu versinken.
»Kevin, nein«, sagte sie und umklammerte seinen freien Arm. »Tu das nicht. Ich meinte nicht sofort.«
Denn mit »nach Hause« hatte sie Blackberry Island gemeint. Das wussten sie beide.
Er sicherte das Segel, dann drehte er sich zu ihr um. »Es ging dir immer darum, nach Hause zu fahren. Das weiß ich. Du musst deine Schwester sehen. Was ich nicht verstehe, ist, dass ihr zwei nicht länger als einen Tag unter einem Dach leben könnt, ohne euch zu streiten. Es spielt dabei keine Rolle, ob sie dich besucht oder du sie. Und trotzdem kannst du anscheinend keine Entscheidung ohne sie treffen. Warum?«
Sie hatte keine Antwort. Am liebsten hätte sie ihm gesagt, dass er sich täuschte, aber er täuschte sich nicht. Nina war … Sie schluckte. Er hatte recht. Nina war die Stimme in ihrem Kopf.
»Es tut mir leid«, sagte sie leise.
![Es geschehen noch Küsse und Wunder (Fool's Gold 30) [ungekürzt] - Susan Mallery - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1203f8a9d2392d768c0151e86639310c/w200_u90.jpg)

![Spiel, Kuss und Sieg (Fool's Gold 20) [ungekürzt] - Susan Mallery - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5c895f4d798af186b780b13113e39b30/w200_u90.jpg)