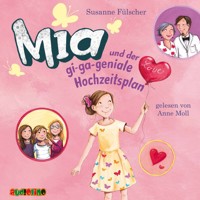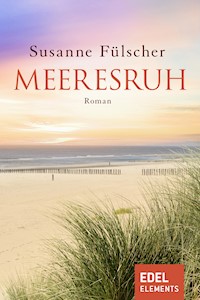
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein schockierender Anlass führt die drei ehemaligen Schulfreundinnen Milena, Edith und Romi wieder zusammen: Ihr alter Schulfreund Tomek hat sich das Leben genommen. Nun machen sich die Mittdreißigerinnen auf den schweren Weg zur Seebestattung nach Ahlbeck. Je länger sich die drei Frauen in dem Ostseebad aufhalten, desto angespannter wird die Stimmung. Alte Eifersüchteleien, Affären und Lebenslügen kommen ans Tageslicht und verändern langsam aber sicher das Leben der drei Frauen, bis kein Stein mehr auf dem anderen bleibt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Susanne Fülscher
Meeresruh
Roman
Edel:eBooks
Copyright dieser Ausgabe © 2013 by Edel:eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg.
Copyright © 2003 by Susanne Fülscher
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-114-9
edel.comfacebook.com/edel.ebooks
Inhalt
Meeresruh
Milena
Zwei Tage bevor es passierte war ich mit so einem merkwürdigen Gefühl aufgewacht. Es rumorte in meinem Magen, ein ziemlich heftiges Grummeln, und mein Gesicht war schweißnass. Schlecht geträumt? Schon möglich, bloß was hatte ich um Himmels willen geträumt? Meistens erinnerte ich mich im ersten Moment nicht an meine Träume, doch wenn ich mich noch einmal hinlegte und die Augen schloss, kamen die Bilder nach und nach wieder. Mit ein bisschen Glück waren es ganze Sequenzen, manchmal machte sich aber auch nur ein unbestimmtes Gefühl in mir breit, das sich den ganzen Tag nicht mehr vertreiben ließ.
Ich zog die Decke noch einmal bis zum Kinn, presste die Augenlider zusammen, und dann fiel mir immerhin ein, dass ich von Tomek geträumt hatte. Etwas Schönes war es mit Sicherheit nicht gewesen, ich mein, kein Mensch fühlt sich nach einem fabelhaften Traum schlecht. Doch je angestrengter ich die nächsten Sekunden und Minuten nachdachte, desto mehr verblasste der Traum, bis schließlich nur noch das Ticken des Weckers, vermischt mit dem Brummen eines Motors draußen, übrig blieb.
Tomek, ach mein Gott! Wie viele Jahre war ich eigentlich unglücklich in ihn verliebt gewesen? Fünf? Zehn? Ach, vielleicht kamen sogar noch ein paar Jährchen hinzu, aber das spielte jetzt keine Rolle mehr. Inzwischen war Tomek für mich nichts weiter als ein guter Bekannter, und dass er damals, noch zu Schulzeiten, nacheinander erst Romi und dann Edith erobert und mich als Einzige verschmäht hatte, tat auch nicht mehr weh. Jedenfalls nicht besonders. Ach herrje, mein Leben war eben anders verlaufen! Bücher schreiben, die gescheiterte Ehe mit Max, so hatte es ausgesehen. Wozu also noch alten Geschichten nachtrauern? Gut – dass ich mir manchmal ausmalte, wie es wohl mit Tomek im Bett gewesen wäre, stand auf einem anderen Blatt. Doch das ging niemanden etwas an. Weder Tomek, geschweige denn Edith oder Romi.
Bloß schnell raus aus den Federn. Ich hatte an diesem Tag jedenfalls einiges zu erledigen. Die Unterlagen für die Steuer zusammensuchen, zur Post gehen, zur Bank, Sachen in die Reinigung bringen, für die Lesereise packen … Kofferpacken war jedes Mal so eine Sache. Ich mein, was sollte ich bloß mitnehmen? Schließlich hatte ich nicht die geringste Ahnung, wie das Wetter werden würde. Vielleicht schon vorfrühlingshaft warm, vielleicht würde aber auch ein neuer Kälteeinbruch jedes Frühlingsgefühl im Keim ersticken. Die dicke Jacke musste mit, ganz klar. Unbedingt aber auch die Jeansjacke und das neue Sakko, falls doch Warmluft im Anzug war.
Tja … Keine Frage, worauf es wieder mal hinauslief: Ich, bepackt mit tausend Taschen und Koffern, schwitzend und stöhnend auf irgendwelchen Bahnhöfen. Na, bravo.
Edith
Als der Anruf kam, stand ich gerade unter der Dusche und kämpfte mit einem Niesanfall. Emmy hatte mich schon den ganzen Tag genervt. Erst wollte sie nicht frühstücken, nach der Schule musste sie unbedingt Mary Poppins zweimal sehen und dabei Gummibärchen essen, die nicht im Haus waren. Emmy, das Kind der Superlative. Mal aß sie, als wolle sie auf Teufel komm raus in höhere Gewichtsklassen aufsteigen, mal verweigerte sie jegliche Nahrung. Aber so war sie schon immer. In jeder Hinsicht extrem. Extremer als Fritz und Zoé allemal. Zum Beispiel bei ihrem letzten Geburtstag. Ich wollte ihr den Miniatursupermarkt kaufen, doch sie schrie den ganzen Spielzeugladen zusammen, weil sie nicht auch noch die elektrische Eisenbahn haben konnte. So gesehen nichts Ungewöhnliches. Für ihre verspäteten Trotzphasen war sie schließlich weltberühmt. Aber Emmy warf sich auf den Boden, sie kreischte und hyperventilierte, bis sich ihre Finger versteiften und sie per Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ein schöner sechster Geburtstag. Die Mettbrötchen, die ich für die erwachsenen Geburtstagsgäste vorbereitet hatte, wurden schlecht. Das heißt, erst legten Schmeißfliegen ihre Eier darauf ab, dann passierte eine Weile lang gar nichts, bis ein fauliger Gestank das ganze Haus durchzog. Zunächst wusste niemand, woher er kam – ich hatte schon Zoés Windel in Verdacht –, tja, und irgendwann stieß Konrad per Zufall auf die vergessenen Hackbrötchen. Im Keller. Schneeweiße Maden wanden sich auf ihnen herum. Das wiederum führte zu einem handfesten Ehekrach, wobei ich doch gar nichts dafür konnte. Die Sorge um Emmy hatte alles überschattet und stand in keinem Verhältnis zu irgendwelchen vergessenen Hackbrötchen.
Jedenfalls befand ich mich an diesem Nachmittag bis zum Anschlag eingeseift in der Dusche, als Emmy mit dem Telefon in der Hand reinplatzte. Mit verschmierten Schokofingern – weiß der Teufel, woher sie die Schokolade hatte – riss sie den Vorhang auf und sprach grimassierend in das Plätschern des Wassers hinein.
»Emmy, ich kann dich nicht hören!«, rief ich.
Eigentlich hatte ich nicht vor, den Hahn abzudrehen, aber weil Emmy so ein jämmerliches Gesicht machte, tat ich ihr doch den Gefallen.
»Für Papa …«, sagte sie und hielt mir das Telefon hin, während ihre andere Hand die Schokolade jetzt auch am Waschbeckenrand verteilte. »Ein Freund.«
»Was für ein Freund?« Ich fröstelte.
»Weiß nicht. Kenn die Stimme nicht.«
»Tomek?«
Emmy schüttelte den Kopf. Welchen Freund konnte sie nur meinen? Außer Tomek hatte Konrad kaum Freunde. Gut, da gab es noch seinen alten Sandkastenfreund Ede, heute Tankstellenbesitzer und immer noch Prolet sondergleichen, doch der hatte sich seit ewigen Zeiten nicht mehr gemeldet.
»Sag ihm, er soll später nochmal anrufen.«
»Du sollst später nochmal anrufen«, plapperte Emmy folgsam in den Hörer. Wenn’s drauf ankam, war sie ein phantastisches Kind.
Der Mann sagte offenbar irgendetwas zu Emmy, denn sie nickte wie aufgezogen.
»Aber der Onkel sagt, es ist dringend!«
»Dann sag dem Onkel, dass ich gerade ganz dringend dusche.« Ich stellte das Wasser wieder an und zog den Vorhang zu. Nichts konnte so wichtig sein, dass man dafür von Kopf bis Fuß eingeseift aus der Dusche stieg.
Romi
Ja, echt, der Moment war total ungünstig. Gerade hatte ich überlegt, ob ich André anrufen sollte. André Wittstock. Ein netter Typ, aber so richtig scharf fand ich ihn eigentlich nicht mehr. Wozu hätte ich ihn also anrufen sollen? Um ihm Hoffnungen zu machen? Um uns Hoffnungen zu machen? Die Kiste war es im Grunde nicht wert, peng und fertig.
Kleine Korrektur: André war es nicht wert. Er war zwar kein Arschloch, das nicht gerade, aber jung und eitel, außerdem schlief er immer zu lange. Ein Kerl, der zu lange pennt, treibt dich in den Wahnsinn. Du sitzt am Frühstückstisch, der Kaffee wird kalt, die Butter zerläuft, und der Käse fängt an zu stinken, jedoch nichts passiert. Der Typ liegt da im Nebenraum und rührt sich nicht. Für jemanden wie mich ist es wie eine Ohrfeige, wenn dir auf diese Weise der Tag versaut wird.
Okay – André war nie die große Liebe, das nicht. Eher eine Notlösung. Ich wollte eine Beziehung, und da bot er sich eben an, auch wenn er acht Jahre jünger war. Unter normalen Umständen wollen Siebenundzwanzigjährige keine füfunddreißigjährigen Frauen. Nicht mal fünfunddreißigjährige Männer wollen das. Die wollen knackige Fünfundzwanzigjährige – Zellulitis, nein danke.
Ja, echt, André war ganz okay und ich nur zu bequem, um das Ganze zu beenden. Und zu ängstlich – das wohl auch. Wieder alleine sein … Darauf war ich nun wirklich nicht erpicht, zumal sich die Zahl der in Frage kommenden Typen von Jahr zu Jahr verringerte. Lag wohl an meinem Alter, ein bisschen aber auch an meinem Anspruch. Thema Manieren, nur mal zum Beispiel. Ich mein, wer will mit Mitte dreißig noch einen Kerl um sich haben, der beim Essen schlingt und sich jeden Finger einzeln ablutscht? Ich garantiert nicht!
Das Handy bimmelte schon eine Weile, aber ich ließ es bimmeln. Wie gesagt – war ja ein total ungünstiger Moment. Zumal auch noch meine Kollegin Katrin reingeplatzt war, abartig nach Parfüm stinkend.
»Wieder ganz in Schwarz?«, fragte sie, während ich mein Handy tief in meiner Tasche vergrub und hoffte, dass die blöde Mailbox endlich anspringen würde.
Idiotische Frage! Bei der Arbeit trug ich immer Schwarz. Schwarzer Pullover, schwarze Hose. Schwarze Bluse, schwarzer Rock. Dazu schwarze Schnürschuhe oder Stiefel. Hatte sich irgendwann mal so ergeben, und ich mochte es, wenn die Dinge so blieben, wie sie eben waren.
Katrin nahm sich eine Mandarine von meinem Tisch, sie bohrte ihren Fingernagel in die Schale, und während sie das Teil irgendwie andächtig abpulte, fragte sie mich, ob ich schon die beiden neuen Solisten gesehen hätte. Nienke Janssen aus den Niederlanden und Adam Slowacki aus Polen. Die Janssen sei ja ganz außerordentlich. Erster Preis beim Prix de Jeunesse, danach gleich ein Engagement in Basel.
Ich nickte nur und durchwühlte meine Tasche nach einem Aspirin. Mittlerweile war auch mein Handy verstummt. Ekelhaft, diese Kopfschmerzen. Meistens fing es im hinteren Teil des Schädels dumpf an zu pochen, wenn ich Glück hatte, blieb es dabei, schlimmstenfalls wurde eine Migräneattacke draus.
»Die Janssen sieht auch noch gut aus.« Katrin warf ihre Haare zurück – wohl um zu demonstrieren, dass sie auch gut aussah.
»Spitze. Echt«, sagte ich ohne jede Begeisterung. In meinen Augen war die Compagnie ein eingespieltes Team mit wirklich genialen Solisten. Wozu brauchte man da noch eine Janssen?
Zum Glück humpelte in diesem Moment ein älterer Herr am Stock an die Kasse und verlangte zwei Karten für Don Giovanni. Erster Rang, Mittelplätze.
»Erster Rang. Moment …« Ich nickte ihm zu. »Da hätten wir noch was. Die Karte zu 60 Euro.«
Der Mann strahlte. Wow – ich hatte doch tatsächlich einen Job, in dem ich Menschen happy machte! Wenn das nichts war! Immer noch lächelnd zückte der Mann seine Brieftasche und schob die Scheine passend rüber. Wahrscheinlich hätte er auch ohne mit der Wimper zu zucken 100 Euro geblecht. Früher, als ich selbst noch auf der Bühne stand, war ich immer der Meinung gewesen, jeder Mensch sollte sein letztes Hemd hergeben, um mich in Aktion zu bewundern. Später sah ich das anders. Wahrscheinlich weil ich selbst nicht bereit war, für irgendjemandes Kunstkram mein letztes Hemd herzugeben.
Schon wieder schrillte das Handy. Meine Güte! Durfte man denn nicht mal in Ruhe seinen Job erledigen und ein Aspirin schlucken? Außerdem machte mich Katrin mit ihrer Abpulerei schier wahnsinnig. Jedes noch so kleine Häutchen entfernte sie hyperpingelig, als könne sie damit allen Ernstes den ganzen Giftkram abkriegen. Wenn das so weiterging, würde sie voraussichtlich erst übermorgen zum Essen kommen. Wie wollte sie überhaupt den Sprung von der Kasse in die Dramaturgie schaffen.? Mit ihrer lahmarschigen, kein bisschen stresserprobten Art.
Ich hatte auch mal den Traum. Dramaturgie … Wenn es schon nicht mit der Choreographie klappte. In Wahrheit sollten wir uns langsam damit abfinden, dass super ausgebildete Fachkräfte in Scharen von den Unis kamen. Leute, die nicht das erste Drittel ihres Lebens mit Tanzen verplempert hatten, sondern das Abi gemacht und danach Kulturmanagement, Musikwissenschaft oder sonstwas studiert hatten.
Sorry, sorry … natürlich hatte ich nichts verplempert. Tanzen war mein Leben gewesen – fertig. Jede Minute der Schinderei totales Glück, selbst wenn sich die Schmerzen nicht mehr aushalten ließen. Hoher Spann, ideale Proportionen, gute Sprungkraft – war ja alles dagewesen. Nur die Zeit arbeitete gegen mich. Das Älterwerden. Jede Minute, die der Zeiger der Uhr vorrückte, war eine Katastrophe, und manchmal hatte ich gedacht, ich würde es nicht ertragen. Wenn es eines Tages vorbei sein würde, meine ich.
Seit ungefähr vierzehn Monaten war es nun vorbei – Scheiße, ja –, aber ich konnte mich ja schließlich nicht einfach in einen Sarg legen und ab die Post. Erschießen ging auch nicht, scheiterte schon an der fehlenden Knarre. Und irgendwo runterspringen? Nee, für solche Aktionen war ich nun ganz bestimmt nicht der richtige Typ, außerdem war das Leben ja auch ohne Tanzen okay. Einigermaßen jedenfalls. Solange es noch Typen gab, die mir auf den Hintern schielten …
Milena
Wahrscheinlich war es Eingebung, dass ich Edith genau an diesem Tag anrief. Normalerweise telefonierten wir nicht so oft. Höchstens im Abstand von einigen Wochen, manchmal vergingen auch Monate, bis eine von uns den Hörer in die Hand nahm. Dass ich es nicht tat – geschenkt. Wer hat schon Lust, von Flughäfen und Bahnhöfen aus seine alte Schulfreundin anzurufen? Edith, machst du gerade Fritz sauber, oder was treibst du so? Ach, du kochst? Langustenschwänze für Konrad. Und die Kinder essen sowieso, was sie wollen, richtig? Alles klar. Fragt sich nur, was mit dir ist, liebe Edith. Pass mal schön auf, dass du nicht auf der Strecke bleibst. Aber gut – war ja nicht mein Problem.
Mein Problem war allerdings, dass ich zu viele Abende im Jahr in Hotelzimmern verbrachte und darauf wartete, dass mir irgendjemand mit seinem Anruf die Zeit vertrieb. Meistens steckte man mich in eins dieser Garni-Hotels. Alles in Beige-Braun-Tönen gehalten. Immerhin funktionierte in der Regel der Fernseher. Das war zwar nicht gerade berauschend, doch zumindest etwas. Zu Hause traute ich mich nämlich nicht, hemmungslos fernzusehen. Allein die Anwesenheit des Laptops machte mir da schon ein schlechtes Gewissen. Anders in Hotelzimmern. Dort gab es keine Computer, und weil ich nur in Ausnahmefällen per Hand schrieb, konnte ich eben ruhigen Gewissens den Fernseher dudeln lassen.
Um ehrlich zu sein, sah ich mir alles an. Serien, B-Movies, Talk- und Quizshows – unterstes Niveau. Nicht weiter schlimm soweit. Ich genoss sie sogar, diese sinnlos vergeudeten Stunden. Probleme machten mir ganz andere Dinge. Vor ein paar Monaten hatte ich nämlich einen Artikel über Fußpilzsporen gelesen, die mit besonderer Vorliebe in Teppichböden lauerten und darauf warteten, dass ein Opfer barfuß vom Bett zum Badezimmer lief. Seitdem konnte ich nur noch in Badelatschen im Zimmer umhergehen, aber falls ich die in meiner Schlampigkeit mal wieder zu Hause vergessen hatte, war das Dilemma groß. Einmal kaufte ich mir gleich bei der Ankunft ein paar Latschen im Ort, ein anderes Mal baute ich mir aus allen verfügbaren Handtüchern eine Brücke vom Bett zum Badezimmer. Was allerdings den Nachteil hatte, dass mir nur noch das Händehandtuch zum Abtrocknen blieb.
An diesem Nachmittag hockte ich also wieder mal in einem miefigen Hotelzimmer, irgendwo in Österreich. Am nächsten Tag hatte ich fünf Lesungen vor mir. Quasi en suite. Ich saß im Schneidersitz auf meinem Hotelbett, aß ein Snickers und ärgerte mich über das Fernsehprogramm. Ich ärgerte mich auch darüber, dass ich ein Snickers aß. Erstens mochte ich den Süßkram überhaupt nicht, zweitens war er ungesund, und drittens war er nach der Pizza, die ich mir schon vor genau einer Stunde bei einem drittklassigen Italiener genehmigt hatte, bestimmt nicht das Richtige. Nach dem Snickers öffnete ich eine Dose gesalzene Erdnüsse, die ich ebenfalls am Bahnhofskiosk erstanden hatte, und musste dabei automatisch an Tomek und Romi und natürlich auch an Edith denken. An eine unserer legendären Partys, damals, in diesem wunderbar milden Oktober. Ich war unsterblich in Tomek verliebt, aber der hatte nur Augen für Romi. Zu späterer Stunde lagen sie plötzlich auf einer Matratze in der Ecke. Sie hatten Tomeks Parka über sich ausgebreitet und fummelten heftig. Nicht dass ich etwas hätte sehen können, aber Romi wand sich wie ein Aal unter Tomeks Händen. Entweder weil er begnadete Hände hatte, oder weil ihre Jeans zu eng waren und er mit seiner Hand nicht reinkam.
Aber das spielte auch keine Rolle, denn so oder so war es ein Schock. Mein heiß geliebter Tomek in Romis Armen. Das hübscheste Mädchen der Schule. Klein, zierlich – wie Schneewittchen aus dem Märchen. Nein, sie war nicht einfach nur Schneewittchen. Sie war eine äußerst raffinierte Märchenfigur.
Getarnt durch ihre liebreizende Fassade, zog sie alle Register, um ihre Beute zu erlegen. Denn alle Jungs gehörten ihr – sozusagen per Naturgesetz –, und wenn einer mal nicht parierte und sich nicht sofort in ihren Bann ziehen ließ, brachte sie ihren berühmt-berüchtigten Augenaufschlag zum Einsatz, und schon war wieder ein Herz gebrochen. Diesmal eben Tomeks. Und ich hatte mich so viele Wochen lang abgemüht, wenigstens so etwas wie Freundschaft zu ihm aufzubauen. Das Einzige, was mir blieb, war Edith. Edith mit einer Plastikschüssel Erdnüsse in der Hand. Weil ich nicht zugriff, steckte sie mir eine Nuss nach der anderen in den Mund. Bloß damit ich nicht auf die Idee kam, in Tränen auszubrechen.
Jetzt, fast zwei Jahrzehnte später, brach ich dann doch in Tränen aus, und während Edith beruhigend auf mich einredete, aß ich die ganze Dose Erdnüsse leer.
Romi
Wie gesagt, es war ein ziemlich ungünstiger Moment. Eigentlich kam ich erst gegen Abend dazu, meine Mailbox abzuhören. Genau genommen vorm Schlafengehen, ich mit dick Fettcreme im Gesicht und so. Klar, ich hatte schon seit fünf Uhr Feierabend, aber wie jeden Tag nach der Arbeit trank ich noch einen Kaffee in einem der Coffeeshops in der Stadt, bevor ich nach Hause fuhr. Ein Ritual. Minuten, die nur mir gehörten. Nicht der blöden Opernkasse, nicht meinem Zweizimmerhaushalt und auch nicht André.
Meistens nahm ich einen Kingsize. Eigentlich konnte man in dem Fall nicht von einem Kaffee sprechen, eher von einem Bottich voll Kaffee, aber wurscht. Kam ja nicht mehr so drauf an. Auf jede Kalorie, meine ich. Und falls es mir doch zu viel sein sollte, hatte ich da so meine Methode. Wie früher zur Zeit meiner größten Bühnenerfolge. Schlimmstenfalls steckte ich mir den Finger in den Hals, oder – na ja – ich nahm es eben einfach hin.
Wie ich so dasaß und meinen Kingsize schlürfte, kam ein riesengroßer Kerl rein, den Blick stur auf die Preistafel geheftet. Manchmal machte ich mir einen Spaß draus und zählte die Sekunden, bis die Typen zu mir rüberguckten. Kürzlich hatte einer geschlagene drei Minuten gebraucht, der Durchschnittswert lag bei zwanzig Sekunden.
Heute dauerte es etwas länger. Erst als ich das Glas schon bis zur Hälfte weggeschlürft hatte, bequemte sich der Hüne mal und glotzte mich an. Ein knappes Grinsen, schon guckte ich wieder weg. War doch nicht so ganz nach meinem Geschmack, der Typ.
Zugegeben – manchmal lief es auch anders. Ich hatte kein Problem damit, den einen oder anderen Kerl mit zu mir nach Hause zu nehmen. Vorausgesetzt, ich stand auf ihn. Dass nie Liebe daraus wurde, war bitter, aber irgendwie hielt es mich nicht davon ab, mein Spielchen gleich beim ersten Date bis zum Äußersten zu treiben. Ich wollte einfach, dass sie es mir sagten. Wie großartig ich sei. Schön. Schlank. Und natürlich begehrenswert. All das war wichtiger, als mal ein bisschen Geduld aufzubringen, um die Sache wachsen zu lassen.
Ein ödes Spiel, fand ich plötzlich, als ich mit dem Bus nach Hause gondelte. Zum Glück war wenigstens der Kühlschrank voll, und im Fernsehen lief eine Reportage über den Startänzer Nicolas Le Riche. Ich stopfte mir zwei Scheiben Brot mit Greyerzer rein, eine Scheibe mit Butter und Honig, vier eingelegte Artischocken, zwei Überraschungseier, ein dickes Stück Biosalami, sieben Kekse, und zum Abschluss kochte ich mir noch Spaghetti. Einfach mit Butter und Parmesan. Zwischendurch ging ich kotzen, und als die Reportage zu Ende war, spuckte ich auch noch die Spaghetti ins Klo. Nur um den teuren Parmesan war es eigentlich schade.
Meistens fühlte ich mich danach erleichtert. Nicht glücklich, aber wenigstens erleichtert. Und dann konnte ich mit einem schönen Krimi ins Bett gehen und darauf hoffen, dass das Universum auch für mich die große Liebe vorgesehen hatte. Einen Mann, mit dem alles möglich war. Die richtig spießige Nummer – Kind plus Eigenheim. Nur mal zum Beispiel.
Mein Handy fiepte; der Akku war fast leer. Ach, und dann fiel mir ein, dass ich immer noch nicht die dämliche Mailbox abgehört hatte.
Milena
Keine Ahnung, warum ich Edith ausgerechnet an diesem Tag anrief Besser, ich hätte es bleiben lassen. Besser, ich hätte meine Lesereise zu Ende gebracht und es dann erfahren. So ging alles den Bach runter. Die Lesereise und … ach, einfach alles ging den Bach runter.
Tomek tot. Wieso sollte Tomek verdammt nochmal tot sein? Das war völlig unmöglich! Vor genau einer Woche hatte ich ihn noch zum Geburtstag angerufen. Immer war ich die Erste, die ihm gratulierte. Er hatte gelacht und gesagt, Milena, du bist ein Schatz, und wie machst du das nur, dass du dir all die Geburtstage merken kannst und schon gleich morgens daran denkst anzurufen?
Das stimmte nicht. Ich wusste nur wenige Geburtstage auswendig. Aber dass ich die meiner Freunde im Kopf hatte, war doch selbstverständlich. Außerdem hatte der 11. März schon immer eine besondere Bedeutung für mich gehabt. Der Tomek-Gedächtnistag … Nein, ich war nicht so naiv zu glauben, dass mein Leben mit Tomek anders verlaufen wäre, ganz sicher nicht. Zumal ich zufrieden war, wirklich wahr, alles lief soweit richtig phantastisch. Einmal hätte er mich allerdings schon erhören können, nur ein einziges Mal! Wo ich ihm so lange die Treue gehalten hatte. Einmal mit ihm ins Bett und fertig. Vielleicht wäre die Seifenblase dann von ganz allein zerplatzt. Edith hatte sich damals nach ihrer Affäre eher abfällig über Tomeks Qualitäten als Liebhaber geäußert. Leider ohne Details preiszugeben, und ich traute mich nicht nachzufragen. Wozu auch? Warum sollte ich mir wieder und wieder vor Augen führen, dass ich die Einzige von uns dreien war, der Tomek einen Korb gegeben hatte?
»Milena, Tomek ist tot.« Edith sagte das in einer Weise, als mache ihr das gar nichts weiter aus. Als könne sie gleich zu irgendeiner Geschichte ihrer Kinder übergehen. Vielleicht, dass Emmy ihr Supergenie wieder mal durch eine herausragende Krakelei in der Schule unter Beweis gestellt hatte. Oder dass sich Zoé einfach nicht abstillen ließ. Dabei war es genau umgekehrt. Emmy und Fritz hatte sie doch auch bis zum Nimmerleinstag gestillt. Und zwar, weil sie es so wollte. Weil sie nicht loslassen konnte und weil es ihre einzige tägliche Glücksdosis war. Jeden Tag mehrmals das Kind an die Brust legen. Irgendwie auch verständlich, wo Konrad sie schon seit Fritz’ Geburt kaum noch angefasst hatte.
Edith redete und redete, aber ich bekam nicht mit, was sie sagte. Denn als hätte der Fernseher eine Tonstörung, rauschte es ganz plötzlich in meinen Ohren, und dann wurde mir derart übel, dass ich es gerade noch zum Klo schaffte. Barfuß über den Teppich mit den ekelhaften Fußpilzsporen.
Edith
Dass Kinder so entsetzlich nerven konnten! Warum hatte die Natur ihnen nicht einen Aus-Knopf mitgegeben, den man nur zu betätigen brauchte, und schon war sofort Ruhe? Emmy toppte an diesern Nachmittag alles. Als wolle sie mich quälen, spielte sie automatische Bandansage und fragte in einer Tour, wer denn nun der Onkel gewesen sei. Wer-war-denn-nun-der-Onkel-wer-war-denn-nun-der-Onkel-wer-war-denn-nun-der-Onkel-wer-war-denn-nun-der-Onkel … Sie ließ sich einfach nicht abstellen, doch je mehr sie nervte, desto weniger war ich in der Lage, ihr zu antworten. Ich starrte nur aus dem Fenster und fragte mich, warum. Verdammt nochmal, wie hatte sich Tomek eigentlich das Recht nehmen können, aus allem auszusteigen? Einfach so, von heute auf morgen! Vor zwei Tagen hatte er doch noch in unserer Küche gesessen, hier auf Emmys feuerwehrrotem Stuhl, und Lasagne in sich hineingeschaufelt, danach die obligatorischen Smarties verteilt, seine Lieblingssüßigkeit. Jetzt lag er im Leichenschauhaus mit einer Marke um den Zeh. So stellte ich mir das jedenfalls vor. So kannte ich es aus den Krimis, die ich mir oft abends ansah, wenn Konrad noch Termine hatte. Und da das häufig vorkam – mindestens zwei-, dreimal die Woche –, saß ich auch oft vor dem Fernseher.
»Sei endlich still, Emmy! Tomeks Bruder Jan hat angerufen. In Ordnung? Ist jetzt gut?«
»Ach so«, meinte Emmy nur und verschwand in ihrem Zimmer.
Zum Glück. Ich brachte es nämlich nicht über mich, ihr auch noch zu sagen, dass es Tomek nicht mehr gab. Dass er jetzt mit Marke um den Zeh in irgendeinem Kühlfach lag. Nicht dass Emmy Tomek heiß und innig geliebt hätte, aber er war immerhin ihr Nenn-Patenonkel und in dieser Funktion dafür gut, sie in regelmäßigen Abständen mit Smarties und anderen Süßigkeiten zu versorgen. Anders Fritz. Der mochte Tomek wirklich. Weil er lustig war und immer neue Spiele erfand, wenn die anderen Erwachsenen schon abgeschlafft auf ihren Stühlen hingen.
Was für einen Grund mochte Tomek bloß gehabt haben? Seine Depressionen gehörten – soweit ich wusste – doch längst der Vergangenheit an. Ansonsten war er gesund, als Lehrer verbeamtet, außerdem hatte er eine nette Frau an seiner Seite … Wenn man mich fragte, war er einfach nur ein Idiot. Ein gottverdammter Riesenidiot, der eben mal so sein Leben weggeworfen hatte.
Zu dumm, dass ich Konrad nicht erreichen konnte. Warum um Himmels willen war sein Handy ausgestellt? Ausgerechnet jetzt! Schon viermal hatte ich auf seine Mailbox gesprochen, aber er rief einfach nicht zurück! Dabei wollte er doch nur kurz nach Potsdam rausfahren, um dort einem Kunden ein Sanierungsprojekt zu zeigen. Erstklassige Eigentumswohnungen in einem zurzeit noch runtergekommenen Art-Déco-Häuserkomplex. Normalerweise ließ er sein Handy immer an. Schon allein deshalb, weil er sich keine potenziellen Käufer durch die Lappen gehen lassen wollte.
Konrad würde es nicht verkraften. Sein einziger, sein bester Freund war nicht mehr am Leben. Incredibile. Hatten wir ihn wirklich alle so wenig gekannt?
Romi
Nicht dass er mir besonders nah gestanden hätte – boah nee, das nun wirklich nicht. Tomek war eben Tomek. Rotwangig, ein bisschen zu spiddelig für meinen Geschmack, auf der anderen Seite belesen und mit einer ausgeprägten Vorliebe für Bach. Irgendwann Anfang der achtziger Jahre hatten wir mal was miteinander gehabt, kurz bevor er mit Edith zusammengekommen war, aber Liebe – um Gottes willen – no! Nicht mal verknallt war ich in ihn gewesen. Moment … auf einer dieser Partys bei Edith hatte es doch angefangen. Engtanzfete im Keller ihrer Eltern. Tomek kam gerade recht. Gut, er sah nicht gerade aus wie ein Adonis, aber ich war einfach scharf aufs Leben. Scharf auf ein bisschen Rumgeturtele, von mir aus auch auf Sex.
Natürlich hatte ich längst mitgekriegt, dass er auf mich stand. Wie er mich in der Pausenhalle immer anglotzte … na ja, immerhin war er gepflegt, und dann hatte er eben noch diese Schwäche für klassische Musik. Damit traf er bei mir genau ins Schwarze. Ich kannte eigentlich nur schwule Männer, die sich für klassische Musik erwärmen konnten. Meine Tänzerkollegen zum Beispiel. Die hörten schon mal privat Tschaikowsky und Händel. Nicht so die Jungs in unserem Jahrgang. Die dröhnten sich mit Pretenders und Police zu – die ganz üble Sorte spielte dazu auch noch Luftgitarre. Umso mehr passte es mir in den Kram, dass Tomek mir seine Lieblingskomponisten einschließlich seiner Lieblingssymphonien und Lieblingsarien ins Ohr säuselte. Im Gegenzug war ich sogar bereit, mit ihm zu Culture Club zu knutschen. Als ein Song von Wham! kam, waren wir immer noch am Knutschen, aber irgendwie hatte Tomek nicht das richtige Händchen. Zu ruppig und zu ungeduldig. Tja – Pech gehabt, Junge.
Nach der Fete setzten wir unser Techtelmechtel noch gut einen Monat fort. So halbwegs jedenfalls, denn gleichzeitig guckte ich auch schon wieder nach anderen Typen. Wovon Tomek natürlich nichts ahnte. Der dachte, wir wären das Paar aller Paare. Als er mich seinen Eltern vorstellen wollte, kriegte ich Panik und machte Schluss. Quasi von heute auf morgen und immer noch als Jungfrau. Das ging in Ordnung, denn zur gleichen Zeit kam ein neuer Schüler in unsere Ballettklasse, von dem man munkelte, er sei hetero. Zumindest dichtete man ihm eine Exfreundin in Stuttgart an. Und während ich meinen ganzen Ehrgeiz in Hanno steckte, bekam ich gar nicht mit, dass Tomek nach und nach vor die Hunde ging.
Okay, kurz darauf lief er sowieso zu Edith über. Daher fand ich auch nicht, dass ich irgendwie schuld an seiner depressiven Phase war. Passierte halt im Leben, dass einer den anderen verließ. Mich hatte man auch mehr als einmal abserviert. Reichlich brutal sogar. Da sollte mir jetzt bitte schön keiner kommen und die Schuld in die Schuhe schieben!
Edith
Konrad kam erst gegen zweiundzwanzig Uhr nach Hause. Emmy und Fritz schliefen schon seit Stunden, nur Zoé war gerade aufgewacht und krakeelte lautstark. So hörte ich gar nicht, wie die Tür aufgeschlossen wurde.
Irgendwann stand Konrad einfach im Schlafzimmer, ein getoastetes und gebuttertes Brot zwischen den Zähnen, und lächelte mich derart gut gelaunt an, dass ich es nicht übers Herz brachte, ihm die schlechte Nachricht mitzuteilen. Um überhaupt irgendetwas zu tun, begann ich Zoé zu schütteln. Mit gestreckten Armen hielt ich sie von mir ab und schüttelte sie sanft – bloß nicht weinen! Endlich nahm Konrad den Toast aus seinem Mund.
»Neue Erziehungsmethoden?« Er lächelte immer noch.
Anstatt etwas zu erwidern, knöpfte ich meine Bluse auf, schob den BH hoch und legte Zoé an. Augenblicklich verstummte das Geschrei, und ein wohliges Schmatzen setzte ein. Einen Moment lang war es ruhig.
»Hast du gegessen?«
Konrad schüttelte den Kopf. Für den Bruchteil einer Sekunde wurde sein Mund schmal. »Eigentlich wollte ich mit dem Kunden essen gehen. Daraus sind dann ein, zwei Cocktails geworden und das Essen …« Er hob entschuldigend die Schultern.
»Ich kann dir die Suppe warm machen. Salat ist auch noch da.«
»Danke. Lass mal.« Konrad lockerte seine Krawatte. Er trug die grün-orange-gemusterte, die ich ihm zu unserem zehnten Hochzeitstag geschenkt hatte. Mit der anderen Hand hielt er immer noch den Toast, biss aber nicht davon ab.
»Hast du versucht, mich zu erreichen?«
Ich nickte.
»Manche Kunden reagieren empfindlich, wenn ständig das Handy klingelt. War was –?«
Ohne meine Antwort abzuwarten, ging Konrad raus und streifte dabei ungelenk sein Sakko ab.
Nein, eigentlich war nicht groß was passiert. Emmy hatte genervt, Fritz Durchfall, Zoé wollte sich nicht abstillen lassen, und dann war auch noch Tomek gestorben.
Milena
Ich las, ohne zu lesen. Fünfmal fünfunddreißig Minuten lang. Im Grunde genommen trug ich nur Buchstaben vor, die sich zwar irgendwie zu Wörtern zusammensetzten, aber dennoch keinen Sinn ergaben. Ab und zu schnarrte das Mikro, meistens wenn ich meinen Blick über den Saal schweifen ließ. Junge Gesichter, einige neugierig, einige abgestumpft.
Ach, vielleicht waren sie gar nicht abgestumpft, sondern nur verlegen. Weil es um Liebe ging. Um dieses unerhörte Gefühl, das einige von ihnen sicher schon kannten, aber auf das alle anderen einfach nur neugierig waren. Doch da man sich schämte, dass Dinge ausgesprochen wurden, von denen man nur träumte, tat man eben besonders cool. Einer versuchte den anderen im Coolsein zu übertrumpfen, egal, ob man vorgab, nicht zuzuhören, oder schlurfend den Raum verließ. Anders die Mädchen. Liebe war ihnen nicht peinlich. Zumindest nicht vor ihren Klassenkameraden. Denn diese Babys kamen als potenzielle Lover sowieso nicht in Frage.
Heute war nicht mein Tag. Bei der zweiten Lesung begann ich mich zu verhaspeln, bei der dritten war ich heiser.
Wie kam ich überhaupt dazu, diesen Jugendlichen hier etwas über Liebe vorzulesen? Ausgerechnet ich? Was hatte ich denn in dieser Hinsicht schon groß auf die Beine gestellt? Nach der ersten Zweijahresbeziehung während des Studiums eine gescheiterte Ehe. Seit nun mehr sechs Jahren zwei, drei kurzlebige Affären. Was war bloß mit den Männern los? Oder stimmte irgendetwas mit mir nicht? Vielleicht war ich einfach nicht mehr beziehungstauglich? Zu anstrengend geworden in all den Jahren, eigenbrötlerisch wie eine alternde Diva. Natürlich hatte ich bestimmte Vorstellungen von einer Partnerschaft. Beispielsweise würde ich nie im Leben die klassische Rollenverteilung akzeptieren und mich nicht unterbuttern lassen, nur – verstand sich das nicht sowieso von selbst?
Ach, wahrscheinlich nicht … Man musste sich nur mal Edith angucken. Ihre Karriere hatte sie zugunsten Konrads und der Kinder an den Nagel gehängt. Stattdessen wischte sie jahrelang Popos ab, und sobald ein Popo auch nur ansatzweise nicht mehr wischbedürftig war, schaffte sie sich sofort einen neuen an. Drei Popos, das machte netto neun Jahre Popoabwischen. Außerdem spielte sie Putzfrau und Köchin und bügelte auch noch ihrem Mann die Hemden. Doch statt Konrad darauf vorzubereiten, dass er seine Hemden demnächst selbst bügeln musste, sprach sie davon, einen Kurs für Fensterbilder an der Volkshochschule zu belegen. Fensterbilder! Man stelle sich nur vor! Wenn sie wenigstens ihr Italienisch, mit dem sie in allen Lebenslagen kokettierte, aufpolieren würde, aber ausgerechnet Fensterbilder! Ganz abgesehen davon war sie seit neuestem in der Mütter-Läuse-Arbeitsgruppe aktiv. Kindern die Köpfe nach Läusen absuchen. Auch schön. Und das als Betriebswirtin mit Diplom.
Eines Tages würde sie sich noch wundern. Wenn es dann hieß, Mama, ich will Geld. Alle meine Freundinnen haben ein Auto, warum eigentlich ich nicht? Dann würde sie schon merken, dass die Jahre einfach vorübergezogen waren und sie es irgendwie gar nicht mitbekommen hatte. Eben noch hatte sie Zoé gestillt, schon brachte ihr Augenstern den ersten Liebhaber mit nach Hause. So würde es sein. Und ich würde sagen: Guck, Edith, ich hab mein Leben wenigstens in irgendwelchen drittklassigen Hotels verbracht und meine Figur mit Snickers ruiniert. Wenn schon nicht mit Kinderkriegen.
Edith
Konrad verschwand einfach. Ich hatte es ihm noch am selben Abend gesagt, doch statt irgendetwas zu erwidern, statt sich an mich zu lehnen oder vielleicht sogar mal ein bisschen zu weinen, ging er wortlos ins Schlafzimmer und packte eine kleine Reisetasche. Dann verließ er ebenso wortlos das Haus.
Nicht dass es mir egal gewesen wäre, aber wenn dies seine Art war, mit Trauer umzugehen, musste ich es eben akzeptieren. Vor ein paar Jahren hätte ich ihm garantiert noch eine Szene gemacht. Warum sagst du nichts? Nun sag endlich was! Das kannst du nicht machen, Konrad, nicht mit mir! Aber nach und nach war mir klar geworden, dass es einfach nichts brachte, ihn zu bedrängen. Außerdem war es ja nichts Neues, dass sich Konrad aus dem Staub machte. Manchmal, wenn wir uns gestritten hatten, haute er auch einfach ab. Nahm sich für ein, zwei Nächte irgendwo im Zentrum ein Hotel, und wenn er wiederkam, war alles okay. Zumindest für ihn. Natürlich hätte ich gerne mit ihm darüber geredet, doch da ich wusste, dass auch das zu nichts führte, ließ ich ihn in Ruhe. So kamen wir immer noch am besten miteinander klar.
Nur eins nervte mich wirklich. Dass er mich ausgerechnet in dieser Situation hängen ließ. Immerhin war Tomek sein Freund gewesen, und falls jetzt Anfragen seitens der Familie kamen, würde ich das alles alleine managen müssen. Hält Konrad eigentlich eine Rede? Sicher weiß er ja die eine oder andere Anekdote über Tomek zu berichten. Oder vielleicht du, Edith? Komm, nur ein paar Schmankerl aus eurer gemeinsamen Schulzeit …
Nein, verdammt, ich wusste nichts und wollte auch nichts wissen. Gott sei Dank hatte Tomeks Bruder bisher noch kein Wort über das Thema Beerdigung verloren. Wahrscheinlich standen noch nicht mal Datum und Ort fest. Möglich, dass er den Leichnam auch erst in Tomeks Geburtsstadt Danzig überführen und dort bestatten lassen würde. Zwar lebten die Eltern nicht mehr, aber Tomek hatte es mindestens einmal pro Jahr zurück in die Heimat gezogen.
Um mich abzulenken, brachte ich Emmy zu ihrer Nachbarsfreundin Laura und fuhr mit Fritz und Zoé zu einer Bekannten aus der Krabbelgruppe nach Charlottenburg. Linda war zwar nicht gerade das, was ich mir unter einer echten Freundin vorstellte, aber alles in allem doch gut genug, um mir durch den Tag zu helfen. Zumal sie einen Sohn in Fritz’ Alter hatte und die beiden sich gut miteinander zu beschäftigen wussten.
Linda kochte immer Lapachotee, wenn ich zu Besuch kam. Einmal hatte ich den Fehler gemacht und ihr gesagt, der Tee schmecke ja interessant – von dem Zeitpunkt an gab es nur noch Lapachotee. Irgendwie musste sie sich in den Kopf gesetzt haben, dieses Gebräu sei neuerdings mein Lieblingsgetränk. Dabei war mir meistens eher nach einem starken Kaffee zumute, heute sogar nach Kaffee und Schnaps. Doch wie nicht anders zu erwarten, setzte Linda sofort Teewasser auf und holte die chinesisch angehauchte Teedose aus dem Schrank. Das nächste Mal würde ich sie zu mir einladen und ihr eine Kaffee-dröhnung verpassen, dass ihr Hören und Sehen verging.
Wie jedes Mal tauschten wir Neuigkeiten über die Kinder aus, doch ich war nicht ganz bei der Sache. Immer wieder kam mir die schreckliche Sache mit Tomek in den Sinn. Was wusste ich eigentlich über ihn? Im Grunde nicht sehr viel. Außer dass ich ihn schon so lange kannte, dass er bereits zum Inventar gehörte und deshalb so gut wie keine Konturen mehr hatte. Vielleicht war es ein Fehler, sich über Leute, die man derart lange kannte, keine Gedanken mehr zu machen. Sie als Freunde hinzunehmen, einfach weil sie schon ewig präsent waren.
Geredet hatten wir eigentlich nie viel. Denn Tomek steuerte immer als Erstes Emmys roten Stuhl an, er verschraubte seine langen dünnen Beine ineinander, und weil auch sein Körper so entsetzlich mager wirkte, stellte ich ihm jedes Mal sofort etwas zu essen hin. Mütterlichen Umsorgungstrieb nannte Tomek das scherzhaft. Bis Konrad dann auftauchte, aß er entweder oder beschäftigte sich mit den Kindern.
Tja – und so kamen wir eigentlich nie zum Reden. Außer Sätzen wie »Na ja, vielleicht haben wir den Winter ja bald geschafft« oder »Alles klar in der Schule?«, »Ja, ja, alles klar«, manchmal noch: »Wie geht’s dir denn so?«, »Ja, geht mir gut. Die vielen Konferenzen, mhm … Und dir?«, herrschte totales Schweigen. Nicht, weil wir uns nicht mochten, sondern eher, weil wir uns keine Mühe gaben, geben mussten. Denn nach dem Essen nahm Fritz Tomek in Beschlag, und wenn der keine Lust hatte, spielte Emmy bei ihm Klette. Es sei denn, Konrad war schon von vornherein anwesend. Dann verschwanden Tomek und er sofort im Arbeitszimmer und rauchten Zigarillos, bis der Qualm unter der Tür hervorquoll.
Wie gesagt, sie waren schon immer beste Freunde gewesen – was sollte ich mich da groß einmischen? Nur weil wir früher alle im selben Jahrgang gewesen waren, und ich mal … Ach, das war einfach zu lange her, um überhaupt von Bedeutung zu sein.
Romi
Zwei Tage später hatte ich dann diesen Brief im Briefkasten. Reichlich makaber. Warum quälte mich Tomek so? Was sollte das? Ich war derart fix und foxy, dass ich sofort Edith anrief, aber die trieb sich wieder mal irgendwo in der Stadt rum. Das ärgerte mich am meisten an diesen angeblichen Hausfrauen. Dass sie nie mal zu Hause rumwurschtelten, wenn man sie wirklich brauchte.
Nur deshalb musste André herhalten, ganz ehrlich. Ich hatte es nämlich schon eine ganze Weile geschafft, ihn nicht anzurufen. Und ihn auch nicht zurückzurufen, wenn er mir aufs Band quatschte. Aber jetzt brauchte ich ihn. Wollte einfach nur, dass er sich für den Abend mit mir verabredete. Bloß nicht alleine sein mit all den üblen Gedanken.
Scheiße … natürlich hatte André keine Zeit. Er fragte auch nicht, Süße, warum hast du dich nie gemeldet?, sondern sagte nur bestens gelaunt, er habe keine Zeit. Punkt und fertig. Erst auf mein Nachfragen bequemte er sich, eine Erklärung vom Stapel zu lassen. Im Moment sei er gerade an den Aktienkursen dran, das würde ihn bestimmt noch zwei, drei Stunden in Beschlag nehmen, und am Abend gäbe er ein Motivationsseminar in Berlin Mitte. Na, bingo. Das mit den Motivationsseminaren kannte ich ja schon, aber seit wann turnte André auch noch an der Börse rum? Zumal er sich doch eigentlich Videokünstler schimpfte und immer noch völlig konzeptlos an der Uni herumstudierte?
Nach einigem Hin und Her einigten wir uns schließlich darauf, dass André nach seinem Seminar vorbeigucken würde. Einigermaßen erleichtert legte ich auf. Würde es nicht ertragen, die Nacht allein zu verbringen. Ein Mensch, der neben mir atmete, war ja wohl das Mindeste, was ich an so einem Tag erwarten konnte.
Netterweise erbarmte sich Katrin und trank nach der Arbeit den obligatorischen Kingsize mit mir. So war die Zeit von siebzehn bis achtzehn Uhr wenigstens gerettet. Wenn ich gegen neunzehn Uhr nach Hause kam, stand sowieso noch Putzen auf dem Programm, vielleicht drehte ich dazu ein bisschen Bach auf, und dann würde auch schon André antanzen.
Keine Ahnung, was ich mir überhaupt davon versprach. Ich mein, als Seelentröster war André schon immer eine ganz miese Nummer gewesen. Andererseits musste ich die Sache mit dem Brief endlich mal loswerden. Zur Trauerfeier hinfahren? Nicht hinfahren? Mich totstellen und so tun, als ob ich den Brief nie gekriegt hätte?
Katrin bestellte noch einen Muffin zum Kaffee, und während sie in Zeitlupe die Streusel mit den Zähnen abschabte, fragte sie mich, ob ich nicht Lust hätte zu unterrichten.
»Wie – was denn?«
»Klassisch. Was sonst.«
Ja, was sonst. Nur wollte ich ums Verrecken nicht unterrichten. Ich würde es einfach nicht aushalten, mir tagein, tagaus die begabten Eleven und Elevinnen anzugucken, die alles noch vor sich hatten. Den Erfolg, aber auch die blutigen Füße. Lieber versauerte ich da an meiner Kasse und verkaufte Karten für Don Giovanni.
»Hat Vladimir etwa das Handtuch geworfen, oder warum fragst du?«
»Romi, ich rede nicht von der Oper.« Katrin biss ein winziges Stück von ihrem Muffin ab und kaute mit affig gespitzten Lippen. »Kennst du dieses neue Luxus-Fitnessstudio? Potsdamer Platz?«
»Du spinnst.«
»Warum denn?« Total ungläubiges Lächeln.
Tja, und dann konnte ich leider nicht anders. Ich stellte meinen Kingsize ab, gab Katrin eine Ohrfeige und verließ ohne zu zahlen den Coffeeshop.
Natürlich entschuldigte ich mich noch am selben Abend. Genauer gesagt, gleich als ich nach Hause kam, und dann war auch alles gar nicht weiter schlimm. Katrin verzieh mir sogar die Ohrfeige, und ich verzieh ihr im Gegenzug, dass sie mir das Angebot mit dem Fitnessstudio gemacht hatte. Klar – war ja nicht böse gemeint. Aber richtig nett auch nicht. Denn war ich wirklich schon so weit gesunken, dass ich durch Fitnessstudios tingeln musste, nur um noch was mit Tanzen zu tun zu haben? Und wenn der Job auch nur ansatzweise in Frage kam, warum hatte sie dann nicht selbst zugegriffen? Katrin war doch nicht so gestrickt, dass sie aus reiner Nächstenliebe auf die Chance ihres Lebens verzichtete! Früher im Ballettsaal hatte sie zumindest auch gnadenlos alle Register gezogen, bloß um eine Rolle zu ergattern. Zum Beispiel mit unserem Choreographen Henri geschlafen – zwar nicht schwul, aber auch nicht bestechlich. Den Sex hatte er mitgenommen, nur die Rolle kriegte dann ich. Ätsch, liebe Katrin. Doch dafür musste sie sich ja nicht jetzt, Jahre später, rächen.
Aber ich wollte nun wirklich keinen Zoff mit ihr. Immerhin war Katrin meine Kollegin, die einzig akzeptable übrigens, und deshalb war mir auch an einem halbwegs freundschaftlichen Verhältnis gelegen. Mal zusammen einen Kingsize trinken zu gehen – das war doch schon was wert.
Milena
Ich fuhr ja reichlich oft Zug. Von Berlin nach Bonn und retour. Von Berlin nach Erfurt und retour. Nach Hamburg und nach Bremen. Nach Halle. Kreuz und quer durch Deutschland. Fliegen lohnte sich meistens nicht. Rein von der Zeitersparnis her.