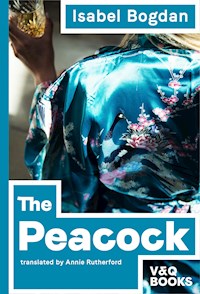Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit Helgoland verbindet Isabel Bogdan eine innige Schreibbeziehung. Oft schon ist sie in Hamburg auf den Katamaran gestiegen, der sie zu "Deutschlands einziger Hochseeinsel" bringt. Denn dort, mit Rundumblick aufs Meer, schreibt es sich viel besser als am heimischen Schreibtisch (wo sie dafür problemlos übersetzen kann). Doch warum ist das so? Nähert man sich einer Geschichte auf dieselbe Weise, wie man eine Insel für sich entdeckt? Auf welcher Seite der Insel beginnt man – und wie findet man in einen Roman? Isabel Bogdan erzählt nicht nur von den Besonderheiten kleiner Inselgemeinden, von Helgolands wechselvoller Historie, von seltenen Vögeln oder Geheimrezepten gegen Seekrankheit. Vielmehr spannt sie den Bogen vom Schaffen des berühmtesten Helgoländer Geschichtenerzählers James Krüss zu der Frage, was gutes Erzählen eigentlich ausmacht und ob man es erlernen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isabel Bogdan
Mein Helgoland
© 2021 by mareverlag, Hamburg
Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann, mareverlag
Coverabbildung Ilyabolotov/iStock.com
Typografie (Hardcover) mareverlag, Hamburg
Datenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-800-7
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-654-6
www.mare.de
Irgendwo ins grüne Meer
Hat ein Gott mit leichtem Pinsel
Lächelnd, wie von ungefähr,
Einen Fleck getupft: Die Insel!
Und dann hat er, gutgelaunt,
Menschen diesem Fels gegeben
Und den Menschen zugeraunt:
Liebt die Welt und lebt das Leben!
James Krüss
Der Hotelier sagt, das ist kein Wind. Ich versuche, die Basstölpel zu fotografieren, aber der Wind, der keiner ist, schlägt mir immer wieder die Kamerahand weg. Ich habe meine Kapuze festgezurrt und lehne mich bei jedem Schritt nach vorn, um überhaupt voranzukommen.
Der Hotelier aber sagt, das ist kein Wind. Er erzählt, dass sie sich früher, als Kinder, wenn richtig Wind war, hier oben im Oberland am Zaun festgehalten haben und dann waagerecht in der Luft geflattert sind. Überhaupt ist der Hotelier ein großer Geschichtenerzähler, was vielleicht kein Wunder ist: Er ist ein Neffe von James Krüss, dem größten Geschichtenerzähler der Insel und vermutlich überhaupt bekanntesten Helgoländer.
Was mich fast von den Klippen pustet, was mich voranschiebt oder mir den Weg versperrt und mir den Atem raubt, ist kein Wind. Man meint ja auch immer, die Sonne sei gar keine Sonne, wenn dazu ein frischer Wind weht, aber hinterher hat man dann doch Sonnenbrand und so ein Sausen in den Ohren.
Auf Helgoland kann man immer und von überall aus das Meer sehen. Im Oberland sogar fast rundum, in alle Richtungen, man steht hoch oben und blickt in dieses unendliche Blau, oder vielmehr diese unendlichen Blaus. Hellblau, Dunkelblau, Mittelblau, Knallblau, Königsblau, Azurblau, Babyblau, Glitzerblau, Himmelblau, Eisblau, Grünblau, Graublau, Fastschwarz, Fastweiß, Marineblau, Blaublau, Türkis, Petrol … man findet schon bald keine neuen Vokabeln mehr. Dazu pustet der Wind einem sofort alles aus dem Kopf, was da nicht drin sein soll, alles, was einem nicht guttut, schlechte Laune, schlechte Gedanken oder Erkältungen. Stattdessen macht sich sofort eine große Ruhe breit und ein großes Glück. Da oben passiert es mir regelmäßig, dass ich einfach lachen muss, nur weil Wind und Blau ist. Lachen, weil der Wind so toll ist und das Blau so blau und alles andere weit weg.
Und dann kommt man an den Vogelfelsen, und aus dem Lachen wird Staunen. Der Helgoländer Lummenfelsen ist Deutschlands kleinstes Naturschutzgebiet, und wahrscheinlich auch das hochkanteste. Stundenlang kann man dort stehen und den Basstölpeln bei ihren Flugmanövern zuschauen, es wirkt, als würden sie das zum Spaß machen. Sie bewegen die Flügel fast gar nicht, sie breiten sie nur aus und stehen in der Luft, und nicht mal die stärkste Windbö kann ihnen etwas anhaben, sie ändern dann eben kurz die Richtung, mit minimalen Flügelbewegungen. Und dann stürzen sie sich kopfüber ins Wasser und kommen mit einem Fisch wieder hoch, und man steht da und staunt und lacht, wegen des Windes, der keiner ist, und ist ganz weit weg von allem. Dabei sind es nur vier Stunden mit dem Schiff von Hamburg aus.
Es geht so schnell. Mit der S-Bahn an die Landungsbrücken, dort steigt man auf den Katamaran, und sobald man auf einem Schiff ist, fängt der Urlaub ja schon an, anders als bei allen anderen Verkehrsmitteln. Bei allen anderen Verkehrsmitteln ist die Reise an sich eher anstrengend, ein notwendiges Übel. Auf einem Schiff hingegen ist sofort Urlaub. Allerdings fahre ich meistens gar nicht zum Urlaubmachen, sondern zum Schreiben nach Helgoland. Weil dort nämlich nichts ist. Nicht mal Wind.
»Beim Geschichtenschreiben muss man allein sein. Hunde stören dabei. (Aber Katzen nicht.)«, schreibt James Krüss in Mein Urgroßvater und ich. Darin wird der Urenkel für zwei Wochen zu seinem Urgroßvater ausquartiert, weil seine Schwestern die Masern haben und er sich nicht anstecken soll. Sowohl der Urgroßvater als auch der Enkel heißen Boy, und der Urgroßvater ist ein ehemaliger Hummerfischer. Auch er ist ein großer Geschichtenerzähler und Dichter, und so sitzen die beiden Boys also in der Hummerbude und erzählen sich Geschichten, oder sie dichten gemeinsam. In all diesen Geschichten und Gedichten geht es um Wörter und Sprache und ums Erzählen. Der zweite Band, Mein Urgroßvater, die Helden und ich, dreht sich um Helden. Was ist ein Held, was macht ihn aus? Um es gleich vorwegzunehmen: Der Held ist im Normalfall ein Mann. Aber das wollen wir mal gnädig darauf schieben, dass James Krüss 1926 geboren wurde, da gab es ja praktisch noch gar keine Frauen.
James Krüss, bzw. in dem Fall der Urgroßvater, war sicher ein kluger Mann, und vor allem verstand er etwas vom Schreiben. Aber was Hunde und Katzen angeht, möchte ich ihm doch widersprechen. Ein Hund würde mich vermutlich nicht stören, mich stört nicht mal ein Mensch, solange er ebenfalls schreibt; im Gegenteil, es tut mir sogar ganz gut, wenn neben mir noch eine Tastatur klappert oder gerade nicht klappert, denn es ist tröstlich zu hören, dass »Schreiben« auch bei anderen Leuten nicht bedeutet, dass es pausenlos klappert. Man muss zwischendurch auch viel ächzen und stöhnen und sich die Haare raufen oder stumpf auf den Monitor glotzen. Was aber stört beim Schreiben, ist der Hund Alltag. Vor dem muss man gelegentlich fliehen, einfach woanders sein, wo einen niemand kennt und nichts ablenkt. Außer dem Wind, der keiner ist, und den Robben und Basstölpeln und Trottellummen und dem ganzen Blau. Der Alltag stört, vor ihm braucht man seine Ruhe, und die kann man durchaus in Gesellschaft haben. (Außer in der von Katzen, da bekomme ich nämlich keine Luft.) Damit bin ich auch nicht die Einzige, viele Autorinnen und Autoren fahren zum Schreiben am liebsten weg. Vielleicht, weil man in einem Ferienhaus oder Hotelzimmer nur das Nötigste um sich hat, nicht all die unerledigten Dinge, die Waschmaschine, die Steuer, die Unordnung auf dem Schreibtisch, die ungeputzten Fenster, die brachliegende Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Man kann sich auf das Wesentliche konzentrieren. Mit einer anderen Aussicht als sonst. Es schadet nämlich durchaus nicht, beim Arbeiten aufs Meer zu gucken. Aufs Meer gucken schadet nie.
Ich glaube sogar, dass es insgesamt nicht schadet, anderswo hinzugucken als sonst. Viele Jahre habe ich allein zu Hause am Schreibtisch gesessen und Bücher übersetzt. Da saß ich gut, ich mag mein Arbeitszimmer. Aber als ich anfing, selbst zu schreiben, stellte ich irgendwann fest, dass ich das so gut wie nie am Schreibtisch tat. Ich zog mit dem Laptop ins Esszimmer, ins Bett, auf den Balkon, in die Küche, aufs Sofa. Saß mal hier, mal da, stand zum Denken auf und lief herum, setzte mich anderswo wieder hin. Ich schrieb überall, nur nicht am Schreibtisch. Sobald ich übersetzte, saß ich wieder dort. Das mag einerseits damit zusammenhängen, dass ich beim Übersetzen das zu übersetzende Buch auf einem Ständer neben dem Computer stehen habe, damit ist das Herumziehen schon aus praktischen Gründen weniger einfach. Aber ich denke auch immer wieder darüber nach, ob es damit zu tun hat, den Blickwinkel zu ändern.
Beim Übersetzen ist alles schon da, es steht alles im Buch, ich muss mich konzentrieren und das, was da auf Englisch gesagt wird, in meiner eigenen Sprache neu formulieren. Beim Schreiben habe ich den Input nicht direkt vor der Nase, aber ich brauche welchen, bevor ich einen Output produzieren kann, ich brauche offenbar veränderte Blickwinkel. Nicht dass der Anblick meiner Küche wahnsinnig neu wäre, oder der auf meine verlausten Balkonpflanzen besonders inspirierend. Aber irgendwie anscheinend doch.
Ist das so? Braucht man zum Übersetzen mehr Konzentration, zum Schreiben mehr Inspiration? Sind Ortswechsel inspirierend, auch innerhalb der eigenen Wohnung? Was soll das überhaupt sein, »Inspiration«? Thomas Alva Edison soll gesagt haben, »Genie« bestünde aus einem Prozent Inspiration und neunundneunzig Prozent Transpiration. Man weiß halt nicht, ob das eine Prozent einen nun am Esstisch oder im Bett überkommt. Calvin (von Calvin and Hobbes) sagt, zum Schreiben müsse man in der richtigen Stimmung sein, und die richtige Stimmung sei »Last Minute Panic«. Da ist etwas dran, jedenfalls bei mir, ich brauche Druck. Termine. Deadlines. Und neue Aussichten, wie es scheint. Ich habe keine Ahnung, was Inspiration ist und woher sie kommt, aber ich weiß, dass ich zum Schreiben am besten wegfahre. Allein, zu zweit, zu mehreren, und am allerliebsten mit Blick aufs Meer.
Und wenn Alleinsein zum Schreiben völlig in Ordnung ist, so ist die Einsamkeit auf Lesereisen etwas ganz anderes. Man braucht in einer Runde von Schreibenden nur das Wort »Lesereiseneinsamkeit« fallen zu lassen, dann seufzen sofort alle »Oh ja«. Ich liebe Lesereisen. Nach monate- oder jahrelanger Schreibtischarbeit rauszugehen und das fertige Buch in die Welt zu tragen, Menschen zu begegnen und ihnen die eigene Arbeit vorzustellen, das ist grandios. Ich sitze gern auf der Bühne, unterhalte mich mit dem Publikum, tausche mich mit Leserinnen und Lesern aus, und das ist etwas ganz Besonderes und Großes. Aber dann sind nach der Lesung alle wieder weg, und mit ein bisschen Pech hat man vergessen, sich vorher noch eine Apfelschorle zu kaufen, und sitzt mit Leitungswasser aus dem Zahnputzbecher im Hotelzimmer. Am nächsten Morgen Hotelfrühstück mit schwitzenden Käsescheiben und angetrockneter Mortadella (für mich eher Müsli, hoffentlich etwas Obst und ein Kaffee), danach klappt man den Koffer zu, zieht ihn über Kopfsteinpflaster zum Bahnhof und reist in die nächste Kleinstadt, sucht das nächste Hotel, sucht sich etwas zu essen, sucht die Buchhandlung, weiß aber nicht, ob die Buchhändlerinnen nach der Lesung noch essen gehen möchten, holt sich was vom Bäcker oder vom Supermarkt, denn um sechs Uhr allein ins Restaurant gehen ist auch nicht toll. Dann abends wieder Lesung, da ist man wieder wie angeknipst und voll mit Adrenalin und Endorphinen. Hinterher gibt es eventuell Pizza mit den Buchhändlerinnen, abends um zehn, und dann mit schwerem Magen ins nächste Hotelbett. Das ist alles sehr schön, einerseits, andererseits denke ich manchmal: Ich wäre gern eine Band. Dann hätte ich nach dem Auftritt ein paar Vertraute um mich, um den Abend ausklingen zu lassen, vielleicht noch ein, zwei Bier zu trinken und morgens gemeinsam über die grantigen, einsamen Geschäftsmänner in Anzügen im Frühstücksraum zu lästern. Glücklicherweise sind die Buchhändlerinnen, die einen einladen, meistens ausgesprochen reizend, das fängt diese sonderbare Einsamkeit ganz gut auf. Am allerliebsten lese ich aber auf Festivals, wo auch andere Autorinnen und Autoren sind, die man hinterher in der Hotelbar trifft. Selbst wenn man sich noch nicht kennt – man erkennt sich, weil man die Pressefotos gesehen hat, und kann einfach fragen: »Und, wie war’s bei dir?« Man hat etwas gemeinsam und fühlt sich wenigstens ein bisschen wie eine Band.
Dass Helgoland für einen Schreibaufenthalt wunderbar geeignet ist, war von der ersten Reise an klar. Meine erste Helgolandfahrt war eine Pressereise, ich war als Bloggerin eingeladen, und der Wetterbericht hatte Sturm angekündigt. Einige Mitreisende jaulten schon vorauseilend, sie würden bestimmt seekrank. Ich werde nicht seekrank, ich werde nie seekrank, ich kenne nämlich den ultimativen Trick gegen Seekrankheit, und der lautet: Gummibärchen. Oder irgendetwas anderes zum Draufherumkauen, denn Kauen stimuliert das Gleichgewichtsorgan im Ohr. Ich werde nicht seekrank, ich habe Gummibärchen, und wenn es schaukelt, mache ich leise jippie. Tatsächlich ist kaum Wind, bei der Abfahrt nieselt es ein wenig, hört aber gleich wieder auf. Und noch vier volle Stunden bis Helgoland. Ich freue mich, an den Tagen davor hatte ich ein bisschen Ärger und kann das Meer jetzt gut gebrauchen. Ich stehe am Heck des Schiffs draußen und lasse mich durchpusten. Auf der Elbe darf der Katamaran nicht so schnell fahren, wie er kann, aber sobald man an Cuxhaven vorbei ist und aufs offene Meer kommt, prescht er in beeindruckendem Tempo los. Die See ist ruhig, nach und nach reißt der Himmel auf, die Sonne kommt heraus, und ich lasse meinen Kummer an Land. Wie das Meer das wohl macht? Wenn ich schlecht drauf bin, wenn ich Kummer habe oder Herzschmerz, dann bringt mich ans Meer, und wenn keins da ist, an irgendein anderes Wasser, es funktioniert immer. Erst recht bei so herrlichem Wetter.
Irgendwo auf offener See dürfen wir auf die Brücke, wir halten ein kleines Schwätzchen mit dem Kapitän, er erklärt uns dies und das. Eine Kollegin fragt, ob wir auch mal steuern dürfen, aber aus irgendeinem Grund hat dann nicht sie die Hand auf dem Steuerknüppel, sondern ich. Der Kapitän hat vorher allerdings schnell auf irgendein Knöpfchen gedrückt. »Jaja«, sage ich, »jetzt haben Sie den Autopiloten eingeschaltet, und ich soll mir einbilden, das Schiff zu steuern?« – »Nein«, sagt er, »im Gegenteil, ich habe den Autopiloten ausgeschaltet, sehen Sie?« Er legt seine Hand auf meine, schiebt den Steuerknüppel bis zum Anschlag nach rechts, und das Schiff macht einen wilden Schlenker. Ich dachte, so ein Schiff reagiert langsamer, aber der Katamaran hat ordentlich Fahrt drauf. Der Kapitän schiebt den Steuerknüppel nach links, das Schiff zieht nach links. Dann nimmt er seine Hand weg und sagt: »Jetzt fahren Sie mal dem weißen Schiff da hinterher.« Und ich gucke auf das weiße Schiff und versuche, ihm mit dem Katamaran hinterherzufahren, statt dass ich mich am Radar orientiere, das wäre wahrscheinlich vernünftiger. Aber da könnte ich das Meer nicht richtig sehen.
Die Kollegin fragt, was denn mit dem angekündigten Sturm sei, ob der noch komme. »Ja«, sagt der Kapitän, »aber erst heute Nachmittag. Und morgen regnet es dann.« Aber ach, was verstehen Kapitäne schon von Seewetter? Nachmittags auf der Insel ist kein Wind, schon gar kein Sturm, es ist zwischendurch zwar grau und neblig, aber der Nichtwind pustet das schnell weg, und am nächsten Morgen ist alles blau, und die Insel macht wieder, was sie am besten kann: blauen Himmel, blaues Meer, weißen Sand, grünes Land, rote Klippen.
Eigentlich ist es ein bisschen langweilig, von Hamburg aus nach Helgoland zu fahren. Denn von Hamburg fährt der Katamaran (jedenfalls im Sommer), und der legt im Helgoländer Hafen an. Wenn man aber mit dem Seebäderschiff von Cuxhaven, Bremerhaven oder Büsum ankommt, wird man vor Helgoland ausgebootet. Die Schiffe ankern, und man muss in Börteboote umsteigen, eine Helgoländer Besonderheit: flache Holzboote, etwa zehn Meter lang und drei Meter breit, mit einem starken, innen liegenden Motor und Platz für vierzig bis fünfzig Personen. Man steigt vom Schiff in diese Boote und wird damit an Land gebracht. Jedenfalls im Sommer. Im Winter legen auch die Seebäderschiffe im Hafen an, denn notwendig ist dieses Ausbooten heute nicht mehr, der Hafen ist tief genug. Es wird aber aufrechterhalten, weil es Tradition ist und eine Einkommensquelle für die Helgoländer. Wie überhaupt ein Großteil der Helgoländer Wirtschaft vom Tourismus abhängt.
Blöderweise habe ich die Helgoländer Wirtschaft noch nie durch Ausbooten unterstützt. Weil ich im Sommer immer mit dem Katamaran von Hamburg aus fahre und im Winter auch die Seebäderschiffe im Hafen anlegen. Das Gute daran ist aber: Es gibt auf Helgoland sowieso nicht viel zu tun, keine große Menge an Touristenattraktionen, die man bei x Aufenthalten nacheinander abklappern könnte. Man hat relativ schnell das meiste gesehen. Lummenfelsen, Robben, Bunkerführung, Aquarium, Vogelfanggarten, Inselrundfahrt mit dem Börteboot. Das war’s eigentlich. So gesehen ist es schön, dass ich das ein oder andere noch vor mir habe, obwohl ich schon so oft dort war, zum Beispiel das Ausbooten.
Schon auf dieser ersten Reise beschlossen meine Freundin Anne, die ebenfalls als Bloggerin dabei war und ebenfalls an einem Buch schrieb, und ich: Wir müssen mal zum Schreiben herkommen. Uns zu zweit ein paar Tage in Ruhe auf diese winzige Insel zurückziehen und arbeiten.
Wir haben sofort gebucht, eine ganze Woche. Und weil wir beide aus dem Internet kommen, füllten wir unsere Blogs, Twitter und Facebook mit der Insel. Wir benutzten den Hashtag #hauptsachedasbuchwirdfertig und posteten Fotos von blauem Himmel, glitzerndem Wasser, Robben, Basstölpeln und Trottellummen, Fotos von uns selbst mit dem Laptop auf den Knien auf einer Bank vor dem Hotel in der Sonne oder am Tisch draußen vor dem Café. Dazu schrieben wir herzzerreißende Kommentare, wie irrsinnig viel wir arbeiten und was für schlimmen Stress wir haben, und hier noch ein metaphorisches Foto von der Brandung. Natürlich wussten wir, dass uns niemand glauben würde, dass wir arbeiten. Aber tatsächlich haben wir in dieser Woche enorm etwas geschafft, sind gut vorangekommen und haben außerdem schrecklich viel gekichert. Und uns nebenbei irgendwie erholt. (Die Bücher sind auch beide fertig geworden. Nicht auf der Insel, aber später.) Wir waren so produktiv und hatten so viel Spaß, dass wir für ein Jahr später gleich wieder gebucht haben.
Wir waren übrigens nicht die Ersten, die auf die Idee kamen, auf Helgoland zu schreiben. Schon August Heinrich Hoffmann von Fallersleben hat 1842 hier das Lied der Deutschen