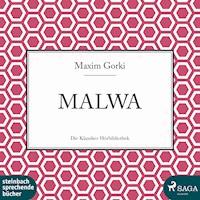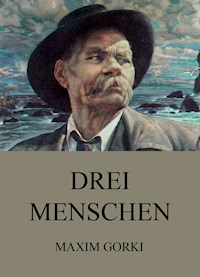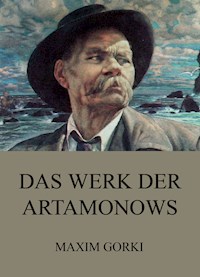2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Große Klassiker zum kleinen Preis
- Sprache: Deutsch
Das Leben meint es nicht gut mit dem kleinen Alexej: Seine Mutter lässt ihn zurück, sein Großvater setzt ihm übel zu. Nur bei der Großmutter findet er Güte und Geborgenheit und durch sie einen Weg hinaus aus Elend und Bigotterie. Maxim Gorkis ungeschönter Rückblick auf seine ersten zehn Lebensjahre ist das berührende Porträt einer Zeit, eines Milieus, einer Familie und eines Kindes und darin ein einprägsames, bildhaft erzähltes Werk voller Strahlkraft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Maxim Gorki
Meine Kindheit
Aus dem Russischen von August Scholz
Anaconda
Titel der russischen Originalausgabe: Детство (1913/1914)
Die Übersetzung von August Scholz erschien zuerst 1917 bei Ullstein in Berlin und folgt hier der Ausgabe Frankfurt a. M.: Europäische Verlagsanstalt 1959. Orthografie und Interpunktion wurden auf neue Rechtschreibung umgestellt.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2020 by Anaconda Verlag, einem Unternehmen
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotiv: Nikolai Petrovich Bogdanov-Belsky (1868–1945),
»The Essay« (um 1903), State Russian Museum, St. Petersburg, Russia / Bridgeman Images
Umschlaggestaltung: www.katjaholst.de
Satz und Layout: InterMedia – Lemke e. K., Heiligenhaus
ISBN 978-3-641-28759-7V002
www.anacondaverlag.de
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
1
In dem halbdunklen, engen Zimmer liegt auf dem Fußboden dicht am Fenster mein Vater, in ein weißes Gewand gehüllt und ungewöhnlich lang; die Zehen an den nackten Füßen spreizen sich seltsam, auch die Finger an den gütigen, friedlich auf der Brust ruhenden Händen sind gekrümmt; seine sonst so fröhlichen Augen sind von den schwarzen runden Scheiben der Kupfermünzen bedeckt, das freundliche Gesicht ist dunkel und ängstigt mich durch die drohend grinsenden Zähne.
Die Mutter, nur halb bekleidet, im roten Unterrock kniet auf der Erde und kämmt das lange, weiche Haar des Vaters mit einem schwarzen Kamme, der mir sonst zum Zersägen der Melonenschalen diente, von der Stirn nach dem Nacken zurück; die Mutter spricht ununterbrochen irgendetwas mit tiefer, heiserer Stimme, ihre grauen Augen sind verschwollen, und wie die Tränen so in großen Tropfen niederrinnen, scheint es fast, als ob die Augen zerschmölzen.
Mich hält die Großmutter an der Hand, eine rundliche Frau mit einem mächtigen Kopfe, in dem die großen Augen und die komisch geformte Nase auffallen; sie ist ganz schwarz und hat so etwas Weiches, und sie interessiert mich ungemein. Auch die Großmutter weint, auf eine ganz eigne, gutherzige Art, wie um der Mutter Gesellschaft zu leisten; sie zittert dabei am ganzen Leibe und zieht und stupft mich zum Vater hin; ich stemme mich dagegen und verstecke mich hinter ihr, denn mir ist so bange, so unheimlich zumute.
Ich hatte noch niemals erwachsene Leute weinen sehen und verstand nicht, was die Großmutter mehrmals wiederholte: »Nimm Abschied von deinem Vater, du wirst ihn nie wiedersehen! Er ist gestorben, mein Junge, ganz plötzlich, und viel zu früh.«
Ich war schwerkrank gewesen und eben erst wieder auf die Beine gekommen. Während meiner Krankheit hatte sich mein Vater, wie ich mich wohl erinnere, viel um mich zu schaffen gemacht; er war dabei stets heiter gewesen – dann war er plötzlich verschwunden, und statt seiner war die Großmutter, diese merkwürdige Frau, gekommen.
»Woher bist du denn gekommen?«, fragte ich sie.
»Von oben herunter, von Nishnij.«
»Bist du gegangen?«
»Auf dem Wasser kann man doch nicht gehen! Gefahren bin ich natürlich. Sei jetzt still.«
Ich wusste nicht, wie ich ihre Rede verstehen sollte. In unserem Hause wohnte oben ein langbärtiger Perser und unten, im Keller, ein alter, gelber Kalmücke, der mit Schaffellen handelte – da konnte man wohl, um von einem zum andern zu kommen, »von oben« auf dem Geländer herunterfahren oder auch, wenn man abstürzte, herunterkugeln; aber was hatte das Wasser damit zu tun? Nein, es war entschieden etwas unrichtig in dem, was die Großmutter sagte.
»Warum soll ich still sein?«, fragte ich sie.
»Weil man hier nicht herumlärmen darf«, antwortete sie gutmütig.
Es war etwas Freundliches, Heiteres, Herzgewinnendes in ihrem Wesen. Gleich vom ersten Tage an hatte ich mich mit ihr befreundet, und nun möchte ich, dass sie mit mir so rasch wie möglich dieses Zimmer verließe. Das Verhalten der Mutter bedrückt mich: Ihr Weinen und Wehklagen hat in mir ein neues, beunruhigendes Gefühl ausgelöst. Ich sehe sie so zum ersten Male – sie war sonst immer so streng, sprach wenig und war so groß, so sauber und glatt wie ein Pferd; sie hatte einen festen Körper und schrecklich starke Arme. Und jetzt bot sie einen so unangenehmen Anblick: Ganz geschwollen und zerzaust war sie, und alles an ihr war Unordnung. Das Haar, das sonst glatt gekämmt war und wie ein großer, schimmernder Kranz ihren Kopf umgab, fiel ihr teils ins Gesicht, teils auf die bloßen Schultern, und die eine, noch in einen Zopf geflochtene Hälfte baumelte gar auf das schlummernde Gesicht des Vaters hinunter. Ich stehe schon eine ganze Weile im Zimmer, sie hat mich jedoch nicht ein einziges Mal angesehen – sie kämmt den Vater und weint und schluchzt dabei in einem fort.
Schwarze Männer, die von einem Polizisten geführt werden, blicken zur Tür herein.
»Macht ihn rasch fertig!«, ruft der Polizist barsch ins Zimmer.
Das Fenster ist mit einem dunklen Tuch verhängt, das sich wie ein Segel bläht. Ich war einmal mit dem Vater auf einem Boote mit solch einem Segel gefahren. Plötzlich erdröhnte ein Donnerschlag; der Vater lachte, drückte mich fest mit den Knien zusammen und rief:
»Hab’ keine Angst, es tut dir nichts!«
Plötzlich warf sich die Mutter schwerfällig in die Höhe, sank jedoch sogleich wieder zusammen und fiel, mit dem Haar den Fußboden fegend, hintenüber, ihre Augen schlossen sich, das bleiche Gesicht wurde blau, die Zähne traten grinsend hervor, wie beim Vater, und mit schrecklicher Stimme rief sie:
»Schließt die Tür! … Alexej – soll hinaus!«
Die Großmutter schob mich zur Seite, stürzte nach der Tür und schrie den Männern zu:
»Fürchtet euch nicht, meine Lieben! Rührt sie nicht an, um Gottes willen, geht fort! Es ist nicht die Cholera – die Wehen sind’s erbarmt euch, ihr guten Leute!«
Ich versteckte mich in dem dunklen Winkel hinter dem Kasten und sah von da aus, wie die Mutter sich ächzend und mit den Zähnen knirschend am Boden wand, während die Großmutter, geschäftig um sie herumtrippelnd, voll Güte und Freude sprach: »Im Namen des Vaters und des Sohnes … Trag’s in Geduld, Warjuscha! … Heilige Mutter Gottes, Fürbitterin …«
Ich war in heller Angst: Sie trieben da auf dem Fußboden ihr Wesen, ganz dicht neben dem Vater; sie stießen gegen ihn an, sie stöhnten und schrien, und er lag unbeweglich da und schien zu lachen. Es dauerte eine ganze Weile, dieses Hin und her auf dem Fußboden; immer wieder versuchte die Mutter sich zu erheben, und immer wieder sank sie zurück; die Großmutter schnellte aus dem Zimmer wie ein großer, weicher, schwarzer Ball, und dann ertönte plötzlich im Dunkeln der Schrei eines kleinen Kindes.
»Ehre sei Dir, o Herr!«, sprach die Großmutter. »Ein Junge ist’s!« Und sie zündete eine Kerze an.
Ich muss wohl in meinem Winkel eingeschlafen sein – denn ich weiß nichts weiter von den Ereignissen jenes Tages.
Ein zweites Erinnerungsbild, das sich meinem Gedächtnis eingeprägt hat: Ein regnerischer Tag und ein öder Winkel auf dem Friedhof; ich stehe auf einem schlüpfrigen Erdhügel und blicke in die Gruft, in die man den Sarg mit dem Vater hinabgelassen hat; auf dem Boden der Gruft ist viel Wasser.
Am Grabe stehen außer mir noch die Großmutter, der Polizist, der ganz durchnässt ist, und zwei brummige Männer mit Schaufeln. Ein warmer Regen, so fein wie kleine Glasperlen, sickert auf uns nieder.
»Schaufelt das Grab zu«, sagt der Polizist und entfernt sich. Die Großmutter weinte und barg das Gesicht in dem Zipfel ihres Kopftuches. Die beiden Männer beugten sich vor und begannen hastig die Erde in die Gruft zu werfen. Das Wasser gluckste auf.
»Geh da fort«, sagte die Großmutter und fasste mich an der Schulter; ich entschlüpfte ihrer Hand – ich wollte noch bleiben. »Was bist du doch für ein Junge, ach du lieber Gott!«, klagte die Großmutter in einem Tone, der es unentschieden ließ, ob sie sich über mich oder über den lieben Gott beklagte. Lange stand sie da, schweigend, mit gesenktem Kopfe: Das Grab war bereits bis an den Rand zugeschüttet, und sie stand immer noch da.
Die beiden Männer klatschten mit den flachen Schaufeln laut auf die Graberde; ein Wind erhob sich und vertrieb den Regen. Die Großmutter nahm mich bei der Hand und führte mich zu der ein ganzes Stück abliegenden Kirche, zwischen die dicht stehenden dunklen Grabkreuze.
»Warum weinst du denn gar nicht?«, fragte sie mich, als wir bereits den Friedhof verlassen hatten. »Du solltest doch ein bisschen weinen!«
»Ich hab’ keine Lust«, sagte ich.
»Nun, wenn du keine Lust hast, dann lass es«, sagte sie leise. Ich weinte als Kind nur selten, und zwar immer nur, wenn ich mich gekränkt fühlte, nicht, wenn ich Schmerz empfand; der Vater lachte immer über meine Tränen, die Mutter aber schrie mich an:
»Du, dass du mir nicht heulst!«
Dann fuhren wir in einer Droschke zwischen dunkelroten Häusern über die breite, sehr schmutzige Straße.
Einige Tage darauf fuhren wir – ich, die Großmutter und die Mutter – in der kleinen Kajüte eines Dampfers auf einem großen Wasser dahin; mein neugeborener Bruder Maxim war gestorben und lag, in weißes Linnenzeug gewickelt und mit einem roten Band umwunden, auf einem Tische in der Ecke. Ich war auf die Bündel und Koffer geklettert und sah durch das vorspringende runde Fenster, das ganz einem riesigen Pferdeauge glich.
Hinter dem nassen Glase flutete ohne Aufhören das trübe, schäumende Wasser. Ab und zu schlug es, das Glas beleckend, gegen das Fenster.
Ich springe unwillkürlich auf den Fußboden.
»Hab’ keine Angst«, sagt die Großmutter, hebt mich mit ihren weichen Händen leicht empor und stellt mich wieder auf die Bündel.
Über dem Wasser liegt ein grauer, feuchter Nebel; irgendwo in der Ferne erscheint das dunkle Ufer und verschwindet wieder in Nebel und Wasser. Alles ringsum zittert und bebt – nur die Mutter steht fest und unbeweglich an die Kajütenwand gelehnt, die Hände im Nacken. Ihr Gesicht ist dunkel, wie von Eisen, die Augen sind fest geschlossen; sie schweigt beharrlich und ist überhaupt eine andere, neue – selbst das Kleid, das sie trägt, ist mir unbekannt.
Immer wieder sagt die Großmutter zu ihr:
»So iss doch etwas, Warja, wenn’s auch nur ’ne Kleinigkeit ist!«
Sie schweigt und rührt sich nicht.
Mit mir spricht die Großmutter nur im Flüsterton; mit der Mutter spricht sie lauter, doch mit einer gewissen Vorsicht und Ängstlichkeit und auch nur sehr wenig. Es scheint mir, als fürchte sie sich vor der Mutter. Das kann ich wohl begreifen, und es bringt mich der Großmutter noch näher.
»Saratow!«, rief die Mutter plötzlich laut und wie im Zorn. »Wo ist der Matrose?« Was für seltsame, fremde Wörter sie im Munde führt: Saratow, Matrose …
Ein breitschultriger, grauhaariger Mann in blauem Anzug trat in die Kajüte ein. Er brachte einen kleinen Kasten, den die Großmutter ihm abnahm: Sie legte den toten kleinen Bruder hinein, schloss den Kasten und trug ihn auf den ausgestreckten Armen zur Tür hinaus. Sie war so dick, dass sie nur seitwärts gehen, unter allerhand komischen Drehungen die schmale Kajütentür durchschreiten konnte.
»Ach, Mama!«, schrie die Mutter sie an und nahm ihr den kleinen Sarg aus den Händen. Beide verschwanden dann, ich aber blieb allein in der Kajüte zurück und betrachtete den Mann im blauen Anzug.
»Na, Kleiner, dein Brüderchen ist nun fort!«, sagte dieser, während er sich über mich neigte.
»Wer bist du?«
»Ein Matrose.«
»Und wer ist Saratow?«
»Saratow ist eine Stadt. Guck’ mal durchs Fenster – da ist sie!«
Ich sah hinaus und erblickte festes Land: schwarz, zerrissen, vom Nebel rauchend – wie eine große Schnitte, die eben von einem frischen Brotlaib abgeschnitten worden ist.
»Wohin ist denn die Großmutter gegangen?«
»Ihren Enkel will sie begraben.«
»Er wird in die Erde vergraben, nicht?«
»Gewiss, gewiss! In die Erde.«
Ein lautes Fauchen und Heulen ertönte über uns. Ich wusste schon, dass das der Dampfer war, und erschrak nicht. Der Matrose ließ mich hastig auf den Fußboden gleiten und eilte rasch davon.
»Ich muss fort!«, rief er mir noch zu.
Auch ich wollte fort aus der Kajüte und trat vor die Tür. Der halbdunkle, schmale Gang davor war ganz leer. Nicht weit von der Tür blinkte der Messingbeschlag an den Stufen der zum Verdeck emporführenden Treppe. Ich sah hinauf und erblickte Leute mit Bündeln und Felleisen in der Hand. Sie verließen offenbar den Dampfer – also musste auch ich ihn verlassen.
Als ich mit den andern zugleich an Bord kam, vor die kleine Brücke, die vom Dampfer zum Ufer führte, schrien alle auf mich los: »Was für ein Junge ist denn das? Wem gehörst du?«
»Das weiß ich nicht.«
Ich wurde lange hin und her gestoßen, geschüttelt und geknufft. Endlich erschien der grauhaarige Matrose, fasste mich bei der Hand und erklärte:
»Das ist ja der Astrachaner aus der Kajüte.«
Rasch trug er mich in die Kajüte hinunter, stellte mich auf die Bündel und sagte, mir mit dem Finger drohend: »Da bleibst du – und wehe dir, wenn du wieder davonläufst!«
Der Lärm über meinem Kopfe wurde immer leiser, der Dampfer zitterte und stampfte nicht mehr im Wasser. Vor das Kajütenfenster schob sich irgendeine nasse Wand. Es war dunkel und stickig in der Kajüte, die Bündel sahen wie geschwollen aus und bedrückten mich, überhaupt war es recht unbehaglich in dem engen Raum. Vielleicht wollte man mich gar für immer dalassen, ganz allein in dem leeren Dampfer?
Ich lief nach der Tür hin. Sie ging nicht auf, die Messingklinke ließ sich nicht herunterdrücken. Ich nahm eine mit Milch gefüllte Flasche und schlug mit aller Gewalt auf die Klinke. Die Flasche ging in Scherben, die Milch floss an meinen Beinen herunter und lief mir in die Stiefel.
Erbittert über meine Misserfolge, legte ich mich auf die Bündel, begann leise zu weinen und schlief mitten in meinem Kummer ein.
Als ich erwachte, stampfte und zitterte der Dampfer wieder, und das Kajütenfenster glühte wie die Sonne. Die Großmutter saß neben mir, kämmte ihr Haar, runzelte dabei die Stirn und flüsterte irgendetwas. Sie hatte sehr langes und dichtes Haar, schwarz mit bläulichem Schimmer; es fiel ihr auf Schultern, Brust und Knie und reichte bis auf den Boden hinab. Sie nahm es mit der einen Hand vom Boden auf, hielt es gleichsam wägend und kämmte mit einem hölzernen Kamm nicht ohne Mühe die dichten Strähnen; ihre Lippen verzogen sich, die dunklen Augen blitzten zornig, und ihr Gesicht erschien in dieser dunklen Haarflut so klein und lächerlich.
Heute erschien sie mir recht böse; als ich sie jedoch fragte, wie es komme, dass sie so langes Haar habe, sagte sie in demselben warmen, weichen Tone wie gestern:
»Die hat mir der liebe Gott wohl zur Strafe so lang wachsen lassen – sollst deine Qual damit haben beim Kämmen, du Sünderin! Wie ich jung war, prahlte ich mit meiner langen Mähne, und jetzt verfluchte ich sie. Schlaf’ nur noch, mein Junge, es ist noch früh – die Sonne ist eben erst aufgegangen …«
»Ich mag nicht mehr schlafen!«
»Nun, wie du willst«, sagte sie gutmütig zustimmend, während sie ihr Haar in einen Zopf flocht und nach dem Diwan sah, wo die Mutter mit dem Gesicht zur Decke lang hingestreckt lag. »Sag’ mal – wie kam’s denn, dass du die Milchflasche zerschlagen hast? Sprich aber leise!«
Sie brachte die Worte eigentümlich singend heraus, und sie prägten sich leicht meinem Gedächtnis ein. Wie Blumen waren sie, so lieb, so hell und so saftig. Wenn sie lächelte, weiteten sich die Pupillen ihrer Augen, die so dunkel waren wie Kirschen, und ein unbeschreiblich angenehmes Licht erstrahlte darin; die weißen, festen Zähne traten schimmernd hervor, und trotz der zahlreichen Runzeln in der dunkeln Haut der Wangen erschien das ganze Gesicht jugendlich und heiter. Es wurde nur durch die weiche Nase mit den aufgetriebenen Nasenlöchern und der rötlichen Spitze entstellt – die Großmutter schnupfte nämlich aus einer schwarzen, mit Silber verzierten Tabakdose und nahm auch gern ein Schlückchen. Ihre ganze Erscheinung hatte etwas Dunkles, aus ihrem Innern jedoch, durch die Augen, strahlte eine unauslöschliche, warme, fröhliche Helligkeit. Sie war gebückt, fast bucklig, und dabei sehr voll; sie bewegte sich jedoch leicht behänd, wie eine große Katze, und auch so weich war sie wie dieses freundliche Tier. Bevor sie kam, hatte ich gleichsam im Dunkel verborgen geschlafen, ihr Erscheinen jedoch weckte mich, führte mich ans Licht, verknüpfte alles rings um mich mit einem unzerreißbaren Faden, verflocht es zu einem bunten Spitzengewebe; sie ward mir vom ersten Augenblick an fürs ganze Leben teuer, stand meinem Herzen so nahe wie niemand sonst in der Welt, war mir so vertraut, so verständlich wie kein zweiter Mensch. Ihre selbstlose Liebe zur Welt machte mich reich, verlieh mir Kraft und Festigkeit für die Kämpfe des Lebens.
Vor vierzig Jahren fuhren die Dampfer noch recht langsam; unsere Fahrt nach Nishnij Nowgorod dauerte sehr lange, und ich erinnere mich noch recht gut dieser Tage, die mich in Schönheit schwelgen lehrten.
Das Wetter hatte sich aufgeheitert; vom Morgen bis zum Abend weilte ich mit der Großmutter auf dem Verdeck, unter dem klaren Himmel, zwischen den vom Herbst vergoldeten, wie mit Seidenstickereien geschmückten Ufern der Wolga. Ohne Hast, mit den Radschaufeln träg und geräuschvoll die graublaue Flut schlagend, fährt der grellrote Dampfer mit der Schaluppe an dem langen Schlepptau stromaufwärts. Die graue Schaluppe sieht ganz wie eine riesige Kellerassel aus. Unmerklich still schwebt die Sonne über die Wolga hin, von Stunde zu Stunde ist alles rings verändert, alles neu; die grünen Berge sind gleichsam bauschige Falten im reichen Gewand der Erde, an den Ufern liegen Städte und Dörfer, die von Weitem wie aus Pfefferkuchen geformt scheinen; goldiges Herbstlaub schwimmt auf dem Wasser.
»Sieh doch, wie schön!«, sagt die Großmutter jeden Augenblick; sie schreitet von Bord zu Bord und strahlt übers ganze Gesicht, während ihre weit geöffneten Augen die herrlichen Landschaftsbilder in sich aufnehmen.
Nicht selten vergisst sie mich ganz über dem wundervollen Anblick, den die Ufer gewähren: Die Arme auf der Brust verschränkt, steht sie lächelnd und schweigend am Schiffsrand, und in ihren Augen glänzen Tränen. Ich ziehe sie an dem dunklen, mit Blumen bedruckten Rocke.
»Was gibt’s?«, fragt sie zusammenfahrend. »Ich bin ganz wie im Schlafe, als ob ich träumte!«
»Und warum weinst du?«
»Das macht die Freude, mein Junge, und das Alter«, sagt sie lächelnd. »Ich bin doch schon alt, siehst du – sechzig Jährchen hab’ ich schon hinter mir, ja!«
Und nachdem sie ein Prischen genommen, begann sie mir allerhand abenteuerliche Geschichten von edlen Räubern, von frommen Einsiedlern, von allerhand Getier und bösen Höllenmächten zu erzählen. Geheimnisvoll, mit leiser Stimme erzählt sie, wobei sie sich zu meinem Gesicht vorneigt und mir mit den großen Pupillen in die Augen sieht, als wolle sie meinem Herzen eine belebende Kraft einflößen. Sie spricht, als ob sie sänge, und je weiter sie kommt, desto melodischer klingen ihre Worte. Es bereitet mir ein unbeschreibliches Vergnügen, ihr zuzuhören. Ich lausche ihrer Rede, wachse durch sie und bitte:
»Erzähl’ noch weiter!«
»Noch weiter? Also hör’ zu! Es saß einmal ein Kobold im Ofenloch, der hatte sich eine Nadel in die Pfote eingetreten, und nun wackelte er hin und her und wimmerte: ›Ach, meine lieben Mäuschen, das tut so weh! Ach, ihr guten Mäuselein, das halt’ ich nicht aus!‹ «
Sie hob dabei ihren Fuß auf, fasste ihn mit beiden Händen, wiegte ihn hin und her und verzog das Gesicht, als ob sie selbst den Schmerz spürte.
Ringsum stehen die Matrosen, bärtige Männer mit freundlichen Gesichtern, hören zu, lachen, spenden Beifall und bitten:
»Nun, Großmutter, erzähl’ noch irgendetwas!«
Und dann laden sie uns ein:
»Kommt, esst mit uns zum Abend!«
Beim Abendessen bewirten sie die Großmutter mit Branntwein und mich mit Melonen; das Letzte geschieht ganz insgeheim, denn auf dem Schiffe befindet sich ein Mann, der das Essen von Obst und sonstigen Früchten verbietet, sie den Leuten wegnimmt und ins Wasser wirft. Er ist wie ein Polizist gekleidet und ewig betrunken; alle verstecken sich vor ihm. Die Mutter kommt nur selten an Deck und hält sich abseits von uns. Sie schweigt fast immer. Wie durch einen Nebel oder eine durchsichtige Wolke sehe ich ihre große, schlanke Gestalt, das dunkle eisenharte Gesicht, den schweren Kranz des in Zöpfe geflochtenen lichten Haares. Alles an ihr ist kräftig und hart; auch die geradeaus schauenden grauen Augen, die ebenso groß sind wie die Augen der Großmutter, blicken hart und unfreundlich, wie aus der Feme.
»Die Leute lachen Sie doch nur aus, Mama«, sagte sie einmal zur Großmutter.
»Nun, Gott mit ihnen«, versetzte die Großmutter ganz vergnügt, »mögen sie nur lachen, wohl bekomm’s ihnen!«
Ich erinnere mich noch der kindlichen Freude, die sie hatte, als wir uns Nishnij Nowgorod näherten. Sie zog und schob mich an den Schiffsrand und rief laut:
»Sieh doch, sieh, wie schön! Da ist es, ihr lieben Leute, mein gutes Nishnij! Wie herrlich ist sie doch, die schöne Gottesstadt: Sieh nur, die Kirchen, als wenn sie in der Luft schwebten!«
Und fast unter Tränen bat sie die Mutter:
»Warjuscha, guck’ doch mal hin! Komm, sieh doch! Hast du sie denn ganz vergessen, deine Vaterstadt? Freu’ dich doch mit mir!«
Ein kurzes Lächeln huschte über das finstere Gesicht der Mutter.
Der Dampfer hielt gegenüber der schönen Stadt, mitten im Strome, der dicht mit Fahrzeugen bedeckt war. Hunderte von spitzen Masten ragten wie die Stacheln eines ungeheuren Igels darauf empor. Ein großes Boot mit zahlreichen Insassen kam dicht an den Dampfer heran, es wurde mithilfe des Bootshakens an die Schiffstreppe gezogen, und alle, die darin saßen, stiegen nacheinander an Bord. Voran schritt rasch ein kleiner, hagerer Alter in einem langen schwarzen Rock, mit einem roten, wie Gold schimmernden kleinen Vollbart, grünen Augen und einer Habichtsnase.
»Papa!«, rief die Mutter laut mit ihrer tiefen Stimme und eilte auf ihn zu, und er umfasste ihren Kopf, streichelte ihr mit den kleinen roten Händen die Wangen und rief mit kreischender Stimme:
»Aha –a, mein dummes Gänschen! Da bist du ja! … Nun, siehst du … Ach, ihr seid mir schon …«
Die Großmutter, die sich wie eine Schraube drehte, küsste und umarmte alle zugleich; sie schob mich zwischen all die Leute und sagte hastig:
»Nun komm rasch! Das da ist Onkel Michailo, das – Onkel Jakow. Hier ist Tante Natalia, und diese da sind deine Vettern, beide heißen Ssascha und deine Kusine Katerina. Das ist unsere ganze Familie, siehst du!«
Der Großvater wandte sich jetzt zu ihr:
»Wie geht’s, Mutter – bist du gesund?«
Sie küssten sich dreimal.
Dann zog der Großvater mich aus der Gruppe hervor, die mich eng umstand, legte mir die Hand auf den Kopf und fragte mich:
»Und du – wer bist du denn?«
»Ich bin der Astrachaner aus der Kajüte.«
»Was redet er da?«, wandte sich der Großvater an meine Mutter, und ohne ihre Antwort abzuwarten, schob er mich von sich weg und sagte:
»Die starken Backenknochen hat er vom Vater … Nun, steigt ins Boot!«
Wir fuhren ans Ufer und gingen alle miteinander die mit großen Kieselsteinen gepflasterte breite Auffahrt zwischen den beiden hohen, mit dürrem Gras bewachsenen Böschungsabschnitten hinan.
Die Alten schritten den andern voraus. Der Großvater war weit kleiner als die Großmutter und ging mit raschen, kleinen Schritten neben ihr her, während sie, gleichsam durch die Luft hinschwebend, auf ihn von oben herabsah. Hinter ihnen schritten schweigend die beiden Onkel einher – der brünette, glatthaarige Michailo, der so mager war wie der Großvater, und der hellhaarige Krauskopf Jakow; ein paar dicke Frauen in grellfarbigen Kleidern und ein halbes Dutzend Kinder, die alle älter waren als ich und sich sehr still verhielten, folgten den Männern. Ich ging mit der Großmutter und Tante Natalia. Sie war von kleiner Gestalt, hatte einen sehr starken Leib und musste häufig stehen bleiben. Mit Mühe Atem schöpfend, flüsterte sie: »Ach, ich kann nicht weiter!«
»Warum haben sie dich denn mitgeschleppt?«, brummte die Großmutter ärgerlich. »Ein unvernünftiges Volk!«
Weder die Erwachsenen noch die Kinder gefielen mir; ich fühlte mich fremd unter ihnen, und auch die Großmutter schien mir auf einmal ferner zu stehen.
Ganz besonders missfiel mir der Großvater; ich ahnte sogleich den Feind in ihm und wandte ihm meine ganz besondere, mit furchtsamer Neugier gepaarte Aufmerksamkeit zu. Wir gelangten bis ans Ende der Auffahrt. Dort stand ganz oben, an die rechte Seite der Böschung gelehnt, als erstes Gebäude der Straße ein einstöckiges Haus mit schmutzig-rosigem Anstrich, niedrigem Dach und glotzend vorspringenden Fenstern. Von der Straße aus erschien es mir groß, im Innern jedoch, in den kleinen, halbdunklen Zimmern, war es eng; überall liefen, wie auf einem Dampfer, der eben anlegen will, aufgeregte Leute umher, Kinder schwirrten gleich einer Schar von diebischen Spatzen durch Haus und Hof, und ein ätzender, mir unbekannter Geruch erfüllte alle Räume.
Ich geriet auf den Hof hinaus. Auch hier gefiel es mir ganz und gar nicht: Überall waren große, nasse Lappen aufgehängt, standen Bottiche mit dicker, verschieden gefärbter Flüssigkeit, in die gleichfalls große Stücke Stoff eingeweicht waren. In einer Ecke stand ein niedriger, halb verfallener Anbau mit einem großen Ofen, in dem Holzscheite lichterloh brannten, während in einem riesigen Kessel irgendetwas kochte und brodelte und ein Mensch, den man nicht sah, mit lauter Stimme seltsame Worte rief: »Sandelholz … Fuchsin … Vitriol …«
2
Es brach nun ein höchst seltsames, grobes buntbewegtes Leben für mich an, das mit erschreckender Schnelligkeit über mich dahinging. Es haftet in meiner Erinnerung wie ein düsteres Märchen, das ein zwar guter, doch zugleich beängstigend aufrichtiger Genius erzählt hat. Jetzt, da ich die Vergangenheit wieder heraufbeschwöre, möchte ich selbst zuweilen daran zweifeln, dass alles sich so zugetragen hat, wie es sich zutrug, ich möchte vieles bestreiten oder ableugnen, denn gar zu reich an Grausamkeit erscheint mir das finstere Dasein dieses »unverständigen Geschlechts«, von dem ich zu reden habe.
Doch die Wahrheit steht höher als alle weiche Empfindsamkeit, und schließlich ist es ja nicht meine Person, von der ich erzähle, sondern vielmehr jener enge, dumpfe, von qualvollen Eindrücken mannigfachster Art erfüllte Bannkreis, in dem ich dereinst gelebt habe, und in dem bis auf den heutigen Tag das einfache russische Volk vegetiert.
Das Haus des Großvaters war von der drückend heißen Atmosphäre einer gegenseitigen Feindschaft aller gegen alle erfüllt. Die Großen waren davon angesteckt, und selbst die Kinder nahmen lebhaften Anteil am Streit. Aus den Erzählungen der Großmutter entnahm ich dann später, dass die Rückkehr der Mutter ins Vaterhaus gerade zu einer Zeit erfolgt war, da ihre Brüder mit aller Hartnäckigkeit vom Vater eine Vermögensteilung verlangten. Die unerwartete Rückkehr der Mutter hatte ihren Wunsch, das väterliche Besitztum aufzuteilen, nur noch verstärkt. Sie fürchteten, dass meine Mutter die Auszahlung der ihr ausgesetzten Mitgift verlangen würde, die der Großvater ihr bis dahin vorenthielt, weil sie sich gegen seinen Willen verheiratet hatte. Die beiden Onkel waren der Meinung, dass die Mitgift der Mutter von Rechts wegen zwischen ihnen geteilt werden müsse. Außerdem bestand zwischen ihnen schon seit Langem eine heftige Meinungsverschiedenheit darüber, wer von ihnen die Färberei in der Stadt übernehmen und wer sich in der Vorstadt Kunawin, jenseits des Oka-Flusses, eine neue Färberei einrichten solle.
Gleich nach unserer Ankunft, als wir in der Küche beim Mittagessen saßen, ging der Streit los: Die Onkel sprangen plötzlich beide auf, beugten sich über den Tisch vor, brüllten auf den Großvater los, fletschten wütend die Zähne und schüttelten sich wie Hunde, der Großvater aber klopfte, ganz rot im Gesicht, mit dem Löffel auf den Tisch und schrie mit seiner schrillen Stimme wie ein Hahn: »Aus dem Hause werf’ ich euch! Betteln sollt ihr gehen!«
Die Großmutter verzog schmerzlich das Gesicht und sagte: »Gib ihnen alles, Vater – du wirst ruhiger leben! Gib’s ihnen in Gottes Namen!«
»Halt den Mund, Alte! Du stehst ihnen noch bei!«, kreischte der Großvater, während seine Augen nur so blitzten; es wirkte höchst verblüffend, dass ein so kleines Männchen so laut schreien konnte.
Meine Mutter stand vom Tische auf, ging mit gemessenem Schritt ans Fenster und kehrte allen den Rücken.
Plötzlich schlug Onkel Michailo seinem Bruder Jakow mit dem Rücken seiner rechten Hand mit aller Macht ins Gesicht. Jakow heulte laut auf, packte den Angreifer, und beide wälzten sich ächzend, röchelnd und schimpfend am Boden.
Die Kinder brachen in lautes Weinen aus, und die arme Tante Natalia begann ganz verzweifelt zu schreien. Meine Mutter umfasste sie mit beiden Armen und führte sie hinaus. Die pockennarbige Kinderfrau Jewegenija, ein lustiges, altes Weibchen, jagte die Kinder aus der Küche. Stühle fielen um, und ein wildes Chaos herrschte. Einer der Färbergesellen, ein breitschultriger, junger Bursche, der auf den Spitznamen »Zigeunerchen« hörte, saß rittlings auf Onkel Michailos Rücken, während der Werkführer Grigorij Iwanowitsch, ein kahlköpfiger Mann mit einem langen Vollbart und dunkler Brille, in aller Gemütsruhe die Hände des Onkels mit einem Handtuch zusammenband.
Der gefesselte Michailo streckte den Hals vor, fegte mit dem spärlichen schwarzen Vollbart auf dem Fußboden hin und her und röchelte unheimlich, der Großvater aber lief immer wieder um den Tisch herum und schrie in kläglichem Tone:
»Das wollen Brüder sein? Von gleichem Fleisch und Blut?! Ach, i–ihr! …«
Ich war gleich beim Beginn des Streites erschrocken auf den Ofen geklettert und sah von dort ganz bestürzt und ängstlich zu, wie die Großmutter über einer kupfernen Waschschüssel das Blut von Onkel Jakows zerschlagenem Gesichte abwusch; er weinte dabei und stampfte mit den Füßen auf, sie aber sagte mit dumpfer Stimme:
»Ihr gottverdammten Burschen, so nehmt doch endlich Vernunft an! Zu roh sind diese Kerle!«
Der Großvater zog das zerrissene Hemd, das ihm von der Schulter gleiten wollte, höher hinauf und schrie sie an: »Ja, solche Bestien hast du zur Welt gebracht, du Hexe!«
Als Onkel Jakow fort war, schleppte die Großmutter sich nach der Zimmerecke und brach dort in herzbrechende Klagen aus: »O heilige Mutter Gottes, Erbarmungsvolle, bring’ doch meine Kinder zur Vernunft!«
Der Großvater stand ein wenig abseits von ihr, sah nach dem Tische, auf dem alles umgeworfen und vergossen war, und sagte leise:
»Hab’ nur gut acht, Mutter, dass sie der Warwara nichts antun, sie sind imstande, sie umzubringen!«
»Um Gottes willen, was redest du da? Zieh doch das Hemd aus, ich will es dir flicken.«
Und indem sie den Kopf des Alten zwischen ihre Hände nahm, küsste sie ihn auf die Stirn. Er schmiegte sein Gesicht an ihre Schulter, an die seine kleine Gestalt gerade heranreichte, und sagte:
»Es wird mir nichts übrig bleiben, Mutter, als dass ich die Teilung vornehme.«
»Tu’s nur, Vater, es bleibt nichts weiter übrig.«
Sie sprachen lange miteinander, zuerst in aller Freundschaft, dann aber begann der Großvater mit dem Fuße auf dem Boden zu scharren wie ein Hahn vor dem Kampfe, drohte der Großmutter mit dem Finger und sagte in lautem, bösem Flüsterton:
»Ich kenne dich schon – du hältst es mit den beiden Burschen! Dein Mischka ist ein richtiger Jesuit, und dein Jaschka ein Freimaurer! Vertrinken und vergeuden werden sie mein Hab und Gut.«
Ich machte auf meinem Ofen eine ungeschickte Wendung und warf das Plätteisen hinunter – es fiel auf einen Vorsprung auf und plumpste von da in den Spülichteimer. Der Großvater sprang auf den Tritt, zog mich vom Ofen herunter und starrte mir ins Gesicht, als ob er mich zum ersten Male sähe.
»Wer hat dich auf den Ofen gesetzt? Deine Mutter?«
»Ich bin selber hinaufgeklettert.«
»Lüge nicht!«
»Nein, wirklich … ich hatte solche Angst.«
Er gab mir einen Klaps gegen die Stirn und schob mich fort.
»Der ganze Vater! Marsch, fort mit dir!«
Ich war froh, dass ich aus der Küche hinauskam.
Es entging mir nicht, dass der Großvater mich mit seinen klugen, scharfblickenden grünen Augen sehr aufmerksam beobachtete, und ich fürchtete mich vor ihm. Ich erinnere mich, dass ich mich vor diesen versengenden Augen immer zu verbergen suchte. Ich hielt den Großvater für einen bösen Mann, er sprach mit allen in einem höhnischen, kränkenden Tone und stichelte und reizte jeden Einzelnen.
»Ach, i–ihr!«, pflegte er häufig verächtlich auszurufen, und die Art, wie er diese Worte aussprach, machte mich jedes Mal frösteln.
Gegen Abend pflegte er mit den beiden Onkeln und den Gesellen aus der Werkstatt nach der Küche zu kommen, um Tee zu trinken. Wie sie so dasaßen, ermüdet von der Arbeit, die Hände von Sandelholz blau gefärbt und von Vitriol verbrannt, das Haar mit schmalen Bändern aufgebunden, glichen sie ganz den dunklen Heiligenbildern in der Ecke der Küche. In dieser gefährlichen Stunde pflegte sich der Großvater mir gegenüber zu setzen und sich mit mir zu unterhalten, und zwar viel eingehender als mit den übrigen Enkeln, was sichtlich ihren Neid hervorrief. Er war von zierlicher Gestalt, alles war scharf geprägt an ihm, wie gedrechselt. Seine blumenbestickte, mattschimmernde Atlasweste war alt und verschabt, sein Baumwollhemd ganz zerknüllt und sein Beinkleid an den Knien mit großen Flicken besetzt, und dennoch machte er einen saubereren und adretteren Eindruck als seine beiden Söhne, die Jacketts, Chemisetts und seidene Halstücher trugen.
Einige Tage nach unserer Ankunft ordnete der Großvater an, dass ich beten lernen sollte. Alle übrigen Enkelkinder waren älter als ich und lernten bereits lesen – der Küster der Himmelfahrtskirche, deren goldene Kuppeln man aus den Fenstern des Hauses sehen konnte, war ihr Lehrer. Mich unterrichtete die stille, scheue Tante Natalija, eine Frau mit einem Kindergesicht und so durchsichtigen Augen, dass ich meinte, man könne durch sie hindurchsehen.
Ich liebte es, ihr lange in die Augen zu sehen, ohne den Blick abzuwenden oder nur zu blinzeln; sie kniff die Augen zusammen, drehte den Kopf hin und her und bat mich leise, fast flüsternd:
»Nun, sag’ jetzt, bitte: ›Vater unser, der du bist …‹ «
Und wenn ich sie dann fragte: »Was ist das – ›der du bist‹?«, sah sie ängstlich im Zimmer um und riet mir: »Frag’ nicht lange, sprich’s einfach nach: ›Vater unser, der du bist …‹ Nun?«
Ich konnte nicht begreifen, warum ich nicht fragen sollte. Das Wort »der du bist« bekam für mich einen geheimnisvollen Sinn, und ich verdrehte es absichtlich auf alle mögliche Weise: »derbudist«, »berdudist« …
Die gute Tante mit dem wachsbleichen, gleichsam schmelzenden Gesicht wurde nicht müde, mich immer wieder mit ihrer leisen Stimme, die einen Sprung zu haben schien, zu verbessern:
»Nicht doch, sag’ einfach: ›der du bist‹ …«
Dabei war das, was ich lernen sollte, gar nicht so »einfach«, es schien mir sogar recht verzwickt. Das ärgerte mich, und dieser Ärger hinderte mich wiederum, das Gebet zu behalten. Eines Tages fragte mich der Großvater:
»Nun, Aljoscha, wast hast du heute getrieben? Gespielt hast du, nicht wahr? Ich seh’s an der Beule da auf deiner Stirn. Sich ’ne Beule holen – das ist nicht schwer! Kannst du schon das Vaterunser?«
»Er hat ein schlechtes Gedächtnis«, sagte die Tante leise.
Der Großvater lachte vergnügt und zog dabei die roten Augenbrauen in die Höhe.
»Ei, da wird er wohl mal eine Tracht Prügel bekommen müssen!«, sagte er, und fragte mich dann weiter: »Hat dich dein Vater oft geprügelt?«
Ich verstand seine Frage nicht und schwieg.
»Maxim hat ihn nie geschlagen«, sagte meine Mutter, »und auch mir hat er’s verboten.«
»Warum denn?«
»Er meinte, mit Schlägen könne man niemandem etwas beibringen.«
»Er war in allen Dingen ein Dummkopf, dieser Maxim – verzeih mir, o Herr, dass ich von einem Toten so rede!«, versetzte der Großvater scharf und böse.
Seine Worte verletzten mich, was er sehr wohl bemerkte.
»Was bläst du die Lippen so auf? Wart’ mal, du!«, sagte er zu mir. Dann fuhr er mit der Hand über sein silbern-rötliches Haar und fuhr fort: »Am Sonnabend werde ich den Ssaschka durchwalken, da kannst du erst mal zusehen!«
Die andern lachten, ich aber ging auf die Seite und dachte über seine Worte nach. In der Werkstatt hatte ich das Wort »walken« schon gehört, der Großvater aber schien es in einem andern Sinn gebraucht zu haben: Sicher bedeutete es in seinem Munde nichts Gutes, und wahrscheinlich hieß es so viel wie prügeln oder schlagen. Ich hatte schon gesehen, dass man Pferde, Hunde und Katzen schlägt, und in Astrachan schlugen die Polizisten auch die Perser. Noch niemals jedoch hatte ich gesehen, dass man kleine Kinder auf solche Weise schlägt, und wenn die beiden Onkel ihren Söhnen öfters eine Maulschelle oder ein Kopfstück gaben, so verhielten sich diese ganz gleichgültig dabei und rieben höchstens mit der Hand die geschlagene Stelle. Ich fragte sie öfters: »Tut’s weh?« –, und sie antworteten jedes Mal tapfer: »Nein, nicht ein bisschen!«
Wenn Ssaschka Prügel bekommen sollte, so war es wahrscheinlich wegen der Geschichte mit dem Fingerhut, die sich kurz vorher zugetragen hatte. Des Abends, in der Zeit zwischen dem Tee und dem Abendbrot, pflegten Onkel und Werkführer die gefärbten Sachen, die vor dem Färben aufgetrennt worden waren, wieder zusammenzunähen und mit Etiketts zu versehen. Eines Tages nun befahl Onkel Michail, um dem halb blinden Werkführer Grigorij einen Possen zu spielen, seinem neunjährigen Neffen Ssaschka, dessen Fingerhut an der Kerzenflamme zu erhitzen. Ssaschka nahm den Fingerhut mit der Lichtputzschere auf, hielt ihn in die Flamme, bis er gehörig durchglüht war, legte ihn an Grigorijs Platz und versteckte sich hinter dem Ofen. Zufällig kam der Großvater selbst hinzu, um beim Nähen zu helfen, und steckte den Finger rasch in den glühend gemachten Fingerhut. Ein gewaltiger Lärm entstand, der auch mich in die Küche lockte, und hier sah ich nun, wie der Großvater, mit den verbrannten Fingern sein Ohr festhaltend, höchst possierliche Sprünge machte und dabei immer wieder schrie:
»Wer hat das wieder angerichtet, ihr Heidenpack?«
Onkel Michail saß über den Tisch gebeugt da, trieb den Fingerhut mit dem Finger wie einen Kreisel an und blies darauf, um ihn abzukühlen. Der Werkführer nähte so eifrig, wie er nur konnte, während auf seiner mächtigen Glatze die Schatten tanzten. Onkel Jakow, der auf den Lärm gleichfalls herbeigeeilt war, lachte, hinter der Ofenecke versteckt, leise in sich hinein, und die Großmutter zerrieb auf dem Reibeisen eine rohe Kartoffel.
»Das hat Jakows Ssaschka gemacht!«, sagte plötzlich Onkel Michail.
»Lüge doch nicht!«, schrie Jakow, hinter dem Ofen hervorkommend, dem Bruder ins Gesicht.
Irgendwo in der Ecke ließ sich die weinerliche Stimme seines Sohnes vernehmen:
»Er hat mich dazu angestiftet, Papa!«
Die beiden Onkel begannen aufeinander loszuschimpfen. Der Großvater war plötzlich ruhig geworden, er legte die geriebene Kartoffel auf den verbrannten Finger auf, nahm mich bei der Hand und entfernte sich schweigend.
Es wurde von dem Vorfall an diesem Abend des Langen und Breiten gesprochen, und alle bezeichneten Onkel Michail als den schuldigen Teil. Ich fragte den Großvater, ob er auch den Onkel Michail »durchwalken« würde.
»Ja, das müsste ich eigentlich tun«, brummte der Großvater und sah mich dabei prüfend von der Seite an.
Onkel Michail, der meine Worte gehört hatte, schlug mit der Hand wütend auf den Tisch auf und schrie meine Mutter an: »Stopf’ deinem kleinen Köter das Maul, Warwara, sonst schlage ich ihm den Schädel ein!«
»Versuch’s mal, den Jungen anzurühren!«, sagte die Mutter in einem Tone, der ihn zum Schweigen brachte.
Sie verstand es vortrefflich, durch kurz hingeworfene, schlagkräftige Bemerkungen den Leuten das Wort abzuschneiden. Ich hatte das Gefühl, dass sich alle vor ihr fürchteten, selbst der Großvater sprach mit ihr nicht wie mit den andern, sondern viel leiser. Das war mir angenehm, und ich prahlte damit stolz vor meinen Vettern:
»Meine Mutter ist doch die Stärkste!«
Sie wagten nicht zu widersprechen. Das aber, was am nächsten Sonnabend geschah, brachte in meinen Beziehungen zur Mutter doch einen starken Umschwung hervor.
Noch vor Sonnabend hatte auch ich eine Schuld auf mich geladen.
Mit großem Interesse hatte ich immer beobachtet, wie geschickt die Leute in der Färberei es verstanden, die Farbe der Stoffe zu ändern: Sie nahmen ein gelbes Stück Stoff, tauchten es in eine schwarze Flüssigkeit und zogen es ganz dunkelblau – »indigoblau«, wie sie sagten – heraus, oder sie spülten ein graues Stück in fuchsigrotem Wasser, und es wurde dunkelrot – »bordeaux« nannten sie es. Die Sache schien so einfach, und doch konnte ich sie nicht begreifen.
Ich brannte vor Verlangen, selbst einmal irgendetwas umzufärben, und ich teilte diesen Wunsch meinem Vetter Ssaschka, dem Sohne Jakows, mit. Ssaschka war ein ernst angelegter Junge, der sich eifrig um den Beifall der Erwachsenen bewarb und gegen alle Welt freundlich, höflich und dienstfertig war. Die Erwachsenen lobten ihn um seiner Folgsamkeit und Klugheit willen, der Großvater aber hatte nicht viel für ihn übrig und nannte ihn einen »Schleicher«. Er war mager, brünett, hatte vorstehende Augen wie ein Krebs, sprach leise und dabei so hastig, dass er die Worte halb verschluckte, und blickte immer geheimnisvoll suchend um sich, als wollte er irgendwohin ausreißen und sich verstecken. Seine braunen Pupillen waren unbeweglich, war er jedoch erregt, so zitterte sein ganzes Auge.
Ich mochte diesen Ssaschka nicht und hatte den andern Ssaschka, den Sohn Michails, einen wenig auffälligen, stillen Jungen, weit lieber. Er hatte schwermütig blickende Augen, konnte recht herzlich lächeln und war seiner sanften Mutter, der Tante Natalija, sehr ähnlich. Er hatte hässliche Zähne, die aus dem Mund hervorragten und im Oberkiefer in zwei Reihen wuchsen. Das machte ihm gar viel zu schaffen, er hatte ewig die Finger im Munde, zog und rüttelte an seinen Zähnen herum, versuchte die Zähne der hinteren Reihe herauszuziehen und gestattete in aller Geduld jedem, der Lust dazu hatte, seinen Kiefer zu betasten. Sonst fiel mir nichts Interessantes weiter an ihm auf. Im Hause des Großvaters, das von oben bis unten von Menschen wimmelte, führte er ein einsames Leben, saß gern in halbdunklen Ecken herum, oder abends am Fenster. Ich liebte es, schweigend neben ihm zu sitzen, eine ganze Stunde lang, dicht an ihn geschmiegt, und zuzusehen, wie am roten Abendhimmel die schwarzen Dohlenschwärme um die goldenen Zwiebelkuppeln der Himmelfahrtskirche herumflatterten, wie sie jetzt hoch emporflogen, dann sich tief hinabsenkten und plötzlich, den erlöschenden Himmel mit einem schwarzen Muster bedeckend, irgendwohin davonflogen, um nichts als den leeren Raum hinter sich zurückzulassen. Es war ein Anblick, der eine stille Wunschlosigkeit, ein angenehmes Gefühl träger Ruhe im Gemüt erzeugte und einen gleichsam stumm machte.
Der andere Ssaschka, Jakows Sohn, konnte über alles sehr viel und sehr gesetzt reden, ganz wie ein Erwachsener. Als er hörte, dass ich mich gern als Färber versuchen wollte, riet er mir, das weiße Feiertagstischtuch aus dem Schrank zu nehmen und es blau zu färben.
»Weiße Sachen lassen sich viel leichter färben, glaub’ mir’s!«, sagte er sehr ernsthaft.
Ich nahm das schwere Tischtuch heraus und lief damit auf den Hof, kaum hatte ich jedoch den einen Zipfel in den Indigobottich getaucht, als auch schon »Zigeunerchen« auf mich zugestürzt kam, das Tischtuch meinen Händen entriss, mit seinen breiten Tatzen es auszuwringen begann und dem Vetter, der vom Hausflur aus mich bei der Arbeit beobachtete, zurief:
»Ruf schnell mal die Großmutter her!«
Zu mir sagte er, während er auf recht unheilverkündende Art seinen schwarzen Zottelkopf schüttelte: »Na wart’ mal, du Schelm, das wird dir teuer zu stehen kommen!«
Die Großmutter stürzte herbei, schrie ach und weh, brach sogar in Tränen aus und schalt mich:
»Ach, du nichtsnutzige Borste, du Hosenmatz! Dass du den Pips bekommst, du naseweises Hühnchen!«
Den Gesellen aber bat sie:
»Sag’ nur dem Großvater nichts, Wanja! Ich will schon zusehen, wie ich’s verheimliche, vielleicht läuft’s noch mal gut ab …«
Wanja, der »Zigeuner«, der sich eben die Hände an einem buntfarbigen Handtuche abtrocknete, meinte besorgt:
»Ich werde nichts sagen, aber der Junge dort, der Ssaschka – dass der nur nicht klatscht!«
»Ich will ihm ein Zweikopekenstück schenken«, sagte die Großmutter, während sie mich ins Haus führte.
Am Sonnabend, vor der Abendmesse, führte mich irgendjemand nach der Küche, in der es dunkel und still war. Die Türen nach dem Flur und den Wohnräumen waren, wie ich mich erinnere, geschlossen, und draußen, im herbstlichen Dunkel, ging ein Regen nieder. Auf der breiten Bank vor dem schwarzen Ofenloch saß »Zigeunerchen« – er schien aufgeregt und in schlechter Stimmung. Der Großvater stand in der Ecke neben einem mit Wasser gefüllten Eimer, zog daraus eine Gerte nach der andern hervor, maß sie aneinander und schwang sie durch die Luft, dass sie nur so pfiffen. Die Großmutter stand irgendwo im Dunkeln, nahm laut vernehmlich eine Prise und brummte: »Wie er sich freut … der Quälgeist!«
Ssaschka, Jakows Sohn, saß mitten in der Küche auf einem Stuhle, rieb sich mit den Fäusten die Augen und flehte mit ganz veränderter Stimme wie ein alter Bettler:
»Verzeihen Sie mir, um Christi willen.«
Wie zwei Holzfiguren standen die beiden Kinder Onkel Michails, Bruder und Schwester, Schulter an Schulter hinter dem Stuhle. »Sobald ich dich durchgeprügelt habe, werde ich dir verzeihen«, sagte der Großvater und zog dabei die lange, feuchte Gerte durch die Faust. »Nun, zieh die Hosen herunter!«
Er sagte das ganz ruhig, und weder der Klang seiner Stimme noch das Knarren des Stuhles, auf dem der Knabe hin und her rückte, noch das Scharren und Räuspern der Großmutter vermochte den Eindruck der unheimlichen Grabesstille zu mildern, die in der halbdunklen Küche mit der niedrigen, verräucherten Decke herrschte.
Ssaschka erhob sich, knöpfte seine Beinkleider ab, ließ sie bis zu den Knien herunter und ging, das herabgleitende Kleidungsstück mit den Händen festhaltend, den Kopf vorbeugend und stolpernd nach der Bank hin. Es war mir recht unheimlich zumute, als ich ihn so daherstolpern sah, und auch mir ging ein Zittern durch die Beine.
Es wurde noch schlimmer, als er sich mit dem Gesicht nach unten demütig auf die Bank legte und Wanja ihn mittels eines breiten Handtuches, das er um Achseln und Hals herumführte, auf der Bank festband, um dann mit den schwarzen Händen seine Beine über den Knöcheln festzuhalten.
»Komm nur näher, Lexej«, rief der Großvater mir zu. »Na, hörst du nicht? … Blick’ mal her, wie so ’ne Tracht Prügel aussieht … Eins!«
Nicht allzu kräftig ausholend, hatte er mit der Gerte einen leichten Hieb gegen den nackten Körper geführt. Ssaschka schrie auf.
»Verstell’ Dich doch nicht«, sagte der Großvater, »das hat ja gar nicht wehgetan! Aber der da wird wehtun!«
Und er schlug so stark zu, dass auf der Haut sogleich ein brennend roter Striemen aufschwoll und der Knabe ganz entsetzlich zu winseln begann.
»Das schmeckt nicht gut, wie?«, fragte der Großvater, indem er die Hand mit der Gerte im Takte hochschwang und niedersausen ließ. »Das ist nicht nach deinem Geschmack! Das ist für den Fingerhut, siehst du!«
Wenn er die Hand emporhob, war’s mir, als ob in meiner Brust alles zugleich mit ihr in die Höhe ginge; wenn er sie senkte, sank auch ich ganz in mich selbst zusammen.
Ssaschka winselte und schrie mit seiner hohen, unangenehm kreischenden Stimme:
»Ich tu’s ja nicht wi–ieder! Ich hab’ doch das, von dem Tischtuch gesa–agt! … Ich hab’s doch gesa–agt!«
»Wer klatscht, wird damit nicht straffrei«, sagte der Großvater ruhig, als wenn er im Psalter läse. »Der Klatscher verdient zuerst die Knute! Da – das ist für das Tischtuch!«
Die Großmutter stürzte auf mich zu, fasste mich bei der Hand und schrie: »Den Lexej lass ich nicht schlagen! Nie erlaub’ ich das, du Schuft!«
Sie begann mit dem Fuße gegen die Tür zu schlagen und rief laut: »Warja! Warwara!«