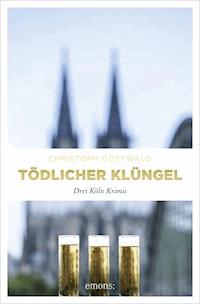Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Erfinder des Regionalkrimis lässt seinen Kult-Ermittler auferstehen. Weil er glaubte, sie hätten seine fünfjährige Tochter Marie getötet, nahm Manni Thielen einst blutige Rache an zwei Kölner Gangsterbossen und floh aus seiner Heimatstadt. Aber der Doppelmord war ein fataler Fehler, denn Marie lebt und ist damals mit ihrer Mutter in Süditalien untergetaucht. Nach fünfundzwanzigjähriger Odyssee kehrt Manni nun unter falschem Namen nach Köln zurück, um die Spur seiner Tochter aufzunehmen. Doch dann schlägt das Schicksal erneut erbarmungslos zu.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christoph Gottwald, geboren 1954, M.A. der Germanistik, lebt und arbeitet in seiner Heimatstadt Köln als Schriftsteller, Drehbuchautor, Dokumentarfilmer, Regisseur und Theatermacher.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2018 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: christinakohnen/photocase.de
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Dr. Marion Heister
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-428-5
Köln Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für meine beiden BrüderUlrich und Dietrich
Our life is like our music,it’s here and then it’s gone.
Mick Jagger/Keith Richards
1
Dieses hinterhältige Schwein! So einem miesen Betrüger hatte sie all die Jahre vertraut! Dabei war sie es, die das Geld verdiente, die ihn durchfütterte, die ihn immer wieder getröstet hatte, wenn er durchhing und jammerte, dass die ganze Welt sich gegen ihn verschworen hätte. Petra schloss die Augen und versuchte, ihren keuchenden Atem etwas zu beruhigen. Schluss, aus, Feierabend! Mit Max Grünfeld war sie fertig. Ein für alle Mal. Da konnte er angekrochen kommen auf blutenden Knien und sie heulend um Verzeihung bitten. No way. Das Kapitel war beendet, das Buch zugeschlagen und verbrannt.
Durch die verkratzte Scheibe des U-Bahn-Zugs, der gerade am Ernst-Reuter-Platz hielt, schaute Petra hinaus in eine ihr fremde Welt. Fahles Neonlicht, trostlos gekachelte Wände, zerlumpte Menschen auf eisernen Sitzbänken, Jugendliche mit in die Stirn gezogenen Kapuzen, gelehnt an Abfalleimer, aus denen die Hälse leerer Schnapsflaschen ragten.
Eine zwergwüchsige Frau mit geblümtem Kopftuch stand regungslos am Bahnsteigrand und schaute Petra aus schwarzen Augen an, bis der Zug anfuhr und sich in den Tunnel schob.
Seit Jahren war Petra nicht mehr nachts mit der U-Bahn gefahren. Und auch heute hatte sie es nicht vorgehabt. Aber als sie ein Taxi anhalten wollte, hatte sie bemerkt, dass sie in der ganzen Hektik ihr Portemonnaie verloren oder in der Wohnung liegen gelassen hatte. Und zurückzugehen kam nicht in Frage. Nicht heute Nacht. Morgen würde sie Max eventuell eine SMS schreiben und ihn auffordern, die Wohnung für zwei Stunden zu verlassen, damit sie ein paar Koffer und Kartons mit ihren Lieblingssachen packen könne.
Auf einem Firmenevent in Schwerin war sie gewesen. Ihr Chef hatte seine sechsundzwanzig erfolgreichsten Mitarbeiter ins Hotel »Niederländischer Hof« geladen. Seit fünf Jahren rekrutierte und betreute Petra Schiffer Anleger, mit deren Geld Dr. Siegmar Hoss Immobilienprojekte plante und meist auch realisierte. Sie war für den Verkauf von Anteilen an Hotelbauten entlang der deutschen Ostseeküste zuständig.
Schon auf der gemeinsamen Anreise im Luxusbus am Samstagmorgen hatten mehrfach Sektkorken geknallt. Nach einer launigen Begrüßungsrede des Chefs und einem ausgiebigen Brunch rackerten sich im Tagungsraum »Wilhelmina« ein schnieker Herr Bungert und eine noch schniekere Frau Zilinsky damit ab, die angeschickerte Belegschaft für Rollenspiele, spaßige Reimkreationen und assoziatives Turmbauen mit unbehandelten Kiefernklötzen zu begeistern.
Ausklingen ließ man den Nachmittag in einem Spaziergang rund um den Pfaffenteich. Anschließend gab es eine Stunde zur freien Verfügung, und um neunzehn Uhr dreißig ging es im Restaurant weiter, wo an einer langen Tafel ein hervorragendes Menü serviert wurde.
Vier der fünf Gänge leitete der wortgewandte Kellermeister mit Monologen ein, die den begleitenden Wein beschrieben, und keiner der Anwesenden wagte es, das emsige Schankpersonal daran zu hindern, die gerade angepriesenen Tropfen in ihre Gläser fließen zu lassen.
Die Folge war, dass die gesamte Belegschaft bedenklich wankte, als man geschlossen in die Hotelbar umzog, wo schon ein öliger Barkeeper diverse Cocktails vorbereitet hatte.
Neun Frauen, siebzehn Männer. Es wurde gebalzt, als ginge es darum, noch heute Nacht eine ganze Generation innovativer Immobilienmakler zeugen zu müssen. Irgendwann war es Petra zu viel geworden, und sie hatte sich von ihrem Chef verabschiedet. Wobei auch der ansonsten distinguierte Dr. Siegmar Hoss seine rechte Hand reichlich übergriffig um ihre Taille geschlungen hatte.
Kaum war sie eingeschlafen, bummerte es an ihrer Zimmertür. Natürlich öffnete sie nicht, aber sie lauschte hinaus und hörte zwei Männerstimmen auf dem Flur herumalbern. Sven Möller und Peter Gerlach. Beide verheiratet, beide Väter von Kindern. Möller baggerte schon seit Monaten unverhohlen an ihr herum, Gerlach erst seit heute Abend. Gegen drei Uhr haute dann wieder jemand an ihre Tür, und eine Stimme, die sie keinem ihrer Kollegen zuordnen konnte, zischte:
»Mach auf, du Nutte!«
Es war etwas in der Stimme, das ihr Angst machte. Petra knipste das Leselicht an und überlegte, ob sie die Rezeption anrufen sollte. Sie legte die Hand auf den Hörer des Telefons, das auf dem Nachtschränkchen stand, und lauschte. Auf dem Flur blieb es stumm. Es dauerte eine Stunde, bis Petra endlich wieder eingeschlafen war.
Am Morgen stand sie frühzeitig auf, duschte und machte einen langen Spaziergang. Auf ein Frühstück im Kreis ihrer mit Sicherheit verkaterten und vom eigenen Verhalten im Suff angeekelten Kollegen verzichtete sie und tunkte stattdessen auf einer Bank vor dem Bahnhof ein noch warmes Croissant in einen Pappbecher mit Milchkaffee.
Auf der Agenda standen Schlossbesichtigung, Schifffahrt über den Schweriner See und am Abend gemeinsames Kochen in Toms Gourmettempel. Das war alles ganz nett, aber als die Kollegen nach der selbst gemachen Crème brûlée gegen neun Uhr ihre Alkoholpegel wieder auf das Niveau des vorherigen Abends hochgestemmt hatten und sich zum gemeinsamen Tagungsausklang in der Hotelbar verabredeten, zog Petra den Stecker.
Um zweiundzwanzig Uhr bestieg sie mit ihrer kleinen Reisetasche den Zug nach Berlin. Offiziell hatte ihr Chef seinen Leuten den Montag als Urlaubstag spendiert und die gemeinsame Rückfahrt im Bus für den nächsten Morgen um elf Uhr festgelegt. Aber Max würde sich bestimmt freuen, wenn sie ihn in der Nacht noch überraschte, hatte Petra gedacht. Die Überraschung war ihr gelungen. Nur etwas anders, als sie es sich vorgestellt hatte. Am Hauptbahnhof war sie gegen Mitternacht ausgestiegen und hatte sich bis zur Taubenstraße ein Taxi genommen.
Als sie die Wohnungstür im dritten Stock öffnete, roch es im Flur nach Marihuana, und aus Richtung Schlafzimmer drangen eindeutige Geräusche. Sie schlich an die Tür heran und hörte dahinter die Stimme von Max ekstatisch jubilieren: »Das ist so geil, Baby, das ist so geil.«
Und eine Frauenstimme quiekte: »Jahh, fick mich, du verkiffte Sau, fick mich.«
Petra stieß die Tür auf. Max kniete auf dem Bett, und vor ihm kauerte in Hundestellung die tätowierte Mutter aus dem zweiten Stock, die ihre fünfjährige Tochter allein erzog, seit sie deren Erzeuger rausgeschmissen hatte. Ihre Ellenbogen waren aufgestützt, ihr Hintern klatschte gegen Max’ Unterleib, und ihre Brüste schlackerten runter bis fast aufs Bettzeug. Max hielt ihre Hüfte umkrallt und schaute zu, wie sein Schwanz mal mehr, mal weniger im Körper seiner Gespielin verschwand. Aber dann hob er plötzlich den Blick zur Tür und schrie: »Scheiße!«
Und auch die tätowierte Mutter hob den Blick zur Tür und schrie: »Scheiße!«
Petra drehte sich um und hastete den Flur entlang, sie nahm einen Schlüssel von der Hakenleiste und stürmte mit der kleinen Reisetasche aus der Wohnung. Sie hetzte die Treppe runter und rannte aus dem Haus bis zur Ecke Glinkastraße, wo sie stehen blieb und versuchte, in klare Gedankengänge zurückzufinden. Ausgerechnet das! Und dann auch noch mit einer Nachbarin! Dabei hatten sie und Max schon seit Langem keinen Sex mehr gehabt. Noch nicht mal an Sexualität grenzende Berührungen. Weil er sich mental dazu nicht in der Lage gefühlt hatte. Solche Sprüche musste sie sich von ihm anhören. Dabei hatte sie mal seinen Browserverlauf zurückverfolgt. Pornoseiten rauf und runter. Während sie im Büro die Brötchen verdiente, saß der Herr zu Hause mit dem Notebook im Bett und onanierte. Und abends war er dann mental nicht mehr in der Lage, seine Partnerin in den Arm zu nehmen. Unmöglich. Mit Voyeurismus im Internet konnte sie noch so gerade leben. Zumal der Sex mit Max im Laufe der Jahre enorm an prickelnder Spannung verloren hatte. Aber gerade deshalb zerstörte das, was sie eben erlebt hatte, mit einem Schlag alles, was sie jemals für ihn empfunden hatte. Sie spürte nur noch tiefe Abscheu und Hass für den Mann, mit dem sie seit ihrem vierzehnten Geburtstag zusammen war. Das ist so geil, Baby, das ist so geil!, hallte seine Stimme durch ihren Schädel. So etwas hatte er ihr noch nie gesagt. Auch nicht vor zehn Jahren, als sie so richtig wild aufeinander gewesen waren.
Sie war zur U-Bahn-Station Mohrenstraße gelaufen, und als sie unten am Bahnsteig ankam, hielt gerade ein Zug der Linie U2 Richtung Ruhleben.
Es waren nicht viele Menschen in dem Waggon. Die meisten zwischen zwanzig und dreißig Jahre alt. Nur einer war älter. So um die fünfzig und unrasiert. Der Mann trug die rote Fan-Kappe eines Sportvereins und eine Hornbrille. Er zog einen kleinen Spiralblock aus seiner olivgrünen Outdoorjacke und schrieb etwas hinein. Vielleicht war er ein Schriftsteller, der nachts durch die Gegend fuhr und sich in der U-Bahn inspirieren ließ. Der Mann schien zu spüren, dass Petra ihn beobachtete. Er steckte den Block in die Tasche seiner Jacke zurück und schaute aus dem Fenster, hinter dem die Tunnelwand vorbeiraste.
Drei junge Männer standen vor der Ausstiegstür. Sie sahen aus wie Flüchtlinge. Durften alle Flüchtlinge eigentlich kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren? Aber morgens um zwei waren bestimmt keine Kontrolleure unterwegs. Hoffentlich nicht. Denn Petra hatte sich schließlich auch kein Ticket kaufen können. Aber sie hatte es nicht mehr weit. Der Zug hielt gerade am Sophie-Charlotte-Platz, und in Neu-Westend würde sie aussteigen. Zum Glück hatte sie noch ihre Wohnung in Charlottenburg. Das beste Geschäft, das sie in ihren neunundzwanzig Lebensjahren bisher gemacht hatte. Wenn man in der Immobilienbranche tätig ist, dann hört man das eine oder andere und kann zuschlagen, bevor ein Objekt offiziell auf dem Markt erscheint. Petra hatte die gut aufgeteilte Zwei-Zimmer-Wohnung mit Küche, Bad und Balkon von einer alten Dame auf Rentenbasis gekauft. Sie hatte der dreiundsiebzigjährigen Eigentümerin einmalig zehntausend Euro bezahlt und überwies ihr achthundertfünfzig Euro im Monat. Bis zu ihrem Lebensende. Das hätte in zwanzig Jahren sein können. Aber Petra musste nur vier Mal achthundertfünfzig Euro überweisen. Dann starb die Frau. Petra ließ die Wohnung renovieren und im Internet von einem rund um den Globus aktiven Portal wochenweise an Touristen vermieten. Da es eine ruhige und verkehrsgünstig in der Marathonallee gelegene Adresse war, funktionierte das prima, egal in welchem Monat. Gestern war das australische Paar nach sechswöchigem Aufenthalt ausgezogen, die nächste Reservierung stand in acht Tagen an. Petra würde sie stornieren und die Wohnung vorerst selbst beziehen. In die Taubenstraße zu Max in die Wohnung, die seiner Mutter gehörte, würde sie nie wieder zurückgehen. Sollte er sich dort mit der Schlampe vom zweiten Stock bekiffen und den restlichen Verstand aus dem Schädel rammeln. Petra würde sich was Besseres suchen. Chancen hatte sie reichlich. Als sie eben durch die Bahn gegangen war, hatten die Männer sie mit Augen wie Nacktscanner angeglotzt.
Am Sophie-Charlotte-Platz stieg eine punkige junge Frau mit einer offenen Weinflasche in der Hand ein und blieb an der Tür stehen. Ihr folgten zwei schwarzhaarige unrasierte Männer, die neben ihr in Halteschlaufen griffen. Sie redeten nicht miteinander. Mit leicht gesenkten Köpfen schauten sie die punkige Frau an. Auch Petra konnte ihren Blick nicht von der bizarren Nachtschwärmerin lassen. Sie hatte eine ähnliche Figur wie sie, zierlich, jungenhaft, Konfektionsgröße maximal sechsunddreißig. Ihre rechte Kopfseite war fast kahl rasiert, die übrigen Haare rot gefärbt. Sie hatte Piercings und Ringe im Gesicht und rund um Hals und Nacken unprofessionell eintätowierte Worte. Sie trug eine knappe Motorradjacke, einen extrem kurzen Rock über einer zerrissenen schwarzen Strumpfhose und ausgetretene Wanderschuhe. Sie nahm einen Schluck aus der Weinflasche, was sie eigentlich nicht tun sollte, denn sie war offensichtlich schon ziemlich betrunken. Einen Schluck Wein aber hätte Petra jetzt auch gut vertragen können. Am liebsten hätte sie die Punkerin gefragt, ob sie ihr mal kurz die Flasche reiche. Aber das passte natürlich nicht. Welten lagen zwischen dem abgerissenen Mädchen und ihr, der gepflegten Jungmanagerin in dunkelblauem Blazer über weißer Bluse, makelloser Jeans und edlen Sneakers, mit auf dem Hinterkopf zu einem Pferdeschwanz zusammengebundenen dunkelblonden Haaren und dezenten Perlenstickern in den Ohrläppchen. Wie gut es ihr doch eigentlich gehen müsste. Eigentlich. Aber vielleicht ging es ja dieser jungen Frau, die sich mit einer Weinflasche in der Hand durch Berlins Nächte treiben ließ, in Wirklichkeit viel besser als ihr.
In Petras unmittelbarer Nähe intonierte Freddie Mercury plötzlich »We Are the Champions«. Das war ihr Klingelton. Wie oberpeinlich! Hastig kramte sie in ihrer Tasche. Aber sie fand das Smartphone nicht, das weiterhin den Queen-Song absonderte. Alle Insassen des Waggons starrten sie an. Auch die Punkerin, mit Fremdschämblick. Der Mann mit der roten Kappe stand auf, kam zu ihr, zog das Handy unter ihrem Sitz hervor und reichte es ihr.
»Vielen Dank«, stammelte sie mit geröteten Wangen. Auf dem Display stand der Name Max. Die Reue kam ja schnell. Aber trotzdem zu spät. Sie klickte den Anruf weg. Die Bahn hielt am Theodor-Heuss-Platz, und die Punkerin stieg aus. Die beiden schwarzhaarigen Männer ließen die Halteschlaufen los und folgten ihr. Kurz bevor sich die Türen wieder schlossen, erhob sich der Mann mit der roten Kappe. Er machte drei hastige Schritte zum Ausstieg und verließ ebenfalls die Bahn. Er war schlank, hatte breite Schultern und humpelte. Vielleicht trug er eine Prothese. Ein einbeiniger Schriftsteller schreibt nachts Gedichte in der U-Bahn. Ein Lächeln huschte über Petras Gesicht. Der Mann blieb auf dem Bahnsteig stehen und suchte ihren Blick. Sie schenkte ihn ihm und las eine mitfühlende Sorge in seinen Augen. Mit den Lippen formte sie ein stummes »Danke schön!« und streckte ihren rechten Daumen in die Höhe. Der Mann mit der roten Kappe nickte lächelnd. Die Bahn setzte sich in Bewegung. Für Sekunden hatte Petra die tätowierte Mutter aus dem zweiten Stock vergessen. Ein Anfang war gemacht.
An der Haltestelle Neu-Westend stieg sie aus. Mit ihr verließen ein paar weitere Personen die Bahn. Petra eilte die Treppe hoch und lenkte ihre Schritte in die Preußenallee. Keiner der Leute, die mit ihr die Bahn verlassen hatten, ging in dieselbe Richtung wie sie. Jedenfalls schien es so zu sein. Den Kopf gesenkt, hastete sie voran. Es war nicht weit. Etwa fünfzig Meter, dann links in die Marathonallee. Sie drehte sich kurz um. Hatte sie gerade hinter sich Schritte gehört? Nein. Niemand war zu sehen. Sie brauchte dringend Schlaf. Ihre Nerven lagen blank. Sie zog den Schlüssel aus ihrer Jackentasche. Nur noch zehn Schritte bis zur Haustür. Nur noch fünf. Sie steckte den Schlüssel ins Schloss, da nahm sie im Augenwinkel eine lautlose Bewegung hinter ihrer rechten Schulter wahr.
2
Wie jede Nacht um dreiundzwanzig Uhr zog Karol Stanjek die Tür seiner Wohnung hinter sich zu und trat mit einem Leinenbeutel über der Schulter ins Treppenhaus hinaus. Den Lichtschalter drückte er nie. Es gehörte zu seinen täglichen Herausforderungen, mit der rechten Hand das Geländer zu ertasten und im Dunkeln die zweiunddreißig Stufen vom zweiten Stock hinunterzusteigen. Immer stellte er zuerst den linken Fuß auf die nächste Stufe, dann zog er den rechten nach. Unten angelangt ließ er den glatt lackierten Handlauf los und schlich die siebzehn Schritte bis zur Haustür, ohne die Seitenwände dabei zu berühren. Das gelang ihm. Das gelang ihm fast immer. Wenn er aber seine Linie mal verlor und eine seiner Schultern den groben Putz der Flurwände berührte, dann musste er zurück zur Treppe, die zweiunddreißig Stufen wieder hoch und wieder runter und dann wieder ganz vorsichtig Richtung Haustür schleichen. Im zweiten Anlauf hatte er es bisher immer geschafft.
Er verließ das Haus und ging durch die mattschwarze Aprilnacht auf der Möckernstraße zum Ufer des Landwehrkanals. Die Luft war feucht und diesig, es roch nach Regen. Karol folgte dem Uferweg ostwärts. Links das bleiern stehende Wasser, rechts vereinzelte Bäume und Büsche und in unregelmäßigen Abständen immer wieder Sitzbänke. Karols Bank befand sich etwa dreißig Meter hinter der Waterloobrücke. Sie stand etwas abseits zwischen wild gewucherten Büschen und war nur von der Uferseite aus zu erkennen.
Karol nahm aus dem Leinenbeutel eine Brille mit ungeschliffenen Gläsern, einen olivgrünen Anorak und die rote Fan-Kappe des FC Union Berlin. Er zog die Jacke an und überprüfte, ob sich sein Notizblock und der Kuli in der linken Innentasche und das Bündel Kabelbinder in der rechten befanden. Da dies der Fall war, setzte er die Kappe auf den Kopf und platzierte das etwas zu große Brillengestell aus beigefarbenem Hornimitat in seinem Gesicht. Er breitete den Leinenbeutel auf der Bank aus, ließ sich darauf nieder und schaute zum dunklen Wasser des Kanals. An einigen Stellen schwebten Schlieren aus weißem Dunst auf der Oberfläche. Die Gläser seiner Brille beschlugen und trübten seinen Blick. Er nahm das Gestell von der Nase, hauchte die Gläser an und rieb sie am Ärmel seiner Jacke.
Weder Fußgänger noch Radfahrer waren auf dem Uferweg unterwegs. Karol genoss die Stille und die angenehm reizlose Umgebung. Nach etwa fünf Minuten stand er auf und setzte seinen Weg in Richtung Carl-Herz-Ufer fort. Sein rechtes Knie schmerzte. Es hasste feuchte Luft.
Zwanzig Minuten später stieg er am Kottbusser Tor in den hinteren Wagen der U8 Richtung Wittenau. Die Bahn war gut gefüllt. Sonntagsausgänger, die gegen Mitternacht zu Hause sein wollten, weil morgen früh das Hamsterrad wartete. Darunter viele Paare, die aus dem Kino oder einem Theaterstück kamen, die bei einem Konzert oder im Restaurant gewesen waren. Nach Hunderten von Nächten konnte Karol die Fahrgäste einschätzen. Ohne wirkliches Interesse hatte er unzählige ihrer Gespräche mitgehört. Karol ging durch den Waggon. Der Geruch war in Ordnung. Ab und zu fand die Sekundenbrise eines Parfüms den Weg zu seiner Nase.
Es war nur noch ein Platz frei. Eigentlich nur ein Dreiviertelplatz, denn daneben saß ein Mann um die zwanzig, der so dick war, dass seine Körpermasse auf die angrenzende Sitzfläche rüberquoll. Als Karol sich auf die noch freien dreißig Zentimeter quetschte, seufzte der Kloß schicksalsergeben, als hätte sich das ganze Universum in dieses Moment gegen ihn verschworen.
Fette Sau, dachte Karol, kommst gerade von Mama, für die es nichts Schöneres auf der Welt gibt, als sonntags einem Mastschwein dabei zuzusehen, wie es sich Unmengen seiner Lieblingsspeisen einverleibt, und du glaubst, die ganze Bahn gehört dir. Karol machte es selbst ja auch keinen Spaß, neben und wegen dem Riesenbaby mit einer halben Arschbacke über dem Abgrund zu hängen. Er war schließlich kein Alpinist in den besten Jahren, sondern ein offiziell ausgewiesen schwer behinderter Mann mit siebenundfünfzig Lenzen auf dem Buckel. Er hätte seinen Ausweis zeigen und sich den Behindertenplatz neben der vorderen Ausstiegstür frei machen lassen können. Aber das machte er nicht. Das wäre zu auffällig. Er wollte nicht auffallen. Also quetschte er sich neben das Mastschwein. Denn Stehen in der Bahn ging gar nicht. Beschleunigen, bremsen, Kurven fahren, alles, was ihn dazu zwang, das Gewicht zu verlagern, verursachte Schmerzen. Gehen konnte er ganz gut. Wenn er das Bein bewegte, gelang es ihm meist, den Schmerz zu ignorieren. Es sei denn, die Luft war feucht. Dann half auch Gehen nicht. Heute Nacht näherte sich die Luftfeuchtigkeit der Schwelle des Unerträglichen. Aber egal. Es lag schließlich an ihm selbst, wie nachtaktiv er war.
Die Strecke vom Kottbusser Tor unter dem Alex durch bis zum Schnittpunkt mit der S-Bahn gehörte noch nicht zu seiner Mission. Er empfand diese neun Stationen in der U8 als Fahrt zur Arbeit, denn seine Nächte begannen erst in der Ringbahn. Karol verließ am Gesundbrunnen die U8 und fuhr die Rolltreppe hoch zum Bahnsteig der Linien S41 und S42. Die S42 fuhr im Uhrzeigersinn um die Stadt, die S41 gegen den Uhrzeigersinn. Karol wechselte die Richtungen von Nacht zu Nacht. Nach vier Minuten fuhr die S41 ein. Karol ließ sie fahren. Sieben Minuten später hielt die 42. Karol stieg ein. Es waren genügend Plätze frei. Er wählte einen am Fenster mit Blick gegen die Fahrtrichtung und streckte sein rechtes Bein aus.
Als der Zug einige Minuten später die Haltestelle Landsberger Allee hinter sich gelassen hatte, schloss er die Augen und ließ sich fallen in das monotone Gebummer, das Räder und Schwellen durch den Boden des Waggons zu ihm hochschickten und seine Fußsohlen angenehm vibrieren ließ. Seine Arme wurden schwer und warm, und der Schmerz verschwand aus seinem Bein. Tu-dumm. Tu-dumm. Tu-dumm. Tu-dumm. Karols Körper schmolz ein zu einer teigartigen Masse, die Gedanken befreiten sich aus seinem Hirn und stiegen auf in den Himmel über Berlin.
So wie heute Nacht hatte es angefangen vor fast drei Jahren. Zufällig eigentlich. Nach dem Unfall, den vielen Operationen und den Monaten in der Reha.
Am Westrand von Kreuzberg in der Wartenburgstraße hatte er das Apartment angemietet. Zwischen Möckernstraße und der Einfahrt zum Krankenhaus am Urban. Haus Nummer 17 gehörte einer vietnamesischen Familie, die während des Kriegs in die DDR geflohen war. Da die junge Frau, die ihm den Mietvertrag vorlegte, nicht nach seinem Personalausweis fragte, nahm Karol den Kuli in die linke Hand und krakelte »Peter Müller« darunter. Auf dem Briefkasten an der Flurwand im Erdgeschoss ließ er das Namensschild seines Vormieters kleben. Die Ein-Zimmer-Wohnung war knapp vierzig Quadratmeter groß, sie bestand aus einem Wohnraum mit Kochnische, einem winzigen Flur und einem Bad ohne Fenster, aber mit Wanne. Darauf hatte Karol Wert gelegt. Seinem Bein tat es gut, in warmem Wasser zu marinieren. Karol hatte in der Möbel-Oase Bozkurt am Kottbusser Damm einen Tisch mit zwei Stühlen, ein Bett und einen Fernsehsessel gekauft, bei dem man per Fernbedienung die Beinablage ausfahren und die Rückenneigung regulieren konnte. Karols Vormieter, ein Slowake namens Mikailovic, war mit einem One-Way-Ticket nach Kuba geflogen, um in Havanna ein neues Leben zu beginnen. Von ihm hatte Karol für neunhundert Euro die Einrichtung der Kochnische und den flachen Fernseher mit achtziger Bildschirm übernommen. Im Preis inbegriffen war eine Satellitenschüssel, die windgeschützt auf dem Flachdach stand. Gesehen hatte Karol das Teil noch nie. Aber es lieferte etwa dreihundert Programme. Er saß in seinem Sessel und schaute Sportsendungen. Rund um die Uhr. Sein Bett blieb so gut wie ungenutzt.
Alle drei Tage stand er auf und ging auf eine Krücke gestützt mit dem Rucksack zum Penny-Markt. Er kaufte Toastbrot, Müsli, Äpfel, Bananen, Aufschnitt, ein paar Konservendosen und H-Milch.
Am dritten Tag jeden Monats schellte gegen Mittag die junge Vietnamesin, überreichte eine unleserlich ausgefüllte Standardquittung und kassierte die Warmmiete in Höhe von fünfhundert Euro. Einen Festnetzanschluss brauchte Karol nicht. Auch keinen Internetzugang. Sein letztes Handy hatte er während der Reha in Bad Saarow zertreten und die Einzelteile in den Scharmützelsee geworfen. Wenn Karol in Mülleimern oder in der Bahn auf leeren Sitzen zurückgelassene Seiten einer Tageszeitung fand, las er jedes darauf abgedruckte Wort. Manches fand er sogar recht interessant. Das meiste aber erreichte ihn nicht. Es blieb draußen. Er las und vergaß. Das hatte nicht unbedingt etwas mit dem Unfall zu tun. Indirekt natürlich schon. Denn sein Leben war seitdem beendet, auf jeden Fall die Existenzform, die er unter Leben verstand. Warum sollte er informiert sein über das, was in der Welt vor sich ging? Er war nicht mehr wert als ein Haufen Hundekacke. Irgendwann kam ein Müllmann mit dem Kehrblech, und das war’s. Ob ein verrückter Amerikaner einem genauso verrückten Nordkoreaner eine Atombombe auf den hohlen Schädel hauen wollte oder ob ein schiitischer Moslem eine Moschee voller sunnitischer Moslems mit sich in die Luft sprengte, das musste er nicht verstehen. Und das wollte er auch nicht. So dachte Karol damals. Tief in ihm drin aber hauste seit Millionen von Jahren eine Druckkammer, klein wie ein Tischtennisball, gefüllt mit glühendem Magma, und bevor die Lava nicht aus ihm herauskatapultiert war, konnte er nicht sterben. Das hatte er während seiner ersten ziellosen Fahrt in der S41 geträumt.
Er hatte es sattgehabt, immer nur in den Fernseher zu starren und sich von einem halbwachen Schlummer in den nächsten rüberzuretten. Tief und traumlos geschlafen hatte er nicht mehr, seit die Schmerztabletten und die Tranquilizer aufgebraucht waren. Und zu Ärzten ging er nicht mehr. Sie hätten sein Bein hinkriegen können. Davor war er überzeugt. Aber es gab da einen Mann, der etwas dagegen gehabt hatte, dass er wieder gesund würde. Dieser Mann verfügte über sehr gute Kontakte und genügend Geld, um ehrgeizigen Chirurgen klarzumachen, dass es für sie sehr lohnend sein könne, den einen oder anderen Schnitt mit dem Skalpell ein paar Millimeter mehr rechts oder mehr links im Knie eines dahergelaufenen Polacken anzusetzen. Aber das war Schnee von gestern, geschmolzen und in die Kanalisation geflossen.
Als nach monatelangem Sitzen im elektrischen Fernsehstuhl sein Rücken im unteren Bereich immer wieder von messerstichartigen Attacken heimgesucht wurde, in deren Folge seine gesamte Wirbelsäule bis hoch in den Nacken über Stunden hinweg versteinerte, kramte Karol im Penny anlässlich der »Aktionswoche Fitness« aus einem Wühlkorb ein dunkelblaues Plastikköfferchen mit einem Paar zwei Kilo schweren Hanteln hervor, und er begann seinen Oberkörper, der nicht nur schmerzte, sondern vom ewigen Sitzen auch schlaff und krumm geworden war, täglich dreimal eine Stunde lang zu trainieren. Die entsprechenden Übungen hatte er noch drauf. So was verlernte man nicht. Schon nach einer Woche fühlte er sich entschieden besser. Die verstärkte Durchblutung des gesamten Systems verfehlte auch bei seinem rechten Bein nicht ihre Wirkung.
Karol machte seine Einkäufe von nun an ohne Gehhilfe und schenkte die Krücke einer Bettlerin, die seit drei Wochen vor dem Penny auf einem Kissen hinter einem leeren Kaffeebecher von McDonald’s und einem Pappschild kniete, auf dem geschrieben stand, sie habe ihren Fuß beim Kampf um Aleppo verloren.
Aber schlafen konnte Karol trotzdem nicht. Selbst wenn er fast den ganzen Tag lang trainiert hatte, stieg die ersehnte Müdigkeit nicht in ihm auf. Eine halbe Stunde dösen bei Snooker im TV, dann aufwachen beim Werbebreak mit zappelnden nackten Frauen, wieder wegtauchen bei einem Pferderennen in der Mongolei, endlich hochkommen bei fahlem Licht, das durch die Jalousie drang. Wieder eine Nacht vorbei. Wieder überlebt. Ohne Sinn und Verstand.
So konnte es nicht weitergehen. Und so ging es auch nicht weiter. Das frühmorgendliche Programm zwischen vier und sechs eines Senders, in den Karol sich zufällig reinzappte, als er es mit der Fernbedienung zum ersten Mal bis zur Nummer 245 geschafft hatte, bestand darin, dass ein Bummelzug durch Mecklenburg-Vorpommern fuhr, aufgenommen mit einer im Führerstand installierten Kamera. Das war alles. Keine Werbeunterbrechungen. Keine zappelnden Frauen, keine überschminkten Propagandistinnen, die Billigschmuck oder Mikrofaserlappen vertickten, oder fiese Animateure, die dazu aufforderten, eine bestimmte Telefonnummer anzurufen, um sich die bereitliegenden zehntausend Euro abzuholen, indem man die Frage beantwortete, wie eine dem Menschen ähnliche tierische Spezies mit vier Buchstaben und zwei Effs in der Mitte hieß, die sich mit Vorliebe von Bananen ernährt. Die Perspektive stur nach vorn, sanfte Kurven im gefühlten Abstand von zehn Minuten waren die Highlights. Ob es an der Verblüffung lag, die das Programm bei ihm auslöste, oder ob der starre Blick in die von den parallelen Linien des Schienenstrangs durchtrennte Landschaft tatsächlich den Ausschlag gab, wusste Karol selbst nicht. Tatsache aber war, dass die Schmerzen aufhörten, nachdem er das Programm eine halbe Stunde lang geschaut hatte, und er anschließend für zwei Stunden in einen traumlosen Schlaf sank. Da kam ihm die Idee, bei einem realen Erlebnis auszutesten, ob ihm dies ähnlich gut bekommen würde.
Während seiner Zeit als Personenschützer hatte er sich mit dem Netz der öffentlichen Verkehrsmittel Berlins vertraut gemacht. Aber eher theoretisch. Als mögliches Ziel von politisch motivierten Terroranschlägen zum Beispiel. Oder als Fluchtmöglichkeit für Intensivtäter nach einem Coup. Deshalb wusste er, dass die S-Bahn-Linien 41 und 42 in beiden Richtungen die Stadt umkreisten. Freitag- und Samstagnacht konnte man unendlich lang in der Ringbahn sitzen, ohne jemals eine Endstation zu erreichen. Karol war damals erst insgesamt vielleicht fünf Mal mit der U-Bahn gefahren, aber noch nie hatte er eine S-Bahn oder einen Linienbus, der durch Berlin fuhr, bestiegen. Das hatte er nicht nötig gehabt. Er war leidenschaftlicher Autofahrer und durfte den Dienstwagen über Nacht auf dem Stellplatz in der Tiefgarage abstellen, bevor er im Lift acht Stockwerke hochfuhr in seine Neunzig-Quadratmeter-Wohnung mit einem Balkon, der groß genug war, dass darauf bequem sechs Liegestühle nebeneinander Platz gehabt hätten.
Aber Karol empfing außer seiner Chefin keinen Besuch. Deshalb stand auf dem Balkon nur ein Sylter Strandkorb, in dem er in vielen Nächten saß und zu der beleuchteten Kuppel des Reichstagsgebäudes rüberschaute. Manchmal hatte seine Chefin neben ihm im Strandkorb gesessen und Champagner über ihre Unterlippe perlen lassen. Dann hatte sie das schlanke Glas abgestellt und den Zipp vom Reißverschluss seiner Anzughose gesucht und immer gefunden. Damals war er von einer Monatskarte für die Berliner Verkehrsbetriebe so weit entfernt wie der 1. FC Union Berlin vom Gewinn der Fußball-Champions-League.
Die Ringbahn wurde Karols rollende Reha-Klinik. Heilung auf Rädern. Er machte es sich auf einem Fensterplatz bequem und schlummerte ein und wachte auf und schlummerte weiter. Oder er schaute stundenlang nach draußen, wo die vorbeifliegenden Bilder der Stadt seinen Blick füllten. An den Wochentagen stand die Ringbahn zwischen ein und vier Uhr still. Während dieser Stunden ließ sich Karol durch das U-Bahn-Netz treiben, und wenn er das Gefühl hatte, gebraucht zu werden, erfüllte er seine Mission.
Gegen sechs Uhr verließ er am Südkreuz die S41 oder die S42 und ging zu Fuß nach Hause. Nach dem langen Sitzen tat das seinem Körper gut, vor allem seinem Bein. Es dauerte zwei Monate, dann konnte er sogar wieder langsam joggen. Mit steifem Knie sah das bestimmt irgendwie witzig aus. Manchmal drehten sich Kinder nach ihm um und grinsten. Karol hatte nichts dagegen, Kindern Spaß zu bereiten. Wenn Mädchen darunter waren, fünf oder sechs Jahre alt, dann lächelte Karol ihnen zu.
Um kurz nach eins stieg dann am Westkreuz eine junge Frau mit prallem Rucksack auf dem Rücken in die S42. Sie sah aus wie die typische asiatische Touristin. Klein, zierlich, naiv und unbeholfen, aber voller Zuversicht, solange ihr Smartphone die gewünschten Informationen übermittelte. Aber irgendwas stimmte bei dieser jungen Asiatin nicht. Offensichtlich übermittelte das Display nicht die erhoffte Hilfe. Nervös tippte sie auf dem kleinen Bildschirm herum, ohne zu einem befriedigenden Ergebnis zu gelangen.
Nicht nur Karol beobachtete die Frau, sondern auch ein etwa vierzigjähriger glatzköpfiger Mann mit breiter nach vorn gewölbter Stirn und kleiner Nase darunter. In seinem braunen Tweedsakko erinnerte er Karol an den Rektor seiner Grundschule in den Sechzigern. Den Kopf leicht weggedreht und etwas gesenkt schaute der Mann die Frau aus den Augenwinkeln verstohlen an. Erst dachte Karol, der Mann würde aufstehen und der Frau Hilfe anbieten, aber dann änderte sich etwas an seinem Augenausdruck. Eine Scham stieg darin auf, als täte er gerade etwas Verbotenes. Als hätte er ein ungutes Gefühl bei den Gedanken, die sein Hirn gerade produzierte. Er rieb seine Handflächen aneinander und presste dann mit der linken Hand die Finger seiner rechten fest zusammen. Seine Schultern zuckten leicht. Er musste sich beherrschen. Irgendetwas passierte mit ihm, etwas, über das er zunehmend die Kontrolle verlor. Seine Augenbrauen wackelten hoch und runter, während sein Blick an der Asiatin klebte.
Karol zog sein Notizbuch aus der Jackentasche und notierte Ort und Zeit und einige Stichworte, die den Mann in dem Tweedsakko beschrieben. Im Laufe der Jahre hatte Karol schon mehrere Notizbücher mit solchen Angaben gefüllt. Er hatte auch schon einige Male von einem öffentlichen Telefon anonym und mit verstellter Stimme die Polizei angerufen und Tipps gegeben. Ein paar Täter konnten aufgrund seiner Hinweise überführt werden. Nicht nur Sexualtäter, auch Räuber und Messerstecher, einmal ein verurteilter Mörder, der aus der Krankenstation geflohen war.
Die junge Asiatin drückte auf den Ausstiegsknopf. Die Bahn hielt an der Hermannstraße. Die Asiatin stieg aus. Der Mann im Tweedsakko stieg auch aus. Karol folgte ihm. Der Mann stellte sich an den Kasten, hinter dessen Scheibe der Plan mit dem Liniennetz aushing. Aber er schaute nicht wirklich auf den Plan.
Als die Asiatin ihrem Handy offenbar irgendeinen Hoffnungsschimmer entlockt hatte, folgte sie dem Wegweiser zur U8 Richtung Wittenau. Der Bahnsteig war voll von jungen Leuten, von denen die meisten nicht so aussahen, als müssten sie morgen früh zur Arbeit.
Als die kleine Asiatin, die mit ihrem hin- und herschwankenden riesigen Rucksack verloren wie ein Alien wirkte, stehen blieb und ihr Smartphone anstarrte, checkten viele der herumlungernden jungen Männer sie hemmungslos ab. Überfallen? Ausrauben? Vergewaltigen? Schlafplatz anbieten? Ihr Drogen verticken? Fast keiner der Männer auf dem Bahnsteig schien wirklich auf die Einfahrt einer U-Bahn zu warten.
Der Mann im Tweedsakko hielt sich im Hintergrund, immer im Rücken der Asiatin, die mit ihrem Smartphone beschäftigt war und seine Blicke nicht bemerkte. Vermutlich nicht. Vielleicht ignorierte sie den Mann in ihrem Rücken ja ganz bewusst. Was hätte sie sonst in ihrer Situation machen sollen? Die U8 fuhr ein, und die Asiatin stieg in den vorderen Waggon. Ein ganzes Rudel junger Menschen folgte ihr und auch der Mann im Tweed. Er blieb etwa fünf Meter hinter ihr stehen und ließ ihren Rücken nicht aus den Augen.
Am Alexanderplatz stieg sie aus, orientierte sich kurz und entschied sich für den Weg zum Ausgang links. Das Tweedsakko folgte ihr, und Karol folgte dem Tweedsakko. Als die Asiatin fast die Rolltreppe erreicht hatte, ertönten von oben mehrere weibliche Stimmen, und drei junge Frauen kamen die Treppe hinuntergerannt und umarmten die Asiatin herzlich. Die vier schienen sich gut zu kennen. Temperamentvoll quasselten sie in englischer Sprache mit unterschiedlichen Akzenten aufeinander ein, während sie gemeinsam die Rolltreppe hochfuhren.
Das Tweedsakko blieb stehen und drehte sich dann ruckartig um. Karol wurde von dieser Bewegung überrascht, der Blick des Manns, der nur ein paar Schritte vor ihm stand, saugte sich fest in seine Augen. Irgendwas schien ihm dabei durch den Kopf zu gehen. Erkannte er die rote Fan-Kappe wieder oder die zu große Hornbrille? Karol hielt dem Blick stand. Wie der unterlegene Rüde auf einer Hundewiese senkte der Mann endlich den Kopf. Vielleicht fühlte er sich durchschaut, vielleicht war er erleichtert, dass diese Nacht so endete. Vielleicht war er kein aktiver Sexualverbrecher, sondern nur ein kranker Mann, der danach gierte, nachts attraktiven Frauen hinterherzuschleichen, zu spüren, wie ihre Angst wuchs, wenn er seinen Schritt beschleunigte. Vielleicht machte ihn das geil. Vielleicht folgte er der Frau, bis sie ihr Ziel erreicht hatte, und hetzte dann zur nächsten dunklen Parkbank, um sich Erleichterung zu verschaffen. Karol war schon einigen solcher Verfolger in dunkle Parks gefolgt. Er hatte sich versteckt, bis der Mann einen Ständer hatte. Dann war Karol aus dem Gebüsch gekommen und hatte gefurzt, während er langsam an dem Wichser vorbeischlenderte, und wenn kein Furz in der Warteschleife war, hatte er einen herzlichen Gruß von Mutti ausgerichtet.
Manchen Männern, denen er immer wieder mal im U-Bahn-Netz begegnete und die schon mehrfach hinter Frauen hergeschlichen waren, folgte Karol, bis sie in irgendeinem Haus verschwanden. Diese Adressen notierte er.
Der Mann im Tweed drehte sich mit einer linkischen Halbdrehung aus Karols Blick und eilte auf die Treppe neben der Rolltreppe zu, über die der schwere Rucksack eben verschwunden war. Er würde die Frauen nicht verfolgen. Er würde den Anblick der hilflosen Asiatin mit in sein Bett nehmen. Er wollte so schnell wie möglich nach Hause und den stechenden Blick dieses seltsamen Hornbrillenträgers mit der roten Fußballkappe aus seiner Erinnerung löschen.
Karol schaute dem Tweedsakko hinterher, bis es oberhalb der Treppe kleiner wurde und verschwand.
Um zehn nach zwei fuhr die U2 Richtung Ruhleben ein. Im vorderen Waggon war einer seiner Lieblingsplätze frei. In Fahrtrichtung außen am Gang mit Blick durch den ganzen Wagen. Etwa die Hälfte der Plätze war besetzt, fast alle von jungen Menschen. Studenten, Touristen, Drogenabhängige, osteuropäische Mindestlohnempfänger, Bettler, Partygänger, die von Partys kamen, und welche, die zu Partys unterwegs waren.
Ein dunkelhäutiger Mann mit wilden Rastalocken stand mitten im Gang und begann hin und her zu swingen. Er streckte die Arme in die Höhe und lachte. Er schloss die Augen, und seine Bewegungen wurden größer. Geschmeidig wie eine Natter ließ er seinen dürren Körper um eine innere Mitte kreisen. Er legte die Hände auf seine Ohren, als wären sie Kopfhörer, aus denen ihm ein Playback eingespielt würde. Er lauschte, nickte im Takt, wartete auf den Einsatz und begann zu singen. Sein Mund öffnete und schloss sich bis zum Anschlag, weiße Zähne blitzten auf, und dazwischen bewegte sich eine rosafarbene Zunge. Er sang voller Hingabe, aber er sang stumm. Als würde er den Song in seinen eigenen Kopf hineinsingen. Irgendwann erstarben seine Bewegungen abrupt. Er nahm die Hände von den Ohren, schaute hinein und schüttelte sie, als könnte er so einen Wackelkontakt beheben. Er hielt sie wieder an die Ohren und zuckte machtlos mit den Schultern. Dann verbeugte er sich lachend und drückte den Halteknopf.
Der Zug stoppte an der Mohrenstraße, und der pantomimische Sänger machte sich bereit zum Ausstieg. Der gelang ihm auch. Aber erst nachdem er mit einem Hüftschwung wie ein Torero einer Frau ausgewichen war, die in die Bahn stürmte, sobald sich die Tür geöffnet hatte. Die Frau hastete ungesund hechelnd durch den Waggon und ließ sich auf einen Platz am Fenster fallen. Schräg gegenüber von Karol. Die Frau war elegant gekleidet und trug eine kleine Reisetasche und ein großes Problem mit sich durch die Nacht. Ihre Welt schien aus den Fugen geraten zu sein. Sie stellte die Tasche in ihren Schoß und stemmte die Ellenbogen darauf. Sie faltete die Hände, schloss die Augen und ließ ihren Kopf auf die Fingerspitzen sinken. Durch die Nase stieß sie in unregelmäßiger Folge kurze Atemstöße aus und schüttelte immer wieder in minimaler Amplitude den Kopf.
Karol holte sein Notizbuch hervor und schrieb ein paar Worte hinein. Was mochte der Frau zugestoßen sein? Sie passte nicht in eine U2, die zwei Stunden nach Mitternacht durch die Unterwelt Berlins rauschte. Vielleicht brauchte sie Hilfe. Vielleicht vor sich selbst.
Karol würde ihr folgen, und falls sie von einer Brücke springen wollte, würde er sie in ein Gespräch verwickeln und ihr ein Taxi oder einen Krankenwagen besorgen, je nachdem. Sie war eine sehr schöne Frau, mit einer guten Figur. Ihre äußere Erscheinung, dezent und stilsicher, entsprach exakt dem Muster einer erfolgreichen Geschäftsfrau oder der Frau eines erfolgreichen Geschäftsmanns. Ein ähnlicher Typ wie Silke Mertens, seine ehemalige Chefin. Nur fünfzehn Jahre jünger. Karol horchte in sein rechtes Bein. Gepuscht vom Adrenalin, das in seinen Adern schwamm, pulsierte das Blut heftig unter der steifen Kniescheibe. Ein gutes Zeichen. Er könnte dieser Frau folgen, auch wenn sie mit großen Schritten losmarschieren würde.
Karol sondierte die Klientel in der Bahn. Niemand außer ihm selbst zeigte offensichtliches Interesse an der eleganten Frau. Karol notierte die Station, an der die Frau eingestiegen war, die aktuelle Uhrzeit und ein paar Stichworte, die ausreichen würden, dass er sich immer wieder an den Anblick dieser eleganten Frau zurückerinnern würde. Vielleicht war sie keine Geschäftsfrau, sondern eine Schauspielerin oder eine Moderatorin. Vielleicht war ja irgendwann mal ein Foto von ihr auf einer der Zeitungsseiten abgedruckt, die er in Bahnen oder Papierkörben fand.
Am Sophie-Charlotte-Platz stieg eine Punkerin in extrem kurzem Minirock ein. Sie hob eine Weinflasche an ihre schwarz gefärbten Lippen und nahm einen tiefen Schluck. Zwei schmale Männer um die zwanzig, gelbliche Haut und ölige Haare, griffen drei Meter neben ihr in die Halteschlaufen und schauten ihr aus schwarzen Augen dabei zu, wie sie sich mit dem Handrücken Rotweintropfen vom Kinn wischte. Nicht befremdet, angewidert oder mitleidig schauten die Männer sie an, sondern wie zwei Füchse, die im Park die Witterung eines verwundeten Kaninchens aufgenommen hatten. Es war der Klassiker. Hilflose junge Frau, betrunken und sexy gekleidet, nachts allein in der Bahn. Die war ja so zugedröhnt, die würde sich doch an nichts mehr erinnern, wenn sie morgen früh zerschunden und mit zerrissenem Slip in irgendeinem Gebüsch aufwachte.
»We are the champions, my friend.« Aus der entgegengesetzten Ecke der Bahn ertönte die triumphale Songzeile. Versteckt lächelnd schaute Karol der eleganten Frau dabei zu, wie sie mit Panikflecken im Gesicht in ihrer Tasche wühlte. Da sah er ein zartes Blinken unter ihrem Sitz. Er ging hin, hob das Handy auf und reichte es ihr. Sie nickte dankbar und würgte hastig den Heldentenor ab.
Die Bahn stoppte am Bahnhof Theodor-Heuss-Platz. Türen gingen auf, ein paar Fahrgäste stiegen ein. Die Punkerin schaute auf den Bahnsteig hinaus, rülpste und stieg aus. Die beiden Füchse stiegen ebenfalls aus. Karol schaute noch mal kurz zu der eleganten Frau und entschied sich für die Punkerin. Er stemmte sich aus dem Sitz hoch und schaffte es gerade noch, aus der Bahn zu kommen, bevor sich die Türen hinter ihm schlossen. Er drehte sich um und schaute zu der eleganten Frau zurück. Sie hob ihren Blick und schickte ihm lächelnd ein »Danke schön«. Die Bahn fuhr los, und das Band ihrer Blicke zerriss.
Die Punkerin stieg die Treppe hoch. Im Abstand von zehn Metern folgten ihr die schwarzäugigen Füchse. Karol heftete sich an ihre Fersen.
Die Punkerin stand auf dem Theodor-Heuss-Platz, leerte die Weinflasche in ihren Mund und ließ sie fallen. Sie kratzte sich am Ohr und schlug dann den Weg in Richtung Pommernallee ein. Die beiden Männer folgten ihr. Ab und an schauten sie sich verstohlen nach Karol um, der die Hände in seinen Jackentaschen vergraben hatte und in gleichbleibendem Abstand hinter ihnen herging.
Kurz vor dem Karolingerplatz blieben die Männer stehen und warteten, bis Karol an ihnen vorbeigehumpelt war. Sie drehten ab und gingen zurück in Richtung Theodor-Heuss-Platz.
Karol schaute der jungen Frau hinterher, deren zierliche Silhouette sich vor den Laternen abzeichnete und ab und an im Schatten der Bäume verschwand, die den Bürgersteig flankierten. Sie schwankte leicht. Aber es wirkte nicht wie ein betrunkenes Schwanken, eher wie der nächtliche Flug eines Schmetterlings, dessen natürliches Umfeld diese einsame und kaum beleuchtete Allee im Westen Berlins war. Sie schien eingebettet zu sein in diese Umgebung, die ihr das Gefühl von Sicherheit und Freiheit verlieh. Karol genoss die Situation. Bis ans Ende der Welt würde er der jungen Frau in dem viel zu kurzen Minirock heute Nacht folgen. Die Gewissheit, sie zu beschützen und eine Gefahr von ihr abgewendet zu haben, die sie selbst gar nicht bemerkt hatte, gab Karol das Gefühl, dass seine Existenz doch etwas mehr wert war als ein Stück ungekackte Scheiße im Po.
Der Schmetterling passierte den Karolingerplatz und setzte seinen Flug fort in die Ubierstraße. Außer Karol und der jungen Frau war kein Mensch mehr weit und breit zu sehen. Als links eine matt leuchtende Bierreklame auftauchte, unterbrach die junge Frau ihnen träumerischen Flug und verschwand in der Kneipe. Falls sie sich nur Zigaretten kaufen wollte, würde er seinen Weg später mit ihr fortsetzen, dachte Karol und blieb stehen.
Die Tür der Kneipe ging auf, und der Schmetterling trat hinaus und mit ihr ein Hüne mit Schultern, so breit wie ein Klavier, und einem glatt rasierten Schädel ohne Hinterkopf. Über seinem tätowierten nackten Oberkörper trug er eine schwarze Lederweste, aus der seine muskelbepackten Oberarme herausquollen wie Presswürste. Die junge Frau nickte zu Karol rüber, und der Hüne setzte sich breitbeinig in Bewegung. Karol wendete und setzte sich ebenfalls in Bewegung.
»Bleib stehen, du perverse Sau!«, hörte er eine raue Stimme in seinem Rücken. Karol blieb stehen und drehte sich um. Einen Meter vor ihm stoppte der Mann und starrte ihn hasserfüllt an. »Du schleichst also nachts hinter den Bräuten her!«
Karol nahm die Hände vorsichtig aus seinen Jackentaschen und schaute in die Augen seines vor Aggressivität berstenden Gegenübers.
»Ich schleiche nicht hinter Bräuten her«, sagte er. »Für so was bin ich zu alt.«
»Genau deshalb machst du es ja!« Aus dem Mund des Hünen sprühten Speicheltropfen. »Weil dich keine mehr ranlässt und du fürn Puff nicht die Patte hast!«
Karol hatte genügend Erfahrungen gesammelt mit Typen wie diesem angetrunkenen Schläger, der sich vor einem Mädchen zum edlen Rächer aufpumpte. Es konnte Karol jetzt nur darum gehen, sich möglichst nicht wehren zu müssen. Aber das würde schwierig werden bei diesem verstrahlten Flachkopf, dem er sofort angesehen hatte, dass er nicht weiter denken konnte als von der Wand bis zur Tapete.
Der Hüne hob die Hand und schnappte in Richtung Karols Kappe.
»Auch noch ’n Freund von den Eisernen! Dieser verkackten Ossibrut!«
Karol machte einen Schritt nach hinten. »Da hat die Kleine was missverstanden«, sagte er ruhig. »Ich bin ihr nicht hinterhergegangen. Ich hab nur zufällig denselben Weg.«
»Wohin bist du denn ›zufällig‹ unterwegs? Ich hab dich hier in der Gegend noch nie gesehen.«
»Ich arbeite als Wachmann drüben auf der Messe. Die Frühschicht fängt in ’ner halben Stunde an.«
»Das kannst du morgen früh deinem Zahnarzt erzählen, aber nicht mir! Niemand stellt ’ne Spreewaldgurke wie dich als Wachmann ein!«
»Ist aber die Wahrheit.«
»Dann zeig mir mal deinen Passierschein fürs Messegelände, du Klugscheißer. Ich bin da nämlich auch ab und zu tätig.«
»Ich brauche keinen Passierschein. Ich bewache auf dem Parkplatz zwei Lkw-Container, die morgen entladen werden.«
Der Hüne schien einen Moment lang abzuwägen, ob Karol log oder vielleicht doch die Wahrheit sagte. Da schob sich hinter seinem Rücken der Schmetterling in Karols Blickfeld und sagte: »Mach das Schwein fertig, Kroko!«
Sie schaute zum Hosenstall des Hünen runter und legte kurz ihre Hand an den Schwanz, der sich unter dem verschlissenen Stoff seiner Jeans abzeichnete. »Er soll bluten für alle Schwestern, die er in Nächten wie dieser in die Büsche gezerrt hat.«
»Ich habe noch nie eine Schwester in ein Gebüsch gezerrt«, sagte Karol.
»Halt deine dumme Fresse und gib mir deine Scheißkappe«, sagte der Schläger, »dann kann ich besser deinen Kopf abreißen und dir in den Hals scheißen.«
Der Schmetterling kicherte. »Yep, dann piss ich ’nen Schwall drauf und spül die Scheiße in seinen Magen ab.«
Das war jetzt genug. Der Karren saß zu tief im Dreck.
»Gib mir deine coole Brille«, sagte der Schmetterling. »Wär schade drum, wenn Kroko sie dir auf der Nase schmäscht.«
Sie streckte die Hand aus.
»Tu, was die Dame sagt!«, befahl der Hüne. »Und die Kappe gibst du mir!«
»Ich gehe jetzt zum Messeparkplatz«, erwiderte Karol. »Und meine Brille und meine Kappe behalte ich lieber. Die sind mir ans Herz gewachsen.«
Karol machte einen Schritt zur Seite, um an dem Hünen vorbeizukommen.
»Du bleibst stehen!«
»Nein.«
Karol machte einen weiteren Schritt. Da holte der Hüne aus. Er kündigte seinen Schlag an, indem er die Schulter nach hinten zog, um Schwung zu holen. Das dauerte viel zu lange. Als sich die schwere Faust endlich in Bewegung setzte, bog Karol sich aus der Hüfte heraus leicht zur Seite, packte mit seiner Linken die herbeifliegende Faust, riss sie mit und blockte den vollen Schwung mit der Vorderkante seiner Rechten auf dem Kehlkopf des Schlägers ab. Es hörte sich an, als würde eine Schildkröte von einem Lkw überfahren. Der Hüne fiel auf den Rücken. Wie ein vom Blitz gefällter Baumstamm blieb er liegen. Seine Augen standen offen und schielten in unterschiedliche Himmelsrichtungen. Das Leder seiner Weste war nach hinten geklappt. Unter seinem rechten Schlüsselbein hatte er als Tattoo die miteinander verschlungenen Buchstaben ABB. Als aus seinen rechten Mundwinkel hellroter Sabber schäumte, ging der Schmetterling mit schneeweißem Gesicht in die Knie, kotzte eine Flasche Rotwein und ein Dönersandwich über den Kopf seines Beschützers und sank ohnmächtig auf seinen Brustkorb nieder.
Karol schaute sich um. Niemand schien den Vorfall beobachtet zu haben. Auch die Kneipentür war die ganze Zeit über geschlossen geblieben.
Mit großen Schritten humpelte Karol los in Richtung Messegelände. Er hörte und sah weder Polizeiautos noch Notarztwagen, und niemand schrie ihm etwas hinterher. Er stopfte Anorak, Kappe und Brille in den Leinenbeutel und ging weiter und weiter. Er hatte viel Zeit, bis die Ringbahn wieder fahren würde. Zeit genug, um zu Fuß zum Westkreuz zu gehen. Und dabei Adrenalin abzubauen.
3
In normalen Nächten hätte er Berlin um diese Uhrzeit noch zwei Mal mit der Ringbahn umkreist. Aber weil heute keine normale Nacht war, stieg Karol um kurz vor fünf am Tempelhof aus und setzte sich auf dem Tempelhofer Damm in Richtung Norden in Bewegung.
Die Sache mit dem Hünen und der Punkerin saß ihm in den Knochen. Vielleicht hätte er etwas milder mit dem Mann verfahren sollen. Aber Karol war stocksauer gewesen. Erstens weil der Typ ihn mit Sicherheit mindestens halb totgeschlagen hätte, wenn er wehrlos gewesen wäre, zweitens weil der Typ ein hirnloses Arschloch war.
Das auf der Brust eintätowierte Monogramm ABB bedeutete Arische Bruderschaft Berlin. Geklaut hatte die Schlägerbande die Idee aus US-Gefängnissen, wo sich weißhäutige Mörder Aryan Brotherhood nannten, ihre muskulösen Körper mit Hakenkreuzen verzierten und sich gegen den Rest der eingeknasteten Welt verbündeten.
Falls der Hüne den zertrümmerten Kehlkopf überlebte, würde er mit seinen arischen Brüdern Jagd auf ihn machen. Kaum einer von denen hatte Arbeit, die meisten lebten von Sozialhilfe. Sie würden sehr gründlich nach ihm suchen, denn sie hatten viel Zeit.
Und drittens war Karol von dem Schmetterling maßlos enttäuscht. Klar, sie hatte gedacht, er wäre hinter ihr her gewesen. Vielleicht hatte sie auch schon mal jemand während eines ihrer Nachtflüge durch die City überfallen. Aber wie sie eben vor ihm durch die dunkle Allee geflattert war, hatte Karol sich mit ihr auf magische Art verbunden gefühlt. Er hatte ihr diese ausgelebte Unbekümmertheit so sehr gegönnt, und sie hatte sich die Schwerelosigkeit erlauben können, denn sie stand unter seinem Schutz. Sie war unantastbar. Und dann das. In den offenen Hals hätte sie ihm am liebsten gepisst. Die Sache war auf sehr unschöne Art eskaliert.
Vor drei Jahren, als er damit begonnen hatte, freitags und samstags die Nächte von dreiundzwanzig Uhr bis morgens um sechs in der Ringbahn zu verbringen, war er nur daran interessiert gewesen, seine Schlaflosigkeit und seine Knieschmerzen zu vergessen. Aber weil die Ringbahn an den Wochentagen zwischen eins und vier stillstand, beschloss Karol, diese Stunden im U-Bahn-Netz zu verbringen. Er stieg an irgendwelchen Stationen ein, an den Endstationen wieder aus und fuhr mit dem nächsten Zug in die entgegengesetzte Richtung zurück.
Er lernte jede Berliner Bahnstation kennen und sah Tausende von jungen Frauen, die allein in den Zügen und auf den Bahnsteigen unterwegs waren, und er wunderte sich, dass offenbar gar nicht so viel Schlimmes mit ihnen geschah. Jedenfalls las er auf den Zeitungsseiten, die er in Mülleimern oder auf Bahnsitzen fand, nur selten Artikel über Attacken gegen junge Frauen, die nachts von Bahnstationen auf dem Nachhauseweg waren.
Dann aber sah er eines Morgens in Hasans Kiosk auf der Titelseite der BZ den fetten Aufmacher vom Mord an einer achtzehnjährigen Abiturientin. Nach einer Party hatte sie die U5 in Wuhletal verlassen und war zweihundert Meter vor dem Haus ihrer Eltern tot aufgefunden worden. Auf den Bildern der Überwachungskameras konnte man sehen, wie der mutmaßliche Täter das Mädchen schon am Bahnhof Frankfurter Allee ins Visier genommen hatte.
Nachdem Karol den Artikel mehrfach gelesen hatte, entschloss er sich, von nun an in den Stunden zwischen eins und vier junge Frauen ohne deren Wissen zu observieren, bis sie ihr Ziel erreicht hatten.
Bereits nach sieben Nächten war aus diesem Zeitvertreib eine Besessenheit geworden, die in ihm die Leere auffüllte, die er brunnentief in sich gespürt hatte, seit er ein Krüppel war.
Jede seiner Begleitaktionen dokumentierte er mit Datum, Uhrzeit und den entsprechenden Bahnstationen, und er machte stichwortartige Notizen über Männer, die ihm verdächtig vorkamen. Über ihr Äußeres, über die Bahnsteige, auf denen sie herumstanden, und darüber, welche Züge sie bestiegen. Ihm war natürlich von vornherein klar, dass diese Zweitexistenz als Schutzengel für ihn nicht ungefährlich war. Wenn Frauen, die er zwangseskortierte, sein Verhalten falsch deuteten, wie es eben der Schmetterling getan hatte, und sie zur Polizei gingen. Wenn man ihn zur Fahndung ausschrieb und im Zuge der gegen ihn eingeleiteten Ermittlungen tatsächlich herausfand, wer er in Wirklichkeit war, dann wäre das sein Ende. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschah, war nicht besonders groß.
Trotzdem musste er vorsichtig sein und unnötige Risiken vermeiden. Eine Maßnahme in diese Richtung war, dass er sich bei seinen nächtlichen Missionen mit der roten Fankappe und der auffälligen Hornbrille verkleidete. Jede Frau, die aufgefordert würde, den nächtlichen Verfolger zu beschreiben, der in der U-Bahn schon so seltsam geguckt hatte, würde sich immer zuerst an die Kappe und die Brille erinnern. Selbst auf den in mindestens zwei Metern Höhe angebrachten Überwachungskameras war sein Gesicht unter dem Schirm der Kappe vermutlich kaum zu erkennen.
Das Schema war immer das gleiche: Wenn junge Frauen allein aus der Bahn stiegen und von verdächtigen Männern verfolgt wurden, ging Karol im Abstand von etwa fünfzig Metern hinterher und ließ die Frauen nicht mehr aus den Augen, bis sie ihr Ziel erreicht hatten.
Als er eines Nachts einer Frau in Hoppegarten folgte, hörte er aus einer Grünanlage unterdrückte Hilfeschreie. Er eilte in den Park und fand unter dem Klettergerüst eines Spielplatzes ein heftig miteinander ringendes Paar. Der Mann lag auf der Frau, hielt mit der einen Hand ihren Mund zu und zerrte mit der anderen an ihrer Gürtelschnalle. Karol riss den Mann an den Haaren hoch und rammte ihm sein gesundes Knie in den Sack. Er zurrte die Handgelenke des etwa vierzigjährigen Täters mit Kabelbindern an einer Reckstange fest, zog ihm Turnschuhe, Hose und Boxershorts aus und steckte ihm eine halbvolle Limoflasche aus dem Mülleimer in den Arsch. Dann suchte er mit der weinenden Frau ihr Handy, das aus der Jeanstasche gerutscht war, als der Mann sie von der Straße zum Spielplatz gezerrt hatte.
Ein Stich fuhr in seine Brust. Seine Lunge verkrampfte. Er atmete so flach wie eine Schuhsohle. Er brauchte dringend Ruhe, er brauchte seinen Fernsehsessel. Nach vorn gebeugt blieb er stehen, stützte sich mit der Hand auf dem Oberschenkel seines gesunden Beins ab und keuchte wie ein altersschwacher Ochse, der einen festgefahrenen Karren aus dem Schlamm ziehen sollte.
Nach einigen Minuten löste sich der Krampf seiner Atemwege etwas, und er konnte langsam weitergehen. Er holte die Kappe aus dem Leinenbeutel und rieb den Schirm sorgfältig an seinem Sweatshirt ab. Er steuerte den Altkleidercontainer an, der neben dem Eingang zum Flüchtlingsdorf Tempelhof stand, und warf die von Fingerabdrücken befreite Kappe hinein. Er nahm Notizblock, Kuli und das Bündel Kabelbinder aus den Taschen und stopfte seinen Anorak hinterher. Die Kappe hatte er vor vier Jahren in einem Gebüsch neben dem Stadion »An der alten Försterei« in Köpenick gefunden, der Anorak stammte aus einem pakistanischen Ramschladen in Neukölln. Niemand würde jemals den Weg zu ihm zurückverfolgen können. Auch die arischen Brüder nicht.
Aber das steife Knie war natürlich verräterisch. Da der punkige Schmetterling sich von ihm verfolgt gefühlt hatte, würde die Frau ihn irgendwann mal kurz in ihrem Rücken bemerkt haben. Und dabei konnte sie gesehen haben, dass er hinkte. Oder aber sie war multitoxisch so zugeballert, dass sie es nicht mitbekommen hatte. Was aber eigentlich unwahrscheinlich war. Wenn sie der arischen Bruderschaft erzählte, dass ein Hinkebein ihren Kroko plattgemacht hatte, dann musste Karol seine junge Frauen eskortierende Zweitexistenz neu bedenken. Aber um all diese Gedanken zu sortieren, brauchte er Ruhe. Und vorher sein Frühstück.
Wie jeden Morgen saß Hasan im Kiosk hinter dem Monitor des Notebooks und verfolgte Nachrichtentweets aus seiner Heimat. Neben dem Mauspad, auf dem seine Hand ruhte, stand ein kleines Radio, aus dem das Programm von B1 plätscherte.
Hasan war der einzige Mensch in Berlin, mit dem Karol regelmäßig redete. Nicht viel, aber regelmäßig. Hasan war fünfunddreißig Jahre alt und lebte seit neun Jahren in Deutschland. Er war freundlich und nicht neugierig. Denn er interessierte sich nicht für Berlin, er interessierte sich für Kurdistan, wo seine Mutter noch lebte und seine Großmutter väterlicherseits auch. Karol hatte ihn mal gefragt, aus welchem Teil des Kurdenlands seine Familie stamme, und Hasan hatte geantwortet, das Dorf liege im Nordirak nahe der Grenze zum Iran.
Den Kiosk, der rund um die Uhr geöffnet war, betrieb er zusammen mit seinem Bruder und einem Vetter in drei Acht-Stunden-Schichten. Hasan machte immer die Schicht von vier Uhr bis mittags um zwölf. Jeden Morgen, meist gegen halb sieben, betrat Karol den Kiosk und setzte sich auf einen der beiden Klappstühle, die neben dem Metalltischchen standen.
Hasan schaute von seinem Monitor auf, zapfte eine Tasse Kaffee aus einem Warmhaltespeicher und stellte sie vor seinen Stammgast.
»Danke, Hasan«, sagte Karol.
Hasan lächelte und zog eine Dose Ölsardinen aus seinem facettenreichen Sortiment, steckte den Zeigefinger in die Öse und öffnete sie mit geübter Grazie. Er drapierte sie neben einem Sesamring auf einem ornamentierten Teller, umwickelte eine Gabel mit einer Serviette und servierte. Karol aß und trank. Er schaute mit trägem Blick auf die drei Titelseiten der deutschsprachigen Blätter, die neben ein paar arabischen Magazinen in Hasans Zeitungsständer steckten. Würden darauf morgen früh die Aufmacher den gewaltsamen Tod des arischen Bruders Kroko in die Welt hinausposaunen? Karol schloss die Augen. Grelle Rottöne tanzten einen wilden Tanz mit gezacktem Gelb, waberten unrhythmisch wie eine ausgeleierte Herzklappe zwischen Horizont und Vordergrund.
Karol legte den obligatorischen Fünf-Euro-Schein auf die schmale Verkaufstheke. »Stimmt so.«
Ohne den Blick vom Monitor abzuwenden, erwiderte Hasan: »Schöne Tag noch.«
Karol war erleichtert, als er endlich den Schlüssel ins Haustürschloss steckte. Er betrat das Treppenhaus und drückte auf den rot leuchtenden Knopf, der mit lautem Klacken die Treppenhausbeleuchtung erstrahlen ließ. Das tat er heute zum ersten Mal seit drei Jahren. Aber heute war der Tag, an dem er alle seine eingefahrenen Rituale einer grundsätzlichen Sinnhaftigkeitsprüfung unterziehen musste.
Karol stieg die Treppe hoch, Stufe für Stufe, das gesunde Bein zuerst, dann das steife hinterher. Er betrat seine Wohnung und ließ die Badewanne volllaufen. Er rührte einen guten Schuss Latschenkiefernextrakt unter und senkte seinen Körper in den dampfenden Sud.
Er erwachte, als er im kalten Wasser zu frieren begann. Er zog den Stöpsel, stemmte sich hoch und griff zum Handtuch. Er putzte sich die Zähne, zog seinen Jogginganzug aus chinesischer Baumwolle an, wickelte sich in zwei übereinandergelegte Vliesdecken und lehnte sich in seinen Fernsehsessel zurück. Nach drei Stunden stand er auf, schob zwei Scheiben in den Toaster und erhitzte Wasser im Elektrokocher. Er legte eine dicke Scheibe Käse zwischen die gerösteten Brotscheiben und schüttete kochendes Wasser über einen Teebeutel.
Er hatte nun einen Plan A und einen Plan B. Welchen der beiden er in Angriff nehmen würde, entschied sich morgen früh in Hasans Kiosk, nachdem er die druckfrischen Tageszeitungen durchgeblättert hatte. Wenn nichts über die Attacke gegen den arischen Bruder drinstand, würde Karol die S1 oder die S7 nehmen und zum Wannsee rausfahren. Er würde ein kleines Kajütboot chartern und mit gutmütigen dreißig Pferdestärken auf der Schraube eine Woche lang die Havel rauf- und runterschippern. Das hatte er immer schon mal vorgehabt. Er würde genug Zeit haben, um zu überlegen, wie sein Leben weitergehen könnte. Ob er weiterhin ein Schutzengel sein wollte. Ob er seine nächtliche Mission in absehbarer Zeit mit neuem Outfit wieder aufnehmen sollte. Er könnte sich einen buschigen Schnäuzer unter seine Nase kleben, er könnte einen jagdgrünen Trachtenjanker mit Lederherzen auf den Ellenbogen tragen und die New York Times lesen.
Natürlich würde er die Gegend zwischen Messegelände, Olympia-Stadion, Westend und Westkreuz meiden. Vielleicht aber kam ihm ja während der langen Stunden auf der Havel eine ganz neue Idee, wie er zukünftig junge Frauen unauffällig auf ihren nächtlichen Heimwegen beschützen könnte. Das war Plan A.
Die nächsten Stunden verbrachte Karol im Dämmerzustand vor dem eingeschalteten Fernseher. Er fand nicht die Kraft, aus dem wärmenden Sessel aufzustehen, sich die beiden Hanteln zu greifen und sein Trainingsprogramm durchzuziehen. Wenn der Hunger größer wurde als das Bedürfnis, mit abgeschaltetem Hirn zwischen Ohnmacht und Tagtraum hin- und herzupendeln, griff er zu den Bananen, die er neben sich auf dem ausklappbaren Snacktablett deponiert hatte. Um fünf Uhr morgens stand er auf, zog Jeans, Sweatshirt und Turnschuhe an und verließ sein Apartment. Das Licht im Treppenhaus schaltete er ein. Er wollte jedes Risiko, sich zu verletzen, vermeiden, denn er spürte, dass er seinem Körper und seinen Sinnen in nächster Zeit unter Umständen einiges zumuten musste.
Die Straßen waren menschenleer, ein paar Vögel zwitscherten, und im Osten zog der schwarze Himmel einen hellgrauen Vorhang unendlich langsam hinter den Häuserblocks in die Höhe. Karol betrat den Kiosk und setzte sich auf seinen Stammplatz. Hasan schaute vom Monitor auf und zapfte Kaffee in eine Tasse. Karol wandte den Blick zum Zeitungsständer. Alle drei Boulevardblätter titelten mit derselben Story. MORD AN MAKLERIN (29).
Es gab viele neunundzwanzigjährige Maklerinnen in Deutschland, die letzte Nacht hätten ermordet werden können, aber Karol wusste sofort, dass die Tote die elegante Dame war, die gestern Morgen gegen zwei Uhr an der Mohrenstraße in die U2 gestiegen war, die innerlich so aufgewühlt gewirkt hatte, deren Handy mit der Fanfare »We Are the Champions« alle Mitreisenden für Momente aus der morgendlichen Lethargie gerissen hatte.