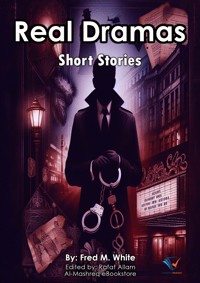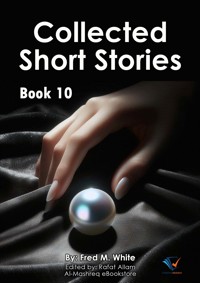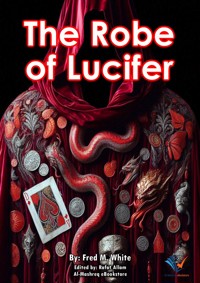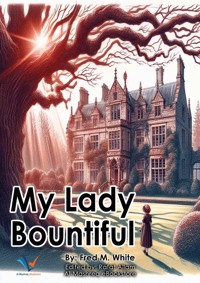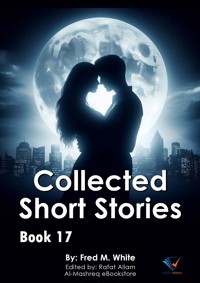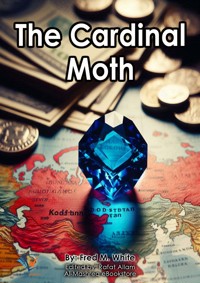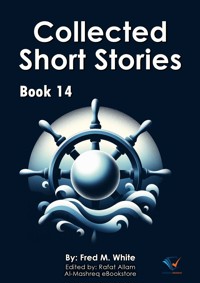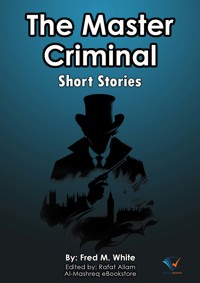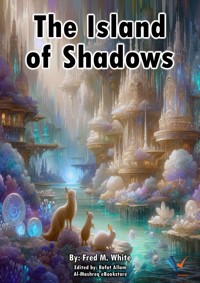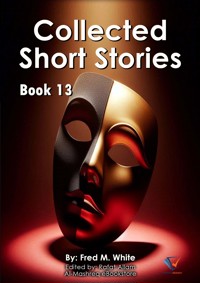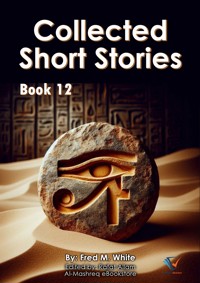0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In Port Indigo auf Kuba gerät der Journalist Drenton Denn in die Hände eines grausamen Diktators, der ein unvorstellbares Experiment an ihm durchführen will. Im Kongo rächt sich eine ehemalige Geliebte auf perfide Art an dem Journalisten und in New York legt Drenton Denn einer Bande von Brandstiftern das Handwerk. Diese spannenden Stories sind nur drei der insgesamt fünf Geschichten über Fred M. Whites Serienfigur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Fred M. White
Miasma
Die Abenteuer des Drenton Denn
Die bisher selten auf Deutsch erschienene Reihe wurde von Walter Brunhuber übersetzt.Inhaltsverzeichnis
Miasma
Specky Spider
Die Feuerkäfer
Das Elfenbeindorf
Der Tempel von Ulu
Fred M. White
Historische Hintergründe
Impressum
Miasma
Erstes KapitelDrenton Denn sah hinüber zu den Feuerstellen. Sie zogen sich die gesamte kubanische Küste entlang. Verborgen unter dem Mantel der Nacht herrschten Korruption und Verbrechen auf der Insel. Wie zu allen Zeiten spielte die Katze ihr tödliches Spiel mit der Maus. Jede Form von Humanität war durch die Ereignisse abgestumpft. Und Europa? Europa scherte sich nicht darum. Wie immer. Alles war in Ordnung, solange sich die Weltpreise für Weizen in einem erträglichen Rahmen hielten.
Für Drenton Denn allerdings hatte das was sich vor seinen Augen abspielte sehr wohl eine Bedeutung. Schließlich war er Kriegskorrespondent. Jenseits der Sandhügel von Port Indigo lag etwas, über das sich zu schreiben lohnte, etwas, das mit einer bis dato unbekannten Art von Grauen aufwarten konnte. Mit neuen Sensationen. Die unterdrückte spanische Bevölkerung wurde durch das Chaos und durch die schrecklichen Zustände die in Port Indigo herrschten langsam ausgehungert. Drenton war entschlossen, dieses Grauen in seinem Notizbuch festzuhalten, auch wenn es strengstens Verboten war, dass auch nur ein einziges Besatzungsmitglied der amerikanischen Kriegsflotte, die vor der Küste Kubas kreuzte, an Land ging.
Zur Blockadeflotte waren merkwürdige Geschichten durchgedrungen. Verbreitet von Einwohnern, die von der Insel geflüchtet waren. Der berüchtigte Don Macdona hatte demnach sein Hauptquartier in Port Indigo aufgeschlagen. Er hielt dort Hof. An seiner Seite hatte sich wohl der Abschaum der Insel versammelt. Früher oder später würde dieser tyrannische Bastard und Blutsauger in die Hände von Onkel Sam fallen und auf der Stelle erschossen werden. Soviel war sicher. Doch Don Macdona war nicht nur ein Fatalist, er war auch ein Lebemann. Deshalb genoss er das Leben solange Zeit dafür war.
Carpe diem. Dieser einprägsame und nicht selten wahre Spruch hatte von der ganzen Insel Besitz ergriffen. Von allen schillernden Insekten, die derzeit auf den Müllhaufen der Insel geboren wurden, war keine so schillernd wie Macdona. Wer er war, woher er kam, das wusste niemand. Es hatte bisher auch niemanden interessiert. Sicherlich war er aus dem Miasma entstanden, aus der vergifteten Luft, die das Gelbfieber hinterlassen hat, das auf Kuba wütete. Macdona hatte sich in der Einsamkeit Port Indigos festgesetzt und hatte dort eine handverlesene Auswahl von Abenteurern - übrigens auch Abenteurerinnen - um sich versammelt.
All das hatte Drenton Denn von einem Eingeborenen erfahren, der zum Schlachtschiff Maryland geschwommen und dort am folgenden Morgen gestorben war. Zuvor hatte er noch ohne Unterlass die eigenartigsten Dinge von sich gegeben.
Gelbe Motten und Macdona!
Weshalb gelbe Motten?
Auf eigenartige Weise vermischten sich diese gelben Motten mit dem Gelbfieber, einer Geißel, die Port Indigo derzeit zu verwüsten drohte.
Verborgen in der Dunkelheit lag an der Küste Kubas also das Material für eine spannende Story. Natürlich sah Drenton es als seine journalistische Pflicht an, darüber zu berichten. Für Autoritäten und Dienstvorschriften hat ein geborener Korrespondent ohnehin nicht viel übrig. Drenton musste die gelben Motten, die womöglich die Boten einer Seuche waren, sehen. Mit eigenen Augen.
Zum Teufel mit den Haien.
Es war nur eine knappe halbe Meile bis zu den Sandhügeln an der Küste. Drenton ließ sich an der Ankerkette nach unten gleiten, tauchte geräuschlos in die glatte Wasseroberfläche der Bucht. Seinen Notizblock und einen Revolver hatte er unter dem Helm verstaut. Mit etwas Glück konnte er sich ein Bild machen und mit den Informationen, die er brauchte, bis zum Tagesanbruch wieder zurück sein. Wenn alles klappte würde Admiral Saxon nichts davon erfahren.
So schwamm der drahtige, untersetzte Mann aus Vermont mit großen Zügen auf die Sandhügel zu. Drentons Körper war schlank und geschmeidig. Asketisch wie eine der Wildkatzen, die er so mochte. Die Haie, die sich in der Bucht tummelten, standen ganz oben auf der Liste der Bedrohungen, auf die er sich einstellen musste.
Tragischer Tot eines berühmten Kriegskorrespondenten.
Eine hervorragende Schlagzeile. Während Drenton noch die reißerische Nachricht seiner Todesanzeige entwarf, gruben sich seine Zehen jedoch bereits in den Sand der Küste. Geschafft: Port Indigo. Seit Jahren hatte kein Europäer mehr einen Fuß in diese Stadt gesetzt. Zu groß war das Unheil, das hier lauerte. Dafür waren die Grundstückspreise wohl etwas erträglicher als anderswo.
Drenton machte sich ohne zu zögern auf den Weg in die Stadt. Überall waren die Zeichen der Zerstörung und des Niedergangs zu sehen. Eine Handvoll Leuchtkäfer schoss glitzernd durch die Nacht. Aus ein paar Häusern fielen Lichtstreifen wie Speere auf die Straße. In einem dieser Lichtstreifen lag etwas, das zu pulsieren schien. Dieses ekelerregende Etwas hatte Ähnlichkeit mit einem menschlichen Körper, der in einer gelblichen Hülle gefangen war. Die eigenartige Hülle zitterte wie die Blätter eines Baumes an einem nebligen Sommernachmittag.
Als Drenton die pulsierende Masse mit dem Fuß berührte, spürte er eine Übelkeit in sich aufsteigen. Sofort erhob sich die gelblich schimmernde Wolke und umflatterte Drentons Kopf. Ein sanfter Rhythmus setzte die träge Luft in in Bewegung. Drenton wich mit einem Schrei des Entsetzens zurück. Er fand sich plötzlich in einer dichten Wolke gelber Motten wieder, kleine pelzige Insekten mit schlüpfrigen Körpern und hervorstehenden Augen. Drenton erschrak zutiefst über diesen Anblick. Der Grund waren die Informationen, über die er bereits verfügte. Jedes Wort, dass der Mann, der von Port Indigo auf die 'Maryland' geflohen war, hervorgestoßen hatte, kehrte in diesem Augenblick mit aller Macht in Drentons Gedächtnis zurück.
Das Gelbfieber das in Port Indigo wütete ging nach Ansicht des Mannes von gelben Motten aus. Dieses ängstliche Insekt war also gleichzeitig Verkünder des Unheils und Totentuch für seine Opfer. Nach kurzer Zeit senkten sich die Motten erneut, wie eine Wolke, auf den Körper, der zu Drentons Füßen lag. Im nächsten Moment sah er, wie sich die Tür eines Hauses öffnete. Die Gestalt einer Frau zeichnete sich als dunkle Silhouette vor dem Licht ab, das aus dem hellen Raum fiel der dahinter lag. Mit erhobenen Händen rief sie verzweifelt um Hilfe.
Drenton überquerte die Straße und fragte in seinem besten Spanisch, wie er helfen könne. Als die Frau ins Haus zurücklief folgte Drenton ihr in ein Zimmer, dessen Möbel von einem gewissen Wohlstand zeugten. In der Mitte des Raumes stand ein Mann, der wild mit den Armen herumfuchtelte. Die sanften Gesichtszüge des etwa vierzig Jahre alten Mannes waren vor Verzweiflung und Panik verzerrt.
„Ist er Wahnsinnig?“, fragte Drenton, kaum, dass er das Haus betreten hatte.
„Nein“, seufzte die Frau. „Die Motten. Sehen Sie die gelben Motten? Wir waren gewarnt. Heute Morgen kam eine davon zu uns. Nicht eine Tür und nicht ein Fenster haben wir seitdem geöffnet. Und doch sind sie im Haus.“
Erneut packte Drenton ein Gefühl tiefen Entsetzens. Tatsächlich begann sich der Raum schnell mit kleinen gelben Motten zu füllen. Der rettungslos verlorene Mann zerschlug sie, wo immer es ging, mit seinen Händen. Unzählige getötete safrangelbe Motten bildeten einen Ring um seine Füße. Und trotzdem konnte Drenton die gegenüberliegende Wand des Raumes bald nicht mehr erkennen, so dicht tummelten sich Schwärme von Motten in dem Zimmer.
„Kann man denn nichts tun?“
„Nein. Sein Leid wird bald ein Ende haben. In ein paar Minuten. Oh, mein Gott.“
Den Spanier schien plötzlich der Mut zu verlassen. Die bizarre schrecklich Lage, in der er sich befand, ließ seine Entschlossenheit zu Staub zerfallen. Mit einem Schrei ließ er die Hände sinken und stürzte wie ein aufgeschreckter Hase aus dem Haus. Drenton folgte ihm. Bald schon sah er ihn auf dem Boden liegen. Der Spanier hatte sich nur ein paar Schritte auf die Straße gekämpft und sich dann der Länge nach hingeworfen. Als Drenton die ausgestreckte Gestalt auf den Rücken drehte waren die Glieder des Spaniers schlaff. Der Mann war tot.
Umgehend senkte sich der gelbe Schwarm wieder über ihn. Drenton wandte sich nach der Frau um. Sie war verschwunden. Von blankem Entsetzen ergriffen war sie wohl in das Herz der Dunkelheit geflohen. Drenton konnte sie nirgends mehr ausmachen.
Eine Sekunde später legte sich eine Hand auf seinen Arm.
„Sie sind Amerikaner“, flüsterte eine sanfte Stimme dicht an seinem Ohr. „Ein tapferer Mann, vermute ich. Helfen Sie mir. Ich bitte Sie.“
Zweites KapitelEin Lichtstreifen fiel durch ein Fenster und legte sich quer über das Gesicht der Frau, die ihn angesprochen hatte. Ihre Gesichtszüge waren auffallend schön und hatten die Frische der Jugend, gepaart mit einer gesunden Hautfarbe. Die junge Frau war geschmackvoll gekleidet und doch lag etwas in ihrem hübschen Gesicht, das Drenton zurückstieß, während es ihn gleichzeitig anzog.
„Sind Sie in Gefahr?“, fragte er.
„Oh ja“, antwortete sie. „Welche Gefahr, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen.“
„Ich nehme an, dass Sie von hier sind.“
„Das ist wahr, Signor. Doch ich bin mittlerweile sehr einsam hier. Alle, die mir nahe standen, sind vor dem gelben Tod geflohen. Ich habe Angst. Schreckliche Angst vor Macdona.“
„Verstehe“, erwiderte Drenton hart. „Ich habe von diesem Herren gehört. Was kann ich tun?“
„Der Signor ist doch Offizier auf einem der Kriegsschiffe in der Bucht. Wenn Sie auf der Suche sind nach einem Abenteuern? - “
„In der Tat. Das bin ich“, meinte Drenton trocken. „Und ich muss gestehen, dass meine größten Erwartungen übertroffen wurden. Aber ich bin kein Offizier. – Ich bin nur ein einfacher Kriegskorrespondent.“
„Könnten Sie mich auf eines der Schiffe schmuggeln?“
Drenton schwieg. Er wusste, dass er nichts dergleichen für die Frau tun konnte. Es stellte sich heraus, dass ihr Name Donna Inez Castalo war. Sie versprach, dass sie einen für ihn interessanten Vorschlag hätte, vorausgesetzt, er könne ihren Wunsch erfüllen.
„Hier ist es nicht sicher“, endete sie. „Macdonas Spione sind überall. Kommen Sie mit zu mir in meine Hütte. Es ist eine sehr einfache Behausung. Dort werde ich Sie mit meiner alten Gouvernante, Donna Bella, bekannt machen. Einverstanden?“
„Meinetwegen“, sagte Drenton. „Ich komme mit.“
Es war nicht weit. Nach kurzer Zeit standen sie vor einem Tor, von dem aus eine Straße zu einem luxuriösen Anwesen führte. Der Vorraum war mit einer gewissen Extravaganz eingerichtet. Im Lichtschein der vielen Gaslampen wirkte das Zimmer verworren und bis zu einem gewissen Grad bizarr. Die Geräusche ausgelassener Festlichkeit drangen aus einem entfernten Winkel des Hauses zu ihnen. Drenton sah sich argwöhnisch nach seiner Begleiterin um.
„Was bedeutet diese Geheimniskrämerei?“, fragte er.
Donna Inez lachte.
„Es bedeutet“, sagte sie, „dass Sie Gast von Don Macdona sind. Sie entschuldigen mich sicherlich. Ich muss Sie nun für eine Weile alleine lassen.“
Sie schloss die Tür hinter sich. Drenton wusste, dass er von nun an ein Gefangener war.
Einen Augenblick später kamen vier kräftige Kerle herein. Sie waren bis unter die Zähne bewaffnet. Es war ihnen auf den ersten Blick anzusehen, dass sie zu allem entschlossen waren. Auf Geheiß der Männer folgte Drenton ihnen. Sie durchquerten einen gefliesten Korridor und bewegten sich auf ein Zimmer zu, aus dem der Lärm der ausgelassenen Feier kam. Schließlich stieß einer der Männer die Tür auf und dem amerikanischen Gefangenen bot sich ein überwältigender Anblick. Ein beeindruckendes Spektakel.
Etwa zwanzig Leute beiderlei Geschlechtes fläzten sich gemütlich um einen Tisch herum, an dessen Kopfende ein kleiner Mann saß, der einen übergroßen Kopf zwischen den Schultern trug und in dessen Gesicht ein diabolisch kluger Ausdruck geschrieben stand. Dieser Mann war Macdona.
Als Drenton eintrat erhob er sich mit einer freundlichen Geste.
„Willkommen in unserem bescheidenen Haus und an unserer bescheidenen Tafel“, sagte er. „Donna Inez hat uns auf Ihr Kommen vorbereitet. Gehen wir richtig in der Annahme, dass Sie der Kriegskorrespondent Drenton Denn sind? Wenn dem so ist, dann sind Sie auserwählt, über einige meiner unscheinbaren Erfindungen zu schreiben. Als Dank für ihre Freundlichkeit habe ich den Test eines sehr interessantesten Apparates für Sie persönlich reserviert. Fühlen Sie sich zunächst aber wie zu Hause.“
Drenton goss sich mit ruhiger Hand ein Glas Wein voll. Er war sich der Stärke seiner Nerven bewusst. Vor allem aber vertraute er auf seinen Revolver. Noch hatte er eine Chance. Einen Moment später ging die Unterhaltung weiter. Ein lautes Lachen war zu hören. Unmittelbar danach setzte ein wilder, spanischer Tanz ein.
Drenton setzte sich an den Tisch und beobachtete die eleganten Drehungen der Tänzer. Zweifellos fand der Tanz zu Ehren von Macdona statt. Als Gefangener, der Drenton wohl noch immer war, hatte er ein Auge auf das wirbelnde Kaleidoskop der Tanzpaare gerichtet und das andere auf die Ausgänge des Raumes.
„Keine Möglichkeit von hier zu entkommen“, flüsterte eine Stimme nahe an seinem Ohr.
Eine flammende spanische Schönheit hatte sich auf den leeren Platz an Drentons rechter Seite fallen lassen. Ihr Gesicht war hart wie Marmor und doch strahlte sie so etwas wie Freundlichkeit aus.
„Ich vermute, Sie würden mir helfen, wenn Sie könnten“, sagte Drenton.
„Versuchen Sie bis zur Tür zu kommen, ohne, dass es jemand bemerkt. Jedenfalls sollten Sie sich etwas einfallen lassen. Wenn Sie eine Idee haben – ich warte an der Tür auf Sie. Lassen Sie uns tanzen. Macdona beobachtet uns argwöhnisch.“
Drenton ergab sich in den irrwitzigen Humor, den die ganze Situation in sich barg. Er war ein Mann, der auf den Rändern eines Vulkans tanzte, ein veritabler Tanz mit dem Tod.
Punkt Mitternacht drang der Schlag einer Glocke in den Lärm des Festes. Drenton hielt instinktiv inne und warf Macdona einen Blick zu. Hatte dieser sein Versprechen vergessen, oder wollte er nur die qualvolle Spannung verlängern? Wie auch immer. Macdona ließ sich nichts anmerken und der Tanz ging weiter. Er wurde immer verrückter, wilder, lauter. Drenton wurde vom Rausch des Tanzes mehr und mehr mitgerissen. Er vergaß alles um sich herum, bis zu dem Augenblick, als sich von hinten ein Arm um seinen Hals legte und ihn zwang stehen zu bleiben. Er keuchte, während der Arm ihn wie ein Schraubstock umklammert hielt. Drenton kämpfte wie eine Wildkatze, doch sein unsichtbarer Gegner war eindeutig im Vorteil. Schließlich näherte sich ein weicher, weißer Arm seinen Lippen und ein Taschentuch, getränkt mit einer süßen ätzenden Flüssigkeit wurde auf seinen Mund und seine Nase gepresst. Drenton hielt entschlossen die Luft an, presste die Lippen aufeinander bis ihm schwummrig wurde vor Augen. Sein Herz pochte so heftig, dass es die Rippen zu sprengen drohte. Jede Faser seines Körpers und sein Blut bäumten sich auf gegen die Luftnot. Drenton schnappte und japste nach Luft. Dann fiel er plötzlich, wie ein müde gewordenes Kind, in einen süßen und friedlichen Schlaf.
Als Drenton wieder zu Bewusstsein kam war er mit einem dünnen Manila-Strick umwickelt, wie ein Vogel, den man für den Bratspieß vorbereitet hat. Er fühlte sich noch immer krank und benebelt von den Nachwirkungen des Chloroforms. Bald spürte er, dass er keinen Grund hatte, sich über fehlendes Interesse der umstehenden Gäste zu beschweren. Auf einem Podest in der Mitte des Raumes stand ein gläserner Kasten der die Form eines Sarges hatte. Die kristallenen Seitenwände waren mit dicken Messingstreben eingerahmt. Das gesamte Ding war am Boden befestigt.