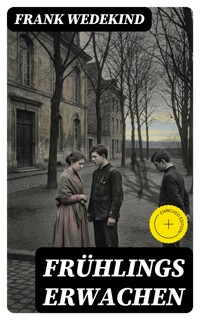Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Frank Wedekinds Buch 'MINE-HAHA' ist ein dramatisches Werk, das die dunklen Seiten der menschlichen Natur und Gesellschaft beleuchtet. Mit einem kritischen Blick auf die Moralität und die soziale Ordnung entlarvt das Buch die Verderbtheit und Heuchelei der damaligen Gesellschaft. Wedekind verwendet eine provokante und kontroverse Sprache, um die Tabus seiner Zeit zu brechen und die Leser zum Nachdenken über die Missstände der Gesellschaft zu bringen. 'MINE-HAHA' kann als ein Stück der rebellischen Literatur betrachtet werden, das die Leser herausfordert, ihre eigenen Werte und Überzeugungen zu überdenken. Das Buch fasziniert durch seine radikale Darstellung von Liebe und Sexualität, die bis heute relevant geblieben ist. Frank Wedekind, ein bekannter deutscher Schriftsteller und Dramatiker des ausgehenden 19. Jahrhunderts, war bekannt für seine kühnen Werke, die die Grenzen der bürgerlichen Moral überschritten. Seine Erfahrungen im Theater und sein kritisches Denken prägten seine schriftstellerische Arbeit und führten zu Werken wie 'MINE-HAHA'. Als künstlerischer Rebell und gesellschaftlicher Außenseiter brachte Wedekind die Themen der Unterdrückung und der Doppelmoral in seinen Werken zur Geltung. 'MINE-HAHA' ist ein zeitloses Werk, das die Leser dazu ermutigt, über die komplexen Fragen von Moral und gesellschaftlicher Normen nachzudenken und dabei die facettenreiche Natur des menschlichen Lebens zu erkunden. Wedekinds Buch bietet einen tiefgründigen Einblick in die menschliche Psyche und die Abgründe der Gesellschaft und ist daher eine empfehlenswerte Lektüre für alle, die sich für literarische Werke mit sozialer und philosophischer Relevanz interessieren. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MINE-HAHA von Frank Wedekind
Inhaltsverzeichnis
Als ich heute vor acht Tagen, um diese Stunde etwa, nach Hause kam, wurde ich unter dem Torweg von einem Schutzmann aufgehalten, der mir den Eintritt nicht eher gestattete, als bis ich ihm durch die Adresse einer an mich gerichteten Postkarte bewiesen hatte, daß ich im Rückgebäude wohne. Auf dem Hofe standen zehn bis zwanzig Menschen enggedrängt beieinander und tauschten mit gedämpften Stimmen ihre Eindrücke und Ansichten aus. Meine Zimmernachbarin, die vierundachtzigjährige pensionierte Lehrerin Helene Engel, hatte sich aus dem vierten Stock in den Hof hinuntergestürzt. Unter den Umstehenden galt es für gänzlich ausgeschlossen, daß ein mit klarem Bewußtsein vollführter Selbstmord vorlag; die Tat wurde vielmehr für die Folge einer geistigen Störung gehalten, die sich bei der alten Dame seit mehreren Monaten in plötzlichen Anfällen von Angst, Verworrenheit und Exaltation bemerkbar gemacht hatte. Nach wenigen Minuten fuhr draußen der Sanitätswagen vor. Nachdem ein Arzt den Tod als unzweifelhaft festgestellt hatte, hielt es unsere Zimmervermieterin für das zweckmäßigste, daß die Verunglückte sofort nach dem Leichenhause gebracht wurde.
Es mögen etwa drei Wochen her sein, daß mich die nun Dahingeschiedene eines Tages auf meinen Gruß hin auf dem Korridor ansprach. Sie sagte, sie habe kürzlich ein Buch von mir »Frühlings Erwachen« gelesen; ob ich ihr erlauben wolle, mir etwas Ähnliches, das sie selber vor langen Jahren einmal niedergeschrieben, zur Einsicht zu geben. Sie lud mich in ihr Zimmer ein, holte aus dem untersten Fach ihres Kleiderschrankes eine angebrochene Flasche Rotwein hervor und füllte zwei Gläser. Das Manuskript, dem ich diese Bemerkungen beifüge, lag auf dem Schreibtisch. Sie erzählte mir dann, sie sei als Kind sehr begüterter Eltern geboren. Mit siebzehn Jahren habe sie sich gegen den Willen ihrer Familie mit einem früheren Offizier, einem Witwer, verheiratet, dem sie schon als Backfisch eine abgöttische Verehrung entgegenbrachte. In wenigen Jahren schenkte sie ihm drei Kinder, die alle zu tüchtigen Menschen heranwuchsen, heute aber längst unter der Erde ruhen. Sie selber ließ sich, als sich ihr Gatte nach fünfjähriger Ehe plötzlich dem Trunk ergab, von einem blutjungen Architekten nach Amerika entführen, kam dort aber offenbar bald in die Lage, für ihren Geliebten arbeiten zu müssen. Sie erzählte mir, sie sei zuerst Dienstmädchen, dann Krankenwärterin und schließlich Lehrerin gewesen. Als solche lebte sie mit einem augenscheinlich hochgenialen Musiker zusammen, der sich sein Brot verdiente, indem er nachts im »Melodion« und anderen Tingeltangeln Klavier spielte. Weitaus die längste Zeit ihres amerikanischen Aufenthaltes habe sie in Brasilien verlebt, wo sie Indianerkinder unterrichtete und dabei auf ungesattelten Präriepferden ebenso sicher reiten lernte wie der geborene Sohn der Wildnis. Diese Erinnerung schien mir die aus ihrem Leben ihr selbst am teuersten zu sein. In der »Gartenlaube« las sie im Jahre 1871, daß ihr erster Mann bei Gravelotte den Heldentod gestorben war, und kehrte darauf nach Europa zurück. Ihre Eltern waren längst nicht mehr am Leben. Nach der Revolution hatten sie ihr Vermögen verloren und starben fast gleichzeitig in freudloser Zurückgezogenheit. Sie selber etablierte sich zuerst als Privatlehrerin und erhielt später Anstellung an einer höheren Töchterschule. Von irgendwelchen Parteinahme für die Ziele der heutigen Frauenbestrebungen konnte ich aus ihren Worten nichts entnehmen. Dagegen ist die Entstehung vorliegenden Manuskriptes wohl auf ihre spätere Lehrtätigkeit in Deutschland zurückzudatieren.
Dieses Manuskript erscheint mir, wenn ich es nicht überschätze, seiner stilistischen Eigenart wegen einer Veröffentlichung wert. Der Untertitel »Über die körperliche Erziehung junger Mädchen« stammt natürlich von mir. Ich glaube ihn beifügen zu müssen, da mir die Aufschrift »Mine-Haha« aus den Aufzeichnungen, soweit ich sie bis heute kenne, offen gestanden, nicht verständlich wird. Ich hoffe aber, daß sich in dem Nachlaß der alten Dame noch weitere Blätter finden.
I
Wenn ich mich dazu entschließe, in diesen Zeilen meine Lebensgeschichte niederzulegen, so geschieht es nicht, weil ich irgendwie den Beruf einer Schriftstellerin in mir fühle. Ich darf wohl sagen, daß mir nichts auf dieser Welt so verhaßt ist wie ein Blaustrumpf. Eine Frau, die ihren Lebensunterhalt durch die Liebe verdient, steht in meiner Achtung immer noch höher da als eine, die sich soweit erniedrigt, Feuilletons oder gar Bücher zu schreiben. Nur der Umstand, daß mein ganzes Leben so vollkommen verschieden war von demjenigen aller übrigen Frauen, kann mich dazu bewegen, das zu Papier zu bringen, was ich so manches Mal erzählt habe und was, wenn ich tot bin, niemand mehr erzählen wird. Ich werde nur dieses eine Buch schreiben; die Welt braucht meinetwegen nicht besorgt zu werden. Aber ich habe auch das bestimmte Gefühl, daß ich dieses eine nicht schlecht schreiben werde. Ob es nach meinem Tode gedruckt werden soll, darüber wird mein Sohn Edgar zu entscheiden haben. Rücksichten, die er den kleinlichen Verhältnissen, in denen er lebt, zu tragen hat, mögen ihn vielleicht davon abhalten. Diese Rücksichten können mich aber nicht davon abhalten, meine Erlebnisse zu Papier zu bringen, und wenn es mir nicht vergönnt ist, für einen verständigen Leser oder eine hübsche Leserin zu schreiben, so schreibe ich für mich selber. Jetzt, wo die fürchterlichen Aufregungen des Lebens vorüber und wo auch seine Freuden für mich erloschen sind, bleibt mir doch nichts besseres mehr zu tun übrig. Der einzige Wunsch, den ich auf dieser Welt noch habe, ist der, daß mich der Tod nicht ereilt, bevor ich die Feder aus der Hand gelegt habe. Ich muß befürchten, daß ich, da ich nun einmal mit Schreiben angefangen, in diesem Falle in der Erde keine Ruhe finden würde, sondern nächtlicher Weile zu meinem unvollendeten Manuskript zurückkehren müßte.
Aus meiner frühesten Kindheit weiß ich eigentlich nicht viel Interessantes zu berichten, obschon meine Erinnerung sehr weit zurückreicht, beinahe bis in mein zweites Lebensjahr. Aus meiner ersten Jugend ist mir nicht ein einziger Regentag in Erinnerung. Ebensowenig kann ich mich darauf besinnen, daß es jemals Winter geworden wäre. Mein ganzes Leben hindurch, wenn ich an jene Jahre zurückdachte, sah ich nur Sonnenschein, der durch dichte grüne Blätter fällt. Das helle Grün der von oben beschienenen Blätter, das ist der Himmel, wie ich ihn zuerst kennen gelernt. Und noch jetzt, wenn es mir manchmal so recht kindlich munter ums Herz ist, habe ich sofort wieder jenes Grün vor den Augen. Grün ist für mich die Farbe des Glückes, nicht die der Hoffnung. Um mir die Hoffnung noch unter irgendeiner Farbe zu denken, dazu bin ich zu alt, indem ich keine Ursache habe, noch irgendwelche besonderen Hoffnungen zu hegen.
Das früheste Bild, das sich meiner Erinnerung eingeprägt hat, ist folgendes: Ich bin auf einen Stuhl geklettert und stehe am offenen Fenster, neben mir Naema, die acht gibt, daß ich nicht herunterfalle. Ich fragte sie, was das vor mir für Blumen seien und sie nannte sie mir eine nach der anderen. Die große Kalla zu meiner Linken sehe ich noch heute so deutlich, daß ich danach greifen möchte; aber dann kommt lange nichts mehr, bis ich eines Tages neben dem Weiher das dichte Laubdach der Linden entdeckte, die den ganzen Garten beschatteten. Julian, einer der älteren Knaben, hatte mich, auf der Steinbrüstung des Weihers kniend, ins Wasser hinuntergelassen und untergetaucht. Jetzt stand ich wieder draußen, heulte, was ich konnte, rieb mir die Augen und blickte aufwärts. Da füllte mir beim Anblick der sonndurchleuchteten Blätter eine Wonne das Herz, die mich den Augenblick nicht hat vergessen lassen. In demselben Augenblick erinnere ich mich auch, zum erstenmal das Haus von außen gesehen zu haben; die niedrige, einstöckige, breite weiße Front mit der langen Reihe Fenster, jedes mit grünen Jalousieläden und einem dichten Blumenflor auf der Fensterbank. Und darüber das zweimal so hohe, steile Schieferdach, das sich in den Wipfeln der Bäume verlor, stellenweise mit Moos bewachsen und mit einem großen Dachfenster, gerade über der Haustür. Unter jener Haustür habe ich nachher so manches Mal auf einem Schemel gesessen und Stroh geflochten für unsere breiten Hüte, während kleinere Knaben und Mädchen, Kinder in dem Alter, in welchem ich damals war, zu meinen Füßen mit Erde und Wasser spielten.
Zusammenhängend werden meine Erinnerungen erst von dem Tage an, wo ich zum erstenmal Schuhe an den Füßen hatte, also mit Beginn meines vierten Jahres. Wir waren unserer sieben, drei Knaben und vier Mädchen, ein ziemlich starker Jahrgang, da wir alles in allem nur unserer dreißig Kinder im Hause waren. Die Schuhe wurden uns von Ella und Aspasia, zwei der ältesten Mädchen, die im darauffolgenden Frühjahre das Haus verließen, angezogen, und wir stolzierten selbstbewußt auf dem knirschenden Kies im Garten umher. Dann mußten wir uns aber gleich dem Hause gegenüber, dicht vor der großen hölzernen Halle der Größe nach aufstellen. Ich war die drittgrößte, über mir zwei Knaben; der dritte Knabe war der Kleinste von uns. Während dieses ersten Sommers trugen wir übrigens die Schuhe nur während der Übungen, was uns nachher ganz angenehm war, da sie immer so fest geschnürt wurden, daß man die leiseste Berührung hindurch empfand. So liefen wir denn die übrige Zeit noch mit Wonne barfuß in Haus und Garten umher.
Gertrud trat zu uns mit einer feinen Rute unter dem Arm. Sie war mit ihrem glattanliegenden schwarzen Haar, ihren funkelnden Augen, ihrem schmalen Gesicht und ihrer schlanken Figur für mich, bis ich jenes Haus verließ, der Inbegriff der Schönheit. Noch in meinem letzten Jahr stieg ich ihr oft bis unter den Dachboden hinauf nach, nur um das Vergnügen zu haben, sie die Treppe herunter kommen sehen. Jetzt mochte sie achtzehn oder neunzehn Jahre alt sein. Sie sowohl wie Naema, die etwas älter war, blieben alle vier Tage einen ganzen Tag über fort. Dann waren wir dreißig mit einer allein und mußten meistens waschen, das heißt die älteren, während die jüngeren die weißen Kleidchen um den Weiher herum zum Trocknen aufhängten.
Gertrud zog die Weidenrute, die sie in der Rechten hielt, durch die linke Hand und sah uns eines nach dem andern lächelnd an. Dann nahm sie ihr Kleid mit beiden Händen soweit hinauf, daß man ihre Beine bis über die Knie sehen konnte und zeigte uns, wie man gehen müsse. Sie trug außer den hohen gelben Schnürstiefeln auch noch weiße Socken, die ihr aber nicht einmal bis zur Mitte der Wade reichten. Sie hob die Knie ein wenig und setzte den Fuß mit der Fußspitze auf; dann ließ sie langsam die Ferse nieder, aber nicht bevor nicht der Fußrücken bis zur großen Zehe mit dem Schienbein eine gerade Linie gebildet hatte. Ihr volles, rundes, aber zart geformtes Knie streckte sich in demselben Moment, wo die Ferse die Erde berührte.
Wir alle mußten unsere Kleidchen hinaufraffen und mit den eingestützten Händen über den Hüften festhalten. Dann ging das Marschieren los, so langsam, daß man zwischen jedem Schritt einmal ums Haus hätte laufen können. Dabei hatte sie ihre Rute fortwährend auf unseren Fußspitzen, unter unseren Knien oder unter den Waden, wenn eins den Fuß zu rasch sinken lassen wollte. Lora, die kleinste von uns Mädchen, übrigens ein ausnehmend hübsches Kind, von der ich später noch viel erzählen werde, hätte beinahe angefangen zu weinen. Wenigstens rollten ihr schon die dicken Tränen über die Wangen hinunter. Aber Gertrud warf ihr einen so unheimlichen Blick zu, daß sie sich von dem Augenblick an mehr zusammennahm als alle übrigen.