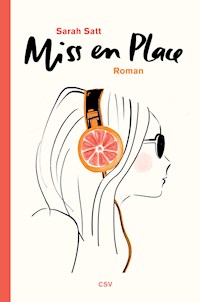
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CSV
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Die junge Musikjournalistin Sofia Sabato wird dazu verdonnert, über Essen zu schreiben. Für sie ein Albtraum. Bis eine junge Köchin ihr Interesse weckt – und sie in eine Welt einführt, die mehr mit Noten und Melodien gemeinsam hat, als sich Sofia jemals erträumt hätte … Sarah Satts erster Roman ist die höchst unterhaltsame Geschichte einer Frau, die erst über sich hinauswachsen muss, um ihren Platz im Leben zu finden. Ein witziges Buch über den Appetit auf mehr, italienische Familienrezepte, den Ernst des Lebens, Lieblingssongs und den Eigensinn der Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Die junge Musikjournalistin Sofia Sabato wird dazu verdonnert, über Essen zu schreiben. Für sie ein Albtraum. Bis eine junge Köchin ihr Interesse weckt – und sie in eine Welt einführt, die mehr mit Noten und Melodien gemeinsam hat, als sich Sofia jemals erträumt hätte …
Sarah Satts erster Roman ist die höchst unterhaltsame Geschichte einer Frau, die erst über sich hinauswachsen muss, um ihren Platz im Leben zu finden. Ein witziges Buch über den Appetit auf mehr, italienische Familienrezepte, den Ernst des Lebens, Lieblingssongs und den Eigensinn der Liebe.
Über die Autorin
Sarah Satt, 1987 in Graz geboren, lebt heute in Wien. Sie ist Kulinarik-Redakteurin und hat eine Reihe von Kochbüchern verfasst, arbeitete einige Jahre bei internationalen Werbeagenturen als Werbetexterin und studierte anschließend an der von Slowfood gegründeten Universität der Gastronomischen Wissenschaften im Piemont Esskultur und Kommunikation. Seit 2010 betreibt Sarah Satt den gleichnamigen kulinarischen Blog. „Miss en Place“ ist ihr erster Roman.Mehr auf www.sarahsatt.com und auf Instagram unter @sarah.satt
Jede Geschichte hat ihren Soundtrack.
Viel Vergnügen mit der Playlist zum Buch:
www.sarahsatt.com/miss-en-place-playlist
Sarah Satt
Miss en Place
Roman
CSV
Für Mama und Christoph
„MISE EN PLACE“ IS FRENCH FOR
„GET YOUR SHIT TOGETHER“.
— Anthony LeDonne
WHEN MUSIC WRITERS GROW UP,
THEY BECOME FOOD WRITERS.
— Drew Tewksbury
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Marmellata di Arance Rosse
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Pasta ca’ Muddica
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Cururicchi
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Arancini alla ’Nduja
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Briccone
Kapitel 25
Kapitel 26
Peperonata di Luciana
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Crostata di Ricotta e Limone
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Epilog
Bonus: Der Soundtrack für die Italien-Reise
Grazie mille!
Impressum
1
Sachen, die mich in den letzten drei Jahren zum Weinen gebracht haben (in beliebiger Reihenfolge, ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
• Der Tod von Chris Cornell (Nearly Forgot My Broken Heart – der Songtitel ein leeres Versprechen –, jedes einzelne seiner Lieder ist und bleibt eine schmerzliche Erinnerung).
• Das Ziehen meines Weisheitszahns rechts unten (hartnäckiger Bastard!).
• Patrick nach seinem Autounfall regungslos im Krankenhausbett liegen zu sehen.
• Das Ende von Extrem laut und unglaublich nah.
• Mit Grippe das Bett zu hüten, während HIM ihr Abschiedskonzert gaben.
• Als ich das erste Mal Julien Bakers Turn Out The Lights gehört habe (bei Minute 2:22 ging’s los).
• Schokokekse mit Zuckergusssternen …
Gibt es einen traurigeren Ort als einen 24-Stunden-Supermarkt nach elf Uhr nachts? Ein sonst lebendiger und geschäftiger Mikrokosmos, der so tut, als wäre alles ganz normal, obwohl sich in seinen Gängen gerade eine Zombie-Apokalypse abspielt. Die betrunkenen, wahrscheinlich eingerauchten Halbstarken, die sich am Snackregal zu schaffen machen, um ihren Heißhunger auf etwas zu stillen, das noch besser funktioniert als Chips und Wasabinüsse. Die blutleeren Workaholics, die mechanisch Smoothies, Fertigsalate und Rohkostriegel hamstern, in Gedanken schon bei der Nachtschicht, mit der sie morgen vor ihren Kollegen prahlen werden, das eigene Schlafdefizit wie einen Mitarbeiter-des-Monats-Orden stolz zur Schau gestellt. Dazwischen die Stadtstreicher, die ziellos zwischen Schildern mit Backwaren, Zahnpflege und Spirituosen umherstreifen.
Gilt man eigentlich auch als obdachlos, wenn man zwar einen Wohnsitz, zu diesem aber gerade keinen Zugang hat? Bescheuerte Sicherheitstür! Und das ausgerechnet heute. Es ist ja nicht so, dass ich mich das erste Mal in meinem Leben irgendwo ausgesperrt hätte – aber doch nicht mitten in der Nacht und ohne Handy! Das liegt jetzt in trauter Zweisamkeit mit meinem Schlüsselbund am Küchentisch.
Wäre ich MacGyver, hätte ich aus dem Inhalt meines Portemonnaies, das Gott sei Dank noch in der Jackentasche steckte, und den vor sich hin gammelnden Resten im Müllsack, den ich nur schnell nach unten bringen wollte, bestimmt eine improvisierte Vorrichtung zum Schlossknacken basteln können. Vorausgesetzt natürlich, ich wäre nicht vorher vom Gestank der zwei Wochen alten Asianudelreste ohnmächtig geworden.
Dass Patrick und ich gegenseitig unsere Ersatzschlüssel verwahren, hat sich schon öfters bezahlt gemacht. Da seine Schicht aber mindestens bis dreiUhr morgens geht, sich der Ersatzschlüssel für seine Wohnung in meiner befindet und ich als Millennial zwar schockierenderweise alle Strophen aus *NSYNCSBye, Bye, Bye, aber gerade mal drei Telefonnummern auswendig weiß (von Polizei, Feuerwehr und Rettung), erschien mir die Redaktion als beste Zufluchtsoption. Das gesamte Gebäude war vor zwei Jahren auf ein Schlüsselkartensystem umgestellt worden, weshalb sich der Schlüssel dazu jetzt in meinem Portemonnaie und nicht am Schlüsselbund in meiner Wohnung befindet. In einer Nachtschicht vor ein paar Wochen hatten Foto-Konstantin und ich noch gewitzelt, dass es angesichts der unzähligen Stunden, die wir in der Redaktion verbrachten, doch einfacher wäre, sie zwischen Arbeitsschluss und -beginn gar nicht erst zu verlassen. Morgen früh steht zweifellos eine Premiere ins Haus: Ich werde die Erste im Büro sein. Auf halbem Weg zu meinem Schlaf-, pardon, Arbeitsplatz ist mir aufgefallen, dass ich seit den zwei Brötchen auf dieser albtraumhaften Weinverkostung nichts mehr gegessen habe. Einer der Vorteile in einer Großstadt: Falls du die Nacht statt mit Partymachen lieber mit Shopping oder U-Bahn-Fahren zum Tag machen willst, kein Problem. Auf den Supermarkt beim Franz-Josefs-Bahnhof ist Verlass.
Im zahnarzthell ausgeleuchteten Inneren untermalt muntere Hintergrundbeschallung das triste Treiben. Willkommen im Fahrstuhl zum Weltuntergang! Und es kommt noch besser: Italienwochen! verkündet ein Werbebanner mit dynamisch wehender Grün-Weiß-Rot-Flagge. Schon habe ich Horvath wieder vor Augen, wie sie ihre Haare zu einem losen Knoten zusammenbindet und dabei eine perfekt gezupfte Augenbraue über der schwarzen Brille nach oben zieht: „Außerdem bist du doch Italienerin! Ist Essen nicht so was wie eure zweite Muttersprache?“
Nur weil ihr Urgroßvater Ungar war, geh ich doch auch nicht davon aus, dass mir meine Chefredakteurin ein Zahnimplantat zu einem unschlagbaren Preis einsetzen kann! Ich habe das Gefühl, keinen Deut italienischer zu sein als die über meinem Kopf ausgelobten Angebotswochen.
Den Großteil meiner Kindheit war Italien in unserem Zuhause ungefähr so präsent wie Autotune in einem Song von Freddie Mercury. Meine Mutter, eine Kalabresin aus der Kleinstadt Rossano, war dermaßen unermüdlich damit beschäftigt, alles echt Wienerische zu verinnerlichen, dass man hätte meinen können, mein Vater wäre in der Familie der mit den italienischen Wurzeln. Nach jahrelangem Perfektionieren und Hinterherrufen hinter ihrem Leo war es ihr sogar gelungen, das L, das ihm im zwölften Wiener Bezirk in die Wiege gelegt worden war, meidlingerischer auszusprechen als er. Hätte meine Großmutter mütterlicherseits nicht unentwegt dagegen gewettert, würde mein Name nicht Sofia Sabato, sondern Sofia Brunner lauten. Was mich nicht nur um eine klangschöne Alliteration, sondern auch um die dreiminütige Galgenfrist bei der alphabetischen Anwesenheitsüberprüfung im Klassenbuch gebracht hätte. Während in den Freundebüchern jede zweite meiner Volksschulfreundinnen unter Lieblingsspeise „Spaghetti“ oder „Pizza“ anführte, war bei mir feinsäuberlich „Schinkenfleckerl“ zu lesen. Ein Rezept, das Mama aus einem dicken Wälzer namens Die gute Küche hatte, der stets auf ihrem Nachtkästchen lag, wenn er nicht gerade in der Küche gebraucht wurde. Nach den Sommerferien schwärmte die halbe Klasse vom Strand in Grado, dem Luna Park in Jesolo oder den Sale Giochi in Lignano. Ich erzählte vom Strandbad Gänsehäufel und dem Wurstelprater.
Nur einmal im Jahr kam die Südländerin in meiner Mama durch. Anfang November, wenn die Sonne den Anschein machte, sich morgens ähnlich aufs Firmament quälen zu müssen wie unsereins aus dem Bett, hielten leuchtende Zitronen und Orangen Einzug in unsere kleine Wohnung. Zum ersten Advent war jede freie Fläche mit Kartons voller duftender Tarocco Blutorangen, Mandarinen, Cedri und Einmachgläsern verstellt, sodass man bei der Suche nach einem Platz zum Zeitunglesen oder Hausaufgabenmachen kreativ werden und ausweichen musste – ins Schlafzimmer oder, wie ich bevorzugte, in die Badewanne. Am besten gelaunt war Mama aber im Jänner, wenn sie Bergamotten aus Kalabrien geschickt bekam. Mir machten die Blutorangen wesentlich mehr Spaß, vor allem, weil ich meinen Klassenkameraden absurde Horrorgeschichten über die Provenienz des namensgebenden Blutes auftischte. Wenn ich am Ende meiner Ausführungen beherzt in mein Kipferl mit Blutorangenmarmelade biss, hoben selbst die coolen Jungs aus der letzten Reihe anerkennend die Augenbrauen.
Der Einkaufsroutenplaner hat seine Arbeit gut gemacht. Der Weg zur Sandwichvitrine führt geradewegs durch Italien. Durch ein Spalier von apulischem Olivenöl, Aceto Balsamico aus Modena, Salami aus der Emilia Romagna. Vorbei an Stapeln von Antipasti und Gläsern mit Sugo, flankiert von Teigwaren für alle geometrischen Neigungen und einem Wall aus Rotweinflaschen. Beim Gedanken an den Wein von heute Vormittag oder vielmehr die damit verbundene Serie an Fettnäpfchen, in die ich gleich beim ersten Termin in meiner neuen Position beherzt gesprungen bin, macht mein leerer Magen einen Salto. Gespräche mit ein paar Winzerinnen und Winzern führen, ihre Statements zum aktuellen Jahrgang einholen und mir die überzeugendsten Tropfen notieren – ein Kinderspiel, hatte ich mir beim Hinaufsteigen der Treppe zur Jahrgangspräsentation in der Hofburg gesagt. Keine zehn Minuten später war meine Zuversicht auf „Wenigstens ist der Spucknapf halb voll“ zurückgeschrumpft.
Drei Dinge, die du auf einer Weinverkostung unterlassen solltest:
1. Dort mit einem Coffee-to-go-Becher in der Hand aufkreuzen – Kaffee macht deine Geschmacksnerven offenbar schwerhörig und dich als Banausin kenntlich.
2. Mit einer Deo-Wolke kaschieren, dass du verschlafen und deshalb nicht geduscht hast – Noten von Katzenpisse können im Bukett eines Sauvignon Blanc durchaus erwünscht sein, Anklänge von Rexona sind es nicht.
3. Dein Glas ohne Übung mit vollem Enthusiasmus schwenken – das Farbspiel lässt sich zwar am besten vor weißem Hintergrund betrachten, aber nicht unbedingt auf der Tischdecke des Präsentationstisches.
Heute Abend also lieber kein Wein. Bleibt mehr für die Zombie-Jugend. Die drei Jungs, dem Oberlippen-Bartflaum nach allesamt um die sechzehn, haben es geschafft, sich von Chips und Co loszureißen, und schlendern mit ihrer salzigen Beute und einer Dopplerflasche Richtung Kassa. Einer von ihnen bleibt neben mir kurz stehen und mustert mich. „He Baby, hast an Tschick für mich?“ Kein Baby. Keine Zigarette. Keine Lust zu antworten. Nach einem zweiten, lauteren „He!“ lässt er es gut sein und versucht, seine Kumpels an der Kassa einzuholen. Ich habe es fast bis zu den Sandwiches geschafft, da schiebt sich eine vertraute dunkelbraune Packung in mein Blickfeld und wirft mich 24 Jahre zurück.
Der Sommer 1994 war ein ganz besonderer. Ich durfte ihn erstmals nicht im überhitzten Wien, sondern bei meiner Nonna Elisa in Rossano verbringen. Meine Eltern waren neben der Arbeit mit dem Umzug in eine größere Wohnung beschäftigt und dachten wohl, sie könnten auf meine Hilfe genauso gut verzichten wie ich auf Ferien zwischen Siedlungskartons. Von den Geschichten und Urlaubsfotos meiner Klassenkameraden beflügelt, sah ich mich bereits unter blau-gelben Sonnenschirmen Eis schlecken und mit anderen Kindern spektakuläre Wasserrutschen hinuntersausen. Nach meiner Ankunft stellte ich fest, dass es in Rossano zwar keine Strandpromenade, dafür aber Kirchen wie Sand am Meer gab. Die Tatsache, dass das Provinzstädtchen einmal eine der bedeutendsten Städte im Byzantinischen Reich war, lässt eine Achtjährige nicht gerade in Freudengeschrei ausbrechen. Angesichts der Cattedrale im Centro Storico, der Chiesa Panaghia, der Chiesa San Marco, der Chiesa San Nilo, der Chiesa Bernardino und der Kapellen wie der des San Francesco, des San Giacomo und San Domenico könnten die Bewohner gut und gerne jeden Tag der Woche ein anderes Gotteshaus aufsuchen. Glücklicherweise beließ es Nonna meist bei der Sonntagsmesse und einem sporadischen Gottesdienst unter der Woche, zu dem ich sie nur deshalb ohne Widerworte begleitete, weil wir am Heimweg im Caffè Tagliaferri einkehrten. Während sie ihren caffè al banco trank, bekam ich eine gefüllte Schoko-Cremerolle oder eine dieser aus Hunderten knusprigen Teigblättern bestehenden Vanille-Taschen serviert – meine zweitliebste Süßigkeit während dieses Sommers. Die wahre Delikatesse bewahrte Nonna in der obersten Lade ihres Nachtkästchens auf. Jeden Morgen, wenn es meiner kindlichen inneren Uhr zufolge höchste Zeit zum Aufstehen war, kam ich zu ihr ins knarrende Bett gekrochen, um sie dann bei ihrem Morgenritual zu beobachten. Nachdem ihre Finger vom Kreuz ausgehend die einzelnen Perlen ihres zartrosa Rosenkranzes abgewandert waren, griffen sie hinüber zur Nachtkästchenlade und förderten eine dunkelbraune Packung mit fein säuberlich eingerolltem oberem Ende und der weißen Aufschrift Pan di Stelle zutage. Mit fast zeremonieller Andacht und einem verschwörerischen Lächeln nahm sie einen Keks für sich und einen für mich heraus, wohlwissend, dass meine Mutter so eine Nascherei vor dem Frühstück nicht erlauben würde. Statt meinen Anteil sofort zu verschlingen, zählte ich zunächst gewissenhaft die weißen Zuckergusssterne ab, die den Schokoladenkeks zierten. Es waren immer exakt elf Stück.
„Wenn einer fehlt, ist er als Sternschnuppe vom Himmel gefallen. Significa: puoi esprimere un desiderio“– dann darfst du dir etwas wünschen, hatte mir Nonna bei meiner ersten Begegnung mit der fremden Nascherei erklärt. Sternschnuppen waren selten und ich hatte noch nie eine mit eigenen Augen gesehen, weshalb es mich nicht weiter verwunderte, dass wir weder in dieser noch in einer der folgenden Packungen ein Exemplar mit zehn Sternen vorfinden sollten. Noch Jahre später brachte mir Nonna, wenn sie uns einen ihrer seltenen Besuche in Wien abstattete, Pan di Stelle mit und betonte in Mamas Hörweite: „Ma solo a fine pasto!“ – aber erst nach dem Essen, wobei sie mir heimlich zuzwinkerte.
Als sie vor vier Jahren gestorben war, fuhren Mama und Papa allein zur Beerdigung nach Rossano. Ich war gerade in Helsinki, um eine Reportage über Tuska, ein mehrtägiges Metal-Festival, zu schreiben. Der finnische Name der Veranstaltung in einem ehemaligen Stromkraftwerk bedeutet so viel wie „Schmerz“ – eine unbarmherzige Pointe, die mir erst nach meiner Rückkehr bewusst wurde. Für die Reportage waren eine Doppelseite in der Printausgabe und ein erweitertes Online-Feature eingeplant. Ich hatte seit meiner Ankunft noch nicht mit dem Veranstalter gesprochen, noch keinen Hauptact gesehen und erst zwei der fünf Bands auf meiner Liste interviewt. Ich hatte meinen Job zu erledigen. Was hätte es auch geändert, wenn ich die Zelte frühzeitig abgebrochen hätte (buchstäblich, denn damals erschien mir ein Einmannzelt noch als passable Schlafgelegenheit) und nach Kalabrien geflogen wäre? Nonna war nicht mehr da. Und ich war inzwischen zu alt, um alle Kekspackungen der Welt nach einem fehlenden Zuckergussstern zu durchsuchen, um mir dann wünschen zu dürfen, dass sie es noch wäre.
Meine Augen brennen. Meine Hand, die Finger fest um die Packung Pan di Stelle geschlossen, zittert. Mühsam unterdrücke ich ein Schluchzen. Dann kommen die Tränen, sie schießen mir unkontrolliert in die Augen und laufen, vermischt mit Mascara, über meine Wangen. Ich bemühe mich mit den Ärmeln meiner Jeansjacke um Schadensbegrenzung. Schwarz wie die meisten meiner Sachen verschlucken sie die Mascaraflecken. Könnte sich bitte ein Loch im Boden auftun und dasselbe mit mir machen? Im Vorbeigehen schnappe ich das erstbeste Sandwich aus der Vitrine, das ich zu fassen bekomme, und lasse es neben die Kekse aufs Kassaband fallen. Die Kassiererin meint es gut mit mir, sie erspart mir Blickkontakt und jeglichen Small Talk. Vielleicht ist sie solche mitternächtlichen Gefühlsausbrüche gewohnt. Ohne eine Miene zu verziehen, überreicht sie mir mein Rückgeld. „Wiederschaun!“
Die Schlüsselkarte erfüllt sowohl am Haupttor in der Porzellangasse als auch im vierten Stock ihren Zweck und gewährt mir Einlass in das, was unter uns Mitarbeitern nur „die Brücke“ heißt. Im offenen Altbaubüro laufen alle Ressorts zusammen. Von hier aus werden große und kleine Geschichten navigiert. So wie in Star Trek, nur mit dem Unterschied, dass unser Lift alles andere als „turbo“ ist und das größte Fenster nicht in den Weltraum, sondern auf den alten Jüdischen Friedhof hinausgeht, der sich auf 2000 Quadratmetern im Innenhof erstreckt. Dass der einzige Zugang zum Friedhof über das gegenüberliegende Pensionistenheim führt, ist Horvaths liebste Pointe, wenn sie Partner und Gäste durch die Redaktion führt.
Wie friedlich die Brücke wirkt, in dieser absoluten Stille und beinahe völliger Dunkelheit. Das schwache Mondlicht spiegelt sich in Horvaths Glaskubus. An den in Sechsergruppen angeordneten Schreibtischen künden grüne Standby-Lichter von der ständigen Einsatzbereitschaft der Bildschirme. Mein Ziel liegt am anderen Ende des Raumes, aber ich denke nicht daran, das Licht einzuschalten. Mitten in der Nacht hier zu sein, ist schon schlimm genug, ich muss meine Misere nicht auch noch ausleuchten. Außerdem würde ich mich selbst mit Augenbinde und Kopfhörern auf der Brücke zurechtfinden. Im Besprechungszimmer stehen bereits Wasserflaschen und Gläser für die morgige Redaktionssitzung bereit. Die Neue vom Empfang muss sie vorsorglich hinübergetragen habe, bevor sie gegangen ist. Direkt dahinter befindet sich der Think-Tank – ein mit Whiteboards getäfelter fensterloser Raum mit zwei großen Sofas und drei vernachlässigten Gymnastikbällen für ergonomisches Sitzen. Ursprünglich wurde der Raum als IT-Kämmerchen genutzt. Nachdem die wachsende Abteilung in den oberen Stock übersiedelt war, standen plötzlich die Sofas drin und der Raum sollte zum Brainstormen und für Yoga genutzt werden – wie unvereinbar die beiden Aktivitäten sind, war der Geschäftsführung wohl entgangen. Ich schlage mein Lager auf dem größeren Sofa auf und begutachte mein in Plastik eingeschweißtes Sandwich. Tofu und Gemüse. War ja klar! Ich hätte mir einfach eine Käsekrainer am Würstelstand holen sollen, denke ich, während ich die Kekspackung aufreiße. Die Schokokekse verfehlen ihre tröstliche Wirkung und drücken erneut auf meine Tränendrüse. Sie schmecken wie früher. Ich mümmle und krümle mich durch die halbe Packung. Sternschnuppe hin oder her, ich wünschte, ich wäre zum Begräbnis nach Italien gefahren. Ich wünschte, alles wäre wieder wie vor einer Woche. Ich wünschte, Horvath würde einsehen, dass sie einen großen Fehler macht.
Marmellata di Arance Rosse
Diese fruchtige Marmelade aus Tarocco Orangen, die sich Mama jeden Winter direkt aus Kalabrien liefern lässt, zaubert in den grauen Wintermonaten das leuchtende Abendrot des Südens aufs Butterbrot, ins Kipferl – oder auch in die Biskuitroulade.
(Ergibt 5 Gläser a 250 Milliliter)
10-12 unbehandelte Blutorangen
(ungeschält ca. 1,8 kg, geschält ca. 1 kg)
1-2 Zitronen (für ca. 50 ml Saft)
350 g Gelierzucker 2:1
1. Zwei Blutorangen mit heißem Wasser abwaschen, gründlich abtrocknen und mit einem Sparschäler die Schale in feinen Streifen entfernen (ergibt ca. 30 Gramm Schale). Falls auf der Innenseite der Schalen noch weiße Haut (Albedo) zu sehen ist, mit einem Teelöffel abschaben, damit die Marmelade nicht zu bitter wird. Die Schalen blanchieren und in feine Streifen schneiden.
2. Alle Orangen sorgfältig schälen und die Schalen entsorgen. Die Orangen in Scheiben schneiden und alle Kerne entfernen. Die Zitronen auspressen. Die Orangenscheiben in einen Topf geben, mit dem Pürierstab pürieren und anschließend aufkochen.
3. Den Gelierzucker in das warme Orangenpüree einrieseln lassen – das verhindert, dass der Zucker karamellisiert und so den Geschmack verfälscht. Gut umrühren, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat.
Die Orangenschalenstreifen hinzufügen. Die Masse 6 bis 8 Minuten unter Rühren köcheln lassen, den dabei entstehenden Schaum immer wieder abschöpfen. Kurz vor Ende der Kochzeit den Saft der Zitronen hinzufügen.
4. Eine Gelierprobe durchführen. Die Marmelade vor dem Abfüllen 5 Minuten stehen lassen, damit sich die Schalen gleichmäßig darin verteilen. Mit einem Krug oder mithilfe eines Trichters in sterile Gläser abfüllen. Die Gläser verschließen und auf dem Kopf stehend abkühlen lassen.
Tipp: Falls die Marmelade eine besonders feine Textur haben soll, das aufgekochte Orangenpüree vor der Zuckerzugabe durch ein Haarsieb passieren. Wer auf die Schalenstücke in der Marmelade lieber verzichtet, püriert die blanchierte Schale mit den Orangenscheiben. In diesem Fall verringert sich die Einkochzeit auf etwa 3 Minuten.
2
Für die meisten Menschen sieht der Himmel auf Erden aus wie ein Postkartenmotiv aus der Südsee. Füße im weißen Sand, dahinter der türkisblaue Pazifik, ein exotischer Cocktail in Griffweite und keine Menschenseele, so weit das Auge reicht. Denk dir statt des Sandstrands wahlweise ein staubtrockenes oder ein schlammiges Feld (wer häufiger Festivals besucht, weiß, dass ein Zustand zwischen diesen beiden Extremen nicht existiert), ersetz den Ozean durch ein zwanzig Meter hohes, mit Technik aufmunitioniertes Bühnenkonstrukt und tausch den Schirmchen-Drink gegen ein Bier im Plastikbecher – willkommen in meiner Wohlfühlzone!
Mit rund Tausend Liveacts auf sechzig Bühnen kommt das Sziget Festival in Budapest meiner Vorstellung vom Paradies ziemlich nahe. Gut, auf den nur mit kniehohen Gummistiefeln bezwingbaren Matsch und den überfüllten, in kürzester Zeit zugemüllten Zeltdschungel kann ich inzwischen prima verzichten. Zu behaupten, dass ich die Dosenravioli à la Gaskocher und den Instantkaffee aus meiner Studienzeit vermisse, wäre ebenfalls gelogen. Ob mich mein studentisches Ich wohl für abgebrüht und versnobt halten würde, wenn es mir heute über den Weg liefe, hier, wo alles angefangen hat?
Damals konnte ich es kaum fassen, dass ich mir den ganzen Tag meine musikalischen Helden ansehen und meiner Begeisterung (Niemand rockt um vier Uhr nachmittags wie 3 Feet Smaller!) oder aber Enttäuschung (Keine Zugabe von Jimmy EatWorld!) schriftlich Ausdruck verleihen durfte und dafür auch noch bezahlt wurde. Das Honorar deckte zwar gerade einmal die Kosten für die Busfahrt hin und zurück und eine halbe Leberkäsesemmel, aber immerhin. Der wahre Lohn war das überwältigende Gefühl, meinen ersten Konzertbericht mit dem Vermerk „von Sofia Sabato“ in Österreichs größtem Magazin für Popkultur veröffentlicht zu sehen.
Würden sich die Bewohner von Wiener Mietshäusern für ihre Nachbarn interessieren, hätten mich meine damals wahrscheinlich für einen hoffnungslosen Nikotinjunkie gehalten. Gleich als Erstes nach dem Aufstehen (was in Anbetracht des studentischen Tagesablaufs ungefähr am frühen Nachmittag gewesen sein muss) war ich im Laufschritt zur Trafik an der Straßenecke geeilt, um mir die neueste Ausgabe des Magazins zu holen. So müssen sich Promis inkognito fühlen, hatte ich mir gedacht, als mir der Trafikant die Zeitschrift über den Tresen zuschob, ahnungslos, dass er eine der publizierten Autorinnen dieses Mediums vor sich hatte. Am ganzen Heimweg hatte ich es nicht gewagt, auch nur einen Blick auf die Anreißer auf der Titelseite zu werfen, geschweige denn einen ins Innere zu riskieren. Erst als ich die Tür meines WG-Zimmers hinter mir geschlossen hatte und im Schneidersitz am Boden kauerte, begann ich, eine Seite nach der anderen umzublättern, so vorsichtig, als wären es Schmetterlingsflügel. Ohne wirklich etwas zu lesen, ließ ich meinen Blick aus Respekt vor meinen Mitverfassern einige Sekunden auf jedem Artikel ruhen, bis zwischen Mutmaßungen über Britney Spears’ Schwangerschaft und Stylingtipps zum Bling-Bling-Look von Rapper 50 Cent endlich der Artikel mit meinem Namen zum Vorschein kam. Nachdem ich den Text Wort für Wort gewissenhaft durchgelesen hatte, fing ich wieder von vorne an – dabei hatte ich so lange daran gefeilt, dass ich inzwischen jeden Satz auswendig kannte. Der Sound-Sampler, der meine ersten Gehversuche als Musikjournalistin abgedruckt hat, ist bereits vor Jahren eingestellt worden. Heute sind alle im Publikum Chronisten, nehmen die Berichterstattung selbst in die Hand und stellen ihre Konzerterlebnisse in Echtzeit auf Blogs, Instagram und YouTube.
Damals hatte ich mich über die verwöhnten Ignoranten im VIP-Bereich lustig gemacht, inzwischen würde ich aber nur ungern auf seine Annehmlichkeiten verzichten. Konstantin scheint das ähnlich zu sehen. Mit zerzausten blonden Haaren und vorgeschobenem Nacken, von dem die Kamera baumelt, umkreist er seit fünfzehn Minuten das üppige Catering-Buffet wie ein wählerischer Geier. Konstantin ist in etwa so lange bei der Zeitung wie ich und ein angenehmer Zeitgenosse. Wie jeder gute Fotograf besitzt er das Talent, sich in beliebige Umgebungen, Situationen und Runden einzufügen, als gehöre er schon immer dazu. Selbst angespannte Interviewpartner scheinen nach wenigen Minuten zu vergessen, dass er überhaupt da ist. Falls die Fotobudgets der Medien weiter schrumpfen sollten, könnte sich Konstantin als Privatdetektiv eine goldene Nase verdienen. Im Moment gibt er sich mit einem Flammkuchen und einer Kräuterlimonade zufrieden. Die Auswahl an warmem Essen und Gratis-Drinks ist nicht übel, der wahre Vorteil liegt aber in der uneingeschränkten Sicht auf jeden einzelnen Auftritt, ohne ständig einen Ellenbogen in die Rippen oder einen Becher an den Kopf zu bekommen.
In Sachen Komfort ist der VIP-Bereich unschlagbar, die besten Geschichten finden sich aber zwischen den Shows mitten im Getümmel. In der mit bunten Sitzsäcken ausgelegten Chillout-Zone erzählt mir ein Däne im orange-schwarzen Tigerkostüm von seiner abenteuerlichen Anreise per Autostopp. Fünf Tage habe er bis nach Budapest gebraucht, alles für seine absolute Lieblingsband. Gerade noch Glück gehabt, denke ich mir, einen Tag länger und er hätte sie verpasst. Um ihren Idolen zu huldigen, bastelt eine bärtige Truppe aus Deutschland eifrig an einem eigenwilligen Kunstwerk. Mit viel Fantasie – oder dem entsprechenden Promillewert – bilden die leeren, auf ein Absperrgitter geklemmten Bierdosen das Bandlogo. Bei meinem Rückweg zu frisch gebrühtem Kaffee und anständigen Sanitäranlagen sticht mir eine Dame ins Auge, die selig ein quadratisches Notizbuch im Arm hält. Mit Dauerwelle, Blümchenbluse und Gehstock könnte sie genauso gut aus Mamas samstäglicher Tarock-Runde stammen. In diesem Rahmen wirkt sie wie ein exotisches Wesen. „Ich hab’ sie alle“, berichtet sie mir wenig später stolz, während sie durch ihre Autogrammsammlung blättert, „Die Fantastischen Vier, meinen Gröhnemeier, die gute Lohrin Hill – und jetzt endlich auch den Mäckelmohr!“
Auch wenn es solche Anekdoten nicht immer in den Artikel schaffen, lassen sich manche Künstlerinnen und Künstler beim Interview damit aus der Reserve locken. Je früher es einem gelingt, das Gespräch von der mit vorgefertigten Antworten und einstudierten Werbeaussagen gepflasterten Route abzubringen, desto besser. Wenn sich der eine oder andere dadurch an eine Zeit erinnert, als er nicht auf, sondern selbst stundenlang vor Bühnen gestanden ist, und daran, warum er nichts anderes als Musik machen wollte: Jackpot! Im besten Fall vergeht die ohnehin schon knapp bemessene Zeit bei dieser Art von Konversation wie im Flug, im schlimmsten fühlst du dich wie eine Mutter, die versucht, ihrem pubertierenden Nachwuchs Details über seinen Schultag aus der Nase zu ziehen (Ok. Wie immer. Will nicht darüber reden.).
Heute läuft alles rund. Ein kanadisches Elektropop-Duo verlegt unseren Interviewtermin vom Hotelzimmer in der Stadt in seinen gleich ums Eck geparkten Tourbus und erweist sich als ebenso gut gelaunt wie gesprächig. Der Deutschrocker der alten Garde ist kurz angebunden, liefert aber – ganz der Profi – zitierfähiges Material. Und selbst der abgehetzte Veranstalter lässt ein paar interessante Details zu den steigenden Künstlergagen und der heiklen Balance zwischen großen Namen und vielversprechenden Newcomern durchblicken. Zur Feuershow der Headliner habe ich mir mein erstes Bier des Tages also redlich verdient.
Manche meiner Kollegen sind der Meinung, um so authentisch wie möglich von einem Event zu berichten, müsse man sich mit allen Mitteln, insbesondere jenen mit der Vorsilbe „Rausch-“, so gut wie möglich ins Publikum oder in die Rockstars hineinfühlen. Ein Umstand, der den immer wieder zitierten Frank-Zappa-Sager „Rockjournalismus ist, wenn Leute, die nicht schreiben können, Leute interviewen, die nicht reden können, für Leute, die nicht lesen können“ inspiriert haben dürfte. Ich schreibe besser, wenn ich nicht zugedröhnt bin. Außerdem macht Zugedröhntsein deutlich mehr Spaß, wenn am Grund der Flasche keine Deadline auf dich wartet.
Konstantin hat alle Bilder im Kasten, und während die Meute grölend zurück zum Zeltplatz drängt, geht es für uns geradewegs zum Bahnhof. Kaum haben wir im Zug einen Viererplatz mit Tisch bezogen, döst der Kollege gegen seinen am Nebensitz thronenden Kamerarucksack gelehnt ein. Das konnte ich nach Konzerten noch nie. Viel zu viel Adrenalin und Endorphine, die zusammen mit der Überdosis an kostenlosem Koffein meine Blutbahn fluten. Zwei Stunden 41 Minuten, zeigt der Fahrplan am Monitor, dann sind wir wieder in Wien. Genug Zeit, um meine Eindrücke in den Laptop zu klopfen und, sollte mir das WLAN der Österreichischen Bundesbahnen gnädig sein, auf die interne Editing-Seite hochzuladen, damit ein Online-Redakteur den redigierten Artikel gleich morgen früh ins Netz und in die Welt entlassen kann.
Liveberichte schiebe ich nur ungern auf die lange Bank. Ganz anders als Rezensionen von Neuerscheinungen. Ein Album früher als einen Monat nach der Veröffentlichung zu besprechen, gehört verboten! Jedes Mal, wenn du einen Song hörst, verändert er sich und damit deine Auffassung davon. Die großartigsten Tracks offenbaren sich oft erst, wenn sich die vermeintlich eingängigeren Hits um sie herum nach mehrmaligem Hören abgenutzt haben. Sie aufzuspüren, geht nur so: Kopfhörer auf, raus ins Leben und herausfinden, über welche Situationen zu welcher Tageszeit sich die Musik an welchem Ort als perfekter Soundtrack legen lässt. Empirisches Ergebnis: Der Schreibtisch gegenüber von meinem, an dem Helmut vom Tech-Ressort für gewöhnlich an einer Smartwatch oder sonst einem hochtechnologischen Gadget herumfingert, ist das eher selten.
Bei Liveshows verlasse ich mich lieber auf mein Gedächtnis als auf bei schlechtem Licht hingekritzelte Notizen. Wenn mir etwas keine zwei Stunden in Erinnerung bleibt, ist es meistens sowieso nicht der Rede wert. Weil ich meine grauen Zellen aber auch nicht unnötig herausfordern möchte, bringe ich Erlebtes gerne möglichst frisch zu Papier.
In meinem Kopf spule ich gerade zu einem euphorisierenden Gitarrenriff zurück, das dem Songtitel Contagion (Ansteckung) alle Ehre gemacht hat, als mir jemand auf die Schulter tippt. Der Schaffner hat sich neben mir im Gang aufgebaut und bewegt seine Lippen wie ein Fisch. Ihnen entweichen zwar keine Luftbläschen, aber eben auch kein Ton. Macht sich der Schnauzbart etwa lustig über mich? Gerade will ich ihm einen entnervten Kommentar entgegenschmettern, da fällt mir ein, dass ich immer noch meinen Gehörschutz in den Ohren habe. Zwei Handgriffe später kann die Fahrkartenkontrolle ihren Lauf nehmen. Die 175 Euro für eigens meinen Ohrmuscheln angepasste Stöpsel waren die beste Investition, die ich je getätigt habe, abgesehen vielleicht von meinen Noise-Cancelling-Kopfhörern. Die schirmen mich nämlich nicht nur vom Lärm der Welt ab und ersetzen ihn durch warme Bässe und präzise Höhen, sondern schützen mich obendrein vor kollegialem Small Talk in der U-Bahn und beim Warten auf den Lift, was nicht nur nach einer kurzen Nacht Gold wert ist. Eine Wirkung, die sich noch verstärken lässt, indem man sich gleichzeitig ein Blickduell mit dem Handybildschirm liefert.
Als ich am nächsten Morgen beim Betreten des Redaktionsgebäudes von der bewährten doppelten Deckung Gebrauch mache, fällt mir das Flugzeugsymbol in der rechten Ecke meines Handybildschirms ins Auge. Während Konzerten stelle ich mein Telefon grundsätzlich auf Flugmodus. Zwischen Hauptbahnhof, Einschlafen während der Wiederholung einer uralten Tatort-Folge am Sofa und meinem Umzug ins Bett hatte ich wohl vergessen, ihn zu deaktivieren. Mit einem Wisch übers Display verschwindet der Flieger. Dafür trudelt jetzt eine Mitteilung nach der anderen ein. Sieben Anrufe in Abwesenheit, drei neue Nachrichten. Alle von Horvath. „Ich muss dringend mit dir reden.“ „Ruf mich an, wenn du im Zug bist.“ „Es ist WICHTIG!“
Oje, von den manikürten Fingern der Kapitänin ins Handy getippte Versalien verheißen nichts Gutes. Die Porträts der Songcontest-Anwärter, schießt es mir durch den Kopf. Nein, die habe ich vor meiner Abfahrt abgeschickt. Vielleicht geht es um das Interview mit dem rebellischen Dirigenten? Das habe ich doch gekürzt, wie sie es wollte. Der Lift scheint sich heute ähnlich schwer motivieren zu können wie ich, nachdem der Wecker geklingelt hatte. Während wir die vier Stockwerke hochfahren, rattern die Rädchen in meinem Hirn wie die Aufzugsketten eines Paternosters.
Kaum hat mich der Fahrstuhl auf der Brücke ausgespuckt, fixiert mich Horvaths eisblau funkelndes Augenpaar und meine Kopfhörer rutschen mir wie von selbst in den Nacken. Meine treuen Begleiter mögen mich vor privaten Herzausschüttungen, Einladungen zu Babypartys und blöden Fragen, die im Google-Suchfenster besser aufgehoben sind, bewahren, bei unvorhersehbaren Turbulenzen sind selbst sie machtlos.
„Sabato, subito!“, zitiert mich meine Chefredakteurin mit ihrer liebsten Klangfiguren-Kombi aus Alliteration und Homoioteleuton in ihren Glaskäfig. Schuldbewusst, ohne mir allerdings über den Ursprung meiner Schuld bewusst zu sein, setze ich an: „Sorry, wegen gestern …“
„Ich will gar nicht wissen, was dich von einem Rückruf abgehalten hat“, unterbricht mich Horvath und wischt meinen Versuch einer Entschuldigung mit einer Handbewegung beiseite.
„Wie du sonst bereits wüsstest, kommt Eduard nicht mehr zurück.“ Sie lehnt sich in ihrem Ledersessel zurück und faltet die Hände. Doch nicht etwa zum Gebet?!
„Oh Gott! Was ist passiert?“
Tatsächlich hatte ich Eddi, unseren Fresskritiker, schon eine Weile nicht mehr gesehen. Es muss mehr als zwei Wochen her sein, dass er zu irgendeiner Pressereise nach Spanien, Italien, möglicherweise auch Frankreich aufgebrochen ist. Das ist nicht ungewöhnlich. Er lässt sich oft wochenlang nicht auf der Brücke blicken, fliegt von einer Restauranteröffnung zur nächsten Weinmesse oder sucht zwischen Anden und Amazonas nach einer seltenen Kaffeesorte.
„Eine französische Winzerin ist ihm passiert.“
Kulinarikredakteur des „Plafond“ von Traktor überrollt. Weinverkostung endet mit tödlicher Alkoholvergiftung. Schlechte Kritik macht Winzerin zur Mörderin. Ich versuche, die Schlagzeilen, die vor meinem inneren Auge entstehen, mit Horvaths Mienenspiel abzugleichen. Ihr Gesicht zeigt nicht die Spur von Mitleid. Meines dürfte inzwischen ungefähr das Kalkweiß von Alice Cooper angenommen haben.
„Der viele Sancerre ist ihm offenbar zu Kopf gestiegen“, fügt sie abwesend hinzu, als würde das irgendwas erklären. Also doch ein Pestizid-Unfall?
„Ist er okay?“, will ich ehrlich besorgt wissen.
„Okay? Wahrscheinlich stampft er mit seiner Maitresse gerade liebestoll barfuß in einem Fass voller Weintrauben herum. Auf jeden Fall hat er sich entschieden, bei ihr in diesem Kaff zu bleiben und einen auf Viticulteur zu machen, was weiß ich.“
Schön, denke ich mir. Mein persönlicher Wunschtraum vom Aussteigen schaut anders aus, aber ist doch toll für ihn. Und für seine Konkurrenten bei anderen Blättern. Angeblich soll sich ja unter den heimischen Kulinarikschreibern die Redewendung „Nur Weller ist schneller“ etabliert haben, weil es Eduard Weller über Jahre hinweg gelungen war, immer als Erster über eine spektakuläre Neueröffnung oder den brisanten Restaurantwechsel eines namhaften Chefkochs zu berichten. Dass die Kleiderordnung manches Genusstempels in spe zum gegebenen Zeitpunkt noch Bauhelme, Gehörschutz und Sicherheitsschuhe vorschrieb, hielt ihn nicht davon ab, den Leserinnen und Lesern die Eröffnung des Jahres, der Saison oder der Stunde schon einmal anzukündigen. Die amüsante Vorstellung von Eddi, wie er in Vichy-Karo-Hemd und Pullunder auf einem Traktor durch den Weingarten tuckert, lässt mich fast vergessen, dass ich noch immer nicht weiß, was ich damit zu tun habe. Wenn nicht in der Redaktionssitzung, werden Mitarbeiterwechsel je nach Bekanntschaftsgrad (und mehr oder weniger erfolgreicher Kopfhörer-Defensive meinerseits) bei einem Feierabendbier oder in einem Abschieds-E-Mail kommuniziert.
„Eddi hat also gekündigt“, fasse ich die mir bisher bekannten Fakten zusammen. „Und das erzählst du mir, weil …?“
Horvath schaut mich an, als läge die Antwort vor uns auf ihrem Schreibtisch. Ist das eine Art von Test? Oder will sie, dass ich ihm gut zurede? Als ob das etwas ändern könnte. So dicke Freunde waren Eddi und ich auch wieder nicht. Er hatte mich mal gebeten, einen Blick auf die Schallplattensammlung aus dem Nachlass seines Vaters zu werfen, die irgendwo zwischen Hard Rock und Fusion Jazz der Siebzigerjahre angesiedelt war.
Zehn Höhepunkte:
1. In-A-Gadda-Da-Vida – Iron Butterfly
2. In the Court of the Crimson King – King Crimson
3. Exile on Maine St. – Rolling Stones
4. Wheels of Fire – Cream
5. Tyranny & Mutation – Blue Öyster Cult
6. Led Zeppelin II – Led Zeppelin
7. Sweetnighter – Weather Report
8. Head Hunters – Herbie Hancock
9. Bitches Brew – Miles Davis
10. The Köln Concert – Keith Jarrett
Auf der letzten Weihnachtsfeier haben wir uns ganz gut über die besten Roadmovies der Sechzigerjahre unterhalten, in Sachen Freundschaftsstatus würde ich damit aber selbst gegen seinen Frisör abstinken.
„Du wirst ab der übernächsten Ausgabe sein Ressort übernehmen.“
„Ich soll … über Essen schreiben?“ Der Gedanke ruft mir meine letzten drei Mahlzeiten in Erinnerung: Dukatenchips mit Mayo am Festival. Ein Falafel-Dürüm abends vor dem Bahnhof und zwei mit kaltem Wasser auf 0,3 Liter gestreckte Espressi gefolgt von einem Maracuja-Trinkjoghurt heute früh.
Ich warte darauf, dass Horvath endlich freudig losprustet, weil sie mich um ein Haar drangekriegt hätte. Aber ihre Augenpartie und Mundwinkel bleiben lachfältchenfrei wie in einer Anti-Aging-Werbung.
„Dein Ernst? Willst du dafür nicht jemand Neues einstellen? Ich kann … ich hab gar nicht genug Kapazitäten neben den Musikthemen und dem, was aus Bühne, Film und Fernsehen noch dazukommt.“
„Darüber mach dir mal keine Sorgen. Wir werden die Musikberichterstattung in der nächsten Zeit etwas herunterfahren. Food klickt bei unseren Onlinelesern einfach besser und darauf müssen wir reagieren.“
Ich weiß nicht, was ich sagen soll, also lasse ich es. Meine Sprachlosigkeit irritiert nicht nur mich. Die Chefredakteurin beugt sich versöhnlich zu mir über den Tisch.
„Es ist ja nur für ein paar Monate, vorerst.“
Immer noch keine Reaktion von mir, was Horvath zum Anlass nimmt, schwerere Geschütze aufzufahren.
„Wenn du so gut bist, wie ich denke, kannst du über alles schreiben.“
Ob sie das aus einem dieser sündhaft teuren Leadership-Seminare hat, in denen Manager lernen, wie sie ihre Mitarbeiter gekonnt manipulieren, pardon, motivieren? Horvath scheint mit dem zwar einseitigen, aber von ihr virtuos gestalteten Gesprächsverlauf zufrieden zu sein und erklärt unsere Unterhaltung mit einem demonstrativen Blick auf die Uhr für beendet.
„Außerdem bist du doch Italienerin! Ist Essen nicht so was wie eure zweite Muttersprache?“
3
„Es hätte viiiel schlimmer laufen können!“, befindet Patrick mit vollem Mund, während er mit der zweiten Hälfte seines Hühnerbagels kämpft und mir im Rückspiegel einen theatralischen Blick zuwirft. Den ganzen Vormittag habe ich meinen Schreibtischsessel hin und her gedreht und alle zehn Minuten die Zeitanzeige auf meinem Laptop fixiert, bis sie endlich 12.30 Uhr anzeigte. Unsere donnerstäglichen Mittagspausen gehören zu den Highlights meiner Woche, diesmal konnte ich es aber besonders schwer erwarten, auf die Rückbank des klimatisierten Patmobils zu klettern. Fast hätte ich vergessen, dass ich mit dem Essenspendieren an der Reihe war, so groß war der Drang, meinem besten Freund die exorbitante Ungerechtigkeit, deren Opfer ich geworden war, zu schildern und mich bei ihm über meine satanische Chefredakteurin auszulassen. Als ich beim Erwin-Ringel-Park um die Ecke bog, wartete meine Psychiatercouch auf vier Rädern bereits auf mich.
Die silbergraue BMW-5er-Limousine ist ein wenig in die Jahre gekommen, aber gut in Schuss. Sie verströmt eine Art weltmännische Lässigkeit. Das hat sie mit Patricks Stammkundschaft gemein. Geschäftsmänner, Medienmacher und Vorstandsmitglieder im Salz-und-Pfeffer-Look, die sich zu Meetings, Geschäftsessen, zum Flughafen und auch gerne einmal zu nächtlichen Terminen in schicke Hotels chauffieren lassen. So wie das hohe Tier, das donnerstags von 12.30 bis 14.00 Uhr unweit der Redaktion in der Börse zu weilen pflegt und Patrick und mir damit unsere gemeinsamen Siestas beschert.
„Sie hätte dir Mode aufs Auge drücken können. Oder Beauty. Oder, oh Mann, Sport!“ Das belustigt ihn dermaßen, dass er sich vor Lachen an einem Bissen verschluckt und zu husten beginnt. Ich enthalte mich jeglichen Kommentars und pfeffere eine Gurkenscheibe auf seinen Hinterkopf.
„Die Nachrufe?“, schlägt er nach einem Räuspern versöhnlich vor.
Ich werfe ihm einen bösen Blick zu und drohe an, einen Paprikastreifen nachzulegen.
„Ich meine ja nur, es geht um Essen – das musst selbst du ein paarmal am Tag, Sofia.“
Pragmatisch, praktisch, Patrick. Wenn ich ihn nicht gerade dafür hasse, liebe ich seinen lösungsorientierten Pragmatismus. Der hat mir in den letzten Jahren oft genützt und mir immerhin durch den Großteil des Publizistikstudiums geholfen. Ich muss wohl ziemlich verloren ausgesehen haben, als ich am ersten Tag der Medienpsychologie-Vorlesung am Rand des Hörsaals gestanden war. Höchstwahrscheinlich damit beschäftigt, schwarze Splitter von meinem Nagellack durch die Gegend zu schnipsen – eine Angewohnheit, die meine Mutter damals zur Weißglut trieb. Patrick hatte den „Soundgarden“-Aufnäher auf meinem Rucksack entdeckt und begonnen, den Refrain Black hole sun wont you come zu singen, während er mich auf den freien Platz neben sich winkte. Dieser war von da an für mich reserviert. Selbst die langweiligsten Vorlesungen – insbesondere solche, bei denen die Vorlesenden ihre Aufgabe wörtlich nahmen – gewannen an Unterhaltungswert, wenn Patrick mir Zettelchen mit völlig aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten der Dozenten zuschob. Seine Spezialität war aber die Bearbeitung trockener Definitionen, bei denen er einzelne Wörter durch andere – na ja, sagen wir weniger trockene – ersetzte (Auszug aus dem ersten Semester Public Relations: Masturbation lässt sich nicht delegieren, sie gehört zu den Führungsaufgaben und liegt in der Verantwortung des Top-Managements. Nur durch langfristige Masturbation lassen sich Konflikte mit Dialogpartnern vermeiden und mildern. Achtung: Nicht jede Masturbations-Maßnahme eignet sich für jedes Masturbations-Ziel gleichermaßen.).
Außer Botschaften und vielsagenden Blicken tauschten wir gewissenhaft füreinander zusammengestellte Mixtapes aus, die in der Post-Walkman-, Prä-MP3-Ära eigentlich Mixdiscs waren und unsere persönlichen Charts oder unseren aktuellen Seelenzustand widerklingen ließen. In einer Prüfungswoche hatte er mir eine CD mit vierzehn Tracks überreicht, bei denen es sich um ein und denselben Song handelte, der knappe fünfzig Minuten lang auf Endlosschleife lief: Limp Bizkits Break Stuff.





























