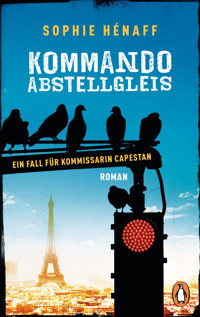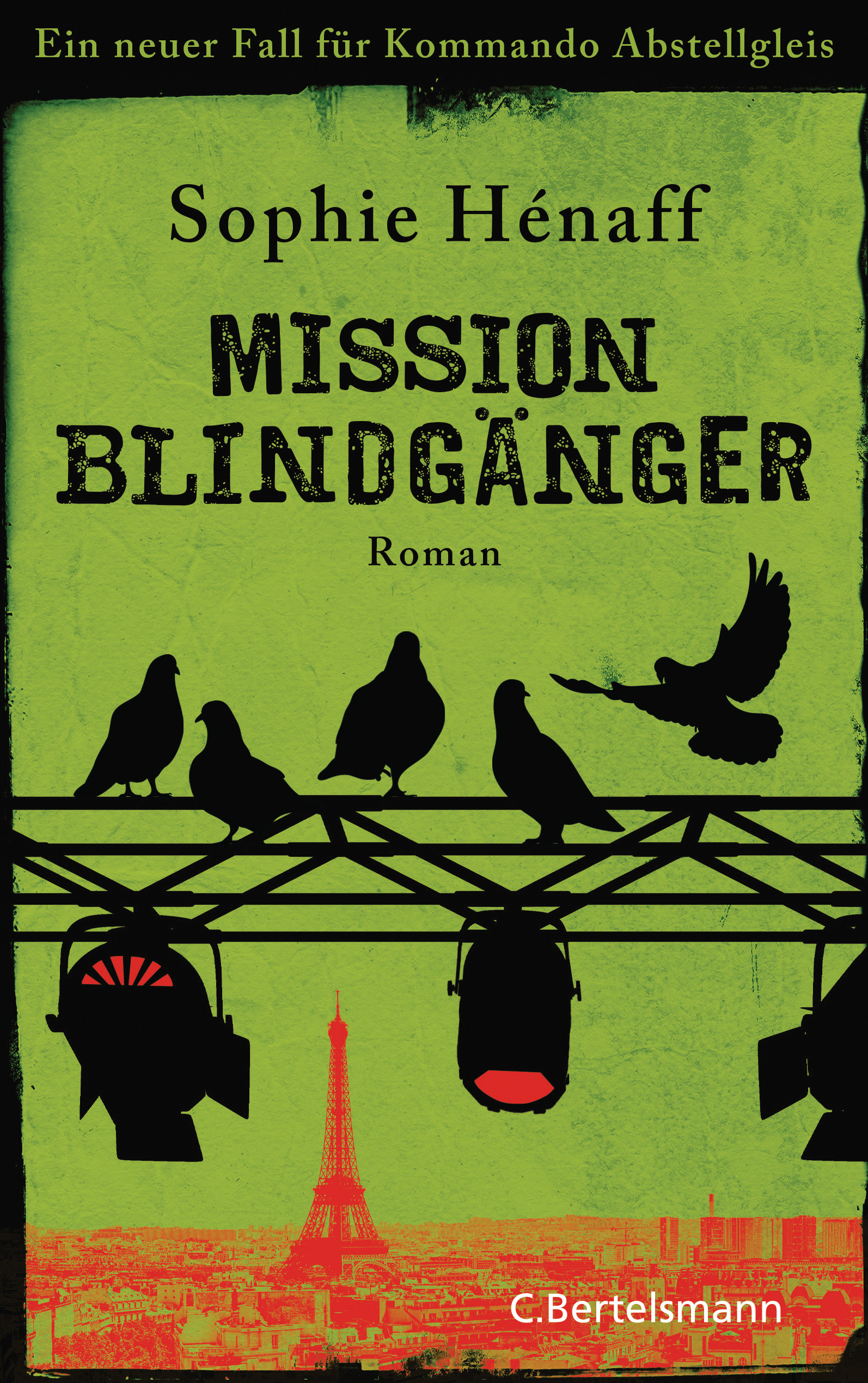
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommando Abstellgleis ermittelt
- Sprache: Deutsch
Der Spiegel-Bestseller: Die Chaostruppe ermittelt wieder - zum Schießen komisch
»Ruhe bitte, es wird gemordet!« Die sympathische Chaostruppe der Pariser Polizei feiert ihr Comeback an einem Filmset – wie immer angeführt von Commissaire Anne Capestan, die ihre Elternzeit unterbricht, um einer Kollegin zur Hilfe zu eilen: Capitaine Eva Rosière, nebenberufliche Drehbuchautorin, steht unter Verdacht, den Regisseur ermordet zu haben. Es ist nicht zu leugnen, Eva hatte geschworen ihn zu töten … Doch fast jeder am Drehort hätte ein Mordmotiv. Das Spiel kann beginnen: Mit Windeln und Schnuller gerüstet, machen sich Anne Capestan und ihr Kommando Abstellgleis an die Ermittlungsarbeit – Baby Joséphine stets mit dabei.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zum Buch:
»Ruhe bitte, es wird gemordet!« Die sympathische Chaostruppe der Pariser Polizei feiert ihr Comeback an einem Filmset – wie immer angeführt von Commissaire Anne Capestan, die ihre Elternzeit unterbricht, um einer Kollegin zu Hilfe zu eilen: Capitaine Eva Rosière, nebenberufliche Drehbuchautorin, steht unter Verdacht, den Regisseur ermordet zu haben. Es ist nicht zu leugnen, Eva hatte geschworen, ihn zu töten … Doch fast jeder am Drehort hätte ein Mordmotiv. Das Spiel kann beginnen: Mit Windeln und Schnuller gerüstet, machen sich Anne Capestan und ihr Kommando Abstellgleis an die Ermittlungsarbeit – Baby Joséphine stets mit dabei.
Zur Autorin:
Sophie Hénaff, geboren 1972, ist Journalistin, Übersetzerin und Autorin. Ihre humoristische Kolumne in der französischen Cosmopolitan hat eine riesige Fangemeinde. Mission Blindgänger ist der dritte Band der preisgekrönten Krimiserie um Kommissarin Anne Capestan und ihre unwiderstehliche Ermittlereinheit der verkrachten Existenzen, die die Herzen von Lesern und Kritikern im Sturm eroberte.
Sophie Hénaff
Ein neuer Fall für Kommando Abstellgleis
Aus dem Französischen von Katrin Segerer
C. Bertelsmann
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel Art et décès bei Éditions Albin Michel, Paris.Die Übersetzerin dankt dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und dem Europäischen Übersetzerkollegium Straelen für die Unterstützung ihrer Arbeit.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 by Éditions Albin Michel
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020 by C. Bertelsmann, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-25479-7V001www.cbertelsmann.de
Für meine inzwischen etwas größere Meute,meine Eltern und meinen Bruder
Prolog
Paris, Entbindungsstation der Clinique Jeanne d’Arc, 9. Februar 2013
Anne Capestan atmete durch. Die Schmerzen waren abgeklungen, die Welt wurde wieder scharf. Pein und Panik würden erst in zwanzig Minuten zurückkehren, achtzehn, wenn alles gut lief. Die Schweißperlen auf ihrer Stirn vermischten sich mit den Wassertropfen aus dem Zerstäuber. Sie wandte den Kopf zum hilflosen Gesicht ihres Ehemanns.
Paul Rufus hatte für die Geburt Sonderausgang bekommen. Commandant Lebreton, ehemals Verhandlungsführer bei der RAID, bevor er aufs Abstellgleis in der Rue des Innocents befördert worden war, hatte ihn hierher eskortiert, nachdem er Kleider und Kulturbeutel für ihn abgeholt hatte. Der Gefangene hatte sich rasiert, frisiert und in seinen schicksten Anzug nebst Krawatte und neuen Schuhen geschmissen. »Ich habe mich hübsch gemacht für unser Kind.« Er sah tatsächlich hübsch aus, wunderschön sogar, wie Capestan gerührt und bewundernd festgestellt hatte, wenn auch etwas abgemagert. Neunzehn Stunden später war der Anzug zerknittert, die Krawatte hing schief, die Haare waren zerzaust, und das steife Leder der Derbys entlockte Paul ein gedämpftes Stöhnen.
Eine weitere Welle türmte sich auf. Capestan schloss die Augen und biss die Zähne zusammen. Die Wehe schlug ihre Krallen ein und spie Feuer in jedes Glied. Paul murmelte, den Blick auf seine Füße gerichtet: »Diese Treter drücken bestialisch.«
Mit unendlicher Anstrengung stieß Capestan hervor: »Ich liebe dich, Paul, aber ich schwöre dir, wenn du noch EIN Wort über deine Schuhe verlierst …«
Paris, sechzehn Monate später
Die drallen kleinen Finger packten den Verdienstorden und wollten das schon sabberdurchweichte Band abreißen.
»Nein, Joséphine, nicht anfassen«, schimpfte Commissaire Capestan im resignierten Tonfall einer Mutter, der eher die Erwachsenen beruhigen als ein schon für den nächsten Versuch bereites Kind überzeugen sollte.
Sie stemmte sich aus dem Sessel vor dem feudalen Schreibtisch des Regionaldirektors der Kriminalpolizei und gesellte sich zu ihrer Tochter am Fuß der Vitrine. Mit ein paar leeren Ermahnungen löste sie die Händchen vom Orden und legte ihn auf ein höheres Brett, nachdem sie ihn diskret am Ärmel abgewischt hatte. Die gutmütige Joséphine nahm es ihrer Maman nicht übel. Eroberungslustig rollte sie sich vom runden Windelhintern auf alle viere und grapschte, gleichzeitig flink und unbeholfen, nach dem nächsten, noch goldeneren Ehrenzeichen, das mit verheißungsvollen Rüschen eingefasst war. Kurzerhand raffte Capestan alles auf den unteren Brettern zusammen und deponierte es in einem Haufen oben auf dem Möbelstück.
»Tut mir leid …«
Buron sah aus, als hätte er einen Liter Rizinusöl auf eine Handvoll Reißzwecken geschluckt.
»Nein, nein, ich bitte Sie, das macht doch nichts. Nun, wie ich eben gesagt habe …«
Richtig, er hatte geredet, aber worüber, hatte Anne Capestan schon wieder vergessen. Sie kramte einen Bund dicker, bunter Plastikschlüssel aus der Handtasche und reichte ihn ihrer Tochter, die ihn an sich riss und begeistert glucksend schüttelte. Buron erhob die Stimme, um das Klappern zu übertönen.
»Commissaire, Sie müssen in den Dienst zurückkehren, ich brauche Sie an der Spitze Ihrer Brigade. Ich verstehe ja, dass die Freuden der Mutterschaft Sie von Ihrer Verantwortung abgelenkt haben, aber es wird höchste Zeit, wieder an die Arbeit und Ihre Truppe zu denken und diesen entzückenden kleinen Engel flügge werden zu lassen. Außerdem …«
Der entzückende kleine Engel hatte sich inzwischen den spitzesten Schlüssel geschnappt und zerkratzte damit systematisch das Bein des Nussbaumholzschreibtischs. Commissaire Capestan bückte sich und platzierte ihre Tochter in der Mitte des Teppichs.
Buron versuchte, die Irritation über das Verschwinden seiner Gesprächspartnerin bei jedem zweiten Satz zu zügeln, und hob erneut an: »Wie gesagt, Ihre Truppe braucht Sie …«
Capestan tauchte ein weiteres Mal ab, um Joséphine einzufangen, die nach drei dickköpfigen Krabbelschritten wieder bei ihrem Kratzspiel angelangt war, und setzte ihr Töchterchen an den Ausgangspunkt zurück.
Sie war zwar seit über einem Jahr in Elternzeit und hatte ihr Kommissariat Commandant Lebretons fähigen Händen anvertraut, deshalb aber noch lange nicht ihre Kollegen aus den Augen verloren, mit denen sie sich von Zeit zu Zeit auf einen Mittagssnack, ein Abendessen oder ein Schwätzchen traf. Ganz zu schweigen von den diversen offizielleren Zusammenkünften.
Zuerst die Einweihungsparty von Dax, dem Computergenie, das nach einem Boxunfall nicht mehr die hellste Kerze auf der Torte war, und Évrard, der blassen Spielsüchtigen. Das junge Paar hatte eine nette kleine Zweizimmerwohnung in Oberkampf bezogen, in die sich für einen Abend die gesamte Brigade gequetscht hatte. Anschließend der Vierzigste von Torrez, dem schwarz behaarten Unglücksbringer, in einem Restaurant, das wenig später abgebrannt war. Dann Rosières Kinofilm. Die erfolgreiche Krimi- und Fernsehserienautorin hatte ihren ersten Spielfilm geschrieben, eine nie da gewesene Geschichte, von der die Geheimniskrämerin nicht ein Wort verriet. Der unterschriebene Vertrag allerdings war ausgiebig verlautbart und mit Champagner begossen worden, trotz Merlots Protesten – der Capitaine war ein leidenschaftlicher Liebhaber sämtlicher alkoholischer Getränke außer derjenigen, bei denen die Blubberbläschen zu viel Platz einnahmen. Auch Saint-Lôs spektakulärer Sieg bei den französischen Fechtmeisterschaften war gebührend gefeiert worden. Der Virtuose an Florett und Degen hatte seine Kunst angeblich noch »als Grünschnabel« vom größten Fechtmeister der Musketiere Ludwigs XIII. erlernt. Orsini, umgeschulter Geiger und be-vorzugte Quelle aller Journalisten im Land, hatte Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um seinen Freund und Kollegen in die Profi-Circuits zu bringen. Und schließlich der Prozess gegen Paul Rufus, Commissaire Capestans Ehemann, der acht Monate – so lang wie eine einsame Schwangerschaft – gedauert und entgegen allen Erwartungen mit einer Verurteilung zu zwei Jahren ohne Bewährung geendet hatte.
Seither hakte sie jeden vergangenen Tag am Wandkalender in ihrer Küche ab. Das schwarze Raster der Ungeduld endete mit dem 10. August, neongelb markiert.
An Pauls statt hatte Louis-Baptiste Lebreton das Kinderzimmer vor der Ankunft des Babys gestrichen. Capestan sah den großen, schweigsamen Commandant noch vor sich, wie er mit ruhigen Bewegungen die Farbrolle über die Wand fahren ließ, eine Hand in der Hosentasche, ein paar cremefarbene Sprenkel auf dem dichten Haar. Unterdessen hatte sich José Torrez, der sich dank seiner Kinderschar bestens mit der Säuglingspflege auskannte, um die Ausrüstung gekümmert. Die zukünftige Mutter hatte kaum die Farbe des Kinderwagens mitbestimmen dürfen. Als Ausgleich hatte sie sich bei der Anzahl der winzigen Bodys und Pyjamas durchgesetzt, der Kleidung also, auf die Joséphine sich von der ersten Minute an eifrig erbrochen hatte, nur um sie gleich darauf nicht mehr zu tragen, weil sie schneller herauswuchs, als diese trocknen konnte. Jetzt war Capestan klar, warum ihr Partner beim Anblick der vollen Kommode nur höhnisch gegrinst hatte. Eva Rosière wiederum hatte sich selbst zur Hausdame befördert und kreuzte regelmäßig mit Bergen von geraspelten Karotten und pasteurisiertem Käse auf. So spielte die gesamte Brigade gute Fee und beugte sich mehr oder weniger standfest über die Wiege. Sogar Buron, der Joséphine ein rosafarbenes Plüschkaninchen in BRI-Uniform geschenkt hatte.
Ursprünglich hatte Capestan nicht vorgehabt, ihren Mutterschaftsurlaub zu verlängern, aber seit der unglaublichen Begegnung mit ihrer Tochter war sie derart glücklich und durcheinander, dass sie sich einfach nicht zur Rückkehr aufraffen konnte. Sie ließ sich treiben, wollte nichts mehr wissen von Polizeiarbeit und Fällen. Sie lebte in einer Blase, auch wenn sie ahnte, dass an deren Wänden, an jeder blanken Nervenzelle Angst und Wut lauerten, zwei alte Freundinnen. Ihre Erinnerungen an die Kinder- und Jugendbrigade, an den Dreck der Pariser Straßen stiegen langsam aus den hintersten Winkeln ihres Gehirns auf und trübten das Meer der Zärtlichkeit. Manchmal brabbelte Joséphine irgendetwas, wedelte mit einem zarten Ärmchen und schaute ihre Mutter voll ungehemmter Liebe an, der Inbegriff bedingungslosen Vertrauens. Capestan schenkte ihr ein breites Lächeln, ehe ohne Vorwarnung die Blitze in ihren Kopf einschlugen. Die Panik erstickte sie, verwandelte sich nach und nach in Zorn und Traurigkeit. Sie gurrte weiter, aber die Gutzi-Gutzis wurden freudlos und heiser.
Sie wich ihrer Tochter keine Sekunde von der Seite.
Irgendwann würde sie die Nabelschnur natürlich durchtrennen müssen. Aber nicht heute, obwohl ihr Mentor offenbar im Begriff war, genau das zu fordern. Er hatte sie angerufen, um sie für Dienstag um zehn einzubestellen. Capestan hatte erwidert, dass sie beurlaubt sei und er sie deshalb gar nicht einbestellen könne. Daraufhin hatte er sie eingeladen, am selben Tag zur selben Zeit. Capestan hatte die Einladung angenommen.
»Es gibt da mehrere Fälle, die ich Ihnen gerne anvertrauen würde. Das Beste wäre wohl eine Rückkehr zum 1. August. Das passt Ihnen ja hoffentlich?« Mit einem sicheren Patriarchenlächeln verschränkte Buron die großen Hände auf der Schreibtischunterlage aus flaschengrünem Maroquin.
»Nein.«
Der Divisionnaire konnte seine Überraschung schwer verbergen. Für jemanden wie ihn, der nur widerwillig Urlaub nahm, überflogen die achtzehn Monate Abwesenheit einer eigentlichen Vollblutpolizistin jedes Verständnis. Vor allem, wo er als ihr Vorgesetzter sie doch so höflich bat.
»Wie, nein?«
Die erschöpfenden Drei-Fläschchen-Nächte hatten Capestans übliche Unverfrorenheit abgestumpft, also begnügte sie sich mit der alten, aber nicht weniger wahren Ausrede: »Ich habe keine Betreuung für Joséphine, ich muss mich erst organisieren.«
Burons Reaktion konnte sie nicht erkennen, ihr war die Sicht versperrt. Sie bewegte den Kopf und bemerkte erst jetzt, dass ihre Tochter geduldig an ihr hochgeklettert war und das Gesichtchen direkt vor sie geschoben hatte, um ihr in Erinnerung zu rufen, wer hier der wichtigere Gesprächspartner war. Capestan drückte Joséphine einen Kuss auf die Stirn und setzte sie, den strampelnden, schon zur nächsten Kletterpartie bereiten Beinchen zum Trotz, wieder auf den Teppich.
Mit der feierlichen Stimme eines Mannes, der Lösungen präsentiert, verkündete Buron: »Kein Problem, ein Anruf von mir genügt, und Sie bekommen einen Krippenplatz.«
Wahrscheinlich hatte er tatsächlich die nötigen Kontakte, um ein solches Wunder zu vollbringen, deshalb offenbarte Capestan, was sie wirklich dachte: »Ja, aber nein.«
Die Stirn unter dem Bürstenschnitt gerunzelt, die feuchten Basset-Augen missbilligend zusammengekniffen, beharrte der hehre Mentor: »Nun aber, Capestan, ich brauche Sie, die Polizei braucht Sie. Nach allem, was ich getan habe, damit Sie nicht entlassen werden …«
»Ja, aber nein. Nein. Nein, nein und nochmals nein«, erwiderte Capestan weder angriffslustig noch diplomatisch.
Genau diesen Moment wählte Joséphine, um mit ihrer Morgenfuhre die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Als der charakteristische Geruch Capestan in die Nase stach, stand sie auf. Buron beobachtete sprachlos, wie sie in ihre Jacke schlüpfte, nach der großen Umhängetasche griff und, sorgsam darauf bedacht, die Windel nicht platt zu drücken, ihre Tochter hochhob. Schließlich fragte sie, leicht verwirrt, ohne wirklich daran zu glauben: »Im Quai des Orfèvres gibt es nicht zufällig einen Wickeltisch?«
»Verdammte Scheiße, ich bringe ihn um!«
Eva Rosière schäumte vor Wut. Ihre Wangen hatten das typische Zinnoberrot angenommen, das einen Sturm ankündigte, und der neue Vertragszusatz drohte in ihrer bebenden Faust zu zerreißen.
Es war nicht zu fassen. Die Dreharbeiten hatten kaum begonnen, da wollte dieser Nichtsnutz von Regisseur, dieser schlappschwänzige Schwätzer, der ihr Skript mit leerem Geblubber aufblies, auch schon als Koautor genannt werden. Und zwar an erster Stelle, vor ihr! Was bildete der sich überhaupt ein!
Begleitet vom grimmigen Gebell ihres Hundes Pilote, Kosename Pilou, platzte Rosière, Capitaine de Police, Bestsellerautorin und jetzt auch Filmdrehbuchschreiberin, mitten in den Dreh, »Ruhe bitte, wir drehen!« hin oder her. Sie bohrte die spitzen Absätze in die Kabel, von denen es auf dem Wachsbetonboden nur so wimmelte, und brüllte durch den Raum: »Wo steckt die alte Sülzwurst?«
Der Toningenieur zuckte zusammen, zerrte sich den Kopfhörer herunter und schüttelte sich kurz, wie um sicherzustellen, dass seine Ohren noch am richtigen Fleck saßen.
»Der wollte sich, glaube ich, nach dem Mittagessen mit dem Produzenten treffen.«
Perfekt, zwei Idioten zum Preis von einem. Ganz nebenbei registrierte Rosière, dass bei Sülzwurst jeder sofort an Michel Aramédian dachte, schließlich war der Regisseur fürs Sülzen und seine Wurstfigur bekannt. Und natürlich musste er direkt den großen Häuptling mit seinem Dank übergießen, nachdem er seinen Vertragszusatz bekommen hatte.
Rosière machte eine Kehrtwendung, die ihre Absätze zum Knirschen, aber ihre wohlgepolsterte Hüfte kein bisschen ins Wanken brachte, und wogte entschlossen wieder von dannen. Pilou folgte ihr mit erhobener Schnauze und wedelte im Takt ihrer Stechschritte mit dem Schwanz wie ein Metronom.
Das Produzentenbüro befand sich am Ende des Flurs und beherbergte nur Tom Dicate, der so knauserig war, dass er sogar den Posten des Produktionsleiters eingespart hatte, um selbst jeden einzelnen in den Dreh investierten Cent zu verwalten, zu verteilen oder vor allem zu verweigern.
Ohne sich mit Anklopfen aufzuhalten, riss Rosière schwungvoll die Tür auf.
»Ist er da?«
War er nicht. Tom stand allein vor der Rauchglasplatte seines Schreibtischs. Mit einer Geste, die lässig wirken sollte, aber seine ständige Nervosität verriet, teilte er eine schmale Linie Kokain ab, rollte das Foto seiner Hauptdarstellerin Luna Sellia auf und beugte sich vor. Um die Anwesenheit einer Gesetzeshüterin schien er sich nicht zu scheren. Pilou, der da strenger war als sein Frauchen, bellte laut. Tom fuhr zusammen und stieß sich das Röhrchen tief in den Riechkolben. Reflexartig schnaubte er kräftig, um es wieder zu entfernen, was die Droge zu einer feinen weißen Wolke zerstäubte. Bevor das Koks wie gewöhnlicher Staub davonwabern konnte, steckte Tom sich kurzerhand das Röhrchen ins noch unversehrte Nasenloch und saugte mit schnellen Zügen die Luft um sich herum ein, um nicht ein Zehntelgramm zu vergeuden – bis ihm wohl aufging, dass dabei die gesamte gespielte Lässigkeit zur Lächerlichkeit verpuffte, und er sein Werkzeug verächtlich auf den Tisch fallen ließ.
»Nein, er ist nicht da. Nur ich, also komm mal wieder runter, Schätzchen. Willst du’s stattdessen mit mir probieren?«
»Wenn’s sein muss«, antwortete Rosière und verkniff sich das »Fick dich!«, das ihr auf der Zunge brannte. »Eigentlich suche ich Michel. Aber wo du schon mal da bist, kannst du mir vielleicht weiterhelfen …«
»Wenn’s sein muss«, gab Tom mit seinem Vorstadtschlingelgrinsen zurück.
Unbeeindruckt wedelte Rosière mit dem Vertragszusatz und stöberte einen letzten Kokswirbel auf.
»Wie hat sich der feine Monsieur Sülzwurst zum Drehbuchautor aufgeschwungen? Ist das auf deinem oder seinem Mist gewachsen? Was soll der Schmu? Willst du ihn in Tantiemen bezahlen, um mich übers Ohr zu hauen, oder hält er sich jetzt für ein Genie, weil er den Figuren neue Lieblingsgerichte angedichtet hat?«
»Aber, aber, Eva, wir sind hier beim Film, da hat dein Schöpferstolz nichts zu suchen, das Drehbuch ist bloß ein Hilfsmittel. Michel hat eine Vision und …«
»Eine Vision? Soll das ein Witz sein? Und wenn er mal pinkeln muss, ist er plötzlich Klodesigner?«
»Geh mir nicht auf die Nerven, Eva, das soll dein Agent mit seinem klären. Der wollte den Punkt unbedingt mit aufnehmen«, sagte Tom, während sein feuchter Zeigefinger wie unabhängig vom Rest des schlaffen Körpers jeden Rauchglaszentimeter systematisch nach Pulverresten ab-tastete.
»Verdammte Scheiße, ich bringe ihn um!«, fauchte Rosière auf dem Weg zur Tür.
Sie selbst hatte diesen Schleimbeutel engagieren lassen. Michel Aramédian war ein Handwerker, ein technisch guter Regisseur ohne eigene Handschrift, der das Skript Wort für Wort umsetzte und keinerlei zusätzliche Ideen einbrachte. Nach über einem Jahr unermüdlicher Arbeit an ihrem allerersten Filmdrehbuch hatte Rosière seinen Namen vorgeschlagen, im Glauben, dass er ihr Werk um keinen Millimeter verrücken würde. Falsch gedacht. Urplötzlich hatte der brave Erfüllungsgehilfe beschlossen, selbst ein paar Autorenlorbeeren zu ernten, wenn auch auf dem Ast einer anderen.
Sie steuerte auf den Regieraum zu, in der festen Überzeugung, Michels große, gebeugte Gestalt in der Nähe des Büfetts vorzufinden, wo er gern Naturjoghurt um Naturjoghurt direkt aus dem Becher schlürfte, ohne Löffel. Anschließend wischte er sich den Mund mit den Fingern und die Finger mit einer Papierserviette ab.
Dort war er allerdings auch nicht. Die Hairstylistin Véro saß mit der Garderobiere Inès und der Maskenbildnerin Zélie zusammen und nippte an einem Kaffee. Es war früher Nachmittag, die Schauspieler waren drehfertig und Haare/Make-up/Kostüm genossen eine dieser endlosen Pausen, die der Arbeit beim Film ihren Charme und den Babysittern ein Vermögen einbrachten. Sie hatten die Maske verlassen, in der sich Michel, der willensschwache Kapitän, schon seit Tagesanbruch herumtrieb und auf die Laune seiner Besatzung lauerte. Der von Hundert-Watt-Birnen erhellte Beichtstuhl barg die Bissigkeiten und Gerüchte des Morgens. In diesem sicheren Hafen, den die Schauspieler nackt betraten und gestylt/geschminkt/gewandet, mit ihren Rollen gepanzert, wieder verließen, wurden traditionell Komplotte geschmiedet und Meutereien angezettelt. Dort beklagten sich die vernachlässigten Egos, während sie für die Pinsel die Lippen spitzten. Véro, Zélie und Inès spielten ihren Part und verbreiteten Klatsch und Tratsch, so oft wie nötig, aber ohne bösen Willen. Als heitere Profis durchsegelten sie sicher die Stürme größenwahnsinniger Regisseure, doch selbst sie liefen gelegentlich auf Michel Aramédians Sandbank auf – er war einer der wenigen gleichzeitig geschmacklosen und ungenießbaren Filmemacher.
Er bereitete seine Schläge im Verborgenen vor.
Szene für Szene, Einstellung für Einstellung brachte er Eva Rosières Figuren auf Abwege, ohne zu begreifen, dass er damit die geliebte Familie der Autorin antastete. Sie waren aus ihren Gefühlen erbaut, aus Tausenden Details, die sie jeden Tag sammelte, aus ihrer Empathie, denn die besetzte knallhart alle Menschen, denen sie begegnete, besichtigte ihr Innerstes und spuckte die Essenz dessen, was sie erstaunt hatte, in einer neuen Seele wieder aus. Rosières Figuren waren Träume, Freundschaft, Mitgefühl, Empörung, eingestampft und zusammengepresst, alles, was sie in gut fünfzig Jahren gesehen und erlebt hatte, und eine Hommage an das, was sie in den letzten drei Jahren aufrechterhalten hatte. Sie trug ihrer aller Verletzlichkeit in sich.
Die ausschweifende Krimi- und Fernsehserienautorin hatte hier ihr persönlichstes Werk, ihr intimstes Projekt abgeliefert. Durch eine unglückliche Verkettung der Umstände hatte sie ihre neueste Geschichte für die große Leinwand geschrieben, wo man so wenig zu sagen hatte, statt als Roman, bei dem man alles entschied. Sie erzählte das Epos einer Truppe verstoßener Polizisten, die von einer alten, heruntergekommenen Wohnung und der Willensstärke einer gefallenen Chefin zusammengeschweißt wurden. Es war ihre eigene Geschichte, die ihrer Kollegen. Capitaine Rosière war eine dieser verkrachten Existenzen gewesen, aber das Kommando Abstellgleis hatte ihr wieder Luft zum Atmen ge-geben.
Aus Dankbarkeit und aus der Gewissheit, ein gutes Thema aufgestöbert zu haben, war dieses Drehbuch entstanden. Sie hatte ihre Freunde in Figuren verwandelt, es aber nicht gewagt, sie vorzuwarnen. Schon in der Vergangenheit war sie aus der Chefetage des Quai des Orfèvres geflogen, weil sie sich von ihren Vorgesetzten und der Staatsanwaltschaft hatte inspirieren lassen. Diese Lektion hatte sie fein säuberlich klein gehackt, zu Schnitzeln und Spänen verarbeitet und dann das Streichholz des Rückfalls angerissen. Nur mit dem Unterschied, dass sie ihre Opfer diesmal mochte. Schreiben oszillierte immer zwischen Huldigung und Verrat, und Rosière war sich nicht sicher, in welche Richtung die Deutung ihrer Freunde neigen würde. Deshalb hatte sie, sowohl aus Feigheit als auch aus künstlerischem Egoismus, um keinen Widerstand zu riskieren, der sie der neuen Inspirationsquelle berauben könnte, auf deren Einwilligung verzichtet. Wenigstens machten die Figuren ihrer Vorlage alle Ehre: Merlot, dem Mann von Welt und Fusel, Blanche Évrard, dem Geist der illegalen Spielhöllen, Dax und Lewitz, den enthusiastischen Idioten, Lebreton, dem unverweslichen Sonnenkönig, Torrez, dem Unglücksbringer, Orsini, dem Spießer mit den schlechten Witzen, Saint-Lô, dem Irren, der sich für den Highlander hielt, Diament, dem Koloss, und natürlich Anne Capestan, der Anführerin mit dem offenen Lächeln und dem lockeren Abzugsfinger. Sie waren realistisch, also voller Fehler, aber spannend und würdevoll. Bis dieser Weichei-Regisseur sie unbedingt in den Leistungsauftrag der Fernsehsender zwängen und ihnen Soap-Eitelkeiten und Schundfilm-Eigenschaften andichten musste. Wenn ihre Kollegen das sahen … Diese Vorstellung trieb Rosière schon jetzt bis tief in die Nacht die Schamesröte ins Gesicht.
Dank geschickter Schachzüge und Überzeugungskraft war es ihr gelungen, die Schmonzetterei des Trottels Detail für Detail auszubügeln, aber durch seinen Namen auf diesem Vertragszusatz schwang er sich nun eigenmächtig zum Herrn über Leben und Tod ihres Textes auf. Ihres Rufes. Ihrer Loyalität ihren Freunden gegenüber.
Sie spürte eine kompromisslose Künstlerseele in sich sprießen, das Profil eines romantischen Genies, das Schicksal einer Soziopathin, die bereit war, alles zu zerstören, um ihr Meisterwerk zu retten.
»Habt ihr Michel gesehen?«
Inès, Véro und Zélie lächelten und antworteten nicht gleich. Im Bruchteil einer Sekunde las die Polizistin in Eva Rosière, die nie verschwunden war, ihnen an den Blicken ab, dass sie den Regisseur sehr wohl gesehen hatten, aber nicht petzen wollten. Anscheinend hatte er sich verkrochen, als er die Autorin hatte kommen hören.
»Verdammte Scheiße, ich bringe ihn um!«
Man musste sich den Hals verrenken, um die Zeichnung auf der Internetseite genau zu betrachten. Die Bildunterschrift war glasklar: »Um das Herz zu treffen und den Gegner kampfunfähig zu machen, sollte die Klinge zwischen die siebte und achte Rippe gestoßen werden.«
Zwei Hände schlugen wütend auf die Tastatur ein.
»Und wie soll ich die Rippen von jemandem zählen, der sich noch bewegt?«
Gaétan Bulinski musterte seinen Kumpel Achille Niessen, der seit seinem großen Neun-Millionen-Kinobesucher-Erfolg ständig wirkte, als würde er von einem Spot beleuchtet. Die Hände in den Taschen eines Maßanzugs, trug er sein Netter-Kerl-Lächeln zur Schau und betrachtete die Welt mit zufriedenem Besitzerstolz. Wenn die Technik an ihm vorbeimusste, ließ sie ihm instinktiv mehr Platz, während Gaétan die Kabel über die Schuhe schleiften. Mit den schmeichelhaften Löckchen und der Vorstadt-Danton-Visage strahlte Achille eine etwas plumpe, aber sonnige Energie aus. Er war zweifelsfrei ein verflixt guter Schauspieler. Aber nicht besser als Gaétan. Eher schlechter.
Jahrelang war Achille der Sidekick gewesen, immer ein bisschen weniger attraktiv, ein bisschen weniger clever, der ewige Zweite, den diese Tatsache nicht störte, der schon so geboren war. Gaétan, der geborene Älteste, dunkel bis zu den bläulich schimmernden Pupillen, schritt voraus, sich seines Geburtsrechts sicher, aber gewillt, einen Flügelmann mitzuziehen, einen friedlichen Rivalen, der ihn niemals einholen würde. Bis zu jenem Film, jener Bombe, mit der niemand gerechnet hatte. Zumindest nicht in diesem Ausmaß. Am Mittwoch waren die Zahlen reingekommen, die Hochrechnungen hatten sich überschlagen. Man erwartete, noch vor dem Monatsende die zehn Millionen zu knacken.
Gaétan hatte die Freundschaftsbekundungen und herzlichen Rippenstöße vermehrt, er freute sich für Achille, war äußerlich ganz Gratulation, aber jeder neue Morgen versetzte ihm einen Schlag in die Magengrube, ließ ihn zur Toilette stürzen und Galle spucken.
Jeder Schauspieler hoffte auf Den Einen Film: Ziemlich beste Freunde, La vie en rose, Willkommen bei den Sch’tis, The Artist, Die fabelhafte Welt der Amélie, einen Hit, der die Besuchercharts auf den Kopf stellte und einen in die Top Ten der Großverdiener katapultierte, die kleine Riege der Götter. Natürlich konnte man auch abseits dieses Olymps eine schöne Karriere hinlegen, Anerkennung und Reichtum erlangen, sich seine Rollen aussuchen und sogar brillieren. Außer man war der beste Freund des Stars in einem solchen Film. Der Kassenschlager veränderte nicht nur Achilles Format, sondern indirekt auch Gaétans. Weil sein Kumpel sich in einen Gewinner verwandelte, wurde Gaétan zum Loser. Er war vom selben Punkt gestartet, aber weniger weit gekommen.
Seither, so wollte es das Gesetz des Erfolgs, verstärkte alles den Kontrast zwischen ihnen. Es war nicht gegen Gaétan gerichtet, zumindest hoffte er das, aber selbst Achilles Haargel glänzte mehr als seins. Am Set spazierte Achille jetzt im feinsten, auf den Leib geschneiderten Balmain herum, während Gaétan in seinem Celio von der Stange vor sich hin knitterte. Tausende winzige Details, ein paar Garderobenquadratmeter mehr, ein paar Warteminuten weniger, nagten Tag für Tag an seiner Fassade.
Zum Glück wussten weder die Öffentlichkeit noch die Presse, ja, nicht einmal die Branche, dass Gaétan Bulinski diese triumphale Rolle abgelehnt hatte. Seit dem ersten Beben des Tsunamis zitterte er bei der Vorstellung, dass irgendwer es herausfinden könnte. Eine solche Demütigung würde er nach all den anderen nicht verkraften. Nicht einmal Achille hatte einen Schimmer. Manchmal brannte es Gaétan auf der Zunge, ihm ein »Du warst bloß die zweite Wahl« ins Gesicht zu schleudern, aber in Anbetracht der Ergebnisse schluckte er es lieber hinunter. Nur zwei Menschen kannten die Wahrheit: der Regisseur des Blockbusters, der Gaétan gleich zu Anfang des Projekts kontaktiert hatte, und Tom Dicate, der den Film eigentlich hätte produzieren sollen, wäre er nicht kurzzeitig durch ein Feuer ruiniert worden. Letzterer schwieg aus denselben Beweggründen wie Gaétan, konnte es sich jedoch nicht verkneifen, mit seinem kleinen Druckmittel zu spielen. Er stichelte, machte Anspielungen und lachte sich jedes Mal ins Fäustchen, wenn der Schauspieler zusammenzuckte.
Genau wie Achille hatte Gaétan schon vor einem Jahr, lange vor dem Wahnsinnshit, für diesen Scheißkrimi unterschrieben, den sie gerade drehten. Damals war es nur eine weitere Komödie für das Duo gewesen, Action am Morgen, eine nette Abwechslung, zugeschnitten auf die Primetime am Sonntagabend. Jetzt hatte man den Eindruck, dass Achille ihm Almosen gab, das Plakat in liebevoller Erinnerung an vergangene Zeiten mit ihm teilte, und Gaétan stand da wie ein Idiot.
»Kinder! Kommt her, meine Kleinen! Bewegt die Ärsche, oder wollt ihr auf MTV landen?«, rief Tom Dicate und ließ gemächlich das mit Speicheltropfen bedeckte Megafon wieder sinken.
Er gehörte nicht zu den Standardproduzenten, die auf Abstand blieben und einmal pro Monat mit einer dicken Zigarre im Mund für eine dreiminütige Stippvisite vorbeischauten. Er hielt sich für einen Künstler, wollte allem seinen Stempel aufdrücken und lungerte von morgens bis abends am Set herum. Michel Aramédian stand schweigend neben ihm. Kaum war Eva Rosière verschwunden, war der Regisseur wie aus dem Nichts wieder aufgetaucht. Eine Kakerlake. Er war genauso hoch gewachsen wie Tom und hatte auch seine schmalen, leicht gebeugten Schultern, seinen rötlichen Teint und seinen Haarschnitt in einem sehr ähnlichen Braunton. Ihm fehlte es nur an Strom, um dem Produzenten völlig zu gleichen. Er war eine leere Dublette, eine Hülle ohne Saft. Gaétan beugte sich zu seinem Freund.
»Schon verrückt, wie ähnlich die zwei sich sehen.«
»Sehen, aber nicht klingen.« Achille nahm die Hände aus den Taschen, richtete sich auf und verschränkte die Arme vor der Brust. »Schau, der Waschlappen kriegt keinen Ton raus, und das Nervenbündel labert uns mal wieder voll.«
Gaétan entfuhr ein kurzes Lachen.
»Chipo und Merguez, so nennt Rosière sie doch immer, oder?«
Achille klopfte seinem Freund auf den Rücken.
»Nein, so nennt sie uns.«
Gaétan verzog das Gesicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass er Chipo verkörperte, war groß. Achille lächelte ihn an.
»Ach komm, das war nur ein Witz, entspann dich.«
Gaétan zuckte betont gleichgültig mit den Schultern, aber er musste dringend wieder Oberwasser bekommen. In ihrer Branche hatten sich schon so einige aussichtslosere Blätter gewendet. Das von Robert Downey jr. zum Beispiel. Geduld, ja, die war in diesem Metier das A und O. Und obwohl Technik für Gaétan ein Fremdwort war, spielte er seit ein paar Tagen mit dem Gedanken an eine Ben-Affleck-Option. Der abgeschlagene Star hatte es geschafft, Matt Damon über den Umweg der Regie einzuholen. Er hatte sich einen Ruf als Autor erworben, als Unternehmer, indem er auf die Straße des Verstands gebogen war. Das Köpfchen machte den fehlenden Glam wett. Das war sowohl männlich als auch erwachsen, so trat man gleich als Großer ins Erwachsenenalter ein. Und man behielt Ansehen und Marktwert, wenn das mit den Tränensäcken unter den Augen losging. Die meisten Schauspielduos endeten nach diesem Muster. Der Beweis, dass es funktionierte.
In Gaétans Fall müsste man, um das Rennen auszugleichen, den Waschlappen beseitigen und seinen Platz einnehmen. Und das Nervenbündel aus dem Weg räumen, denn wenn Tom Dicate die Klappe aufriss, wäre jede Chance, intelligent zu wirken, schon von vorneherein vertan. Gaétan würde zum Horst Buchholz werden, der die Sergio Leones Clint Eastwood überlassen hatte und dessen Namen heute niemand mehr kannte außer eben Gaétan, der solche Geschichten als Warnungen für seine eigene Laufbahn sammelte.
Nachdem Tom das Wort für eine halbe Sekunde abgegeben hatte, ergriff er es wieder und ließ sich über die sozialen Netzwerke, Mediapläne und Sichtbarkeit aus. Dann drehte er sich zu seinen beiden Stars und bemerkte mit einem gehässig-vertraulichen Augenzwinkern, speziell an Gaétan gerichtet: »Wisst ihr, was ohne den geringsten Aufwand viral gehen würde? Eine große Enthüllung!«
Brennender Hass versengte Gaétans Eingeweide. Nein. So konnte das auf keinen Fall weiterlaufen.
Eine große Enthüllung. Achille musterte den Produzenten. Was sollte das denn schon wieder heißen? Dieser Typ sollte sich bloß nicht einfallen lassen, ihm zu drohen, sonst würde er ihn mit zwei SMS zerquetschen wie eine Schmeißfliege.
Jeden Tag blähte die neue Macht Achilles Brust auf, er wuchs und erblühte wie Hulk, der aus dem unscheinbaren Kadaver von Bruce Banner hervorbrach. Dieser Erfolg, der sich im ganzen Land verbreitete, wie ein Funkenheer über eine Leinwand aus Zündschnur raste, stimmte den Schauspieler euphorisch und leicht paranoid. Die Pupillen ringsum weiteten sich vor Faszination, vor Angst, Neid und Ungläubigkeit. Achille hatte es geschafft, ihm passierte das alles.
Wie Unvorsichtige sich die Finger verbrannten, versengte ihm der Ruhm die Haut beim Kontakt mit anderen. Er musste seine Gelassenheitsreserven zusammenkratzen, um sich den Anschein zu geben, als würde er einen kühlen Kopf bewahren, als könnte ihn nichts ändern, aber alle seine Freunde und Kollegen waren zwanzig Zentimeter geschrumpft. Das Wichtigste war, dass man es ihm nicht anmerkte. Fürs Image. Das war inzwischen ein kostbares Gut, flüssiges Gold, das überall, wo er hinkam, großzügig verteilt wurde. Achille war ein netter Kerl, positiv, ein Star zum Anfassen. »Ein Star des Volkes«, höhnte er innerlich.
Er beschloss, ein paar Minuten nach draußen zu gehen, um seine Nachrichten zu checken. Im Studio hatte man keinen Empfang – und keine Privatsphäre. Kaum hatte er sich eine Zigarette angezündet, klingelte auch schon sein Telefon. Auf dem Display der Name seiner Agentin. Erregung wogte in ihm auf. Aktuell versetzte ihm jeder Anruf einen Adrenalinkick.
»Ja?«, fragte er ruhig.
»Soderbergh. Soderbergh! Seine Nummer zwei hat hingeschmissen, er will dich in zehn Tagen für die Italienerinnen, ich schicke dir das Skript, zum Niederknien! Über die Gage verhandeln wir noch, aber es sieht gut aus.«
Achille stiegen Tränen in die Augen, die er unauffällig mit dem Ärmel wegtupfte, bevor sie sein Make-up verschmierten. Soderbergh. Die Angebote rissen nicht ab. Wer kam wohl als Nächstes? Spielberg? Coppola? George Lucas?
Was zur Hölle trieb er noch an diesem armseligen Set hier?
»Ich drehe ja gerade für Tom Dicate, wie machen wir das?«
»Wir scheißen darauf, ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber er will nichts davon hören. Die Amis sollen ihm eine Entschädigung überweisen.«
»Ich rede mit ihm«, entschied Achille. »Er will mich bestimmt nicht vor den Kopf stoßen, wir einigen uns gütlich.«
»Das Wort kennt er gar nicht, Achille. Lass mich das regeln, es ist besser, wenn du da nicht mit reingezogen wirst.«
Achille lachte spöttisch. »Was soll er mir denn schon können?«
»Keine Ahnung, aber ihm fällt sicher was ein.«
»Ich kümmere mich darum, das geht schneller.«
Er legte auf, drückte seine Zigarette im Aschenbecher aus und marschierte im Sturmschritt zurück ins Studio. Gleich als er die Tür aufschob, entdeckte er Tom. Mit leicht schwankendem Gang, der ihm wohl eine angesäuselte Lässigkeit verleihen sollte, kam der Produzent seinem Star entgegen, dem einzigen Menschen am Set, bei dem die Machtverhältnisse nicht zu seinen Gunsten standen. Trotzdem konnte er sich eine Spitze nicht verkneifen.
»Ein seltenes Vergnügen, dich bei einem Dreh so eifrig zu erleben. Was ist los mit dir, genießt du heute Nachmittag gar nicht die Annehmlichkeiten deiner VIP-Garderobe?«
»Nein, nein, ich will mich nicht verspäten. Hollywood ruft, wie du weißt, deshalb: Je schneller wir fertig sind …«
»Ich tue alles, um die Sache zu beschleunigen, Achille, das siehst du ja. Aber an diesen Film glaube ich wirklich aus tiefstem Herzen. Es ist das richtige Thema, der richtige Regisseur, das richtige Skript, alle Sterne stehen günstig, da darf der hellste nicht plötzlich abhauen.«
»Lass mich gehen, Tom. Deine Komödie kannst du auch mit einem anderen drehen.«
»Machst du Witze? Alles ist finanziert, wir haben die Sender, den Verleiher, der Streifen wird picobello produziert, mit allem Drum und Dran, damit wir nichts riskieren, das kann ich nicht einfach aufgeben, das würde niemand verstehen, meine Schwester würde mich umbringen, wenn ich so eine Chance nicht nutze. Aber ich habe den Drehplan geändert, deine Szenen haben absolute Priorität. Ich mache allen Druck.«
»Absolute Priorität? Du willst mich wohl verarschen, Tom! Ich bin in jeder Szene, ich spiele die Hauptrolle. Was werde ich los? Den Abspann? Na schön, ich rufe meine Agentin an, wir annullieren den Vertrag.«
»Der ist wasserdicht, da müsst ihr schon vor Gericht ziehen. Und das würde euch schön um die Ohren fliegen. Die Presse würde sich darauf stürzen, das könnte ich nicht verhindern, sie werden behaupten, du hättest Gaétan im Stich gelassen, deinen besten Freund, und natürlich dein Betthäschen, die kleine Braunhaarige, die deine Kollegin spielt …«
Entrüstet protestierte Achille: »Aber mit der läuft doch gar nichts!«
Tom hob beschwichtigend die Hände. »Schon, aber du kennst ja die Journalisten, manchmal spinnen die sich einfach was zusammen. Sie denken bestimmt, dass dir der Erfolg zu Kopf gestiegen ist, und versauen dir dein Image, kurz bevor du so richtig durchstartest. Das will ich nicht erleben müssen, das würde mir das Herz brechen.«
Achille fixierte den Mistkerl, der eine betrübte Miene aufsetzte, um ihn an seine Kameras zu fesseln.
»Du bist ein genialer Schauspieler, ich bin unheimlich froh, dich bei diesem Projekt dabeizuhaben, das wird großartig.«
Nachdem der Produzent Süßholz direkt in die Wunde geraspelt hatte, ließ er den Blick über den Set schweifen und entdeckte Inès, die gerade vorbeilief.
»He, Make-up, kannst du nicht mal ’nen Zahn zulegen? Jede Minute hier kostet mich ein Vermögen! Achille ist fertig, für wen hältst du dich, ihn warten zu lassen? Na los, zack, zack, hol mir Kostüm her, und dann drehen wir endlich!«
Tom Dicate arbeitete seit Jahren mit diesen Frauen, kannte aber noch immer nicht ihre Namen und versuchte nicht einmal, es zu kaschieren. Außerdem war Inès, die er Make-up nannte, in Wahrheit selbst Kostüm. Zélie war die Maskenbildnerin, und die nannte er Haare.
Mit verkniffener Miene stapfte Inès davon, um Zélie zu suchen.
Tom klatschte in die Hände, um sie weiter anzutreiben, und brüllte durch den Raum: »Hoch mit euch, ihr faulen Säcke, an die Arbeit, wir drehen!«