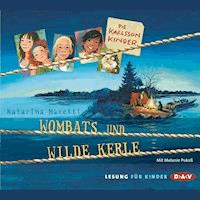6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Die Bestseller aus Schweden: Der Doppelband „Der Kerl vom Land & Mein Kerl vom Land und ich“ von Katarina Mazetti jetzt als eBook bei dotbooks. Dem Traummann auf dem Friedhof begegnen? Desirée hätte nicht gedacht, dass das möglich ist – aber als die junge Witwe Benny kennenlernt, funkt es sofort. Nur leider hat der charismatische Mann ein Manko: Er ist Landwirt! Nicht gerade das, was sich die waschechte Großstädterin vorgestellt hat … Nach einigen Wochen voller Leidenschaft fallen die beiden darum krachend von ihrer rosaroten Wolke. Doch das Schicksal scheint ihnen einen Wink zu geben, als sich plötzlich Nachwuchs anmeldet – und die beiden Sturköpfe erst recht ins Gefühlschaos stürzt … „Eine sehr komische und gleichzeitig sehr tragische Geschichte, mit viel Humor und Feingefühl erzählt.“ Westdeutscher Rundfunk Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Doppelband „Der Kerl vom Land & Mein Kerl vom Land und ich“ von Katarina Mazetti. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 487
Ähnliche
Über dieses Buch:
Dem Traummann auf dem Friedhof begegnen? Desirée hätte nicht gedacht, dass das möglich ist – aber als sie den charismatischen Benny kennenlernt, funkt es sofort. Nur leider hat der Mann ein Manko: Er ist Landwirt! Nicht gerade das, was sich die waschechte Großstädterin vorgestellt hat … Kein Wunder, dass die beiden nach einigen Wochen voller Leidenschaft krachend von ihrer rosaroten Wolke fallen. Doch das Schicksal scheint ihnen einen Wink zu geben, als sich plötzlich Nachwuchs anmeldet – und die beiden Sturköpfe erst recht ins Gefühlschaos stürzt …
»Eine sehr komische und gleichzeitig sehr tragische Geschichte, mit viel Humor und Feingefühl erzählt.« Westdeutscher Rundfunk
Über die Autorin:
Katarina Mazetti, geboren 1944 in Stockholm, arbeitete als Schwedisch- und Englischlehrerin sowie als Journalistin bei Sveriges Radio. Mit ihrem Erfolgsroman »Der Kerl vom Land« stand sie monatelang in Schweden auf der Bestsellerliste, 2002 wurde das Buch verfilmt.
Katarina Mazetti veröffentlichte bei dotbooks auch den Liebesroman »Ein Kerl zum Verlieben« sowie den fesselnden Kriminalroman »Das Schweigen der Schuld«.
***
Bitte verwechseln Sie diesen Doppelband nicht mit dem Roman »Mittsommerküsse« von Pia Engström.
***
Doppelband-Originalausgabe September 2019
Copyright © der enthaltenen Neuausgabe »Der Kerl vom Land«: Die schwedische Originalausgabe erschien 1998 und 2005 unter dem Titel »Grabben i graven bredvid« bei Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm; Copyright © der schwedischen Originalausgabe 1998 und 2005 Katarina Mazetti; Copyright © der deutschen Erstausgabe 2001 und 2005 Piper Verlag, München; Copyright © der Neuausgabe 2017 dotbooks GmbH, München
Copyright © der enthaltenen Neuausgabe »Mein Kerl vom Land und ich«: Die schwedische Originalausgabe erschien 1998 und 2005 unter dem Titel »Familjegraven« bei Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm; Copyright © der schwedischen Originalausgabe 1998 und 2005 Katarina Mazetti; Copyright © der deutschen Erstausgabe 2001 und 2005 Piper Verlag, München; Copyright © der Neuausgabe 2018 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Doppelband-Originalausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/Serge64, Piotr Wawrzyninh, TTphoto, naKornCreate, ARTvektor und sakdan
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96148-822-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Mittsommerküsse« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Katarina Mazetti
Mittsommerküsse
Zwei Bestseller aus Schweden in einem Band
Aus dem Schwedischen von Annika Krummacher
dotbooks.
Der Kerl vom Land
Kapitel 1
Wer ergreift Partei für die Toten?
Wer wahrt ihre Rechte,
schenkt ihren Problemen Gehör
und gießt ihre Topfpflanzen?
Vor mir sollte man sich in acht nehmen!
Eine vergrämte alleinstehende Frau mit einem offenbar ziemlich abnormen Gefühlsleben. Wer weiß, was ich beim nächsten Vollmond anstelle?
Sie haben doch sicher Stephen King gelesen?
Ich sitze auf einer abgewetzten dunkelgrünen Parkbank am Grab meines Mannes und ärgere mich über seinen Grabstein.
Es ist ein kleiner, nüchterner Naturstein mit nichts als seinem Namen darauf: »Örjan Wallin«, in einer schnörkellosen Schrift. Schlicht, um nicht zu sagen überdeutlich, genau so, wie er selbst war. Er hatte ihn selbst ausgewählt und einen Vertrag mit dem Bestattungsunternehmen Fonus geschlossen.
Allein schon so was. Ich meine, er war ja nicht mal krank.
Ich weiß genau, was er mit seinem Stein sagen wollte: Der Tod ist ein »völlig natürlicher Bestandteil des Kreislaufs«. Er war Biologe.
Besten Dank, Örjan.
Mehrmals pro Woche sitze ich hier in der Mittagspause, und immer mindestens einmal am Wochenende. Wenn es anfängt zu regnen, packe ich eine Plastikregenjacke aus, die sich zusammenfalten und in einen kleinen Beutel stecken läßt. Sie ist unglaublich häßlich, ich habe sie in der Kommode meiner Mutter entdeckt.
Hier auf dem Friedhof haben viele so eine Regenjacke.
Ich gehe erst, wenn ich mindestens eine Stunde hier gesessen habe. Vermutlich hoffe ich, die richtige Art der Trauer hervorlocken zu können, wenn ich nur ausdauernd genug bin. Ich würde mich viel besser fühlen, wenn ich mich schlechter fühlen würde, könnte man sagen. Wenn ich ein Taschentuch nach dem anderen auswringen könnte, ohne mich die ganze Zeit von der Seite zu beobachten, ob die Tränen wohl echt sind.
Die peinliche Wahrheit ist, daß ich die halbe Zeit einfach nur wütend auf ihn bin. Verdammter Verräter, warum konntest du nicht besser aufpassen? Und was ich die restliche Zeit empfinde, ähnelt vermutlich am ehesten dem, was ein Kind fühlt, wenn sein Wellensittich nach vielen Jahren stirbt. So sieht es aus.
Ich vermisse die ständige Gesellschaft und unsere Alltagsgewohnheiten. Niemand sitzt neben mir auf dem Sofa und raschelt mit der Zeitung, nie riecht es nach Kaffee, wenn ich nach Hause komme, und das Schuhregal sieht ohne die ganzen Boots und Gummistiefel von Örjan aus wie ein entlaubter Baum.
Wenn mir ein »Sonnengott mit zwei Buchstaben« nicht einfällt, muß ich das Wort erraten oder es überspringen.
Die eine Hälfte des Doppelbetts ist immer unberührt.
Niemand würde sich wundern, falls ich nicht nach Hause käme, weil mich zufällig ein Auto überfahren hat.
Und niemand betätigt die Toilettenspülung, wenn ich nicht da bin.
Hier sitze ich also auf dem Friedhof und vermisse das Rauschen der Toilettenspülung. Weird enough for you, Stephen?
Irgendwie fühle ich mich auf Friedhöfen immer wie eine zweitklassige Kabarettistin. Verdrängung durch schwarzen Humor, klar – aber das werde ich mir doch wohl gönnen dürfen. Ich habe mittlerweile nicht so viel anderes zu tun, als mich mit meinen kleinen Verdrängungen zu beschäftigen.
Zusammen mit Örjan wußte ich immerhin, wer ich war. Wir definierten einander, vermutlich sind Beziehungen genau dazu da.
Wer bin ich jetzt?
Ich bin den Leuten, die mich sehen, völlig ausgeliefert. Für die einen bin ich eine Wählerin, für die anderen eine Fußgängerin, eine Angestellte, eine Teilnehmerin am kulturellen Leben, human resource oder Wohnungseigentümerin.
Oder nur eine Ansammlung von gespaltenen Haarspitzen, undichten Slipeinlagen und trockener Haut.
Natürlich kann ich nach wie vor Örjan zu Hilfe nehmen, um mich zu definieren. Diesen Dienst kann er mir postum ruhig erweisen. Hätte es Örjan nicht gegeben, könnte man mich als »Singlefrau, dreißig plus« bezeichnen, diese Formulierung habe ich gestern in einer Zeitung gelesen, und mir haben sich die Nackenhaare gesträubt. Statt dessen bin ich eine »noch junge, kinderlose Witwe«, wie tragisch und wehmütig! Besten Dank, Örjan!
Irgendwo regt sich peinlicherweise auch ein kleines Gefühl von purer Enttäuschung. Ich fühle mich betrogen, weil Örjan gestorben ist, einfach so.
Dabei hatten wir unsere nähere und fernere Zukunft schon geplant! Den Kanuurlaub in Värmland und unsere vorteilhaften Rentenversicherungen.
Eigentlich müßte Örjan auch enttäuscht sein. Das ganze Tai Chi, die ungespritzten Kartoffeln und die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Was hat er jetzt davon?
Fragt sich die Kabarettistin und zeigt ihre gelben Schneidezähne.
Manchmal bin ich einfach zornig seinetwegen. Es ist ungerecht, Örjan! Dabei warst du so wohlmeinend und kompetent!
Außerdem spüre ich nach fünf Monaten Zölibat ab und zu ein kleines, unruhiges Flattern zwischen den Beinen. Das gibt mir das Gefühl, als sei ich nekrophil.
Neben Örjans Stein steht ein wahres Monster von Grabstein, geradezu vulgär. Weißer Marmor mit Schönschrift in Gold, Engel, Rosen, Vögel, Sinnsprüche auf verschlungenen Bändern und sogar ein kleiner, aufmunternder Totenkopf und eine Sense. Das Grab selbst ist mit Pflanzen übersät wie eine Baumschule. Auf dem Grabstein stehen ein Männername und ein Frauenname mit ähnlichen Geburtsjahren. Wahrscheinlich möchte ein Kind seine Eltern auf diese übertriebene Art und Weise ehren.
Vor einigen Wochen habe ich den Trauernden am vulgären Nachbargrab zum ersten Mal gesehen. Es ist ein Mann in meinem Alter mit quietschbunter Daunenjacke und einer gefütterten Mütze, die Ohrenklappen hat, vorne etwas erhöht ist, wie bei den Amerikanern, und den Schriftzug »Wir Waldbesitzer« trägt. Er war eifrig damit beschäftigt, in der Bepflanzung herumzuharken und zu graben.
Auf Örjans Grab wächst nichts. Er hätte vermutlich einen kleinen Rosenbusch völlig unangebracht gefunden, diese Pflanzenart hat im Friedhofsbiotop nichts zu suchen. Und Schafgarbe und Mädesüß führen sie nicht im Blumenladen an der Friedhofspforte.
Der Waldbesitzer kommt im regelmäßigen Abstand alle paar Tage gegen zwölf Uhr mittags. Immer ist er mit neuen Pflanzen und Düngemitteln beladen. Er scheint erfüllt von einem gewissen Gärtnerstolz, als ob das Grab sein Schrebergarten wäre.
Neulich hat er sich neben mich auf die Bank gesetzt und mich von der Seite betrachtet, aber er hat nichts gesagt.
Er roch merkwürdig, und an der linken Hand hatte er nur drei Finger.
Kapitel 2
Verdammt, ich kann sie nicht ausstehen, ich kann sie einfach nicht ausstehen!
Warum muß sie bloß immer da herumsitzen?
Bisher habe ich mich normalerweise eine Weile auf die Bank gesetzt, wenn ich das Grab versorgt hatte, um alle meine unterbrochenen Gedanken wieder aufzunehmen, um ein Fadenende zu finden, an dem ich mich festhalten könnte, damit ich mich noch einen Tag vorwärts schleppen kann, oder auch zwei. Zu Hause auf dem Hof kann ich nicht nachdenken, während ich meine Arbeit mache. Wenn ich mit meinen Gedanken nicht bei der Sache bin, passiert unweigerlich eine kleine Katastrophe, die mir einen zusätzlichen Tag Arbeit beschert. Ich fahre mit dem Traktor auf einen Stein, und die Hinterachse ist hinüber. Eine Kuh tritt sich auf eine Zitze, weil ich vergessen habe, den Euterhalter anzubringen.
Zum Grab zu gehen ist meine einzige Atempause, und nicht einmal dort habe ich das Gefühl, mich einfach nur hinsetzen und nachdenken zu dürfen. Ich muß harken und pflanzen und Ordnung schaffen, ehe ich mir erlauben kann, mich auszuruhen.
Und dann sitzt sie da.
Ausgeblichen wie ein altes Farbfoto, das jahrelang in einem Schaufenster gestanden hat. Helles, ausgefranstes Haar, ein blasses Gesicht, weiße Wimpern und Augenbrauen, langweilige, farblose Kleider, immer irgendwas Hellblaues oder Beiges. Ein Mensch in Beige. Ihre ganze Erscheinung ist eine Unverschämtheit – ein bißchen Schminke oder Glitzerschmuck hätten der Umwelt verraten, daß hier ein Mensch sitzt, der sich zumindest Gedanken darüber macht, was die anderen sehen und über ihn denken. Ihre Blässe vermittelt bloß: Mir ist es scheißegal, was ihr denkt, ich sehe euch nicht.
Ich mag es, wenn mich das Aussehen einer Frau auffordert: Schau mich an, sieh, was ich habe! Dann fühle ich mich irgendwie geschmeichelt. Frauen müssen leuchtenden Lippenstift und kleine spitze Schuhe mit Riemchen tragen und einem den Busen entgegenstrecken. Es macht nichts, wenn der Lippenstift verläuft, wenn das Kleid über den Rettungsringen aus allen Nähten platzt, wenn sich riesige Kunstperlen aneinanderreihen – nicht alle können einen guten Geschmack haben, was zählt, ist der Versuch. Ich bin immer ein bißchen verliebt, wenn ich eine Frau mittleren Alters sehe, die einen halben Tag investiert hat, um sichtbar zu sein, vor allem wenn sie lange, künstliche Fingernägel und eine herausgewachsene Dauerwelle hat und auf wackeligen hohen Absätzen geht. Dann will ich sie in den Arm nehmen, sie trösten und ihr Komplimente machen.
Natürlich tue ich das nie. Ich komme ihnen ohnehin nicht näher, sondern sehe sie nur in der Post oder auf der Bank. Zu Hause auf dem Hof gibt es keine Frauen, abgesehen von der Besamungstechnikerin und der Tierärztin. Mit langer, blauer Gummischürze, groben Stiefeln, Kopftuch und der Spritze mit dem Stiersperma griffbereit. Und niemals haben sie Zeit, auch nur auf einen Kaffee zu bleiben – gesetzt den Fall, ich hätte Zeit, welchen zu kochen.
Mutter hat mir in den letzten Jahren in den Ohren gelegen, daß ich »mal raus« solle, um mir ein Mädel zu suchen. Als ob es irgendwo eine Herde williger Mädchen gäbe, von denen man sich einfach eine aussuchen könnte. Wie wenn man in der Jagdsaison seine Flinte mitnimmt und sich einen Hasen schießt.
Sie wußte ja selbst, lange bevor ich es wußte, daß der Krebs sie langsam von innen auffressen würde und daß ich allein klarkommen müßte. Nicht nur mit der ganzen Arbeit, sondern auch mit dem, was sie mir in all den Jahren gegeben hatte: ein warmes Haus, ein gemachtes Bett, jeden zweiten Tag einen sauberen Stalloverall, gutes Essen, heißen Kaffee und dazu frischgebackene Wecken. Und dahinter stand all die Arbeit, an die ich nicht zu denken brauchte – Holzhacken und Feuermachen und Beerenpflücken und die Wäsche, all das, wozu ich jetzt keine Zeit habe. Der Overall starrt vor Dreck und saurer Milch, die Laken sind grau, wenn man reinkommt, ist das Haus ausgekühlt, und statt Kaffee gibt es eine Tasse Heißwasser aus der Leitung mit Nescafé. Und Tag für Tag die verdammte in Plastik abgepackte Fleischwurst, die in der Mikrowelle platzt.
Sie legte mir immer den zweiten Teil von »Land«, der Zeitschrift des Bauernverbandes, neben die Kaffeetasse, aufgeschlagen bei den Kontaktanzeigen. Manchmal hatte sie eine davon eingekreist. Aber sie sagte nie irgendwas.
Mutter wußte nicht, daß unten an der Milchrampe keine Scharen von holden Maiden darauf warteten, die Hausfrau eines »attraktiven Junggesellen mit eigenem Hof« zu werden. Sie sind im Laufe der Jahre alle in die Stadt gegangen, und jetzt sind sie Kindergärtnerinnen und Schwesternhelferinnen und mit Kfz-Mechanikern und Verkäufern verheiratet und sparen auf ein Reihenhaus. Im Sommer kommen sie manchmal her, bringen ihre Kerle und einen kleinen Blondschopf im Tragegurt mit und liegen ein paar Wochen lang in einem Liegestuhl auf dem alten Hof ihrer Eltern.
Carina, die in den letzten Schulklassen immer hinter mir her war und die auch mal die Beine breitmachte, wenn man bloß ein bißchen mit ihr flirtete, liegt manchmal im Laden hinter den Regalen auf der Lauer. Das Geschäft ist während der Sommermonate geöffnet, vielleicht noch einige Sommer lang. Und plötzlich springt sie hervor und tut so, als wären wir uns rein zufällig begegnet, und fängt an, mich auszuhorchen, ob ich verheiratet bin und Kinder habe. Sie wohne jetzt in der Stadt, zusammen mit Stefan, der im Warenlager von Domus arbeite, sagt sie triumphierend und sieht aus, als müßte ich Tränen darüber vergießen, was mir entgangen ist. Von wegen!
Vielleicht hat die Blasse vom Friedhof ja auch alte Eltern, zu denen sie im Sommer fährt, um sich bei ihnen zu erholen. Es wäre schön, sie ein paar Wochen lang nicht sehen zu müssen. Wobei ich im Sommer vermutlich ohnehin keine Zeit haben werde, herzukommen, außer es regnet mal einen Tag in Strömen und die Heuernte verschiebt sich.
Und dieser Grabstein, auf den sie die ganze Zeit starrt, während sie da rumsitzt! Was ist das bloß für ein Stein? Er sieht aus wie so ein Teil, mit dem Vermessungsingenieure die Grundstücksgrenzen markieren!
Mutter hat den Grabstein für Vater ausgesucht. Mir ist klar, daß er überladen wirkt, aber ich sehe auch all die Liebe, mit der sie ihn ausgewählt hat. Sie hat sich mehrere Wochen damit beschäftigt und lauter Prospekte besorgt. Jeden Tag hatte sie einen neuen Einfall für die Verzierung, und am Schluß wurde es eben eine Kombination von allem.
Örjan, ob das wohl ihr Vater oder ihr Bruder ist – oder ihr Kerl? Und wenn sie schon Tag für Tag hier rumsitzt und den Stein anstarrt, warum kann sie sich nicht aufraffen, wenigstens eine Blume aufs Grab zu pflanzen?
Kapitel 3
Natürlich kämpfen die Wundränder, um zusammenzuwachsen,
und auch die Uhr will aufgezogen werden
(wie peinlich, auf halb zwei stehen zu bleiben!).
In abgetrennten Gliedern entstehen Phantomschmerzen.
Heute ist etwas völlig Unerwartetes passiert.
Es war ein klarer, kalter Herbsttag, und ich machte in der Mittagspause meinen üblichen Spaziergang zum Grab. Der Waldbesitzer saß wieder auf seiner Bank und warf mir einen düsteren Blick zu, als würde ich auf seinem Friedhof Hausfriedensbruch begehen. Seine Fäuste waren voller Erde, vermutlich hatte er seine Gärtnertätigkeit für heute abgeschlossen. Warum hat er wohl nur drei Finger?
Ich setzte mich auf die Bank und begann darüber nachzudenken, was für Kinder Örjan und ich wohl bekommen hätten. Örjan hätte Vaterschaftsurlaub genommen und alles über Stoffwindeln und praktische Tragegurte gewußt. Und er wäre zum Babyschwimmen gegangen.
Wir waren fünf Jahre verheiratet, und in dieser Zeit stritten wir uns fast nie. Ab und zu waren wir mal ein bißchen kurz angebunden, hier und da ein unfreundliches Wort oder eine scharfe Formulierung, immer von meiner Seite, aber es eskalierte nie.
Das war nicht mein Verdienst. Örjan stritt sich nie mit irgend jemandem. Freundlich erklärte er immer und immer wieder seinen Standpunkt, bis man vor Erschöpfung die Segel strich.
Ein paarmal verlor ich wegen seiner ewigen Freundlichkeit die Kontrolle und begann mich wie ein Kind aufzuführen – ich trat gegen die Möbel, stampfte aus dem Zimmer, knallte die Türen. Er tat immer so, als bemerke er es nicht, und ich ließ es auf sich beruhen, denn ich hatte das Gefühl, als würde ich ihm damit auch noch Punkte zuschanzen.
Eines Tages zerknüllte ich die »Dagens nyheter«, einen Teil nach dem anderen, und bombardierte ihn mit den Zeitungskugeln. Wir hatten den halben Samstag auf die Zeitungslektüre verwendet – die Leitartikel mußten diskutiert, die kulturellen Ereignisse registriert werden, auch wenn sie dreihundert Kilometer entfernt stattfanden, man mußte über den Cartoon lachen und ein raffiniertes Abendessen mit sonnengetrockneten Tomaten planen. Mich überkam das Gefühl, als entglitte mir das wirkliche Leben, es brauste nur so vorbei dort draußen vor dem Fenster, während wir drin saßen und »Dagens nyheter« lasen, und ich riß die Zeitung an mich und ging zum Angriff über. Da wurden seine braunen Augen so betrübt, daß ich nur noch die Wahl hatte, ihm entweder eine zu langen oder zu heulen.
Natürlich heulte ich, voller Wut. Denn das Ärgerliche daran war, daß er immer seine grünen Gummistiefel anzog und hinaus in die Wirklichkeit ging, noch ehe ich beim Kulturteil der Zeitung angelangt war. »Du hast immer ein Fernglas zwischen dir und der Wirklichkeit«, schniefte ich und fühlte mich noch mißverstandener, da ich mich nicht einmal selbst verstand.
Ein paar Tage später steckte er mir wie im Vorübergehen einen Artikel über das prämenstruelle Syndrom zu und streichelte mir freundlich über die Hand. Ich wollte den Artikel sofort zerknüllen und Örjan damit bewerfen, aber noch ehe ich Anlauf genommen hatte, war er schon unten auf dem Hof, wo er sein Mountainbike aufschloß und verschwand.
Anfangs war ich in ihn verliebt. Ich schrieb Liebesbriefe in Hexametern, über die er lächelte. Ich balancierte auf knackenden Ästen umher, um für ihn Vogelnester zu fotografieren, und stand im eiskalten Wasser, während sich Blutegel, die er für seine Forschungen brauchte, an meinen Beinen festsaugten.
Es mag daran gelegen haben, daß er gut aussah: warme, braune Farben, ein großer, gutgebauter Körper, schöne, muskulöse Hände, die ständig beschäftigt waren. Es war ein gutes Gefühl, wenn andere Frauen ihm unauffällig hinterhersahen und sich dann vor Erstaunen beinahe verschluckten, wenn sie meine ausgeblichene Erscheinung an seiner Seite sahen. (Da staunt ihr, was! Diesen Teufelskerl hab ich mir ganz allein geangelt, da könnt ihr noch was lernen, Mädels!)
Alles leere Worte. Keine Ahnung, wie ich ihn »gekriegt« habe. Normalerweise wecke ich bei schönen Männern kein größeres Interesse als ein Tapetenmuster, das irgend jemand von der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft ausgewählt hat.
Aber nachdem Örjan mich gesichtet hatte – ich arbeitete an der Auskunft der Bibliothek und war ihm behilflich, englische Fachzeitschriften für Zoologie zu finden –, entschied er sich offenbar zielstrebig dafür, daß ich »seine Frau« war, die er künftig allen anderen vorziehen würde. Ungefähr so, wie er die Outdoorprodukte von Fjällräven bevorzugte.
Am Anfang hatte ich ständig das Gefühl, als wolle er mich prüfen, als sei das Ganze eine großangelegte Untersuchung der Stiftung Warentest. Im Wald. Im Bett. Im Kino und hinterher beim Gespräch im Café. Und nirgendwo tauchten scharfe Ecken und Kanten auf. Wir hakten alle unsere Ansichten ineinander wie zwei Stricknadeln die Maschen und betrachteten zufrieden das Muster, das allmählich entstand.
Also heirateten wir und atmeten erleichtert auf. Reifeprüfung bestanden, Zeit für die nächste Phase.
Wir hatten gerade begonnen, uns vor dem Schaufenster des Kinderwagenladens zuzulächeln, als er einfach starb. Eines Tages wurde er von einem Lkw angefahren, als er früh morgens losradelte, um Auerwild bei der Balz zu beobachten. Eine Kassette mit Vogelstimmen steckte in seinem Walkman – entweder hatte er den Lkw nicht gehört und war auf die Fahrbahn gefahren, oder der Lkw-Fahrer war am Steuer eingeschlafen.
Dieser kleine nüchterne Stein vor mir ist alles, was übriggeblieben ist. Und ich bin wütend auf ihn, weil er mich so zurückgelassen hat, ohne daß wir vorher jemals darüber diskutiert hätten ... Jetzt werde ich niemals erfahren, wer er war.
Ich zog mein Notizbuch aus der Tasche. Es ist ein kleines blaues Buch mit festem Einband, auf dessen Vorderseite ein Segelboot auf einem leuchtend blauen Meer abgebildet ist. Und dann schrieb ich:
Natürlich kämpfen die Wundränder, um zusammenzuwachsen, und auch die Uhr will aufgezogen werden ...
Ich bilde mir wirklich nicht ein, daß ich in meinem Notizbuch »Dichtung« erschaffe. Ich versuche nur, das Dasein in Bildern einzufangen. Das mache ich beinahe jeden Tag, ungefähr so wie andere Leute To-do-Listen schreiben, um Ordnung in ihren Alltag zu bringen. Niemand braucht sie jemals zu lesen – ich erzähle den Leuten ja auch nicht meine Träume. Jeder hat seine eigene Methode, um das Leben in den Griff zu bekommen.
Der Waldbesitzer sah mich vorsichtig von der Seite an. Glotz du nur, dachte ich, und glaub ruhig, daß ich eine »ordentliche Hausfrau« bin, die gerade ihr Haushaltsbuch führt.
Gerade als ich meinen Füllfederhalter zuschraubte (ich habe mir extra einen Füller besorgt – derartiges muß mit Tinte geschrieben werden), kam eine Mutter mit einem kleinen Mädchen von drei, vier Jahren zu dem Grab, das hinter dem des Waldbesitzers lag. Das Mädchen hatte eine kleine, glitzernde quietschrosa Gießkanne dabei, die ganz neu aussah, und sie trug sie so, als seien es die Kronjuwelen. Die Mutter machte sich mit spitzen Plastikvasen und raschelndem Blumenpapier zu schaffen, und das Mädchen hüpfte um den Grabstein herum und spritzte Wasser aus der Kanne. Plötzlich schlug es die Hand vor den Mund und sah erschrocken aus, und seine Augen waren rund wie Murmeln:
»Oh, Mama! Ich habe auf das Schild gegossen! Jetzt wird Opa aber sauer!«
Ich spürte, wie sich meine Mundwinkel nach oben zogen, und warf dem Waldbesitzer einen Blick zu. Und im selben Moment sah er mich an.
Er lächelte auch. Und ...
Es gibt keine Worte, um dieses Lächeln zu beschreiben, ohne in der wunderbaren Welt der Schlagertexte zu landen.
Sonne und Walderdbeeren, Vogelgezwitscher und Buchten mit glitzerndem Wasser lagen darin. Und es war mir gewidmet, vertrauensvoll und stolz, als wäre er ein Kind, das ein zerdrücktes Geburtstagsgeschenk überreicht. Meine Mundwinkel blieben an den Ohren hängen. Und zwischen uns verlief ein Lichtbogen, das schwöre ich bis heute – so ein blauer, den mein Physiklehrer mit irgendeinem Gerät erzeugen konnte. Es dauerte drei Stunden oder vielleicht auch nur drei Sekunden.
Dann drehten wir unsere Köpfe geradeaus, beide auf einmal, als hätte jemand an einem Faden gezogen. Die Sonne verschwand hinter Wolken, und ich saß einfach nur da und ließ vor meinem inneren Auge sein Lächeln in Zeitlupe Revue passieren.
Wenn Märta, meine beste oder vielleicht sogar einzige Freundin, mir von einem Lächeln erzählt hätte, das der Waldbesitzer und ich soeben ausgetauscht hatten, dann hätte ich es auf ihre besondere Fähigkeit geschoben, die Realität immer zu etwas Größerem und Schönerem umzudichten.
Darum beneide ich sie. Ich selbst neige eher dazu, die Ursache für das Lächeln eines Säuglings bei geglückten Verdauungsvorgängen zu suchen und eine Sternschnuppe für einen havarierten Fernsehsatelliten zu halten. Vogelgesang ist eigentlich nichts anderes als eine Warnung an die Artgenossen vor Eindringlingen, und Jesus hat vermutlich nie existiert, zumindest nicht dort und damals.
Die sogenannte Liebe ist das Bedürfnis einer Art nach genetischer Variation, sonst würde es ja reichen, wenn sich die Weibchen durch Knospung fortpflanzen würden.
Ich bin mir durchaus darüber im klaren, daß zwischen Mann und Frau starke Kräfte herrschen. Da drinnen in uns schwappt das Ei umher und will von einem geeigneten Spermium befruchtet werden. Die ganze Maschinerie setzt sich mit einem Ruck in Gang, sobald eines in Reichweite ist.
Allerdings war ich nicht darauf vorbereitet, daß die äußere Hülle des Spermiums so lächeln würde! Das Ei zuckte in mir, hüpfte und planschte und schlug Purzelbäume und sandte Signale aus: »Hierher! Hierher!«
Am liebsten hätte ich dem Ei »Platz!« zugerufen.
Ich wandte mich vom Waldbesitzer ab und schielte statt dessen aus dem Augenwinkel auf seine Hand. Seine drei Finger spielten die ganze Zeit an einem Volvoschlüsselanhänger herum.
Wo der Ringfinger und der kleine Finger hätten sein sollen, befanden sich nur glatte Knöchel. In seine Haut schienen Erde und vielleicht auch Öl wie eingewachsen, und die Adern auf dem Handrücken schwollen an. Ich wollte an seinen Händen riechen und die leeren Knöchel mit den Lippen liebkosen.
Herrgott, ich mußte hier weg! Passiert so was einer erwachsenen Frau, die eine Zeitlang ohne Mann gelebt hat?
Also erhob ich mich und packte mit kalten Händen meine Tasche und rannte über Steine und niedrige Hecken geradewegs zur Friedhofspforte.
Kapitel 4
Ich bin mit der Buchführung in Verzug. Ich habe das Gefühl, als ob alles den Bach runtergeht, und frage mich, ob das vielleicht der wahre Grund ist, warum ich es nicht fertigbringe, die Rechnungen in Angriff zu nehmen. Der Papierhaufen, der aus Vaters altem Sekretär herausquillt, wirkt explosiv – als würde da drin irgendein verdammter kleiner Zettel von der Vereinsbank vor sich hin ticken, ein Zettel mit der Mitteilung, daß der Dispokredit vollständig ausgeschöpft ist. Zu Bürozeiten traue ich mich kaum noch ans Telefon zu gehen, es könnten ja die von der Bank sein.
Ich konnte mit Geld und dem ganzen übrigen Papierkram noch nie gut umgehen. Mutter konnte das. Sie saß immer drüben am Sekretär und murmelte halblaut vor sich hin, und ab und zu drehte sie sich um, sah mich über den Rand ihrer Brille hinweg an und stellte irgendwelche Fragen, die einigermaßen leicht zu beantworten waren:
»Kommen wir mit dem Saatgut aus? Hast du die Rechnung der Tierärztin bezahlt?«
Um alles andere kümmerte sie sich selbst. Und man mußte ihr nur sagen, wieviel Bargeld man brauchte – sie fragte nie nach, nicht einmal, als ich den Einfall hatte, Annette, mit der ich eine Weile zusammen war, ein breites Goldarmband zu schenken. Annette lag mir ständig in den Ohren, daß sie Panzerketten liebte, das ist fast das einzige, was mir von ihr in Erinnerung geblieben ist.
Gegen Ende sagte Mutter einmal, daß ich den Betrieb künftig der Landwirtschaftlichen Buchstelle überlassen solle. An so was dachte sie, während sie da am Tropf hing. Der Tropf führte dazu, daß sie ständig eine Bettpfanne brauchte, was ihr unendlich peinlich war. Ich sagte immer, ich müsse eben rausgehen und eine rauchen, wenn die Schwester mit der Bettpfanne reinkam. Und ich brachte es nicht übers Herz, ihr zu sagen, daß ich mir die Landwirtschaftliche Buchstelle wohl nicht würde leisten können, die Milchabrechnung schien von Monat zu Monat zu schrumpfen.
Die vor kurzem angestellten jungen Schnösel in der Buchstelle sehen aus wie Börsenmakler. Ich fühle mich in ihrem Büro völlig fehl am Platz.
Mutter war beinahe verärgert über den Krebs, der sie daran hinderte, aufzustehen und etwas Nützliches zu tun. Durch die Chemotherapie erlosch allmählich ihr Lebenslicht, aber wenn ich kam, sah sie aus, als wolle sie sagen: »Wie ärgerlich! Es tut mir wirklich leid, daß es mir so schlecht geht!«
Verdammt, jetzt ist sie schon wieder da, die Beige! Hat sie denn nichts anderes zu tun? Sie sieht aus wie eine alte Jungfer, die noch bei ihren Eltern wohnt. So eine, die stundenweise in der Bank arbeitet und auf die Hochzeit mit dem Zweigstellenleiter wartet. Im Grunde sieht sie verdammt noch mal so aus, als würde sie in der Vereinsbank arbeiten!
Sie setzt sich hin und sieht mich von der Seite an, als sei ich ein ungedeckter Scheck – was zwar ziemlich peinlich ist, sie aber eigentlich nichts angeht. Dann seufzt sie tief und zieht ein Notizbuch aus einer großen, geblümten Tasche. Umständlich schraubt sie den Deckel von ihrem Stift (ein Füller? Ich dachte immer, so was benutzt keiner mehr, seit der Kugelschreiber erfunden wurde) und beginnt zu schreiben, langsam und pedantisch.
Natürlich werde ich furchtbar neugierig. Wer ist diese Frau,. die an einem Grab sitzt und sich Notizen macht? Führt sie Buch über die Ehemänner, die sie um die Ecke gebracht hat? Plötzlich blickt sie auf, und ich höre ein kurzes, entschlossenes Schnauben: Sie hat gemerkt, daß ich sie beobachte. Um mich an ihrer überheblichen Art zu rächen, stelle ich sie mir mit einer gelockten lilafarbenen Nylonperücke und in Netzstrümpfen vor. Die Brüste, weiß wie Mehl und fest zusammengepreßt, quellen aus einem geschnürten Lackkorsett. Die weißen Augenwimpern dürfen bleiben, und die alberne Zottelmütze mit den Pilzen drauf darf sie aufbehalten.
Was ich vor mir sehe, ist unglaublich albern, und plötzlich geht mir auf, daß ich dasitze und sie anstarre und von einem Ohr zum anderen grinse. Wieder wirft sie mir einen Blick zu – und ehe ich mein Gesicht wieder zurechtgerückt habe, lächelt sie zurück!
Das heißt – ist sie das wirklich?
Die Beige, die eben noch dagesessen und einen alten Feldstein angestarrt und ihre bleichen Lippen verzogen hat – kann die so lächeln?
Wie ein Kind in den Sommerferien oder wenn es sein erstes Fahrrad bekommen hat. Dasselbe glückliche Lächeln wie bei dem kleinen Mädchen mit der rosafarbenen Gießkanne am Grab dort drüben.
Wir lächeln einfach weiter. Wir haben beide das Fernlicht angeschaltet, und keiner von uns gibt nach.
Worum geht es hier überhaupt, verdammt noch mal?
Sollte ich irgendwas tun? Zu ihr sagen: »Sind Sie oft hier? Viel los auf dem Friedhof heute – wie gefällt Ihnen die Kapelle?« oder womöglich näher rücken?
Dann zieht irgend jemand den Stecker raus, und wir starren beide geradeaus nach vorne.
Eine Weile sitzen wir reglos da, als wäre die Bank vermint. Dann beginne ich an den Schlüsseln herumzuspielen, um innerlich nicht zu platzen.
Aus dem Augenwinkel sehe ich, daß sie ihren Blick insgeheim auf meine Hand geheftet hat. Ich habe jahrelang geübt, sie nicht in die Tasche zu stecken, wenn Leute sie anglotzen. Und ich tue es auch jetzt nicht. Three-finger-Benny, that's me, babe. Take it or leave it!
Es wurde »leave it« daraus, ha ha. Sie steht auf und stolpert davon, als wollte ich sie mit meinen armseligen drei Fingern angrabschen. Warum sieht sie nur so wütend aus?
Ich nehme an, daß mal wieder Benny, der Tangokavalier, zugeschlagen hat.
So ist es mir damals ergangen, als ich ständig auf der Suche nach Mädchen war. Ich ging, wohin der Schwanz zeigte, und der zeigte immer auf Frauen, wie eine Wünschelrute, mir blieb nichts anderes übrig, als hinterherzulaufen. Im Sommer in den Volkspark. Im Winter in ein Tanzlokal in irgendeinem Dorf, auch wenn man manchmal ziemlich weit fahren mußte. Große, triste Säle mit Neonröhren, in denen unter der Woche die Sportstunden der Dorfschule und abends die Treffen des Guttemplerordens stattfanden, und am Freitag und Samstag wurde ein bißchen Kreppapier über die Lampen geklebt und irgendeine Band engagiert. Ich fuhr fast nie in die Stadt, um dort in die Disko zu gehen – teils, weil mir klar war, daß ich den Anschluß an die aktuellen Trends verloren hatte (das begriff ich, als die Leute anfingen, die Schirmmützen falsch herum zu tragen), teils aber auch, weil ich es für vergebliche Liebesmüh hielt, ein Stück voneinander entfernt herumzuwippen. Ich wollte sie im Arm halten. Ich fand es so herrlich, einem fremden Mädel den Arm um den Rücken zu legen und sie zur Tanzfläche zu schieben, es war so, als würde man ein Los ziehen, jedesmal mit Gewinn. Sie rochen so gut, und ich fand sie alle so wahnsinnig niedlich. Ich verliebte mich in jede und wollte sie nicht loslassen, wenn das Stück vorbei war. Und auf gar keinen Fall wollte ich die Band übertönen und mich mit ihnen unterhalten oder so. Ich wollte sie nur im Arm halten und an ihnen schnuppern und durch den Saal gleiten und die Augen schließen.
Niemals wäre ich auf die Idee gekommen, daß ich mich nicht einfach nur bedienen konnte – in der Abschlußklasse war ich einer von denen gewesen, der von allen möglichen Mädchen angegraben wurde, hier und da stand mein Name sogar auf ihren Schulbänken. Aber seit ich den Hof übernommen habe, sind mir nicht sonderlich viele Frauen über den Weg gelaufen, und woran merkt man selbst, daß die Jahre vergehen? Mir war nicht klar, daß ich allmählich aus dem Rennen war.
Anfangs ging es immer gut. Ich trampelte etwas herum, wie ich es für richtig hielt, und die Mädels sind ja meistens geschickt genug, um ihre Füße rechtzeitig zurückzuziehen. Manchmal waren sie noch viel besser, sie bewegten sich so unwiderstehlich im Rhythmus der Musik, daß wir irgendwie in Eigenrotation gerieten, und das war herrlich. Wenn das Stück vorbei war, begannen sie mich von der Seite anzugucken, und ich stand einfach nur da, sah sie an und lächelte und sagte nie: »Bist du oft hier ... wie findest du die Band ... viel los heute abend ...«, wie es sich gehört. Ich habe nichts gegen Smalltalk, aber es ist irgendwie nicht mein Ding. Einige der Mädels rissen sich nach ein paar Tanzrunden los und gingen wieder an ihren Platz zurück – sie standen immer in einer Traube an derselben Wand. Aber die meisten tanzten weiter.
Einmal öffnete ich den Mund und sagte zu einer: »Was macht dich glücklich?« Irgendwie hatte ich beim Tanzen darüber nachgegrübelt.
»Was macht mich wie?« schrie sie und versuchte, den Lärm zu übertönen.
»Glücklich! Was macht dich ... ach, vergiß es!« Ich schob sie schnell zur Mädchentraube zurück, mit roten Ohren.
Aber das war nicht mein schlimmstes Erlebnis. Einmal tanzte ich fünf Tänze nacheinander mit einem Mädchen, ohne weiter darüber nachzudenken, denn sie roch so gut. Nach dem fünften Stück beugte ich mich vor und schnupperte an ihrem Halsgrübchen, ohne mich vorzusehen.
Sofort machte sie drei Schritte rückwärts. Glaubte sie, ich sei ein Vampir? Vor meinem inneren Auge sah ich, wie meine harmlosen Fluorzähne zu Vampirzähnen mutierten, und konnte mir das Grinsen nicht verkneifen. Da zischelte sie wie ein wütender Schwan, machte auf dem Absatz kehrt und ging davon.
Später stand ich im Foyer zufällig hinter ihr. »Was war das denn für ein Tangokavalier?« fragte ihre Freundin.
»Wahrscheinlich war er besoffen«, sagte sie. »Hat kein Wort gesagt, bloß wie ein Blöder gegrinst!«
Tangokavalier. Das Wort hat einen Beigeschmack von Seidenhemd und zuviel Aftershave. Einer, der zuviel versucht.
Benny, der Tangokavalier. Jagt die Frauen mit seinem Mörderlächeln davon. Deshalb ist vermutlich auch die Beige vor mir geflohen.
Aber ... na ja, sie hat doch auch gelächelt?
Kapitel 5
Tag für Tag
Auge in Auge
mit kaputten Spiegeln
und schadenfrohen Politessen
Wenn ich die Aufzeichnungen in meinem blauen Buch von jenem Herbst lese, kommt mir im nachhinein der Gedanke, daß ich vielleicht depressiv war, und zwar im klinischen Sinne.
In der Mittagspause im Aufenthaltsraum war ich beinahe hysterisch albern, und ich genoß es, die anderen lachen zu sehen, bis ihre Wimperntusche verlief. In dem Moment fühlte sich alles plötzlich so normal an, und ich selbst hatte am meisten Spaß von allen.
Und wenn ich mit meinem Einkaufsbeutel nach Hause kam, sorgte ich dafür, daß ich immer genug zu tun hatte. Mit dem eingekauften Gemüse arrangierte ich ein Stilleben auf einer dänischen Keramikplatte, ich goß meine Keimlinge, wählte sorgfältig eine nicht zu dramatische Opernarie aus, die ich dann in voller Lautstärke hörte, zündete in meinem weißen Badezimmer die Kerzen im Kandelaber an und nahm ausgedehnte Bäder, während das Lavendelaroma der Duftlampe den Raum durchzog.
In jenem Herbst las ich Autobiographien und Fantasybücher, die bestenfalls eine betäubende Wirkung hatten – als würde ich in fremde Welten eintauchen. Und wenn die Bücher plötzlich zu Ende waren, lag ich ermattet und zitternd in der Sofaecke, wie nach einem Schiffbruch an Land gespült. Die Biographien und Fantasywelten stellten mir die Frage: Warum lebst du eigentlich, und was machst du aus deinem Leben, das so zerbrechlich ist, so unhandlich und kurz?
Nachts träumte ich mir verschiedene Antworten zurecht. In einem meiner Träume war ich eine Göttin, bewegte mich in einem Gitternetz von Licht und Schatten, und meine Fingerspitzen erzeugten Leben in den unterschiedlichsten Formen: üppige, fleischige Schlingpflanzen und dralle Kinderkörper.
Andere Tage schienen hauptsächlich aus Schneeregen und einer ewigen Warterei auf den Bus zu bestehen. Ich erhöhte die Prämie meiner Rentenversicherung und schrieb mein Testament – wenn Örjan sich seinerzeit dafür entschieden hatte, wollte ich ihm wenigstens darin folgen. An solchen Tagen legte ich Mappen für verschiedene Sorten von Quittungen an, kaufte Schubkästen von IKEA für meinen Kleiderschrank und begann alte Dias zu rahmen – Bilder, die ebenso bedeutungslos schienen wie das raschelnde Laub des Vorjahres.
Ich masturbierte oft. Die Männer in meiner Phantasie waren alle grobschlächtig, hatten schwielige Hände und ein kratziges Kinn. Gesichter hatten sie keine.
Märta war mein Rettungsring, meine Verankerung im Leben. Sie kam ins Badezimmer gestürmt und wedelte mit zwei Kinokarten herum, bis ich mich aufraffte, die Kerzen auspustete und mitging. Hinterher fläzten wir uns zu Hause bei mir auf meine Sofas und redeten über die großen und kleinen Dinge des Alltags, was eine herrliche Mischung ergab – von der neuesten Geschichte über ihren neurotischen Chef bis zu einer boshaften Kritik am Frauenbild des Kirchenvaters Augustinus.
Märta verbreitete einen warmen Duft von Brot, Parfüm und Zigarillos. Phasenweise wohnte sie mit ihrer Großen Leidenschaft namens Robert zusammen, und manchmal, wenn er auf einer seiner geheimnisvollen Geschäftsreisen war, leerten Märta und ich eine Flasche weißen Portwein, und dann übernachtete sie auf meinem Sofa. Den folgenden Morgen verbrachten wir unter friedlich brummelnden Zankereien, mit strähnigem Haar und aufgedunsenen Gesichtern, Märta in Örjans dunklem Bademantel, denn ich hatte nicht übers Herz gebracht, ihn wegzuwerfen. Mehr als einmal bedauerten wir, daß wir nicht lesbisch waren – ich hätte mir vorstellen können, mit jemandem wie ihr zusammenzuleben, und oft fand sie Robert nur schwer erträglich.
Eines Nachts erzählte ich ihr vom Waldbesitzer und von dem unerklärlichen Lächeln. Sie richtete sich im Bettsofa auf, steckte einen Finger in den Mund und hielt ihn in die Luft, als wolle sie die Windrichtung feststellen.
»Da bahnt sich was an!« sagte sie entzückt.
Kapitel 6
Ein einsames Leben, ohne Familie und Kinder, fällt vielleicht besonders ins Gewicht, wenn man Bauer ist, mit einigen Hektar nutzbarem Boden und Wald dazu.
Für wen bewirtschaftet man eigentlich einen Wald, der erst in dreißig Jahren abgeholzt werden kann? Für wen läßt man die Felder brachliegen, damit die Erde keinen Schaden nimmt und auf lange Sicht ausgelaugt ist?
Und wer wird mir bei der Heuernte helfen?
Ich versuchte mich an den Ergebnissen des monatlichen Probemelkens festzuhalten. Stetig bessere Zahlen, höhere Erträge und weniger Bakterien. Ich plante Verbesserungen bei der Düngung, reinigte den Melkstand und schaffte einen neuen Tank an. Ich kaufte einen neuen Traktor mit Zwillingsbereifung – nicht, weil ich ihn unbedingt gebraucht hätte, sondern weil ich das Gefühl haben wollte, daß sich zumindest irgendwas in meinem Leben zum Besseren wendete.
Wie verrückt es auch klingen mag, ich blieb abends immer länger draußen und beschäftigte mich mit verschiedensten Dingen. Ich scheute die kompakte, armselige Stille im Haus. Sie roch ein wenig nach Verfall und Ungemütlichkeit – daher fuhr ich eines Tages mitten in der Woche in die Stadt und kaufte mir ein schwarzes, zigarrenförmiges Monsterradio, das ich in der Küche mitten auf die Arbeitsplatte stellte.
Von da an drehte ich, sobald ich abends reinkam, irgendeinen Werbesender auf volle Lautstärke, bevor ich duschen ging. Die erregten Stimmen, die aus dem Radio schallten, gaben mir das Gefühl, als spiele sich irgendwo das Leben ab und als plätschere wenigstens ein kleines Rinnsal davon in meine alte, abgenutzte Küche. Dennoch konnte ich es nicht übers Herz bringen, das alte, braune Bakelitradio mit dem gelblichen Gewebe wegzuwerfen, das Vater irgendwann in den fünfziger Jahren Mutter zum Hochzeitstag geschenkt hatte – ich ließ es sogar mit abgedrehtem Ton laufen, weil die Katze so gern darauf lag, wenn es sich erhitzte.
Ich wusch alle meine Kleider zusammen, und sie nahmen denselben graublauen Farbton an. Manchmal blätterte ich im zweiten Teil von »Land« und las, wie die Leute ihre Veranda vor dem Haus mit Schnitzereien verzierten und wie sie selber Wurst herstellten. Wen kümmerte es schon, wie es vor der Haustür aussah, das war doch sowieso nur ein Platz, wo man seine Stiefel und leere Bierkästen abstellte! Und Wurst zu kaufen dauerte nur wenige Sekunden, wenn man ohnehin seine wöchentliche Einkaufsrunde im Konsum machte.
Ich hatte vage Pläne, den alten Kühlschrank auszuräumen. Darin befanden sich nämlich Dinge, die vermutlich von selbst hätten davonlaufen können: Mutters Marmeladengläser mit handgeschriebenen Etiketten und einer dicken, flaumigen Schimmelschicht unter dem Deckel. Sie wegzuwerfen wäre dasselbe gewesen, als hätte ich Mutter hinausgeworfen.
Natürlich wäre es durchaus machbar gewesen, abends Kurse zu besuchen und »Leute zu treffen«. Die Regionalgruppe des Bauernverbandes veranstaltete einen Fortbildungskurs mit dem Titel »Lernen Sie Ihren Hof kennen«, der sofort in »Lassen Sie Ihren Hof brennen« umgetauft wurde – die Lösung erschien allen am ertragreichsten. Am Anfang war ich ein paar Male dabei und traf genau dieselben Leute, die ich sonst auch bei »Göte Nilssons Landmaschinen«, bei den Versammlungen und bei der jährlichen Weihnachtsfeier des Bauernverbandes traf.
Mit dem Unterschied, daß sie auf der Weihnachtsfeier ihre Frauen dabeihatten, und ich tanzte mit ihnen und ließ meine Hände mal hierhin, mal dorthin gleiten. Manchmal fing eine von diesen Frauen an, schwer zu atmen und mit dem Unterleib zu rotieren, so daß ich ganz verlegen wurde und zu ihren Männern hinüberschielte. Am späteren Abend, wenn wir Männer um die nächste Ecke verschwunden waren und dort unseren mitgebrachten Schnaps gepichelt hatten, erzählten wir uns Witze über die Bauerstochter und den Handelsreisenden und über die Magd und den Knecht. Manchmal wurden wir sentimental und sagten zueinander, daß wir zwar die Erde verwalteten, aber nur Scheiße dafür kriegten.
Und dann war das Fest vorbei, und diejenigen, die verheiratet waren, tanzten den letzten Tanz miteinander, und wir anderen standen in der Türöffnung und stritten über Faulschlamm oder die EU, und dann gab es immer jemanden, dessen Frau nüchtern geblieben war, weil sie früh am nächsten Morgen aufstehen und zur Arbeit ins Krankenhaus mußte, und die fuhr mich dann nach Hause. Wenn ich nicht zu besoffen war, phantasierte ich mir irgendwas zurecht über eine Frau, mit der ich Engtanz getanzt hatte, und die ganze Zeit hatte ich im Hinterkopf, daß ich um sechs wieder aufstehen mußte, weil ich mir keine Vertretung für den Kuhstall leisten konnte.
Jetzt fahren sie nach Hause, alle miteinander, zu ihrer verdammten Veranda mit Schnitzereien und decken ihre schlafenden Kinder zu, dachte ich, und morgen kocht sie ihm starken Kaffee, damit er besser in Schwung kommt, und dann setzt sie einen Brotteig an und macht Warst. Wofür lebe ich eigentlich, verdammt noch mal?
Ich schäme mich nicht mal dafür, daß ich an so eine Vermittlung geschrieben habe, die einem eine Philippinerin zur Ansicht schickt. Aber als ich den Prospekt bekam, eine schlechte Kopie mit schmuddeligen Schwarzweißfotos, drehte sich mir der Magen um. Plötzlich frage ich mich, was die Beige vom Friedhof wohl gedacht hätte, wenn sie mich in diesem Prospekt hätte blättern sehen. Ich glaube, ich bin in meinem Leben noch nie so tief gesunken.
Kapitel 7
Parkuhren
Haltbarkeitsdaten
letzter Zahltag
Metastasen des Gesellschaftskörpers
Eine Weile lang widerstrebte es mir, zu Örjans Grab zu gehen. Es wird allmählich kälter, sagte ich mir, da kann man doch nicht auf der Bank herumsitzen und sich eine Eierstockentzündung holen. Das Risiko gehen wir ein, sagten die Eierstöcke, wir wollen diesen Waldbesitzer etwas genauer in Augenschein nehmen.
Eines Tages stand ich mitten in einer Besprechung über das Jahresbudget der Bibliothek einfach auf und trabte zum Friedhof.
Der Waldbesitzer war natürlich nicht dort. Übrigens war ich mir gar nicht sicher, ob ich ihn überhaupt wiedererkannt hätte, wenn er andere Kleidung getragen und ernst dreingeblickt hätte.
Das Lächeln dagegen hätte ich wiedererkannt. Überall auf der Welt.
Örjan tat mir so leid, mein brauner, schöner, wohlmeinender Örjan. Jemanden zu haben, der am Grab von einem sitzt und an völlig andere Dinge denkt! Obwohl ... wenn ich unter der Erde gelegen und Örjan dort auf der Bank gesessen hätte, dann hätte er vermutlich sein Vogelfernglas dabeigehabt.
Meine Verliebtheit war schon vorbei, als wir heirateten. Sie verschwand wie eine Urlaubsbräune – wer merkt schon, wann sie weg ist? Aber im Gegensatz zur Sonnenbräune kehrte sie nie wieder. Und es gab Phasen vor meiner Hochzeit, in denen ich händeringend dasaß und etwas hinter den Bergen ahnte, was ich nie zu sehen bekommen würde, zumindest nicht zusammen mit Örjan.
In dieser Phase beanspruchte ich Märta stark. Eimerweise Tee bis morgens um halb vier.
»Man kann doch nicht in alle Ewigkeit verliebt sein, oder? Verliebtheit wird nach und nach durch Liebe ersetzt, etwas Dauerhafteres, worauf man bauen kann, nicht wahr? Eine Liebe, die aus einer warmen Freundschaft besteht, Sex inklusive?« lamentierte ich. Ein Wunder, daß sie davon nicht total angekotzt war. Bei ihr lagen die Therapiebücher über Liebe auf dem Klo, und man konnte sich bei Bedarf Seiten herausreißen.
»Es ist ganz schön anstrengend, sich selbst zu überzeugen, oder?« meinte sie nur ungerührt und starrte mich über ihre ewigen Zigarillos hinweg an. Märtas Prinzip lautete: Hör auf dein Herz.
»Örjan hat alles«, sagte ich starrköpfig.
»Nach den Richtlinien des Verbraucherschutzes?« schnaubte Märta. »Best in test, ausgewählt unter den Männern der Altersgruppe 25-35? Aber gibt es ihn überhaupt, oder ist er nur ein Prototyp? Hast du nachgesehen, ob er vielleicht batteriebetrieben ist? Du weißt, wenn du ein schwach surrendes Geräusch aus seinem Ohr vernimmst ...«
Wenig später verkaufte Robert ihr Auto und türmte mit dem Geld nach Madagaskar, allein. Märta Gesicht ging für eine Weile aus den Fugen, aber sie eroberte es sich wieder zurück, indem sie ihn haßte, ein paar Tränen vergoß, wie eine Verrückte arbeitete und ihn abends vorm Zubettgehen noch ein bißchen haßte. Und als er drei Wochen später nach Hause kam, braungebrannt und gutaussehend, empfing sie ihn mit offenen Armen.
Damit war meine Entscheidung gefallen. Wenn es das war, was sich hinter den Bergen verbarg, dann hatte es sich für mich erledigt.
Also stellte ich mich der Aufgabe, »glücklich verheiratet« zu sein. Binnen einem halben Jahr hatten wir eine Ehe, die ebenso bequem war wie ein Paar gut eingelaufene Pantoffeln. Solidarisch teilten wir unsere Ausgaben und die Hausarbeit, veranstalteten Partys mit unseren Kollegen und kauften Demestica und den echten bulgarischen Fetakäse, erstanden Schnäppchen auf der Antiquitätenauktion und strichen sie neu, und wir schnitten uns gegenseitig interessante Zeitungsartikel aus.
Unser Leben im Doppelbett gestaltete sich ein wenig problematisch, und das pflegten wir auf meine in bezug auf Sinnlichkeit eher dürftige Kindheit zu schieben. Örjan mühte sich mit Vorspielen ab, die immer mindestens eine halbe Stunde dauerten, und ich war trocken wie Sandpapier, daß es nur so knirschte.
Natürlich kannte ich Örjan nie so richtig.
Es war keineswegs so, daß er irgendwas geheimgehalten hätte – auf Nachfrage teilte er bereitwillig alles mit, was ich wissen wollte, von politischen Vorlieben bis hin zum Geburtsnamen seiner Mutter. Aber ...
»Die Personen auf dem Foto stehen in keinerlei Zusammenhang mit dem Inhalt des Artikels«, heißt es manchmal in Zeitungen. Diese Formulierung brachte Örjans Persönlichkeit auf den Punkt, auf irgendeine dunkle Art und Weise. Also hörte ich auf zu fragen.
Er fragte auch nicht viel, und wenn er es tat, dann war auf seiner Stirn »ich zeige Interesse« zu lesen. Also hörte ich auf zu antworten. Das schien ihn nicht weiter zu stören.
Die größte Zusammengehörigkeit spürten wir, wenn wir über Freunde und Bekannte diskutierten, die sich nach stürmischen Sitzungen in der Familientherapie scheiden ließen. Wir liebten es, ihre Fehler von allen Seiten zu beleuchten, und es kam vor, daß wir anschließend in unsere Designerbetten stiegen und ich weniger knirschte als sonst.
Aber niemals, kein einziges Mal schlug ein Ei in meinem Inneren Purzelbäume – trotz Örjans Bemühungen um meine erogenen Zonen.
Ich fror mir auf der Friedhofsbank beinahe den Hintern ab und ging wieder. Heute kein Waldbesitzer, haha! Auch die beiden folgenden Male war er nicht am Grab.
Beim dritten Mal begegnete ich ihm auf dem Rückweg an der Friedhofspforte. Er hatte Tannenzweige, einen kleinen Kranz mit weißen Callablüten aus Plastik und ein Grablicht dabei. Richtig, es war ja Allerheiligen! Er nickte mir streng zu wie ein alter Volksschullehrer, als wollte er sagen: Na? Ist Ihr Grablicht schon am rechten Platz, junge Dame?
Ich dachte an Märta und ihre Große Leidenschaft. Hatte es so begonnen? Damit, daß man hinging, wo man eigentlich gar nicht hinwollte, daß Füße und Eierstöcke ein Eigenleben zu führen begannen?
Ein Kranz aus Plastikblumen! Örjan hätte seinen Spaß gehabt – denn lachen, das konnte Örjan wirklich.
In der folgenden Woche ging ich nicht zum Friedhof. Meine Füße und Eierstöcke mußten erzogen werden, alles andere war lächerlich.
Olof, Bibliotheksleiter und frisch geschieden, fragte mich, ob ich Lust hätte, mit ihm nach der Arbeit einen Happen essen zu gehen. Wir gingen in einen Pub, der vor kurzem eröffnet hatte und mit viel Sorgfalt in einem Stil eingerichtet war, den es seit den dreißiger Jahren in keinem echten britischen Pub gegeben hatte. Olof hat jungenhafte, grau melierte Ponysträhnen, die ihm in die Stirn fallen, wenn er sich ereifert, und lange, weiße Hände, mit denen er sehr elegant gestikuliert. Ich glaube, damit hat er angefangen, als er in seiner Jugend an der Sorbonne studierte.
Wir aßen Lammspieß, ich trank Wein und Olof trübes belgisches Bier, über das er sich lange ausließ, während sein Haar ihm ins Gesicht fiel. Dann diskutierten wir Lacan und Kristeva und gregorianische Chormusik, und dann gingen wir zu mir nach Hause und liebten uns. Es war ganz in Ordnung, ich war ja so lange ohne Mann gewesen.
Aber auch jetzt zuckte es nicht in den Eierstöcken.
Als wir aufgestanden waren, geduscht und die Pernodflasche geleert hatten, zeigte er mir Fotos von seinen beiden Kindern und erzählte detailliert von der kieferorthopädischen Behandlung seiner Tochter. Dann weinte er. Ich glaube, wir waren beide erleichtert, als er ging.
Danach dachte ich mehrere Tage lang nicht mehr an den Waldbesitzer. So macht man es vermutlich, wenn man seine Eierstöcke erziehen will. Man nehme sich dann und wann zur Schlafenszeit einen Liebhaber, um das System in Gang zu halten. Das Interesse am Waldbesitzer war nur das Symptom einer Mangelerscheinung gewesen, ungefähr so wie brüchige Nägel ein Anzeichen für Vitamin-B-Mangel sind. Ein paar Hefetabletten, und schon ist alles wieder in bester Ordnung.
Kapitel 8
Ich bin der Trottel, der Reichstrottel von Schweden. Ich werde im Freilichtmuseum Skansen enden, ausgestopft. Das spüre ich jedesmal, wenn ich in die Stadt fahre, und auch sonst ziemlich oft, wenn ich fernsehe zum Beispiel. Ich gehöre eben nicht so recht ins dritte Jahrtausend. Das gilt nicht nur für meine Ansichten, sondern auch für mein äußeres Erscheinungsbild.
Ich bin vom Land und trage eine etwas übereilt getroffene Auswahl von Kleidung aus dem Bestellkatalog der Firma Halén. Mit sechsunddreißig Jahren ist man in unserem Dorf der ewige Junggeselle. Inzwischen werfen mir Frauen nur noch selten Blicke zu. Es ist bergab gegangen, seit ich der beste Speerwerfer der Schule war ... vor zwanzig Jahren! Herrgott, wo sind die Jahre nur geblieben, ein Viertel meines Lebens ist vorbeigegangen, ohne daß ich es geschafft hätte, die Nase aus dem Stallbuch zu heben.
Aber nicht nur die Kleider machen mich zum Trottel, es gibt in diesem Land genug Leute, die aussehen wie ich, ohne auch nur im entferntesten unzufrieden zu sein. Es liegt wohl eher daran, daß ich immer öfter Dinge tue, die mich als minderbegabt dastehen lassen, gelinde gesagt. Ich habe keine Umgangsformen. Bin wohl zu lange auf dem Hof herumgelaufen und habe niemand zum Reden gehabt außer den Kühen.
Wie vorgestern zum Beispiel. Es war Allerheiligen. Seit Vater tot ist, sind Mutter und ich jedes Jahr zu Allerheiligen auf den Friedhof gegangen und haben ein Grablicht angezündet. Mutter kaufte immer einen Kranz aus Tannenzapfen oder weißen Plastikblumen, die lange halten sollten, denn wir hatten ja nicht Zeit, so oft zum Friedhof zu fahren. Jetzt lag sie selber unter der Erde und sollte auch so einen Kranz bekommen.
An der Friedhofspforte traf ich die Beige. Mir kam es plötzlich so vor, als befürchte sie, daß der Tangokavalier wieder sein Wahnsinnslächeln abfeuern werde, und ich legte daher die Stirn in tiefe Falten, nickte und schritt vorüber.
Und dann.
Es war so, als hätte mir jemand eine gelangt, mitten zwischen die Augen.
Ich war enttäuscht, weil sie ging! Mehrere Wochen lang hatte ich mir gesagt, wie angenehm es doch sei, allein auf der Bank zu sitzen und zu meditieren. Aber jetzt wollte ich sie neben mir haben. Ich wollte wissen, wo sie hinging, wenn sie den Friedhof verließ.
Ich machte kehrt und begann ihr in einiger Entfernung zu folgen. Die Leute zuckten zusammen, als sie mich herumschleichen sahen, mit einem Kranz und einem Grablicht in der Hand, vor allem, weil ich ab und zu hinter einem geparkten Auto in Deckung ging, wenn ich fürchtete, sie könne sich gleich umdrehen.
Das tat sie nicht. Sie durchquerte rasch die halbe Stadt und ging geradewegs in die Bibliothek.
Das hätte ich mir denken können. Sie sah aus wie eine, die ununterbrochen und freiwillig Bücher liest. Dicke, eng bedruckte, ohne Abbildungen.
Unentschlossen blieb ich vor dem Eingang stehen. Sogar der Reichstrottel begriff, daß man nicht mit einem Kranz und einem Grablicht in der Hand in eine Bibliothek platzt. Ich sah vor mir, wie ich den Kranz auf der Hutablage plazierte, das Grablicht auf den Ausleihtresen stellte und mich an der Auskunft erkundigte, ob jemand ein beiges Mädchen gesehen habe.
Vielleicht würde sie bald wieder herauskommen, mit einer bis zum Rand gefüllten Tasche, ihrer Tagesration? Aber wie lange sollte ich warten? Schon jetzt starrten mich die Leute merkwürdig an. Der Reichstrottel konterte mit seinem strahlendsten Tangokavalierlächeln und wedelte höflich mit dem Grablicht. Schaut mal, ich bin ganz harmlos! Bin bloß auf Freigang!
Plötzlich machte ich auf dem Absatz kehrt und begann durch die Stadt zu laufen, zurück zum Friedhof.
Was nicht dazu führte, daß die Leute weniger geglotzt hätten. Wo will der bloß so eilig hin mit seinem Kranz, was ist los, was ist passiert, und wo ist eigentlich die Leiche?
Wie blöd die Menschen doch sein können!
Kapitel 9
Ich träume von einem Duft nach Apfelblüten –
du schwankst unter dem Gewicht schwerer Körbe.
Wer von uns weiß etwas über Äpfel?
»Bei dir ist das ja alles kein Problem«, sagte Lilian vielsagend. Sie ist die Kollegin in der Bibliothek, der ich am liebsten aus dem Weg gehe, wenn sie angekeucht kommt – mit wichtig klappernden Absätzen und den Händen voller unwichtiger Dinge, die sie mit geschäftiger Miene hin und her trägt. Sie ist immer erschöpft, arbeitet wenig effektiv und sieht schon zu, daß niemand sich insgeheim bei seiner Arbeit wohlfühlt.
»Klar«, seufzte sie dann und drehte ihr Kenzo-Tuch zu einem Tau. »Ich meine, du hast ja abends genug Zeit. Du kannst dich voll und ganz deiner Arbeit widmen.«
Sie sagte das mit einem aggressiven Unterton, als würde ich irgendwie mogeln. Erwachsen und ohne Familie, eine Streikbrecherin im Frauenleben.
Blöde Kuh! Insbesondere, weil sie sonst gern den Kopf schief legte und mich bat, ob ich (»wo du doch keine Familie hast«) nicht ihre Abend- und Sonntagsschichten übernehmen könne.
Ich war gerade zur Leiterin der Kinderbuchabteilung befördert worden. Das mag vor allem daran gelegen haben, daß ich im Lauf der letzten Jahre eine Menge Veranstaltungen auf die Beine gestellt hatte: Märchenstunden, Theateraufführungen, Kinderbuchfestivals und eine Ausstellung mit Kinderzeichnungen. Frau Lundmark, die bis dahin für die Kinderbuchabteilung verantwortlich gewesen war, sollte bald pensioniert werden und wollte auf Teilzeit gehen. Sie betrachtete noch immer das Lesebuch der Volksschule als Norm für gute Kinderliteratur, aber hatte wohl schon seit langem das Interesse verloren. Oft sahen wir sie nicht einmal, sie hielt sich unten im Magazin auf. Es war ihr nur recht, wenn ich ihre langweilige alte Abteilung aufpeppte, und sie ließ mir freie Hand, obwohl es eigentlich nicht zu meinem Arbeitsbereich gehörte. Eigentlich tat ich es, weil ich insgeheim so fasziniert von Kindern bin.
Insgeheim! Denn das darf man ja nicht zeigen, wenn man eine kinderlose Witwe von fast fünfunddreißig ist! Hätte ich auch nur ein Kind auf den Schoß genommen, hätte ich beim gesamten weiblichen Teil meines Bekanntenkreises – außer bei Märta – wollüstiges Mitleid erregt, und das gönnte ich ihnen nicht. Und sie hätten sich gesagt, daß sie immerhin nicht kinderlos seien, auch wenn sie zur Familientherapie gingen und/oder geschieden waren und nur halbtags arbeiten konnten und arm wie Kirchenmäuse waren. Sie klagten darüber, daß die Kinder sie nachts wach hielten und sich mit ihren Geschwistern prügelten, daß sie beim Autofahren spucken mußten und sich weigerten, ihre Hausaufgaben zu machen, und sie beschwerten sich über die Preise von Milch und Fußballschuhen und Reitstunden. Dann mußten sie früher gehen, weil Pelle Fieber hatte und Fia zum Zahnarzt mußte. Oder sie waren »Eltern, die in der Stadt unterwegs waren«, wenn sie nicht gerade zu Elternabenden oder Suzukikursen hetzten. »Für dich ist es ja kein Problem, Überstunden zu machen«, sagten sie oft. »Du hast es gut.«
Deshalb machte ich es mir zur Gewohnheit, abends manchmal zurück zur Arbeit zu gehen und heimlich Überstunden zu machen. Denn ich hatte solche Freude an all diesen lustigen Kinderzeichnungen, und ichorganisierte Märchenstunden, nur um den Kindern heimlich zuzusehen, wenn sie lauschten. Mit großen Augen, den Mund halb geöffnet, den Körper zum Märchen gedreht wie eine Blume zur Sonne.
Ich war eine Art Kindervoyeurin.
Peinlich, wir Kinderlosen dürfen kein Interesse an Kindern zeigen, das scheint die »richtigen« Eltern zu provozieren. »Wenn du wüßtest«, seufzen sie. »Manchmal will man sie einfach an die Wand klatschen.«
Vermutlich meinen sie es gut mit mir.
Klar, ich weiß: Die biologische Uhr tickt immer lauter. Märta hat auch keine Kinder, weil ihre Große Leidenschaft sich auf gar keinen Fall noch mehr davon aufhalsen will. Er arbeitet hart daran, sich vor dem Unterhalt für die drei zu drücken, die er schon hat, mit verschiedenen Müttern. Sie hat einmal mit einem schiefen Lächeln gesagt, daß Eltern wirklich keine Kinder haben dürften, denn sie wüßten sie nicht zu schätzen.
Im Gegensatz zu uns. Aber wir mußten schließlich auch nie Erbrochenes von den Autositzen wischen.