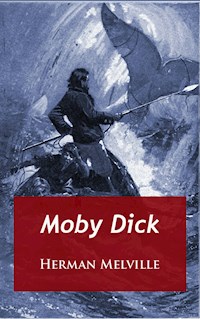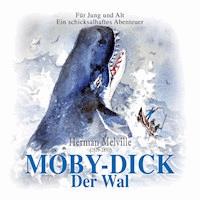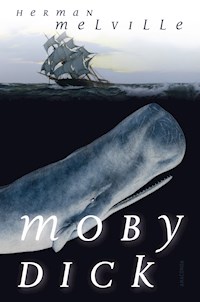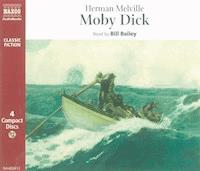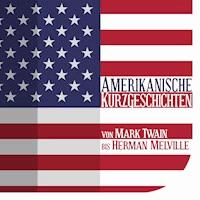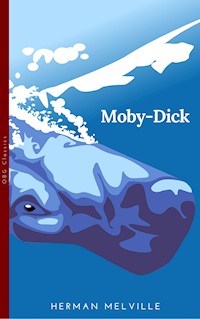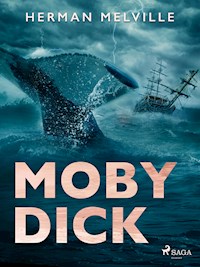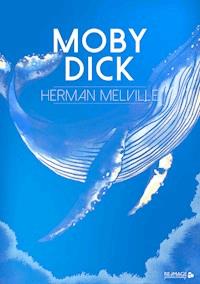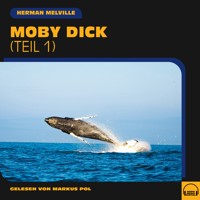Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
»Moby Dick« ist das bedeutendste Prosawerk des amerikanischen Symbolismus. Eine bis ins kleinste Detail recherchierte Abenteuergeschichte und philosophische Reflexion über das Leben, die Rache und einen wahnsinnigen, alles vernichtenden Hass. »Nenne mich Ismael« - einer der berühmtesten Anfänge der Literaturgeschichte. Zu Lebzeiten von Melville stieß »Moby Dick« auf ein geteiltes Echo, noch schien die Welt nicht reif für diese komplexe Erzählstruktur. Heute gehört das Werk unbestreitbar zu den größten Romanen der Literaturgeschichte. Ein Buch, das man gelesen haben muss. Die vorliegende digitale Ausgabe beinhaltet die vollständig neu überarbeitete und erstmalig mit 100 Fußnoten kommentierte deutsche Erstausgabe, welche ursprünglich 1927 von Thomas Mann und H. G. Scheffauer veröffentlicht wurde, nebst einem einführenden Aufsatz zu Leben und Werk des Autors. »Oh, hätte ich das geschrieben.« - Thomas Mann Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herman Melville
Moby Dick
Gekürzte und kommentierte Fassung
Herman Melville
Moby Dick
Gekürzte und kommentierte Fassung
(Moby-Dick or The Whale)Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: J. Schulze, Wilhelm Strüver EV: Berlin, Knaur, 1928 3. Auflage, ISBN 978-3-954183-70-8
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Der Autor und sein Werk
Erster Teil – Kapitän Ahab
Zweiter Teil – Moby Dick
Dritter Teil – Die Jagd
Epilog
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Das Buch
Moby Dick ist das bedeutendste Prosawerk des amerikanischen Symbolismus. Eine bis ins kleinste Detail recherchierte Abenteuergeschichte und philosophische Reflexion über das Leben, die Rache und einen wahnsinnigen, alles vernichtenden Hass.
»Nenne mich Ismael« – einer der berühmtesten Anfänge der Literaturgeschichte.
Zu Lebzeiten von Melville stieß Moby Dick auf ein geteiltes Echo, noch schien die Welt nicht reif für diese komplexe Erzählstruktur. Heute gehört das Werk unbestreitbar zu den größten Romanen der Literaturgeschichte. Ein Buch, das man gelesen haben muss.
Die vorliegende digitale Ausgabe beinhaltet die vollständig neu überarbeitete und erstmalig mit 100 Fußnoten kommentierte deutsche Erstausgabe, welche ursprünglich 1927 von Thomas Mann und H. G. Scheffauer veröffentlicht wurde, nebst einem einführenden Aufsatz zu Leben und Werk des Autors.
»Oh, hätte ich das geschrieben.« – Thomas Mann
Der Autor und sein Werk
Moby Dick gehört zu den Klassikern der internationalen Abenteuerliteratur. Das Werk erschien 1851. Autor ist Herman Melville.
Herman Melville
Der Autor von »Moby Dick«, Herman Melville, wurde am 1. August 1819 in New York geboren. Er wuchs in einer kinderreichen Kaufmannsfamilie mit schottischen und niederländischen Wurzeln auf. Aufgrund des Konkurses seines Vaters musste Melville mit zwölf Jahren die Schule verlassen. Zeit seines Lebens versuchte er die mangelnde Schulbildung mit Selbststudium zu kompensieren. Nach dem Tod des Vaters arbeitete der Junge als Hilfskraft bei einem Onkel und im Pelzgeschäft des Bruders.
1839 fuhr Herman Melville erstmals zur See. Auf einem Postschiff erreichte er Liverpool, arbeitete dort kurzfristig als Lehrer, bevor es ihn wieder aufs Meer zog. Von 1841 bis 1844 unternahm er auf einem Walfänger eine Reise in den Pazifischen Ozean. Aufgrund angeblich unzumutbarer Bedingungen desertierte er mit einigen anderen Matrosen auf den Marquesas-Inseln.1 Auf einem weiteren Walfänger entkam Melville nach Tahiti, fiel jedoch erneut negativ auf und wurde verhaftet. Er konnte wiederum fliehen und gelangte über dem Umweg nach Hawaii nach Boston, wo er 1847 Elisabeth Shaw heiratete und mit ihr zwei Söhne bekam. Er begann Bücher zu schreiben und fand mit »Typee« und »Omoo« erste Anerkennung. Den literarischen Durchbruch erlangte er 1851 mit »Moby Dick«. Zu jener Zeit lebte er auf einer neu gekauften Farm in Massachusetts als Nachbar des Literaten Nathaniel Hawthorne, zu dem sich eine Freundschaft entwickelte. Rasch wurde der schriftstellerische Erfolg jedoch wieder von Misserfolgen eingeholt, sodass Melville ab 1866 bis 1885 als Zollinspektor im Hafen arbeitete. Sein letztes, heute ebenfalls berühmtes Werk »Billy Budd« verfasste der Autor 1891, seinem Todesjahr.
Moby Dick – ein klassischer Abenteuerroman
Der Roman Moby Dick wurde zeitgleich 1851 in London und New York herausgebracht und entwickelte sich zu Herman Melvilles größtem Erfolg. Der Autor widmete das Buch seinem Freund Nathaniel Hawthorne. Inhaltlich dreht sich das Buch, welches in Deutschland auch unter dem Titel »Der weiße Wal« bekannt wurde, um die Geschichte des Walfangs im 19. Jahrhundert. Der erste Satz des Buches »Call me Ismael« wurde weltberühmt. Es ist offensichtlich, dass die Figur des Ismael, dessen vollständiger Name nie erwähnt wird, autobiografisch mit Herman Melville verbunden ist.
Ismael reist nach New Bedford, wo er sich noch an Land mit dem Polynesier Quiqueg anfreundet. Die Reise der beiden geht bald schon weiter nach Nantucket, wo sie auf dem Walfänger »Pequod« anheuern. Der Kapitän des Schiffes offenbart sich ihnen erst, als sie schon längst einige Tage auf hoher See sind. Ahab, so sein Name, hat einst im Kampf mit dem weißen Wal »Moby Dick« sein Bein verloren. Sein einziger Lebensinhalt ist seit diesem Vorfall die Rache an »Moby Dick«. Auch die Crewmitglieder kann er dafür einnehmen – mit einer Golddublone als Belohnung für denjenigen, der den Wal zuerst sichtet. Einziger Gegenspieler von Ahab ist Starbuck, der erste Steuermann, der in einer Nacht sogar erwägt, den Kapitän zu töten.
Melville schildert im weiteren Verlauf des Buches ausführlich die Begebenheiten der Seefahrt – Begegnungen mit Piraten, Unwetter, Walfang. Quiqueg erkrankt während dieser Zeit schwer und lässt sich schon seinen Sarg zimmern, der jedoch nach dessen Gesundung ungenutzt bleibt.
Alles strebt im Buch dem Höhepunkt, der Begegnung mit »Moby Dick«, entgegen. Der Wal wird vor Japan gesichtet und daraufhin drei Tage lang von Kapitän und Matrosen gejagt. Am dritten Tag zerstört der Wal die »Pequod«. Ahab hält aber trotz des sinkenden Schiffes an seinem Wahn fest und wird letztendlich von seinem eigenen Harpunenseil in die Tiefe gerissen. Am Ende ist der Wal der Sieger dieses ungleichen Kampfes. Ismael ist der einzige Überlebende der Katastrophe: Er klammert sich an den Sarg, der einst für Quiqueg bestimmt war.
Man möchte denken, dass die Jagd nach dem weißen Wal das Thema des Buches ist. Doch »Moby Dick« gilt darüber hinaus nicht umsonst als eines der prägendsten Werke sowohl der Abenteuerliteratur, als auch des Symbolismus. Es sind die philosophischen Reflexionen über das Thema »Suche« bei den beiden Hauptpersonen Ismael und Ahab, welche das Buch zu etwas Besonderem machen.
In seinem Buch hat Herman Melville viele reale Erlebnisse verarbeitet. Offenkundig ist dabei natürlich seine Zeit auf Walfänger-Schiffen zwischen 1841 und 1843. Außerdem verarbeitete er den Untergang des Walfangschiffes Essex im Pazifischen Ozean, nachdem dieses von einem Pottwal gerammt worden war. Melville lernte den Sohn eines Überlebenden kennen und erhielt von diesem die Schilderung der Erlebnisse seines Vaters.
Zudem gab es tatsächlich zur damaligen Zeit Schilderungen eines Journalisten im »New York Knickerbocker Magazine«, welche einen weißen Wal im Pazifik beschrieben, der für seine besondere Wildheit bekannt war. Weiteren Einfluss auf den Roman hatte auch die »United States Exploring Expedition« in den Pazifik, dank der Melville eine lebendige Schilderung des Polynesiers Quiqueg gelang.
Rezeption in der modernen Kultur
In der modernen Kultur spielt »Moby Dick« sowohl in den Vereinigten Staaten als auch Großbritannien, Deutschland und weiteren europäischen Ländern eine wichtige Rolle in der Schulliteratur. Nach seinem Erscheinen waren die Kritiken zunächst bestenfalls gemischt, tendierten jedoch zu einer negativen Rezeption des Buches. 100 Jahre nach Melvilles Geburt wurde der Roman jedoch zum Klassiker. William Faulkner, einer der bekanntesten amerikanischen Autoren des 20. Jahrhunderts, erklärte in den 20er Jahren, dass »Moby Dick« das Buch wäre, welches er am liebsten selbst geschrieben hätte.
Die Filmwelt widmete der Geschichte mehrere Hollywood-Adaptionen. Die erste Verfilmung entstand 1926 unter dem Titel »The Sea Beast« mit dem Hauptdarsteller John Barrymore, der diese Rolle 1930 in »Moby Dick« nochmals verkörperte. Berühmt wurde vor allem die Verfilmung aus dem Jahr 1956 unter der Regie von John Huston, in der Gregory Peck die Hauptfigur Kapitän Ahab verkörperte. Der Film gewann zahlreiche Preise. 1998 gab es eine weitere Bearbeitung als Fernsehfilm mit Patrick Stewart, welche mit einem Golden Globe Award ausgezeichnet wurde. Mittlerweile existieren sogar Zeichentrick-Adaptionen von »Moby Dick«, welche selbstverständlich sehr kindgerecht aufbereitet wurden und mit der eigentlichen Geschichte von Herman Melville kaum noch etwas gemeinsam haben.
Die Marquesas-Inseln (franz.: Archipel des Marquises) gehören geografisch und politisch zu Französisch-Polynesien. Sie liegen 1.600 Kilometer nordöstlich von Tahiti, südlich des Äquators im Pazifischen Ozean. <<<
Erster Teil – Kapitän Ahab
Nenne mich Ismael. Hör zu, was ich dir zu erzählen habe. – Es gibt Jahre ohne Gesicht, man hat wenig oder gar kein Geld in der Tasche, weiß nichts Besonderes anzufangen an Land, da packt einen das Verlangen, auf See zu fahren und den wässerigen Teil der Welt zu sehen. Das ist so meine Art und Weise, den Miesmacher aus meinem Herzen zu verjagen und das Blut in Bewegung zu setzen. Wenn ich Bitterkeitsfalten spüre um den Mund, wenn meine Seele wie ein nasskalter und nieselnder November ist, wenn ich mich dabei ertappe, dass ich vor jedem Sargmagazin stehenbleibe und wie von selbst jedem Leichenzug folge, dann… und hauptsächlich, wenn mein Miesmacher dermaßen Oberhand gewinnt, dass ich an mich halten muss, um nicht auf die Straße hinunterzusteigen und den Leuten die Hüte vom Kopf zu schlagen…, dann begreife ich, dass es höchste Zeit für mich ist, auf See zu gehen. Das ersetzt mir den Gebrauch von Pistole und Kugel. Mit einer großen Gebärde stürzte sich der Philosoph Cato in sein Schwert, ich – getrost, nehme das Schiff. Nichts überrascht hierbei. Jeder Mensch, in etwelchen Stadien seines Lebens, hat den gleichen Durst nach Ozean verspürt. Schau dir mal eure Stadt an auf den Manhattoes. Sie ist umgeben von Werften wie eine indische Insel von Korallenriffen. Der Handel umschäumt sie, und rechts und links führen dich die Straßen zum Wasser. Der äußerste Punkt der unteren Stadt heißt »Batterie«, ihr hochmütiges Bollwerk wird von den Wellen gewaschen und gekühlt von Winden, die vor einigen Stunden noch nicht wussten, was unser Land ist. Schau dir die vielen Leute an, die eine verlangende Sehnsucht ans Wasser treibt.
Das soll nun allerdings nicht heißen, dass ich meine Seereisen als Passagier mache, denn dazu braucht man einen Geldbeutel, und wenn er leer ist, dann ist er nicht mehr als ein wertloser Lappen. Außerdem werden Passagiere seekrank, werden streitsüchtig, können des Nachts nicht schlafen und haben im Ganzen keine Freude an der Reise. Nein, ich bin nie als Passagier gefahren, auch nicht als Kommodore,1 Kapitän oder Koch, obwohl ich doch ein alter, erfahrener Seemann bin. Diese ehrenvollen Stellungen überlasse ich gern denen, die sich danach drängen. Ich habe genug mit mir selber zu tun und kann mich nicht auch noch um Schiffe, Barken, Briggs, Schoner2 und dergleichen kümmern. Und als Koch zu fahren? Nun, ich gebe zu, das ist ein angesehener Posten, denn der Koch ist eine Art Offizier an Bord. Aber es hat mir nie Freude gemacht, Geflügel zu braten, obwohl gerade ich ein gut gewürztes und in zarter Butter gebratenes Huhn besonders zu schätzen weiß. Nein, wenn ich zur See gehe, dann fahre ich vor dem Mast3 als gewöhnlicher Matrose. Gewiss, sie hetzen mich umher, und ich muss springen wie ein Grashüpfer im Mai. Und zuerst ist das ein höchst unangenehmer Job. Es geht einem sogar gegen die Ehre, vor allem, wenn man aus einer alteingesessenen Familie stammt. Besonders schlimm ist es aber, wenn man kurz vorher noch als Dorfschulmeister Herr über eine Klasse war und nun mit dem blütenweißen Hemd in einen Teertopf langen muss. Der Übergang ist schwer, aber auch das gibt sich mit der Zeit. Was macht es denn schon, wenn mich ein filziger alter Kapitän nach dem Besen schickt und das Deck fegen lässt? Wer wäre denn, so betrachtet, kein Sklave? Das möchte ich wissen! Sollen mich also die Kapitäne herumkommandieren und herumschinden. Jeder kriegt auf seine Weise seinen Teil ab.
Ich gehe auch deshalb zur See, weil man mir für meine Mühen auch noch etwas zahlt, während man noch nie gehört hat, dass ein Passagier Geld bekommen hätte. Im Gegenteil: Er wird zur Kasse gebeten. Zahlen und Bezahltwerden, das ist ein gewaltiger Unterschied.
Und schließlich ist da noch ein letzter Grund, warum ich als Matrose zur See gehe; es ist nämlich gesund, sich in der frischen, reinen Seeluft auf dem Vordeck kräftig zu bewegen, während der Kapitän auf dem Achterdeck die Luft nur aus zweiter Hand erhält.
Warum ich aber diesmal auf die Idee kam, ausgerechnet auf einem Walfänger anzuheuern, das kann ich nicht genau sagen. Von allen Beweggründen war sicher die überwältigende Vorstellung vom großen Wal der stärkste. Das riesenhafte, geheimnisvolle Ungetüm reizte meine Fantasie; dazu die fernen, wilden Meere, durch die er seinen Riesenleib wälzt wie eine Insel, und die unnennbaren Gefahren und die tausend Wunder der Südsee, das alles lockte mich unwiderstehlich, denn ich fahre für mein Leben gern in verbotenen Gewässern und gehe an den Küsten der Barbaren an Land. Gewiss, ich verachte nicht das Gute und Schöne, aber das Grauenhafte zieht mich unsagbar an.
Aus diesen Gründen war mir die Fahrt auf einem Walfänger gerade recht. Die Tore zu einer Wunderwelt taten sich auf.
Ich stopfte meine paar Hemden in einen alten Seesack, nahm ihn unter den Arm und brach auf nach Kap Hoorn und dem Pazifik. Dem guten alten Manhattan sagte ich Lebewohl und kam glücklich in New Bedford an. Es war an einem Samstagabend im Dezember. Meine Enttäuschung war groß, als ich erfuhr, dass das kleine Postschiff nach Nantucket schon abgefahren sei. So musste ich bis zum Montag warten.
Da die meisten jungen Anwärter für eine Fahrt mit dem Walfangschiff ihre Reise bereits in New Bedford antreten, muss ich ausdrücklich erwähnen, dass ich ganz andere Pläne hatte. Ich wollte durchaus mit einem Schiff aus Nantucket fahren, denn alles, was mit dieser alten, berühmten Insel zusammenhing, hatte etwas Abenteuerliches an sich, was mich ungemein anzog. Wohl hatte in letzter Zeit New Bedford den größten Teil des Walgeschäfts an sich gerissen, und das arme, alte Nantucket war bedenklich ins Hintertreffen geraten. Aber Nantucket ist das große Vorbild, denn schließlich wurde hier der erste von Amerikanern erlegte Wal an Land gebracht, und von hier aus fuhren die Ur-Walfänger, die Rothäute, mit Kanus hinaus.
Da ich nun in New Bedford eine Nacht, einen Tag und noch eine Nacht vor mir hatte, ehe ich mich nach meinem Bestimmungshafen einschiffen konnte, musste ich mich zunächst einmal nach einem Quartier umsehen. Der Ort sah am Abend wenig vertrauenerweckend aus, und obendrein war es bitter kalt. Ich kannte keine Menschenseele. Sorgenvoll kramte ich in meiner Hosentasche herum und zog schließlich ein paar Silberstücke hervor. »Aufgepasst, Ismael«, sagte ich zu mir, während ich auf der Straße stand und meinen Seesack schulterte, »wo du zu übernachten beschließt, mein lieber Ismael, vergiss nicht, nach dem Preis zu fragen, und sei nicht wählerisch.«
Zögernd tappte ich die düsteren Straßen entlang und kam am Wirtshaus »Zu den gekreuzten Harpunen« vorüber; aber das sah zu teuer für mich aus. Außerdem ging es dort laut und ausgelassen zu. Weiter unten leuchteten die Fenster der »Schwertfisch-Kneipe« so strahlend in die Nacht hinaus, dass es mir schien, als hätten sie Schnee und Eis vor dem Haus weggetaut, denn sonst lag der Schnee überall zehn Zoll hoch und war hart wie Straßenpflaster. Allmählich wurde ich milde. Einen Augenblick blieb ich stehen, sah das grelle Licht, das auf die Straße fiel, und hörte das Gläserklingen von drinnen. »Nein, auch da geht’s zu lustig zu, Ismael«, sagte ich zu mir, »mach, dass du weiterkommst.«
Ohne lange zu überlegen, folgte ich der Straße, die hinunter zum Wasser führte, dorthin, wo die billigsten, vielleicht aber auch die nettesten Kneipen liegen.
Trostlose Straßen! Zu beiden Seiten keine Häuser, vielmehr Quader aus rabenschwarzer Finsternis, hin und wieder der trübe Schein einer Kerze wie aus einem Grab. Zu dieser Stunde, am letzten Tag der Woche, war das Viertel wie ausgestorben. Doch bald drang aus einem niedrigen, weitläufigen Gebäude verschwommen ein Schimmer. Die Tür stand einladend offen und gewährte einen Blick in den verwahrlosten Vorraum. Ich hörte eine laute Stimme von drinnen, fasste mir ein Herz und öffnete eine zweite Tür.
Hundert dunkle Gesichter wandten sich nach mir um, als ich eintrat. Über ihnen auf einer Kanzel stand ein schwarzer Engel und schlug heftig auf ein Buch. Es war die Kirche einer Negergemeinde. Der Text des Predigers handelte von Nacht und Finsternis, von Heulen und Klagen und Zähneklappern. »O Ismael«, murmelte ich und ging rückwärts wieder hinaus, »wohin bist du geraten!«
Ich ging weiter, bis ich schließlich in der Nähe der Docks einen schwachen Lichtschimmer erspähte und über mir ein klägliches Kreischen vernahm. Als ich aufblickte, sah ich ein Blechschild hin und her schwingen. Darauf stand, undeutlich zu lesen, »Gasthaus zum Walfisch – Peter Coffin«.
»Coffin, das heißt Sarg; und dazu Walfisch – das ist kein gutes Vorzeichen in dieser Zusammenstellung«, sagte ich mir, »aber der Name soll häufig vorkommen in Nantucket.« Das Licht schien trübe, die Gegend war still, und das verfallene Blockhaus sah aus, als hätte man es aus einer Feuersbrunst hierher gerettet. Aus all dem schloss ich, dass ich hier vor der richtigen Tür war und mit einem billigen Quartier und einem erbärmlichen Kaffee rechnen konnte. Etwas verdächtig sah das alte Haus schon aus, wie es so windschief an der Ecke stand, als hätte es die Gicht.
Aber ich hatte keine andere Wahl.
Betrat man das Gasthaus »Zum Walfisch«, dann kam man in einen weiten, niedrigen Vorraum mit einer altmodischen Holztäfelung, die an das Schanzkleid eines alten, abgewrackten Schiffes erinnerte. Auf der einen Seite hing ein riesiges Ölgemälde, das so verräuchert und entstellt war, dass man, bei dem ungewissen Licht, nur nach eingehender Betrachtung und Befragung der Nachbarn überhaupt etwas erkennen konnte. Unerklärliche Massen von Schatten und Schattierungen türmten sich aufeinander, sodass man zunächst glaubte, ein ehrgeiziger junger Künstler habe sich bemüht, einen Hexentanz aus Neuenglands frühen Tagen darzustellen.
Besonders rätselhaft und wirr war eine langgestreckte, unheildrohende, schwarze Masse in der Mitte des Bildes, die über drei senkrechten Linien aus blässlichem Blau schwebte. In der Tat glich das ganze Gemälde einer schwabbligen, quabbligen Masse, die einen empfindsamen Menschen wohl beunruhigen konnte. Und doch ging von dem Bild eine eigenartige Wirkung aus. Was mochte es darstellen? Einen Sturm zur Mitternacht über dem schwarzen Meer? Den Kampf der vier Elemente? Eine verdorrte Heidelandschaft? Eine nordische Winterlandschaft? Doch alle Deutungsversuche scheiterten zuletzt an dem unheilvollen schwarzen Etwas in der Mitte. Wenn das Rätsel gelöst war, dann war alles übrige klar. Erinnerte es nicht von ferne an einen riesenhaften Fisch? Sollte es etwa der große Leviathan selbst sein?
Die Absicht des Künstlers war es wohl gewesen, einen Kap-Hoorn-Fahrer im Orkan darzustellen. Von dem sinkenden Schiff waren nur noch die drei abgetakelten4 Masten zu sehen. Ein wütender Wal, der mit einem gewaltigen Satz über das Schiff hinwegspringen wollte, spießte sich dabei auf den Mastspitzen auf.
Die gegenüberliegende Wand des Vorraums war über und über mit furchterregenden Keulen und Speeren behangen. Manche waren dicht mit blinkenden Zähnen bedeckt und erinnerten an elfenbeinerne Sägen, andere waren mit Strähnen aus Menschenhaar geschmückt. Auch eine sichelförmige Waffe war darunter, mit der man wohl unter den Feinden wüten konnte wie ein Schnitter in frischem Gras. Mich schauderte allein vom Hinsehen. Dazwischen hingen rostige, alte Wal-Lanzen und Harpunen, alle zerbrochen und geknickt. Mit dieser Lanze da, die jetzt völlig verbogen war, tötete vor fünfzig Jahren Nathan Swain fünfzehn Wale an einem einzigen Tag. Und diese Harpune dort, die jetzt aussah wie ein Korkenzieher, wurde einst ins Meer bei Java geschleudert, von dem getroffenen Wal davongetragen und erst nach Jahren wiedergefunden, als der Wal bei Kap Blanco erlegt wurde. Die Waffe war damals am Schwanz eingedrungen und dann wie eine Nadel im menschlichen Körper weitergewandert, bis man sie schließlich, im Höcker eingebettet, wiederfand.
Durch einen düsteren, gewölbten Flur, wohl durch den ehemaligen Hauptkamin gebrochen, gelangte man in die Gaststube, wo es noch dunkler war. Die mächtigen Deckenbalken waren so niedrig und die Bodenplanken so abgetreten, dass man sich fast ins Raumdeck eines alten Kahns versetzt fühlte, besonders an einem Abend, wo der Sturm heulte und die schlecht vertäute alte Arche in allen Fugen ächzte. Auf der einen Seite stand ein langer, niedriger Tisch mit einigen zersprungenen Glaskästen darauf, gefüllt mit allerlei verstaubten Raritäten aus den entlegensten Winkeln der Welt. Ganz hinten ragte ein schwärzliches Gebilde in den Raum, die Theke – eine rohe, ungeschickte Nachbildung eines Walfischkopfes. Darüber wölbte sich ein Walkiefer so riesengroß, dass beinahe eine Kutsche hätte hindurchfahren können. Darunter standen ein paar schäbige Regale mit alten Flaschen und Karaffen. Und mitten in dem mörderischen Rachen stand wie ein zweiter von Gott verfluchter Jona – so wurde er übrigens auch gerufen – ein dürres, altes Männchen, das den Matrosen für gutes Geld die abscheulichsten Getränke verkaufte.
Als ich eintrat, saßen da ein paar junge Matrosen um einen Tisch und prüften beim trüben Licht einer Kerze allerlei Schnitzereien aus Muscheln und Walfischbein. Ich trat auf den Wirt zu und fragte ihn nach einem Nachtquartier, erhielt aber zur Antwort, das Haus sei voll, kein Bett sei mehr frei. »Doch halt«, fügte er hinzu und griff sich an die Stirn, »haben Sie etwas dagegen, mit einem Harpunier das Bett zu teilen? Sie wollen doch vermutlich auch auf Walfang ausfahren. Da können Sie sich beizeiten daran gewöhnen.«
Ich erwiderte ihm, ich hätte noch nie gerne zu zweit unter einer Decke geschlafen; wenn es aber sein müsse, so hänge es ganz davon ab, was der Harpunier für ein Kerl sei. Wenn es aber wirklich keinen anderen Platz gebe und gegen den Harpunier nichts einzuwenden sei, dann sei es besser, mit einem anständigen Burschen die Bettdecke zu teilen, als bei der bitteren Kälte noch länger durch eine fremde Stadt zu strolchen.
»Das habe ich mir gedacht. Geht also in Ordnung. Setzen Sie sich. Wollen Sie noch essen? Wird gleich fertig sein.«
Ich ließ mich auf einer alten Holzbank nieder, in die Generationen von Seeleuten ihre Zeichen geschnitzt hatten. An der anderen Ecke saß, ganz in sich gekehrt, ein Seebär und bearbeitete ein Stück Holz.
Endlich wurden wir, vier oder fünf Mann, zum Essen in den Nebenraum geholt. Dort herrschte eisige Kälte, kein Feuer im Kamin, denn der Wirt behauptete, er könne es sich nicht leisten. Eilig knöpften wir unsere Jacken zu und griffen mit klammen Fingern nach dem kochendheißen Tee. Das Essen war jedenfalls sehr kräftig, denn es gab nicht nur Fleisch und Kartoffeln, sondern sogar Klöße – Donnerwetter, auch noch Klöße! Ein junger Bursche im grünen Mantel widmete sich denn auch den Klößen mit einem geradezu entsetzlichen Appetit.
»Mein lieber Freund«, sagte der Wirt, »nach dieser Portion wirst du heute Nacht Alpträume haben.«
»Herr Wirt«, flüsterte ich ihm zu, »das ist doch nicht etwa der Harpunier?«
»Nein, nein«, erwiderte er, und man merkte, dass es ihm einen ganz teuflischen Spaß machte, »der Harpunier ist ein dunkler Bursche, der isst niemals Klöße. Der frisst nur Steaks, je roher, desto lieber.«
»Zum Teufel, wo steckt er denn eigentlich? Ist er hier?«, fragte ich.
»Nur Geduld, der kommt schon noch«, war die Antwort.
Dieser dunkle Bursche wurde mir allmählich unheimlich. Auf jeden Fall, so beschloss ich bei mir, sollte er sich als erster ausziehen und ins Bett kriechen, wenn wir schon zusammen schlafen sollten.
Nach dem Essen gingen die anderen Gäste wieder in den Schankraum, und da ich nichts weiter vorhatte, entschied ich mich, den Abend als Zuschauer zu verbringen.
Da plötzlich gab es Lärm auf der Straße. Der Wirt sprang auf und rief: »Das sind die Leute von der ›Grampus‹, drei Jahre unterwegs und voll bis oben hin. Holla, Jungs, jetzt erfahrt ihr das Neueste von den Fidschi-Inseln!«
Seestiefel trampelten durch den Vorraum, die Tür wurde aufgerissen, und herein torkelte eine wilde Rotte von Matrosen. Eingehüllt in ihre rauen Wachmäntel, zerlumpt und zusammengeflickt, mit steifgefrorenen Bärten, aus denen die Eiszapfen hingen, schienen sie geradewegs aus Labrador zu kommen. Sie waren eben an Land gegangen, und dies war das erste Haus, das sie betraten. Kein Wunder, dass sie sogleich auf den Walfischrachen zusteuerten, wo ihnen der dürre, kleine Jona die Gläser bis zum Rand vollschenkte. Einer beklagte sich über seinen fürchterlichen Schnupfen, worauf ihm der Alte ein pechzähes Getränk zusammenbraute und heilige Eide schwor, das sei die beste Arznei für alle Arten von Erkältungen und Katarrh, die man sich in Labrador oder auf der Wetterseite eines Eisbergs holen könne.
Der Schnaps stieg ihnen bald zu Kopf, und sie begannen, wie nicht anders zu erwarten war, Krach zu schlagen.
Ich hatte indessen bemerkt, dass sich einer von ihnen etwas abgesondert hatte, andererseits aber offenbar bestrebt war, den anderen durch seine Nüchternheit die Stimmung nicht zu verderben. Er erweckte mein Interesse, weil er sich so still verhielt. Als das Gelage seiner Gefährten auf dem Höhepunkt angelangt war, verschwand er unbemerkt, und ich sah ihn erst wieder, als er mein Kamerad auf See wurde. Wenig später vermissten ihn seine Gesellen. Sie erhoben eine großes Geschrei: »Bulkington! Bulkington!« und stürmten hinaus auf die Straße.
Es war jetzt etwa neun Uhr, der Raum schien beinahe unnatürlich still nach dieser Sauferei. Glücklicherweise hatte ich mir, ehe die Matrosen hereingepoltert waren, einen Plan zurechtgelegt.
Niemand schläft gerne mit einem anderen in einem Bett, und wenn es sein eigener Bruder wäre. Im Schlaf ist man eben am liebsten allein. Wenn man nun gar mit einem Fremden in einer fremden Wirtschaft in einer fremden Stadt zusammen schlafen soll und der Fremde obendrein ein Harpunier ist, dann stimmt das noch weit bedenklicher. Und auch für einen Seemann gibt es keinen einleuchtenden Grund, mit einem anderen sein Bett zu teilen, denn schließlich hat auch ein Seemann seine eigene Hängematte und seine eigene Decke.
Je mehr ich nun über diesen Harpunier nachdachte, desto unangenehmer war mir der Gedanke, mit ihm zusammen schlafen zu müssen. Im übrigen wurde es allmählich auch spät, und ein anständiger Harpunier hätte schon längst zu Hause und im Bett sein müssen. Wenn er nun gar erst gegen Mitternacht hereintorkeln sollte! Und wer konnte denn schon wissen, aus welcher gemeinen Kneipe er kommen mochte?
»Hallo, Wirt! Ich habe mir’s anders überlegt. Mit dem Harpunier schlafe ich nicht. Ich will mir’s hier auf der Bank bequem machen.«
»Wie Sie wollen. Schade, dass ich kein Tischtuch übrig habe. Sie könnten sonst darauf schlafen, denn das Brett hier ist verdammt rau. Einen Augenblick, ich habe da einen Hobel hinter der Theke. Sie sollen’s ganz bequem haben.« Mit diesen Worten holte er den Hobel, staubte erst einmal mit einem alten Seidentuch die Bank ab und begann aus Leibeskräften, mein Bett glattzuhobeln. Dabei grinste er wie ein Affe. Die Späne flogen nach allen Seiten, bis plötzlich das Eisen gegen einen Knorren stieß, der nicht nachgab. Ich sagte ihm, er solle jetzt um Gottes willen aufhören, das Bett sei mir schon weich genug, und aus Fichtenbrettern würden eben mal keine Eiderdaunen. Er grinste wieder, kehrte die Späne zusammen und warf sie in den großen Ofen mitten in der Gaststube. Dann machte er sich wieder hinter der Theke zu schaffen und ließ mich mit meinen düsteren Gedanken allein.
Nun maß ich die Bank aus und fand, dass sie einen Fuß zu kurz war. Doch konnte man immerhin einen Stuhl anstellen. Aber sie war auch um einen Fuß zu schmal, und die zweite Bank in der Stube war um vier Zoll höher als die abgehobelte, sodass sie nicht zueinander passen wollten. Schließlich rückte ich die erste Bank an die Wand und ließ einen kleinen Zwischenraum, um meinem Rücken Platz zu schaffen. Aber bald merkte ich, dass vom Fenster her ein eiskalter Luftzug kam; und da es auch von der Tür her zog, entstand fortwährend ein kleiner Wirbelwind gerade an der Stelle, wo ich mein Lager aufgeschlagen hatte.
Der Teufel soll den Harpunier holen, dachte ich bei mir. Doch halt! Könnte ich ihm nicht zuvorkommen, die Tür von innen verriegeln und ins Bett steigen? Mag er dann klopfen, ich wach’ nicht auf. Kein übler Plan. Aber wer konnte mir garantieren, dass mir nicht morgen der Harpunier den Schädel einschlägt, wenn ich aus der Tür trete?
Wieder sah ich mich um, fand aber keine Gelegenheit, die Nacht angenehmer zu verbringen, es sei denn, zusammen mit einem anderen. Vielleicht waren es doch nur grundlose Vorurteile gegen den Harpunier? Warten wir noch ein Weilchen, dachte ich mir, er muss ja bald kommen. Dann schaue ich mir den Burschen einmal genau an. Vielleicht werden wir noch ganz gute Bettgenossen.
Nach und nach kamen die anderen Schlafgäste herein, allein, zu zweit, zu dritt – aber von meinem Harpunier keine Spur.
»Herr Wirt«, sagte ich, »was ist denn das für ein Kerl? Bleibt der immer so lange aus?« Es war fast Mitternacht.
Der Wirt ließ wieder sein dünnes Gemecker vernehmen. Irgend etwas schien ihm mächtig Spaß zu machen, nur wusste ich nicht, was. »Nein«, sagte er, »im Allgemeinen ist er früh dran, zeitig im Bett, zeitig wieder ’raus. Morgenstund hat Gold im Mund. Aber heute will er was verkaufen. Weiß der Teufel, wo er sich so lange herumtreibt. Vielleicht wird er seinen Kopf nicht los.«
»Seinen Kopf nicht los? Erzählen Sie keine Märchen!« Ich wurde wütend. »Wollen Sie tatsächlich behaupten, dass dieser Harpunier heute am heiligen Samstagabend oder vielmehr Sonntagmorgen unterwegs ist, um seinen Kopf feilzubieten?«
»Genau so ist es«, erwiderte der Wirt, »und dabei habe ich ihm doch gesagt, dass er ihn hier nicht loskriegt. Es gibt zu viel von diesem Zeug.«
»Was für Zeug?«, schrie ich ihn an.
»Na, Köpfe. Gibt’s nicht sowieso zu viele Köpfe auf der Welt?«
»Ich will Ihnen was sagen, Herr Wirt«, sagte ich ganz ruhig, »hören Sie auf mit dem Unsinn. Ich bin kein grüner Junge mehr.«
»Grün vielleicht nicht«, er nahm ein Stückchen Holz und schnitzte sich einen Zahnstocher zurecht, »aber vielleicht werden Sie braun und blau geschlagen, wenn der Harpunier erfährt, dass Ihnen sein Kopf nicht passt.«
»Einschlagen werde ich ihm seinen Schädel«, gab ich zurück, denn allmählich machte mich das unsinnige Gerede wütend.
»Der ist schon eingeschlagen«, sagte er.
»Eingeschlagen? Wirklich eingeschlagen«, fragte ich, »was soll das heißen?«
»Eingeschlagen. Und gerade deswegen kriegt er ihn wohl nicht los.«
»Herr Wirt«, ich trat auf ihn zu, »jetzt aber Schluss mit dem Geschnitze da. Wir müssen klarkommen, und zwar sofort. Ich komme hier herein und will ein Bett. Sie können mir nur ein halbes anbieten, weil die andere Hälfte einem gewissen Harpunier gehört. Und von diesem Harpunier, den ich noch nicht gesehen habe, erzählen Sie mir die merkwürdigsten und haarsträubendsten Geschichten, bis es mir vor dem Menschen graut, mit dem ich zusammen schlafen soll. Offen und ehrlich: Was ist mit diesem Harpunier los? Bin ich denn meines Lebens sicher? Und dann erklären Sie mir gefälligst die Geschichte mit dem verhökerten Schädel. Denn wenn die Geschichte stimmt, dann ist der Harpunier verrückt, und ich denke nicht daran, mit einem Irrsinnigen das Zimmer zu teilen. Und Sie, Herr Wirt, ja, Sie, wenn Sie mich wissentlich in eine solche Lage bringen, dann gehören Sie vor Gericht gestellt.«
»Schon recht, schon recht«, sagte der Wirt und holte tief Luft, »das war eine lange Predigt für einen armen Teufel, der hin und wieder auch gern einmal das Maul zu weit aufmacht. Immer mit der Ruhe. Der Harpunier, von dem ich erzählte, kommt eben von der Südsee. Und von dort hat er einen ganzen Sack voll einbalsamierter Neuseeländerköpfe mitgebracht, lauter Kuriositäten. Und die hat er alle bis auf einen verkauft, und den will er heute Abend verhökern, weil doch morgen Sonntag ist. Und wenn die Leute in die Kirche gehen, dann kann er doch den Kopf nicht auf der Straße anbieten. Vergangenen Sonntag habe ich ihn gerade noch im letzten Augenblick erwischt, als er eben mit vier Köpfen, schön wie Zwiebeln auf einer Schnur aufgereiht, aus dem Haus wollte.« Der Bericht klärte das Geheimnis auf und bewies, dass der Wirt mir wenigstens keinen Bären aufgebunden hatte – aber andererseits, was sollte ich von einem Harpunier halten, der sich bis in den heiligen Sonntag hinein auf der Straße herumtrieb, um seinen kannibalischen Geschäften nachzugehen und Köpfe von toten Heiden anzubieten?
»Glauben Sie mir, Herr Wirt, der Harpunier ist ein gefährlicher Bursche.«
»Immerhin, er zahlt pünktlich«, war die Antwort. »Kommen Sie, es ist spät. Es ist ein schönes, ein breites Bett. Los, ich mache Ihnen Licht.« Damit zündete er eine Kerze an, reichte sie mir und wollte schon vorangehen. Aber ich zögerte noch. Er sah auf die Uhr in der Ecke: »Was? Schon Sonntag?«, rief er erstaunt. »Da werden Sie den Harpunier heute Nacht nicht mehr zu Gesicht kriegen. Der hat irgendwo Anker geworfen. Also, vorwärts jetzt! Oder wollen Sie nicht?«
Einen Augenblick stand ich noch da, dann stiegen wir die Treppe hinauf. Die Kammer war zwar eiskalt, aber das Bett, das drinnen stand, war so groß, dass tatsächlich vier Harpuniere bequem Platz gefunden hätten.
»So«, sagte der Wirt und stellte die Kerze auf eine alte Seekiste, die als Waschtisch und Esstisch diente, »jetzt machen Sie sich’s bequem. Gute Nacht.« Als ich mich umwandte, war der Wirt schon verschwunden.
Ich schlug die Decke zurück und beugte mich über das Bett. Elegant war es nicht, aber es sah ordentlich aus. Dann sah ich mich in der Kammer um. Außer Bett und Tisch war kein anderes Möbelstück zu erblicken, nur ein grob gezimmertes Bord, die vier Wände und ein tapezierter Kaminschirm mit einem Mann darauf, der einen Wal erlegte. In einer Ecke auf dem Fußboden lag eine Hängematte, dazu ein Seesack, der die Kleider des Harpuniers enthielt. Ferner lag auf dem Kaminsims ein Bündel fremdländischer, beinerner Angelhaken, und am Kopfende des Bettes stand eine lange Harpune.
Doch was lag dort auf der Seekiste? Ich nahm es in die Hand und hielt es nahe ans Licht, befühlte es, beroch es und suchte herauszubekommen, was es wohl sein mochte. Es ließ sich am ehesten noch mit einer großen Fußmatte vergleichen, die an den Kanten mit klingenden Stäbchen verziert war. In der Mitte befand sich ein Loch oder vielmehr Schlitz wie bei einem südamerikanischen Poncho. War es denn wirklich denkbar, dass ein ehrlicher Harpunier sich eine Fußmatte über den Kopf zog und in dieser Aufmachung durch die Straßen einer christlichen Stadt stolzierte! Ich steckte meinen Kopf durch den Schlitz, um es selbst einmal auszuprobieren. Das Gewicht drückte mich nieder, so ungewöhnlich zottig und dicht war das Gewebe und auch ein wenig feucht, als hätte es der geheimnisvolle Harpunier an einem regnerischen Tag getragen. Ich besah mich in dem Spiegelscherben an der Wand. Ein unvergesslicher Anblick! Hastig befreite ich mich wieder von der Matte und verrenkte mir dabei fast den Hals.
Ich setzte mich auf die Bettkante und dachte über den Kopfhändler und Harpunier nach. Dann stand ich auf, legte meine Jacke ab, stellte mich mitten ins Zimmer und dachte immer noch nach. Doch dann wurde mir kalt, und da der Wirt gesagt hatte, der Harpunier werde wohl in dieser Nacht nicht mehr zurückkehren, zog ich mir rasch Stiefel und Hose aus, löschte das Licht, fiel ins Bett und empfahl mich dem Schutz des Himmels.
Ob die Matratze mit Maiskolben gefüllt war oder mit Topfscherben, darüber schweige ich mich aus. Jedenfalls wälzte ich mich unruhig hin und her und konnte lange nicht einschlafen. Endlich fiel ich doch in einen leisen Schlummer und war schon beinahe tief eingeschlafen, als ich auf dem Flur schwere Schritte hörte. Unter der Tür drang ein schwacher Lichtschimmer in die Kammer.
»Gott steh mir bei«, dachte ich, »das muss der Harpunier sein, der höllische Kopfhändler.« Ich lag mäuschenstill da und beschloss, kein Sterbenswörtlein zu sagen, bis er mich anredete. Ein Licht in der einen Hand, in der anderen den bekannten Neuseeländerkopf, so trat der Fremde ins Zimmer. Dann stellte er, ohne einen Blick aufs Bett zu werfen, die Kerze in eine entfernte Ecke auf den Boden und machte sich an dem schon erwähnten Seesack zu schaffen. Ich wollte unbedingt sein Gesicht sehen, aber er hielt es abgewendet, während er an dem Seesack herumnestelte.
Als der Sack endlich offen war, wandte er sich um. Gott im Himmel, welch ein Anblick! Was für ein Gesicht! Dunkles Gelb mit Purpur, dazwischen große, schwärzliche Vierecke! Also doch: ein grauenvoller Bettgenosse! Der war natürlich bei einer Messerstecherei, wo man ihm das Gesicht so grausam zugerichtet hatte; und jetzt kommt er eben vom Wundarzt. Doch in diesem Augenblick drehte er sich zufällig so, dass das Licht voll auf sein Gesicht fiel. Ich sah nun deutlich, dass die Quadrate keine Wundpflaster sein konnten. Es waren einfach Flecken, über deren Herkunft ich mir allerdings auch nicht im klaren war. Dann aber erinnerte ich mich an eine Geschichte von einem weißen Mann, einem Walfänger übrigens, der den Kannibalen in die Hände gefallen und von ihnen tätowiert worden war. Vielleicht war das auch dem Harpunier auf seinen weiten Reisen zugestoßen. Und wenn schon, dachte ich mir, unter jeder Haut kann ein anständiger Kerl stecken. Aber wie sollte ich mir die ungewöhnliche Hautfarbe rings um die dunklen Flecken erklären? Vielleicht ein tropischer Sonnenbrand, gewiss, aber ich hatte nie gehört, dass ein Sonnenbrand einen weißen Mann in einen purpurgelben verwandelt. Allerdings war ich noch nie in der Südsee gewesen. Wohl während mir all diese Gedanken blitzschnell durch den Kopf schossen – möglich, dass die Sonne dort solch eigenartige Farbenspiele hervorruft –, nahm der Harpunier überhaupt keine Notiz von mir. Als er seinen Seesack mit vieler Mühe endlich geöffnet hatte, wühlte er darin herum und zog dann eine Art Tomahawk5 und einen Beutel aus Seehundfell hervor. Beides legte er auf die alte Kiste in der Mitte Kammer, packte dann den Neuseeländerkopf, das grausige Ding, und stopfte ihn in den Sack. Als er seinen Hut, eine Art Zylinder, abnahm, da hätte ich vor Überraschung beinahe laut geschrien: Sein Kopf war völlig kahl, nur über der Stirn hatte er eine kleine Skalplocke, kaum der Rede wert. Der purpurrote Glatzkopf sah beinahe wie ein vermodernder Totenschädel aus. Wenn mir der Fremde nicht den Weg zur Tür versperrt hätte, ich wäre auf und davon gelaufen. Ich dachte sogar einen Augenblick daran, durch das Fenster zu entwischen, aber das Zimmer lag im zweiten Stock.
Ich bin kein Feigling. Aber der purpurrote Bursche, dieser Kopfhändler, erschien mir zu dieser mitternächtlichen Stunde wie der Teufel. Ich hatte tatsächlich solche Angst, dass ich es nicht über mich brachte, ihn anzusprechen und ihn zu fragen, was das alles bedeuten sollte.
Indessen zog er sich weiter aus, bis auch Brust und Arme zum Vorschein kamen. So wahr ich lebe, sein ganzer Körper war genauso gefleckt wie sein Gesicht; auch der Rücken war übersät mit den dunklen Quadraten, als wäre er mit knapper Not und mit einem Hemd aus Wundpflastern dem Dreißigjährigen Krieg entronnen. Selbst seine Beine waren gezeichnet, als kletterte eine Schar von grünen Fröschen an den Stämmen junger Palmen empor.
Jetzt war mir alles klar: Der Kerl musste ein gräulicher Wilder sein, der in der Südsee an Bord eines Walfängers gelangt und auf diese Weise in unser christliches Land geraten war. Ich schauderte, wenn ich nur daran dachte. Und noch dazu mit Köpfen handeln, vielleicht gar mit den Köpfen seiner eigenen Brüder! Womöglich gefiel ihm auch der meine – und dann noch dieser Tomahawk!
Doch ich hatte gar keine Zeit mehr, meine Gedanken weiterzuspinnen, denn nun tat der Wilde etwas, was meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm und mich endgültig überzeugte, dass ich einen Heiden vor mir hatte. Er nahm seine schwere Seemannsjacke vom Stuhl, wühlte in den Taschen herum und brachte schließlich ein merkwürdiges, buckliges Figürchen zum Vorschein, so schwarz wie ein drei Tage altes Kongo-Baby. Im Hinblick auf den einbalsamierten Kopf glaubte ich zunächst, die Puppe sei vielleicht tatsächlich ein präparierter, echter Säugling. Als ich aber sah, dass es nur ein Stück polierten Ebenholzes war, schloss ich, dass es wohl ein Götzenbild aus Holz sein müsse, und damit hatte ich schließlich recht. Denn nun trat der Wilde an den leeren Kamin heran, schob den Schirm zur Seite und stellte seinen buckligen Götzen wie einen Kegelkönig zwischen die beiden Feuerböcke. Die Wände und Backsteine im Inneren waren so verrußt, dass sie einen passenden Hintergrund, eine Art Kapelle für den kleinen Kongo-Götzen abgaben.
Ich fühlte mich etwas unbehaglich, aber ich konnte kein Auge abwenden, denn ich musste sehen, was jetzt geschah. Zuerst nahm er zwei Handvoll Sägespäne aus seiner Jackentasche und streute sie andächtig dem Götzen zu Füßen, dann legte er obendrauf ein Stück Schiffszwieback und setzte mit der Kerze die Späne in Brand, bis das Opferfeuer aufflammte. Dann zog er, nicht ohne sich die Finger zu versengen, den Zwieback aus der Glut, reinigte ihn sorgfältig und hielt ihn dem kleinen Götzen hin. Das Teufelchen schien aber nicht den geringsten Appetit zu haben, denn es bewegte nicht einmal die Lippen. Das ganze Zeremoniell begleitete der Wilde mit merkwürdigen Kehllauten, möglicherweise einem Gebet oder irgendeinem heidnischen Singsang. Dabei zuckte sein Gesicht ganz eigenartig. Als er das Feuer schließlich gelöscht hatte, packte er ohne Umstände den Götzen und stopfte ihn höchst unfeierlich wieder in die Jacke. Der ganze Hokuspokus war nicht dazu angetan, mich zu beruhigen, und da ich jetzt merkte, dass er sich anschickte, ins Bett zu steigen und das Licht zu löschen, hielt ich den Augenblick für gekommen, etwas zu unternehmen.
Doch während ich noch überlegte, nahm er den Tomahawk vom Tisch, prüfte flüchtig das eine Ende und hielt es an die Flamme, und schon paffte er Wolken von Tabaksqualm in die Luft. Im nächsten Augenblick erlosch die Flamme, und der wüste Kannibale sprang, mit seinem Tomahawk im Mund, zu mir ins Bett. Ich stieß einen Schreckensschrei aus, und schon begann er unter verwundertem Grunzen nach mir zu tasten.
Ich stammelte noch etwas Unverständliches, rollte mich zur Wand und beschwor ihn, wer er auch sei, still liegenzubleiben und mir zu gestatten, das Licht wieder anzumachen. Die gurgelnden Laute, mit denen er mir antwortete, überzeugten mich, dass er mich überhaupt nicht verstanden hatte.
»Wer-är Teufel du?«, knurrte er endlich. »Du nicht sprächen – värdammt-rr, ich dich totschlärr«, und schon sah ich den qualmenden Tomahawk über mir.
»Herr Wirt! Um Gottes willen, Peter Coffin!«, schrie ich. »Wirt! Hilfe! Coffin! Ihr Engel Gottes! Helft mir!«
»Redä-rr! Wer-är du sein, oder dich totschagä-rr«, knurrte er von neuem, während bei dem scheußlichen Herumgefuchtel mit dem Tomahawk die Asche herumflog, sodass ich schon fürchtete, das Bettzeug könnte Feuer fangen. Doch Gott sei Dank, in diesem Augenblick erschien der Wirt mit einer Kerze in der Hand. Ich sprang auf und stand schon neben ihm.
»Keine Angst«, sagte er und grinste schon wieder so infam. »Quiqueg wird Ihnen kein Haar krümmen.«
»Hören Sie doch endlich auf zu grinsen!«, schrie ich ihn an. »Und warum haben Sie mir nicht gesagt, dass der Höllen-Harpunier ein Menschenfresser ist?«
»Ich dachte, Sie wüssten das längst. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass er mit Köpfen hausieren geht. Aber jetzt marsch ins Bett und gut geschlafen! Und du, Quiqueg, hast mich verstanden, der Mann schlafen mit dir.«
»Verstanden genug«, grunzte der und stieß gewaltige Rauchwolken aus.
»Du in Bätt-rr«, fügte er hinzu und wandte sich an mich und schlug die Decke zurück, das alles auf freundliche und durchaus menschliche Weise. Ich stand noch einen Augenblick da und betrachtete ihn, und da fand ich, dass er eigentlich ein ganz appetitlicher, netter Menschenfresser war, trotz all seiner Tätowierungen. Ich hatte allen Grund, mich ein wenig zu schämen. Lieber ein nüchterner Menschenfresser als ein betrunkener Christ, dachte ich bei mir.
»Herr Wirt«, sagte ich, »er soll doch seinen Tomahawk ausmachen oder die Pfeife. Kurzum, er soll aufhören zu rauchen. Dann will ich mit ihm schlafen. Ich kann es nicht ausstehen, wenn einer im Bett raucht, gefährlich ist es auch.«
Quiqueg war sofort einverstanden und lud mich nochmals aufs freundlichste ein, ins Bett zu steigen, und dabei drückte er sich ganz hinaus auf seine Seite, als wolle er sagen, keine Angst, ich tu’ dir nichts.
Quiqueg
»Gute Nacht, Wirt, Sie können jetzt gehen«, sagte ich.
Ich kroch ins Bett und schlief wie nie zuvor.
Jetzt fielen mir auch die Ereignisse des vergangenen abends wieder ein, und ich empfand meine eigenartige Lage. Nach einigen vergeblichen Versuchen gelang es mir nun auch, mich von dem Arm zu befreien. Quiqueg grunzte und schüttelte sich wie ein Neufundländer.
Als ich beim Morgengrauen aufwachte, lag Quiquegs Arm liebevoll und zärtlich über mich gebreitet. Endlich, nach krampfhaften Schlangenbewegungen, um mich freizuwinden, erreichte ich, dass er grunzend den Arm wegzog, sich wie ein Neufundländer, der eben aus dem Wasser kommt, schüttelte und sich stocksteif im Bett aufsetzte. Er rieb sich die Augen und sah mich an, als entsänne er sich nicht recht, wie ich eigentlich hierhergekommen sei. Unterdessen lag ich ganz still und betrachtete mir dieses merkwürdige Produkt der Schöpfung sehr genau, denn ich hatte keine Angst mehr vor ihm. Als er sich endlich über seinen Schlafkameraden im klaren zu sein schien und gegen meine Anwesenheit nichts Besonderes einzuwenden hatte, sprang er mit einem Satz aus dem Bett und gab mir durch Zeichen und Laute zu verstehen, falls es mir recht sei, wolle er sich zuerst anziehen und mir dann die ganze Kammer für meine eigene Toilette überlassen. Quiqueg, dachte ich, wenn man alle Umstände in Betracht zieht, ist das eigentlich ein recht manierliches Angebot.
Mit dem Ankleiden fing er von oben an, indem er sich seinen riesigen Zylinder aufstülpte. Dann machte er, noch immer ohne Hose, Jagd auf seine Stiefel. Als nächstes kam – warum, weiß nur der liebe Himmel –, dass er sich, die Stiefel in der Hand und den Zylinder auf dem Kopf, unters Bett verkroch. Endlich kam er wieder zum Vorschein, den stark verbeulten Zylinder bis über die Augen verrutscht. Die ganze Kammer knarrte, wie er so umherhumpelte, denn die Stiefel waren ihm noch ungewohnt. Die ersten Schritte in dem feuchten, eingeschrumpften Schuhwerk, das bestimmt nicht nach Maß angefertigt war, müssen ihm an diesem bitterkalten Morgen schwergefallen sein.
Dann begann er mit der Morgenwäsche. Jeder normale Christenmensch hätte sich zu so früher Morgenstunde zuerst das Gesicht gewaschen. Zu meiner Verwunderung beschränkte sich Quiqueg darauf, Brust, Arme und Hände abzuspülen. Dann zog er Hose und Weste an, nahm vom Mitteltisch, der zugleich Waschtisch war, sein Stück Seife, tauchte es ins Wasser und seifte sich das Gesicht ein. Ich war neugierig, wo er sein Rasiermesser haben mochte. Doch siehe da, er holte die Harpune aus der Ecke am Bett, und nachdem er die hölzerne Scheide entfernt hatte, wetzte er die Stahlspitze am Leder seiner Stiefel. Nun trat er vor die Glasscherbe, die den Spiegel ersetzte, und schabte, vielmehr harpunierte sich beide Wangen. Quiqueg, dachte ich, du hast es heraus, wie man mit hochwertigen Stahlwaren umgeht. Später allerdings, als ich aus eigener Erfahrung wusste, aus was für feinem Stahl die Harpunenspitze geschmiedet ist und wie haarscharf die langen, glatten Schneiden sind, wunderte ich mich nicht mehr.
Er war rasch fertig, und in seiner derben Lotsenjacke stolzierte er erhobenen Hauptes hinaus, wobei er seine Harpune wie einen Marschallstab schwang.
Nicht lange darauf ging auch ich hinunter ins Gastzimmer und redete den schmunzelnden Wirt freundlich an. Ich hegte keinen Groll mehr gegen ihn, obwohl er mir mit diesem Schlafgenossen einen üblen Streich hatte spielen wollen.