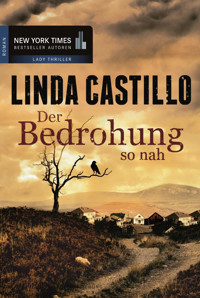9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kate Burkholder ermittelt
- Sprache: Deutsch
Wenn die Geister der Vergangenheit sprechen 1979: Ein amischer Vater und vier seiner Kinder sterben bei einem missglückten Raubüberfall. Seine Frau wird von den Tätern entführt und nie wieder gesehen. Allein der vierzehnjährige Sohn Billy Hochstetler überlebt diese grausame Nacht. 2014: Jeder in Painters Mill weiß, dass es auf der verlassenen Farm der Familie Hochstetler spukt. Aber nur einige wenige wissen, was damals in jener Nacht tatsächlich geschah. Und nun wird einer nach dem anderen auf grausame Weise ermordet. Wer ist ihrem Geheimnis auf die Spur gekommen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Linda Castillo
Mörderische Angst
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Helga Augustin
FISCHER E-Books
Inhalt
Für alle, die meine Bücher gelesen und geliebt haben.
Ich danke euch!
Was vergangen ist, sei tot.
Henry Wadsworth Longfellow, Ein Psalm des Lebens
Prolog8. März 1979
Er träumte von druckluftbetriebenen Schleifmaschinen, die über feinstes Wurzelholz glitten, und von Schwalbenschwanzzinkungen mit Zapfen und Schlitzen, die so präzise herausgestanzt waren, dass man sie kaum sah. Er und sein Datt schreinerten gerade eine Waschkommode für seine Mamm, denn seit sie so etwas im Antiquitätenladen in Painters Mill entdeckt hatte, wünschte sie sich nichts sehnlicher. Er freute sich jetzt schon auf ihr Gesicht, wenn sie ihr die Kommode präsentierten …
Billy Hochstetler schreckte aus dem Schlaf hoch. Was ihn geweckt hatte, wusste er nicht, vielleicht ein Geräusch im Erdgeschoss oder aber das Trommeln des Regens auf dem Dach. Er war vierzehn Jahre alt, lag in seinem kuschelig warmen Bett und versuchte, den Traum zurückzuholen. Doch es gelang ihm nicht. Sein Herz schlug heftig, und er hatte keine Ahnung, warum. Er starrte in die Dunkelheit, lauschte, hörte jetzt aber nur noch Donnergrollen und das gelegentliche Klappern der losen Regenrinne. In den nächsten Tagen mussten er und sein Datt auf die Leiter steigen, um sie zu reparieren.
»Billy?«
Er war gerade wieder eingenickt, als das Flüstern seines kleinen Bruders ihn erneut weckte. »Schlaf weiter«, murmelte er.
»Ich hab was gehört.«
»Ach Quatsch. Und jetzt schlaf, bevor du noch alle weckst.«
»Unten sind Leute. Englische.«
Billy stützte sich auf die Ellbogen und blickte seinen kleinen Bruder verdrossen an. Little Joe war gerade acht geworden und sah in dem viel zu großen Nachthemd so süß aus, dass er trotz seines Ärgers über die Schlafstörung grinsen musste. »Das ist bloß das Gewitter. Angsthase.«
»Gar nicht!«
»Pssst!« Billy kicherte, glaubte ihm nicht. »Willst du bei mir schlafen?«
»Ja!« Sein kleiner Bruder kam angelaufen und machte einen Hechtsprung zu ihm ins Bett.
Gerade kuschelte er sich an ihn, da hörte Billy es auch. Das Geräusch kam von unten, ein Knall und dann das Kratzen von Holz auf Holz. Er sah Little Joe an. »Hast du das gehört?«
»Ich hab’s dir ja gesagt.«
Billy drehte sich auf die andere Seite, nahm die Taschenuhr vom Nachttisch und sah blinzelnd auf das Zifferblatt. Drei Uhr dreißig. Sein Datt würde erst in einer Stunde aufstehen. Aber wer war dann unten im Haus?
Er stieg aus dem Bett und ging zum Fenster, schob die Gardine beiseite und spähte hinunter zur Kiesauffahrt. Niemand war zu sehen. Auch kein Buggy oder Auto. Kein Laternenlicht in der Scheune, und Werkstatt und Verkaufsräume waren ebenfalls dunkel.
Billy nahm die Hose vom Stuhl und schlüpfte hinein. Ein schwaches Murmeln drang jetzt durch die Lüftungsklappe über der Fußleiste. Bei ihnen zu Hause wurde nur Pennsylvaniadeutsch gesprochen, doch das war eindeutig Englisch. Aber wer besuchte sie mitten in der Nacht?
»Wo gehst du hin?«, flüsterte Little Joe.
Billy blickte zu seinem Bruder, der die Decke bis zum Kinn hochgezogen hatte. »Schlaf weiter.«
»Ich will mit dir gehen.«
»Pssst.« Er streifte sein Hemd über, öffnete die Tür und ging langsam die Treppe hinunter. Doch er hatte die unterste Stufe noch nicht erreicht, als der gelbe Strahl einer Taschenlampe über die Wand huschte.
»Datt?«, rief er. »Mamm?«
Keine Antwort, nur das Scharren von Schuhen auf Holz.
Er trat in die Küche, wo ihn der Strahl einer Taschenlampe im Gesicht traf. »Wer ist da?«, fragte er, die Hand schützend vor den Augen.
»Halt den Mund!«, zischte eine männliche Stimme.
Vor Schreck taumelte Billy in den Flur zurück. Aus dem Augenwinkel sah er die Umrisse eines Mannes in Jeansjacke und mit wollener Gesichtsmaske, dann wurde er unsanft am Arm gepackt und wieder in die Küche gezerrt. »Da rüber! Auf die Knie!«
Als er seine Mamm und seinen Datt erblickte, die mit den Händen hinterm Kopf auf der anderen Seite des Tisches knieten, packte ihn die nackte Angst. Mit zittrigen Beinen ging er um den Tisch herum. Wer war der englische Mann? Warum war er hier? Und was wollte er?
Niemand sprach, als er neben seiner Mamm niederkniete und leicht vorgebeugt seinen Vater ansah, der sicher wusste, was zu tun war. Willis Hochstetler wusste das immer.
»Gott wird uns schützen«, flüsterte sein Vater auf Pennsylvaniadeutsch.
»Mund halten!« Der Mann zog eine Pistole aus dem Hosenbund. »Und du nimm die Hände hoch, hinter den Kopf!«
Billy hob die Hände, aber sie zitterten so heftig, dass er Mühe hatte, sie hinter dem Kopf zu verschränken.
»Wo sind Laternen?«, wollte der Mann wissen.
»Da ist eine«, sagte Datt. »Neben dem Herd.«
Der Mann ging hin und nahm die Laterne. »Mach sie an«, befahl er Billy.
Billy sprang auf die Füße und ging zu ihm, spürte den Blick des Mannes auf sich. Tapfer nahm er die Laterne, holte Streichhölzer aus der Schublade und zündete den Docht an. Dabei dachte er an Litte Joe oben in ihrem Zimmer und betete, dass er wieder eingeschlafen war.
»Her damit«, sagte der Mann und riss ihm die Laterne so heftig aus der Hand, dass das Petroleum darin schwappte.
»Geh da rüber und sei still.«
Billy kniete sich wieder neben seine Mamm und hoffte, dass der Mann sich einfach nahm, was er wollte, und verschwand.
Ein zweiter Mann betrat die Küche, eine Taschenlampe in der einen und eine Pistole in der anderen Hand. Er war athletisch gebaut, hatte blonde Haare und ein Tuch über Mund und Nase gebunden. »Wo ist das Geld«, herrschte er Billys Vater an.
Noch nie hatte sein Datt Angst gezeigt, doch als der zweite Mann erschien, konnte Billy sie sehen, an seinen weit aufgerissenen Augen und dem bebenden Mund. Aber die Sorge galt nicht ihm selbst oder dem Geld, für das er so schwer gearbeitet hatte. Er fürchtete um das Leben seiner Frau und seiner Kinder.
»In einem Glas«, sagte sein Datt. »Im Schrank über dem Herd.«
Mit einem hungrigen Leuchten in den Augen, das Billy nicht verstand, ging der blonde Mann zu dem Hängeschrank und riss die Tür auf. Er holte ein altes Erdnussbutterglas heraus, schraubte es auf und schüttete das Geld auf die Ablage.
Billy sah die Scheine herausfallen – Zwanziger und Zehner und Fünfziger –, die Einnahmen aus den Verkäufen von mindestens einem Monat.
»Wenn Sie gesagt hätten, dass Sie Geld brauchen, hätte ich Ihnen Arbeit und einen fairen Lohn angeboten«, sagte Willis Hochstetler.
Der blonde Mann ignorierte ihn.
»Mamm?«
Billys Blick schoss zur Küchentür, wo Little Joe stand, die Beine unter dem Nachthemd wie dürre bleiche Knochen. Als er hinter ihm auch noch Hannah und Amos und Baby Edna entdeckte, sank ihm das Herz in die Hose.
»Die Kinner.« Mamm sprang auf. »Die Zeit fer in bett is nau.« Geht sofort ins Bett.
»Was soll das?« Der blonde Mann drehte sich um und richtete die Pistole auf sie. »Runter auf die Knie!«
Aber Mamm eilte zu den Kindern, sah nur sie und hatte die Worte des Mannes scheinbar gar nicht gehört.
»Sag ihr, sie soll zurück an ihren Platz!« Der Mann in der Jeansjacke richtete die Pistole auf Datt. »Das ist mein Ernst! Sag’s ihr!«
»Wanetta«, sagte Datt. »Gehorch ihm.«
Als spürte sie, dass etwas nicht stimmte, fing Baby Edna an zu weinen, unmittelbar gefolgt von Hannah, und dann weinte auch Little Joe, der sich mit seinen acht Jahren für einen Mann hielt und zu alt für so etwas.
Mamm kniete sich hin und zog die Kinder in ihre Arme. »Pssst.«
»Es reicht!« Der blonde Mann stampfte zu Billys Mutter und riss sie von den Kindern weg. »Zurück auf deinen Platz!«
»Sie sind doch noch so klein.« Sie entwand sich seinem Griff und schlang die Arme um ihre Kinder. »Sie verstehen das doch gar nicht.«
»Mamm!«, entfuhr es Billys Mund, ohne dass er es beabsichtigt hatte.
»Wanetta!« Datt sprang auf die Füße.
Ein Schuss durchschnitt die Luft. Der Knall hallte wie nach einer Explosion stoßwellenartig in Billys Kopf. Wie eine Kugel, die durchs Wasser zischt und alles um sich herum aufwühlt. Sein Datt schwankte, Unglaube in den Augen.
Schlagartig war es still.
»Datt?«
Billy hatte das Wort kaum herausgebracht, als sein Vater auf die Knie sank, nach vorn kippte und reglos liegen blieb. Billy hielt die Luft an, betete, dass er aufstehen möge. Doch sein Datt rührte sich nicht.
Der blonde Mann wirbelte zu dem anderen in der Jeansjacke herum und starrte ihn an. »Bist du wahnsinnig«, schrie er.
In der Küche brach Chaos aus. Die beiden Einbrecher gingen aufeinander los, stoßend und zerrend brüllten sie sich an, dazwischen Mamms Wehklagen und die schrillen Schreie der Kinder. Ein entsetzliches Durcheinander erfüllte den Raum.
Billy erinnerte sich nicht, dass er zu seinem Vater gekrochen war, bemerkte nicht das warme Blut an den Händen, als er ihn an der Schulter fasste und auf den Rücken drehte. »Datt?«
Willis Hochstetlers Augen standen offen, jedoch ohne einen Funken Leben darin. Das Gesicht war grau, die Lippen blau. »Wach auf.« Billy berührte das blutige Hemd seines Vaters, wusste nicht, was er tun sollte oder wie er ihm helfen konnte. »Sag mir, was ich machen soll«, stieß er weinend hervor.
Aber sein Datt war tot.
Er sah den Mann an, der ihn erschossen hatte. »Er hat Ihnen doch das Geld gegeben«, stieß er weinend hervor. »Warum haben Sie das getan?«
»Halt den Mund!«, schnauzte der Mann ihn an, doch in seinen Augen stand Panik.
»Wir verschwinden«, schrie der andere Mann.
»Steck das Geld in einen Beutel!«
Von irgendwoher drangen Schreie in Billys Ohren, Schreie von seiner Mamm oder seinen Geschwistern. Doch vielleicht waren es auch seine eigenen.
Ein dritter Mann betrat die Küche. Er trug Jeans und ein Sweatshirt und hatte das Gesicht mit einem dünnen Stofftuch verhüllt. »Du und die Kinder, runter in den Keller. Sofort!«, sagte er und zeigte dabei auf Billy.
Die Kinder drückten sich wimmernd an Mamm, ihre Gesichter rot und tränenüberströmt.
»Tun Sie ihnen nichts«, flehte Mamm den Mann an.
Auf dem Weg zum Keller bat Billy sie mit flehenden Blicken mitzukommen. Aber als seine Mutter sich erheben wollte, drückte der Mann in der Jeansjacke sie an der Schulter nach unten.
Die drei Männer tauschten Blicke. Billy wurde übel. Er war zwar erst vierzehn Jahre alt, aber so furchtbar das alles schon war, ahnte er doch, dass das Schlimmste noch bevorstand.
Der blonde Mann hob seine Pistole und richtete sie auf Billys Kopf. »Geh mit den Kindern in den Keller.«
Billys Verstand hörte auf zu funktionieren. Auch sein Körper war wie betäubt. Er führte seine Geschwister zur Kellertür und redete beruhigend auf sie ein, als sie einer nach dem anderen hindurchgingen. Bevor er ihnen folgte, drehte er sich um und sah zu seiner Mamm. Der blonde Mann hielt ihren Arm umklammert, der in der Jeansjacke hatte sie am Nacken gepackt und schob sie in Richtung Wohnzimmer. Ihr Nachthemd war gerissen, denn Billy konnte ihre Unterwäsche sehen.
Er wollte zu ihr, aber der Mann mit dem Tuch überm Gesicht stieß ihn zurück und schlug die Tür zu. Das Schloss schnappte ein. Dunkelheit umhüllte ihn wie in einem Sarg. Billy drehte am Knauf, doch die Tür ließ sich nicht öffnen. Hinter ihm schnieften und wimmerten wieder seine Geschwister. Sie zählten auf ihn, das wusste er.
»Billy, ich hab Angst.«
»Ich will zu Mamm.«
»Warum ist Datt nicht aufgewacht?«, schniefte Hannah.
»Pssst.« Die aufsteigende Panik bekämpfend, drehte er sich zu ihnen um. Das spärliche Licht, das unter der Tür durchfiel, war gerade hell genug, um ihre verheulten Gesichter zu erkennen. »Little Joe, auf dem Arbeitstisch ist eine Laterne, hilf mir, sie anzuzünden.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, stieg Billy, die Hand auf dem Holzgeländer, die Treppe hinab. Unten auf dem Lehmboden ging er nach links und tastete sich zum Arbeitstisch vor, auf dem seine Mamm Seife herstellte. Er fuhr mit der Hand über die Tischplatte, stieß etwas um, dann streiften seine Fingerspitzen den Sockel der Laterne und ertasteten die Streichhölzer daneben. Er zündete den Docht an.
»Little Joe.« Er hielt ihm die Laterne hin. »Du musst jetzt tapfer sein und auf deine kleinen Geschwister aufpassen.«
Der Junge nahm die Laterne. »A… Aber wo gehst du hin?«
»Ich hole Mamm.« Erst da wurde Billy bewusst, was er vorhatte. Er lief zu dem ebenerdigen Kellerfenster, aber es war zu hoch für ihn, und er sah sich nach etwas um, wo er sich draufstellen konnte. Eine Leiter gab es nicht, und die Holzregale waren mit Werkzeugen, Einmachgläsern und Tontöpfen vollgestellt. Dann fiel sein Blick auf die alte Wäschemangel in der Ecke.
»Hilf mir, die Mangel da rüberzuziehen.«
Little Joe unterdrückte die aufsteigenden Tränen, reichte die Laterne seiner Schwester und eilte zu ihm hin. Gemeinsam schoben sie die Mangel unters Fenster, wobei sie tiefe Furchen in den Erdboden grub.
Billy stieg auf den hölzernen Unterbau, dann oben auf die Walze und zerbrach mit dem Ellbogen das Fensterglas. Er warf seinen Geschwistern noch schnell einen Blick über die Schulter zu und sah im flackernden Licht der Laterne, dass sie kaum einen Meter weit weg aneinandergedrängt standen – ein Häufchen tränennasser, verängstigter Gesichter und bibbernder Münder.
»Ich komme mit Mamm zurück«, sagte er. »Versprochen.«
Mit beiden Händen zog er sich am Fensterrahmen hoch und schob sich durch die Öffnung. Dann war er im Freien. Nieselregen benetzte sein Gesicht. In der Ferne brummte ein Motor. Er drehte sich um und sah die Rücklichter des Wagens in der Mitte des Schotterwegs, der zu ihrem Hof führte, rannte los und betete, dass er ihn erreichte, bevor er auf die Straße abbog. Der Schotter schnitt ihm in die nackten Füße, doch den Schmerz spürte er nicht. Sein heißer Atem ging stoßweise. Er wusste nicht, wie er den Wagen zum Anhalten bringen sollte, er hatte keinen Plan. Nur eines wusste er genau: Er durfte nicht zulassen, dass sie seine Mamm mitnahmen.
Kurz vor der Landstraße holte Billy das Auto ein, rannte seitlich neben ihm her und schlug mit den Handflächen ans Fenster. »Stopp! Stopp!«
Mit knirschenden Reifen kam der Wagen auf dem nassen Schotter rutschend zum Stehen. Billy baute sich neben der Fahrertür auf. »Ich will meine Mamm!«
Die Tür ging auf, und er erhaschte einen Blick ins Wageninnere, wo seine Mutter verzweifelt vom Rücksitz aufzustehen versuchte. »Billy, nein! Lauf weg, lauf!«
Der Fahrer versetzte ihm einen Schlag ins Gesicht, er verlor den Boden unter den Füßen, landete auf dem Rücken und schlug mit dem Kopf auf den Schotter. Seine Nase schmerzte höllisch, und er spürte, wie der Schlamm durch sein Hemd drang. Dann hörte er Reifenquietschen, roch Autoabgase.
Stöhnend rappelte er sich auf alle viere. Entsetzt sah er, wie der Wagen auf die Landstraße abbog, und schrie aus Leibeskräften: »Mamm!«
Er überlegte, ob er hinter dem Auto herrennen sollte, als ihm das seltsam orangefarbene Leuchten der Baumkronen auffiel. Verwundert drehte er sich um – und erstarrte beim Anblick der gelben Flammen. Dann fiel ihm die Laterne ein.
Schreiend rannte er zum Haus und durch den seitlichen Garten zum Kellerfenster, aus dem er gekrochen war. Rauch quoll daraus hervor.
»Little Joe! Hannah!«
Billy warf sich auf den Bauch und schob den Kopf durchs Fenster. Hitze schlug ihm entgegen, versengte sein Gesicht und brannte ihm in den Augen. Drei Meter entfernt züngelten gelbe Flammen an der Kellerdecke. Der beißende Geruch von verbranntem Plastik erfüllte die Luft.
Billy blickte verzweifelt um sich, schrie um Hilfe.
Er setzte sich auf den Po und schob die Beine durchs Fenster, aber die Hitze und der Rauch waren unerträglich. Als er sie wieder zurückzog, roch seine Hose angesengt, und seine Fußsohlen waren voller Brandblasen.
Wieder rief er, und wieder bekam er keine Antwort.
Und dann war nur noch dicker Rauch zu sehen, der durchs Fenster drang, und das Brüllen der Flammen zu hören, die das Haus von innen heraus verschlangen.
1. KapitelGegenwart
Es war schon lange her, dass man ihn als Letzten aus einer Bar gekehrt hatte – und dann noch aus einer wie dem Brass Rail. Die Musik war zu laut, der Alkohol war unterste Kategorie, und die Leute waren so jung und ungehobelt, dass es kaum auszuhalten war. Der allerletzte Ort, an dem sich ein Mann wie er normalerweise aufhielt. Oder sich aufhalten wollte. Aber für heute Abend war er perfekt: Dunkel und anonym – und niemand würde sich an ihn erinnern.
Bis jetzt hatte er vier Nachrichten bekommen, und mit jeder war seine Besorgnis gewachsen. Die erste lag letzte Woche in seinem Briefkasten. Ich weiß, was du getan hast. Die zweite war unter den Scheibenwischer seines Lexus geklemmt. Ich weiß, was ihr alle getan habt. Die dritte hatte er auf der Schwelle zwischen der Windfangtür und dem Hintereingang zur Küche gefunden. Ich will dich treffen, oder ich gehe zur Polizei. Alle Nachrichten waren in blauer Tinte geschrieben auf einem in der Mitte durchgerissenen Blatt eines linierten Notizblocks. Die vierte Nachricht hatte heute Abend an seiner Haustür geklebt. Hochstetler-Farm. Ein Uhr. Komm allein.
Zuerst tat er, als ob er nicht verstand, worum es ging. Die Welt war voller Verrückter, und er war immerhin ein erfolgreicher Mann mit einem schönen Haus und einem angenehmen Leben. Er fuhr einen teuren Wagen. Das reichte bereits, um sich Feinde zu machen. Er war ein Mann, der das hatte, was viele wollten. Er hatte die Nachrichten zerknüllt und in den Müll geworfen. Und so gut es ging verdrängt. Doch ihm war klar, dass das Problem nicht einfach verschwinden würde.
Ich weiß, was ihr alle getan habt.
Jemand wusste etwas, was er nicht wissen durfte. Über ihn und die anderen. Über jene Nacht. Etwas, das unmöglich jemand wissen konnte.
Es sei denn, er war dort gewesen, fügte eine innere Stimme hinzu.
Er hatte sich das Hirn zermartert, was dahinterstecken könnte. Es gab nur eine Erklärung: Jemand wollte ihn erpressen. Aber wer?
Dann, vor zwei Nächten, hatte er sie nahe seines Hauses die Straße entlanggehen sehen. Doch als er anhielt, um genauer hinzuschauen, war sie verschwunden. Und er hatte sich gefragt, ob er überhaupt etwas gesehen hatte oder ob sein Gewissen ihm womöglich einen Streich spielte.
Es war schon Jahre her, dass er mit den anderen gesprochen hatte. Doch nach der dritten Nachricht rief er sie – aus Neugier und einem gewissen Pflichtbewusstsein – schließlich an. Keiner von ihnen gab zu, irgendwelche mysteriösen Nachrichten bekommen zu haben, doch alle versprachen, sich zu melden, falls sich das änderte. Wenn einer von ihnen mehr wusste, als er zugab, hatte er das gut verheimlicht.
Nach dem Erhalt der letzten Nachricht hatte er erst einmal ganz normal den Abend verbracht, mit Essen vom Chinesen und Fernsehen. Danach hatte er die Flasche Macallan geöffnet, ein schottischer Whisky, den er vor zwei Jahren von seiner Tochter zu Weihnachten bekommen hatte. Nachts um halb zwölf war er aber noch immer so unruhig und gereizt gewesen, dass er die Walther PK 380 aus dem Waffenschrank holte, lud und in die Innentasche seines Jacketts steckte. Dann hatte er die Schlüssel seines Lexus genommen und war zur Brass Rail Bar gefahren, weil die als einzige noch geöffnet hatte.
Jetzt saß er hinten in einer Nische, dröhnende Rockmusik in den Ohren, ein flaues Gefühl und zwei gepanschte Scotchs im Magen, starrte auf die Uhr und wartete.
Ich weiß, was ihr alle getan habt.
Er beobachtete, wie zwei junge Mädchen, die seiner Ansicht nach zu jung waren, um Alkohol zu trinken, auf die Tanzfläche gingen. Er zog sein iPhone aus der Tasche und scrollte runter zu der gesuchten Nummer. Da es zu spät war, den Mann anzurufen, der jetzt kaum mehr als ein Fremder für ihn war, verfasste er eine Textnachricht.
Treffen findet statt. Melde mich wg. Ausgang.
Bevor er sie abschickte, saß er einen Moment lang da, starrte aufs Telefon und sagte sich, dass niemand wissen konnte, was er getan hatte. Es war fünfunddreißig Jahre her, eine Ewigkeit. Inzwischen hatte er geheiratet, eine erfolgreiche Immobilienfirma gegründet, vier Kinder großgezogen und war wieder geschieden. Er war halb im Ruhestand, Großvater und ein geachtetes Mitglied der Gemeinde. Jene Nacht hatte er hinter sich gelassen, hatte vergessen, was damals passiert war. Oder es zumindest versucht.
Jemand weiß Bescheid.
Wie ein Messer bohrte sich die Angst in seinen Bauch. Stöhnend schob er das Telefon zurück in die Jackentasche und sah wieder hoch zur Uhr. Fast eins. Zeit zu gehen. Er leerte das Glas, nahm die Schlüssel vom Tisch und verließ die Bar.
Zehn Minuten später fuhr er auf der Old Germantown Road in Richtung Norden. Inzwischen regnete es so stark, dass er kaum die Mittellinie erkennen konnte.
»Immer schön auf Kurs bleiben«, murmelte er, Trost in der eigenen Stimme suchend.
All die Jahre hatte er geglaubt, die Vergangenheit hätte keine Macht mehr über ihn. Es gab Momente, da war er beinahe überzeugt, dass es diese Nacht niemals gegeben hatte. Dass es bloß ein wiederkehrender Albtraum war, das Hirngespinst seiner hyperaktiven, grenzenlosen Phantasie. Doch in Nächten wie dieser legte sich die Wahrheit wie ein Würgeisen um seinen Hals. Dann wusste er – hatte immer gewusst –, dass sein Gewissen, jene strafende, krebsartige Geschwulst, ihn niemals in Ruhe lassen würde, weil manche Sünden nicht vergeben werden können. Er musste für seine Tat büßen. Eines Tages, da war er sicher, würden Gott oder das Schicksal – oder vielleicht sogar der Teufel – dafür sorgen, dass er seine Schuld beglich.
Er umklammerte das Lenkrad mit beiden Händen und beugte sich so weit vor, dass sein Gesicht fast die Windschutzscheibe berührte. Der Regen, der aufs Dach trommelte, klang wie Kugelhagel auf Wellblech. Aus dem Radio röhrte Jim Morrisons schwermütige Stimme, und er drehte die Musik so weit auf, bis sie alles übertönte. In Nächten wie dieser hatte Musik etwas Beruhigendes. Sie war ein Zeichen von Leben, erinnerte ihn daran, dass noch andere Menschen da draußen waren, und gab ihm das Gefühl, nicht so isoliert und allein zu sein. Doch in diesem Moment hätte er schwören können, dass sie in jener Nacht im Autoradio den gleichen Song gehört hatten.
Er nahm den Blick von der Fahrbahn und suchte einen anderen Sender. Als er wieder aufsah, stand sie mitten auf der Straße, nur ein paar Meter von seiner Stoßstange entfernt. Er trat voll auf die Bremse, und der Lexus brach seitlich aus. Die Scheinwerfer malten wilde Bilder auf die Regenwand und die schwarzen Baumstämme. Der Wagen drehte sich um hundertachtzig Grad und blieb in der entgegengesetzten Fahrtrichtung stehen.
Einen Moment lang saß er einfach nur da, schwer atmend und das Lenkrad so fest umklammernd, dass seine Knöchel schmerzten. Er hatte noch nie an Geister geglaubt, konnte unmöglich gesehen haben, was seine Augen ihn glauben machen wollten. Wanetta Hochstetler war seit fünfunddreißig Jahren tot. Bestimmt hatte der Alkohol ihm einen Streich gespielt.
Da die Möglichkeit bestand, dass zufällig eine Polizeistreife vorbeikam und sehen würde, wie er mitten in der Nacht hier im Auto saß, mit zittrigen Händen und einer Whiskyfahne, wendete er den Wagen. Doch wegfahren konnte er nicht. Erst musste er sich vergewissern. Er starrte durch die Windschutzscheibe, kniff die Augen zusammen, aber im Licht der Scheinwerfer war nichts zu erkennen, weder auf der Straße noch auf dem Seitenstreifen. Als sein Blick auf einen alten Briefkasten fiel, machte sich ein mulmiges Gefühl in ihm breit. Dieser hatte über Jahrzehnte Dutzende Schläge mit Bierflaschen oder Baseballschlägern von Teenagern abbekommen, und sogar Löcher von Schrotkugeln waren zu sehen. Nur der Name darauf war noch immer gut lesbar: HOCHSTETLER.
Er zwang sich auszusteigen, auch wenn er weder eine Regenjacke noch eine Taschenlampe dabeihatte. Die Pistole in seiner Jackentasche hatte keine beruhigende Wirkung, und sicherer fühlte er sich damit auch nicht. Er stellte den Jackenkragen hoch, machte die Tür auf und trat hinaus in die Nacht, ließ den Motor aber laufen. Regen peitschte ihm ins Gesicht, Wasser lief ihm in den Kragen, und die Kälte umklammerte seinen Nacken wie Totenfinger.
»Ist da jemand?«, rief er.
Er ging zur Vorderseite des Wagens und sah sich Stoßstange und Motorhaube an. Keine Dellen, kein Blut. Um ganz sicher zu sein, fuhr er auf der Beifahrerseite mit der Hand über den Kotflügel, doch nicht der geringste Kratzer war zu spüren. Er hatte nichts angefahren, weder einen Menschen noch etwas anderes. Seine müden Augen hatten ihn zum Narren gehalten …
Er stand neben der Beifahrertür und wollte gerade wieder einsteigen, als sie aus dem nebelhaften Dunkel trat. Ihr Anblick ließ ihn vor Angst erstarren. Doch es war mehr als Angst: Es war die Erkenntnis, dass er sich geirrt hatte. Dass die Zeit nichts vergaß, auch wenn man es noch so sehr wollte – und jetzt wurde abgerechnet.
Das Kleid klebte an ihrem Körper, der noch immer fest und schlank war. Regen und Dunkelheit verschleierten ihre Gesichtszüge, nur ihr rosiger Mund mit den vollen Lippen war deutlich zu erkennen. Langes Haar ohne jedes Grau. Aber wie konnte es sein, dass sie dort stand, nach all den Jahren unverändert? Nach allem, was mit ihr passiert war. Was sie mit ihr gemacht hatten.
»Sie können es nicht sein.« Seine Stimme krächzte wie die eines alten Mannes auf dem Totenbett, der an seinem eigenen Auswurf würgte. Der um ein Wunder flehte, wohl wissend, dass es hoffnungslos war.
Das Lächeln, das jetzt ihren Mund umspielte, ließ ihn das Blut in den Adern gefrieren. »Sie scheinen überrascht, mich zu sehen.«
»Sie sind tot.« Mit zittrigen Fingern rieb er sich übers Gesicht, blinzelte das Wasser aus seinen Augen. Doch sie verschwand nicht, stand noch immer da, lebendig und vertraut wie die Frau, die ihn seit fünfunddreißig Jahren in seinen Albträumen heimsuchte. »Wie –«
Sie sah ihm unverwandt in die Augen und ließ den Blick auch nicht von ihm, als sie die Fahrertür seines Wagens öffnete und den Motor abstellte. Mit dem Schlüssel in der Hand, ging sie zum Kofferraum, drückte auf den Knopf. Die Verriegelung klickte, und der Deckel sprang auf.
»Reinlegen«, sagte sie.
Als er keine Anstalten machte, ihrer Aufforderung nachzukommen, richtete sie plötzlich einen Revolver auf ihn. Er dachte an die Walther in seiner Jackentasche und ob er an sie herankommen könnte, bevor sie auf ihn schoss.
Er hob die Hände. »Was wollen Sie?«
Die Pistole in Kopfhöhe, trat sie so dicht vor ihn, dass die Mündung keinen Meter von seiner Stirn entfernt war. Ihre Hand mit dem Finger am Abzug war vollkommen ruhig. »Los.«
Unkontrolliert zitternd, legte er sich in den Kofferraum, sah zu ihr hoch. »Wir wollten das nicht. Ich schwöre, das haben wir nicht gewollt.«
Den Schuss hörte er nicht.
Belinda Harrington stand auf der Veranda vom Haus ihres Vaters und klopfte so fest an die Tür, dass ihr die Finger weh taten. »Dad?« Sie wartete einen Moment, dann hämmerte sie noch ein paarmal mit dem Handballen dagegen. »Dad? Bist du zu Hause?«
Seit zwei Tagen versuchte sie, ihn telefonisch zu erreichen, aber er hatte nie zurückgerufen. Was nicht ungewöhnlich war, denn er legte größten Wert auf seine Unabhängigkeit. Wenn ihm gerade der Sinn danach stand, hatte er ihre Anrufe auch früher schon ignoriert. Aber zwei Tage waren eine lange Zeit, selbst für Dale Michaels.
Da sie vergessen hatte, einen Schirm mitzunehmen, blickte sie im Schutz der Veranda durch die vom Dach fallende Regenwand hindurch zur Auffahrt, wo sein Lexus auf dem üblichen Platz stand; ihr Vater musste also irgendwo hier sein. Sie fragte sich, ob er vielleicht eine Frau kennengelernt hatte und sich mit ihr in einem Hotel in Wooster oder bei ihr zu Hause vergnügte. Zuzutrauen war es ihm. Ihre Mom hatte es zwar nie offen ausgesprochen, aber Belinda mehr als deutlich zu verstehen gegeben, dass Treue nie Dale Michaels Stärke gewesen war.
Die Hände um den Mund gelegt, rief sie noch mal. »Dad!«
Ihr Blick wanderte zu der zwanzig Meter entfernten Scheune, und sie sah, dass die Schiebetür ein Stück offen stand. Bei ihrem Vater war zwar noch nie eingebrochen worden, aber was Sicherheitsvorkehrungen betraf, war er geradezu fanatisch. Er würde niemals das Scheunentor offen lassen, schon gar nicht, wenn er außer Haus war. Und sie spürte, wie auf einmal ein ungutes Gefühl Besitz von ihr ergriff. Hatte er die Hühner gefüttert und war gestürzt? Lag er in der Scheune und konnte nicht aufstehen, wartete auf Hilfe? Er hatte bislang kaum Unfälle, aber vielleicht war ja doch etwas passiert. Und wenn er einen Herzanfall gehabt hatte?
Mit der Jacke über dem Kopf, lief sie zur Scheune. Es schüttete wie aus Eimern, so dass ihre Schuhe und der Hosensaum pitschnass waren, als sie das Scheunentor erreichte und ein Stück weiter aufschob. Sie huschte hinein, schüttelte die Jacke aus und zog sie wieder an. Drinnen war es dunkel und roch nach Hühnerdreck und modrigem Heu. Ein paar Meter weiter scharrten und pickten drei Bantam-Hennen auf dem Erdboden herum. Blöde Dinger. Sie hatte sich schon immer gefragt, warum ihr Vater solche Hühner hielt. Die Hälfte der Zeit legten sie keine Eier und zerpflückten dafür die Petunien, die sie ihm letztes Frühjahr gepflanzt hatte. Es war kalt hier drin, und sie zog die Jacke zu. Dann knipste sie das Licht an, und eine einzelne Birne erhellte spärlich den Raum.
»Dad? Bist du hier?«
Belinda lauschte angestrengt, doch bei dem Regen, der unablässig auf das Blechdach trommelte, war es schwer, noch irgendetwas anderes zu hören. An Dutzenden Stellen tropfte Wasser durch das undichte Dach und bildete Pfützen auf dem Boden. Wenigstens hatten die Hühner reichlich zu trinken.
Es war eine große Scheune, in der die Pferdeboxen langsam verrotteten und Spinnweben die hohen Dachsparren überzogen. In ihrer Kindheit hatten sie und ihre Geschwister oft hier gespielt, und eine Zeitlang hatten sie sogar ein Pony gehabt. Allerdings interessierte sie sich nicht besonders für Tiere, und als dann die Immobilienfirma ihres Vaters florierte, wurde die Scheune zu einer Werkstatt umfunktioniert, in der er an seinen Autos bastelte. Die Werkbank mit der Stecktafel für Werkzeuge gab es immer noch, aber alles war mit Staub überzogen. An der Wand lehnten ein Dutzend planlos abgestellte Bretter, und in dem schwachen Licht, das durchs Fenster fiel, waren die Umrisse der alten Bodenfräse zu erkennen. Mit zwölf hatte ihr Bruder sich fast den Fuß damit abgetrennt.
Dreck klebte an ihren Schuhen, als sie hinüber zur Werkbank ging. Sie rief ein letztes Mal nach ihrem Vater, dann kehrte sie um. Auf halbem Weg zurück zur Tür weckte etwas hinter einem dicken Balken ihre Aufmerksamkeit. Vorsichtig trat sie näher, sah nach oben und hatte zwei Ledersohlen und Hosensäume vor Augen. Verstört stolperte sie zurück, wodurch die Beine und der ganze Körper in ihr Blickfeld kamen. Ein Arm hing herunter, und der Hals war in einem unnatürlichen Winkel abgeknickt.
Der Laut, der ihrem Mund entkam, war ihr fremd. Irgendwie wusste sie, dass das ihr Vater war, der dort am Dachbalken hing. Dass er tot war. Und sie fand es traurig, dass sein Leben so geendet hatte, ohne jeden Abschied. Doch alle Gefühle von Trauer oder Verlust wurden von dem Schock überdeckt, den der Anblick seines leblosen, im Tod so grotesk wirkenden Körpers bei ihr auslöste.
»Dad! O mein Gott, Dad! Was hast du getan?«
Schreiend rannte Belinda Harrington zum Scheunentor hinaus in den strömenden Regen.
2. Kapitel
John Tomasetti schneidet grüne Paprika auf der Küchenanrichte in kleine Stücke. Ich sitze am Tisch vor meinem Laptop und tue so, als würde ich ihm nicht zusehen, denn ich muss eine Mail an Bürgermeister Auggie Brock schreiben und ärgere mich im Stillen, dass Diplomatie in meinem Job eine so große Rolle spielt. Da meldet sich mein Handy.
»Und wieder mal vom Telefon gerettet«, sagt er.
Ich werfe ihm einen vieldeutigen Blick zu, stehe auf und gehe zur Kommode, wo das Telefon schon gefährlich nah an der Kante vibriert. Beim dritten Klingeln nehme ich ab. »Burkholder.«
»Ich bin’s, Glock.«
Rupert »Glock« Maddox ist einer der vier Officer meines kleinen Polizeireviers. Als ehemaliger Marine mit zwei Einsätzen in Afghanistan ist er gut ausgebildet, handelt besonnen und ist generell entspannt – alles Eigenschaften, die ich bewundere und besonders bei der Polizeiarbeit sehr schätze. Normalerweise arbeitet er die erste Schicht, doch ich erinnere mich vage, dass er sie diese Woche gegen ein paar Nachtschichten getauscht hatte.
»Hallo.« Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Tomasetti eine Zwiebel nimmt und sie auf dem Schneidebrett attackiert, was mir ein Lächeln entlockt. »Was gibt’s?«, frage ich Glock.
»Einen toten Mann auf dem Grundstück von Dale Michaels. Er hängt in der Scheune am Dachbalken.«
»Selbstmord?«
»Sieht so aus.«
»Weiß man schon, wer es ist?«
»Ich glaube, es ist Dale Michaels.«
Der Name kommt mir bekannt vor, aber persönlich kenne ich den Mann nicht. Er hatte etwas mit der Erschließung von Maple Crest, einem Wohngebiet für Reiche, zu tun. »Wer hat ihn gefunden?«
»Die Tochter.«
»Ist Doc Coblentz benachrichtigt?« Das ist der zuständige Coroner.
»Er müsste in Kürze eintreffen.«
»Ich bin in zehn Minuten da.«
»Roger.«
Ich nehme das Mobiltelefon vom Ladegerät, drehe mich um und sehe, wie Tomasetti sich die Hände am Geschirrtuch trocknet. »Klingt, als hättest du eine Leiche am Hals«, sagt er.
Ich nicke. »Glock meint, es könnte Selbstmord sein.«
»Weißt du, wer es ist?«
»Ein Mann namens Dale Michaels. Kennen tue ich ihn nicht.«
»Ist das Sheriffbüro zuständig?«
Ich schüttele den Kopf. »Es ist Sache der Stadt, also meine Zuständigkeit.« Ich blicke zu der Ablage mit dem argentinischen Cabernet, den er aufgemacht hatte, damit er atmen kann, und eine Welle der Enttäuschung durchströmt mich. »Es tut mir echt leid, aber ich muss weg.«
»Dann muss ich das ganze Gemüse wohl allein kleinschnippeln.«
»Und nicht zu vergessen, auch den ganzen Wein trinken.« Ich lächele. »Das gehört zum Risiko, wenn man mit der Polizeichefin zusammenlebt.«
Er kommt zu mir, nimmt mich in die Arme, und ich lehne mich an ihn. Er riecht nach Aftershave, grünem Paprika und seinem ureigenen Duft, den ich liebe. Ich schließe die Augen und drückte die Stirn an seine Brust, will nicht gehen. Doch diese Option habe ich beim Fund einer Leiche nicht.
»Die Domestizierung bekommt dir gut, Tomasetti.«
»Du willst mich doch sowieso nur wegen meiner Kochkünste.«
»Nicht nur, aber auch deswegen.« Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und drücke ihm sanft einen Kuss auf den Mund. »Es kann dauern.«
»Ich werde warten.«
Ich entziehe mich seiner Umarmung und nehme meine Jacke von der Stuhllehne. Beim Blick über die Schulter sehe ich, dass er das Messer schon in der Hand hat und weiter die Zwiebel kleinhackt. »Trink nicht den ganzen Wein allein.«
»Bleib nicht zu lange weg.«
Als ich zur Tür hinausgehe, haben wir beide ein Lächeln im Gesicht.
3. Kapitel
In einer Nacht wie dieser mit dem Auto zu fahren ist wirklich kein Vergnügen. Es regnet und stürmt dermaßen heftig, dass ich für die Strecke von Wooster bis zu Dale Michaels’ Grundstück, das gerade noch innerhalb der Stadtgrenze von Painters Mill liegt, fast zwanzig Minuten brauche. Zweimal muss ich die Geschwindigkeit reduzieren, einmal wegen einer überfluteten Straße, und ein andermal schaffen die Scheibenwischer die Wassermengen kaum. Die Farm von Michaels liegt an einer schmalen Straße parallel zu den Eisenbahnschienen, die durch die Stadt verlaufen. Als ich abbiege, fällt das Licht meiner Scheinwerfer auf einen Schotterweg mit hohem Unkrautstreifen in der Mitte, und zum zweiten Mal an diesem Abend bin ich froh, einen höhergelegten Wagen zu fahren. Weiter vorn sehe ich das rotierende Blaulicht von Glocks Streifenwagen.
Ich parke hinter einem neueren Lincoln Navigator und stelle den Motor aus. Die Fenster in dem großen Haus im Tudorstil zu meiner Rechten sind dunkel. Links von mir erhebt sich eine massive Scheune, durch deren offenstehende Schiebetür der gelbe Lichtkegel von Glocks Taschenlampe zu sehen ist. Ich aktiviere das Funkgerät. »Bin vor Ort.«
»Verstanden, Chief«, ertönt die Stimme von Jodie Metzger. Sie arbeitet die zweite Schicht in der Telefonzentrale des Polizeireviers.
»Ich brauche eine Kennzeichenüberprüfung.«
»Legen Sie los.«
Mit zusammengekniffenen Augen sehe ich durch die Windschutzscheibe, an der der Regen in Strömen hinunterläuft, und lese das Autokennzeichen des SUV laut vor. »David, Henry, Adam, drei, sieben, null, neun.«
Am anderen Ende klappern Tasten, sie gibt das Kennzeichen in die Datenbank der Kfz-Zulassungsstelle ein. »Ein 2006er Lincoln, kein Eintrag. Registriert auf den Namen Christopher Thomas Harrington hier in Painters Mill.«
»Okay.« Ich nehme Regenjacke und Taschenlampe vom Rücksitz und steige aus. Als ich endlich die Kapuze aufhabe, sind meine Haare schon nass. Beim Betreten der Scheune trommelt der Regen lautstark auf das Blechdach. Ich stehe in einem höhlenartigen Raum mit Lehmboden und riesigen Stützbalken aus Holz. Hinter einem dieser Balken hängt am Dachsparren der Tote. Viel kann ich nicht erkennen, dafür ist es zu düster. Doch das Licht der nackten Glühbirne reicht aus, um zu sehen, dass der Kopf zur Seite hängt und die Zunge aus dem Mund quillt. Ausgetretene, elegante Herrenschuhe baumeln knapp zwei Meter über dem Boden, wo Glock gerade Leitkegel aufstellt und ein Absperrband zieht. Wie immer ist seine Uniform makellos, und seine Stiefel sind auf Hochglanz poliert. Er sieht aus, als käme er gerade vom Dreh eines Werbevideos zur Rekrutierung von Polizisten.
Eine Frau Anfang dreißig, in Steppjacke, Yogahose und lavendelfarbenen Slippern, steht links neben der Tür und weint leise in ihr zerfleddertes Papiertaschentuch. Die Tochter, denke ich. Sie hat ihn gefunden. Wahrscheinlich gehört ihr auch der Lincoln Navigator vor dem Haus. Ihre Haare, die wie nasse Korkenzieher an ihrem Kopf kleben, haben die Farbe neuer Kupfermünzen. Glock hat ihr offensichtlich seine Regenjacke angeboten, die sie sich über die Schultern gehängt hat. Trotzdem zittert sie wie Espenlaub.
Als ich zu Glock hinübergehe, suche ich ihren Blick und gebe ihr mit einem Nicken zu verstehen, dass ich gleich mit ihr sprechen möchte. »Sie hat ihn gefunden?«
Er nickt. »Sie heißt Belinda Harrington und wohnt in Painters Mill.«
»Haben Sie schon mit ihr gesprochen?«
»Nur um ihren Namen zu erfahren und in welcher Beziehung sie zu dem Toten steht. Er ist ihr Vater. Anscheinend hat sie ihn seit Tagen zu erreichen versucht und Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Weil er nie zurückgerufen hat, ist sie hergekommen. Als er auf ihr Klingeln an der Tür nicht reagierte, hat sie sich Sorgen gemacht und ist in die Scheune gegangen.«
Ich blicke hoch zu dem Toten, muss ein Schaudern unterdrücken. Der Hals ist im scharfen Winkel abgeknickt, der Strick schneidet tief in den Kehlkopf. Die Finger der linken Hand klemmen zwischen Strick und Hals, als hätte er es sich nach dem Sprung noch anders überlegt, war aber gegen das Gewicht seines Körpers machtlos. Ich bin keine Expertin, aber in meinen Jahren als Polizistin habe ich schon einige Menschen am Strick hängen sehen, und das hier ist nicht wie geplant verlaufen.
»Eine echt beschissene Art zu sterben«, sage ich leise.
Auch Glock blickt zu dem toten Mann. »Was geht nur in Leuten vor, die so etwas machen?«
Eine Antwort erspare ich mir. »Haben Sie einen Abschiedsbrief gefunden?«
Er schüttelt den Kopf. »Ich sehe mich aber noch mal genauer um, sobald wir besseres Licht hier drin haben.«
»Das Haus muss auch unter die Lupe genommen werden.« Ich zeige auf den tellergroßen feuchten Fleck am Boden unter der Leiche. »Haben Sie eine Idee, was das sein kann?«
»Sieht nach Körperflüssigkeit aus, aber sicher bin ich nicht.«
Es ist zwar nicht ungewöhnlich, dass sich die Blase eines Gehängten beim Eintritt des Todes entleert, aber irgendetwas stört mich hier. Ich leuchte mit der Taschenlampe seinen ganzen Körper ab und entdecke einen dunklen Fleck beim Hosenbund. Zu dunkel für Urin. »Das sieht nach Blut aus«, sage ich zu Glock.
»Verdammt.« Der Strahl seiner Taschenlampe verbindet sich mit meinem. »Auf dem Hemd scheint auch ein Fleck zu sein. Nasenbluten? Vielleicht ist er bei dem ruckartigen Fall an irgendwas gegengestoßen.«
»Keine Ahnung, aber wir müssen es herausfinden.« Der Tote trägt dunkle Hosen, ein weißes Hemd und ein Sportjackett. Ich lasse den Lichtstrahl langsam über den Oberkörper kreisen. Und wirklich, in dem kleinen Dreieck zwischen den Jackettaufschlägen ist tatsächlich ein dunkler Fleck auf dem Hemd.
»Machen Sie ein paar Fotos von Opfer und Fundort, ja? Sobald die Feuerwehr ihn runtergeholt hat, sehen wir ihn uns genauer an.« Ich blicke zu der Frau bei der Tür. »Ich rede mit der Tochter.«
»Alles klar.«
Ich überlasse Glock seiner Arbeit und gehe zu der Frau. »Mrs Harrington?«
Sie schnieft heftig in ihr Papiertaschentuch, von dem nur noch Fetzen übrig sind, und wirft bekümmerte Blicke zum Leichnam ihres Vaters. Als ich auf sie zugehe, sieht sie mich mit riesigen, schreckgeweiteten Augen an. »Mein Gott, ich kann nicht fassen, dass er tot ist.«
»Es tut mir leid.«
Sie schließt die Augen, und ich sehe eine einzelne künstliche Wimper auf ihrer Wange kleben. »Ich fasse es nicht, dass er so etwas tun konnte.«
Diese Worte höre ich nicht zum ersten Mal. Die meisten Familienangehörigen von Selbstmördern sind im ersten Moment fassungslos. Erst nachdem sie genügend Zeit hatten, über die Dinge nachzudenken, die er oder sie in den Wochen und Monaten vor der Tat gesagt oder getan hatte, wird ihnen bewusst, dass es Hinweise gegeben hatte. Doch dann ist es schon zu spät.
»Ich bin Chief of Police Kate Burkholder.« Wir schütteln uns die Hand. »Fühlen Sie sich in der Lage, mir ein paar Fragen zu beantworten?«
»Ja, geht schon.« Ihr Blick huscht jedoch immer wieder zu ihrem toten Vater. »Können Sie nicht dafür sorgen, dass man ihn da runterholt? Ich halte es kaum aus, ihn so zu sehen. Sein Hals … O Gott.«
»Das machen die Feuerwehrleute, sobald sie mit der entsprechenden Ausrüstung und ein paar Scheinwerfern eintreffen. Sie sind schon unterwegs.« Ich zeige auf die etwa sechs Meter entfernte Werkbank und gehe los. Sie folgt mir.
An der Werkbank drehe ich mich um und sehe sie an, so dass sie mit dem Rücken zu der Leiche stehen bleibt. »Wann haben Sie Ihren Vater zum letzten Mal gesehen?«
»Oje. Vor einer Woche, am Sonntag, glaube ich. Da haben wir in LaDonna’s Diner zusammen Mittag gegessen.«
Ich ziehe meinen Notizblock hervor und notiere es. »Standen Sie sich nahe?«
Sie holt ein frisches Taschentuch aus ihrer Handtasche und tupft sich über die Augen. »Ich sehe ihn nicht mehr so oft wie früher. Aber als ich jünger war, standen wir uns nahe. Er war ein guter Vater.« Sie gibt einen Laut von sich, halb Lachen, halb Schluchzen. »Er war ganz vernarrt in seine Enkelkinder.« Sie verzieht das Gesicht und fängt an zu weinen.
Den Hinterbliebenen Trost zu spenden gehört nicht unbedingt zu meinen Stärken, doch inzwischen war ich schon oft genug in der Situation, um es irgendwie hinzukriegen. Ich lege mitfühlend die Hand auf ihren Arm. »Hat er zu Depressionen geneigt?«
»Eben nicht, deshalb ist das ja auch so ein Schock. Er war vom Typ her ganz anders, nie niedergeschlagen oder so. Er war stark … damit will ich nicht sagen, dass depressive Menschen schwach sind, aber …«
»Hatte er gesundheitliche Probleme?«
»In den letzten Jahren hat er langsamer gemacht, und manchmal hat er über seine Knie geklagt. Ach ja, und vor sechs Monaten ist ihm eine kleine Stelle Hautkrebs entfernt worden. Aber seither nichts mehr. Er war kerngesund.«
»Irgendwelche Probleme mit Drogen oder Alkohol?«
»Drogen hat er nie genommen und auch nicht übermäßig getrunken, soviel ich weiß.«
»Hatte er in letzter Zeit viel Stress?«
»Er hat nie etwas erwähnt.«
»Gab es Todesfälle in der Familie? Oder ist jemand gestorben, der ihm nahestand?«
»Nein.«
»Finanzielle Probleme?«
»Nein. In den späten neunziger Jahren hat er viel Geld bei der Erschließung des Maple-Crest-Wohngebiets gemacht, dadurch war er für alle Zeit saniert.«
»Wie steht es mit Freunden, Belinda?«
»Er traf sich öfter mit ein paar Altersgenossen. Sie haben sich gegenseitig besucht, Poker gespielt oder sind essen gegangen.«
»Kennen Sie ihre Namen?«
Sie senkt den Kopf, presst sich die Handballen auf die Augen. »Um ehrlich zu sein, nein.«
Zum ersten Mal habe ich den Eindruck, dass ihre Trauer mit Schuldgefühlen durchwoben ist, weil sie sich nicht mehr so nahegestanden haben wie früher.
»Hatte er eine Freundin?«, frage ich.
Belinda schüttelt den Kopf. »Nicht, dass ich wüsste. Aber in solchen Dingen war er sehr verschwiegen … Privatsache, pflegte er zu sagen.«
An der Tür tut sich etwas. Deputy Frank Maloney vom Holmes-County-Sheriffbüro schleppt einen großen Scheinwerfer herein, die orangefarbene Verlängerungsschnur wie ein Seil über die Schulter gehängt. Ich greife in meine Jackentasche und hole eine Visitenkarte heraus, reiche sie der Frau. »Mrs Harrington, rufen Sie mich bitte an, wenn Ihnen noch etwas einfällt, was wichtig sein könnte.«
»Ja, natürlich.«
Ich zeige mit dem Kopf zur Leiche ihres Vaters. »Sie müssen das jetzt nicht mit ansehen. Und wenn Sie sich nicht in der Lage fühlen, Auto zu fahren, kann ich einen Familienangehörigen anrufen, oder ein Officer bringt Sie nach Hause.«
»Danke, das ist nicht nötig.« Sie schüttelt den Kopf. »Jetzt hier zu sein ist das mindeste, was ich für ihn tun kann.«
Ich will gerade gehen, als mir noch eine Frage einfällt. »Mrs Harrison, besitzen Sie einen Schlüssel zu seinem Haus?«
»Ja. Warum?«
»Möglicherweise hat er einen Abschiedsbrief hinterlassen.«
»Oh.« Sie verzieht das Gesicht. »Daran habe ich überhaupt nicht gedacht.«
»Ist es okay, wenn wir uns drinnen umsehen?«
»Sicher. Wenn das nötig ist.«
Ich verabschiede mich mit einem Nicken und gehe. Inzwischen ist auch der Coroner von Holmes County, Dr. Ludwig Coblentz, eingetroffen. Seine rundliche Gestalt steckt in einem übergroßen Arztkittel, sein Markenzeichen, und über die Schulter hat er eine Regenjacke gehängt. Ein junger Techniker ist bei ihm. Dem Kinnflaum nach zu urteilen, ist er noch in der Ausbildung und ein Neuling bei Einsätzen vor Ort. Mal sehen, wie lange er durchhält.
Während der Doktor die Schutzkleidung überstreift, öffnet der Techniker, bereits in voller Montur, den Reißverschluss des Leichensacks. In einigen Metern Entfernung, nahe der Schiebetür, stehen zwei Sanitäter vom Pomerene Hospital in Millersburg und sehen ihnen zu. Ein freiwilliger Helfer der Feuerwehr hat unter der Leiche eine Podestleiter aufgestellt, auf der ein zweiter Feuerwehrmann steht und offensichtlich überlegt, wie er den Toten am besten herunterholt.
Ich gehe zu Doc Coblentz. »Haben Sie Schnelltests für Blut dabei?«, frage ich ihn und zeige auf die Flüssigkeit am Boden unter der Leiche.
»Ja, haben wir.« Er nickt dem Techniker zu. »Randy, machen Sie das, bitte?«
Der Techniker klappt den Ausrüstungskoffer auf und nimmt einen Hemastix-Teststreifen aus einem der Plastikbehälter.
»Wir testen die Flüssigkeit auf Hämoglobin, was wiederum auf Blut hinweisen würde«, erklärt Coblentz. »Wenn es vorhanden ist, ändert sich die Farbe.«
Wir sehen dem Techniker dabei zu, wie er das farbige Ende des Teststreifens auf die feuchte Erde drückt. Innerhalb von Sekunden wird die Spitze grün.
»Positiv«, ruft er zu uns herüber.
Maloney steht nahe der Werkbank und verbindet gerade den Scheinwerferstecker mit dem Stecker der Verlängerungsschnur. Augenblicklich erstrahlt die Scheune in grellem Neonlicht, und ich sehe die Leiche zum ersten Mal hell erleuchtet – und auch der rotschwarze Fleck auf dem Hemd ist nun gut zu sehen.
»Zu viel Blut für einen, der sich aufgehängt hat«, bemerkt der Doc kopfschüttelnd.
»Holen wir ihn runter und sehen ihn uns genau an«, erwidere ich.
Schweigend beobachten wir, wie der Feuerwehrmann auf der Leiter den Strick mit einem Messer durchtrennt und den Toten langsam nach unten lässt, wo Doc Coblentz und der Techniker mit dem geöffneten Leichensack stehen. Sobald der Tote den Boden mit den Schuhen berührt, zieht der Techniker seine Füße ans untere Ende des Sacks und bettet den Körper in Rückenlage. Da seine Beine vollkommen steif sind, kann er nicht allzu lange hier gehangen haben, denn die Totenstarre ist nach cirka zwölf Stunden voll ausgeprägt und klingt nach vierundzwanzig bis sechsunddreißig Stunden wieder ab. Der Anblick wäre um einiges grausiger gewesen, hätte man ihn erst dann entdeckt.
Im grellen Licht der Arbeitsleuchte ist Dale Michaels’ Gesicht violett und geschwollen. Seine Zunge ist doppelt so groß wie normal und hängt wie eine überreife Frucht aus dem Mund. Das Fleisch um die Augen ist aufgeschwemmt, die Haut gleicht Krepppapier und ist beinahe schwarz; die getrübten Augäpfel sind mit blutroten, stecknadelgroßen Punkten durchzogen. Obwohl ich jetzt fast zwei Meter zurücktrete, ist der Gestank nach Urin und Kot schwer zu ertragen.
Tote Menschen sind nie ein schöner Anblick, egal ob die Ursache ihres Todes gewaltsamer oder natürlicher Art ist. Und Dale Michaels’ Ableben scheint besonders brutal gewesen zu sein. Der Doc hat den Strick von seinem Hals genommen, an dem jetzt eine fünf Zentimeter tiefe Kerbe sowie schwere Hautabschürfungen zu sehen sind. Das gelbe, etwa zwölf Millimeter dicke, neun Meter lange und mit Blut und Hautfetzen behaftete Nylonseil wird gerade vom Techniker aufgerollt und in einem Beweismittelbeutel verstaut.
Die polizeilichen Untersuchungen sind bei einem Selbstmord weniger genau als bei Mord, der Fundort muss aber dokumentiert werden. Zudem ist es im Bundesstaat Ohio Vorschrift, bei Todesfällen mit ungeklärter Ursache – wenn also Fremdeinwirkung nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann – eine Autopsie durchzuführen. Das trifft auch hier zu. Aber sobald klar ist, dass es sich nicht um ein Verbrechen handelt, gibt es keine weiteren Ermittlungen.
Während der Doc sich an die Arbeit macht, stelle ich mir schon vor, dass der Fall in ein paar Stunden erledigt ist, ich nach Hause fahre und Tomasetti helfe, die Flasche Cabernet zu leeren. Doch der Blick, den er mir jetzt über die Schulter zuwirft, verheißt nichts Gutes.
»Chief, hier stimmt etwas nicht.«
Ich gehe zu ihm hin und knie mich neben ihn. Mit behandschuhten Händen öffnet er das Jackett, wobei ein halb im Hosenbund steckendes Hemd sichtbar wird, mit einem Loch so groß wie mein kleiner Finger. Drumherum ist ein großer Blutfleck, der die Unterwäsche durchtränkt und sich bis hinunter zum Hosenbund zieht.
»Das ist der Grund für das Blut«, sagt er. »Sieht mir ganz nach einer Schusswunde aus.«
»Selbst zugefügt?«, frage ich.
»Schwer zu sagen.« Er sieht mich über den Brillenrand hinweg an. »Allerdings bin ich mir relativ sicher, dass er gelebt hat, als die Kugel ihn traf. Es gibt zwar nicht allzu viel Blut, aber genug, dass sein Herz wohl noch geschlagen hat.«
»Das heißt, er hat die Schusswunde bekommen, bevor er am Strick hing?«, frage ich.
»Richtig«, bestätigt Doc Coblentz.
Ich sehe Glock und Maloney an. »Haben Sie eine Schusswaffe gefunden?«
»Nein«, murmelt Glock. »Aber ich habe mich auch nur flüchtig umgesehen.«
»Vielleicht hat er sich im Haus den Schuss zugefügt und ist in die Scheune gegangen, um es hier zu Ende zu bringen«, sagt Maloney.