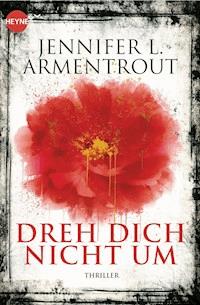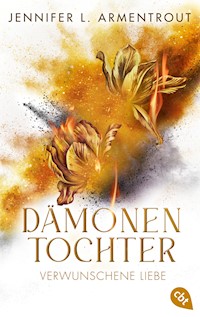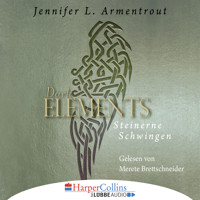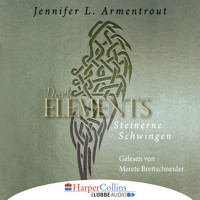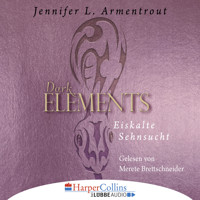8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Eine Liebe so groß wie die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft...
Mallory und Rider kennen sich seit ihrer Kindheit. Vier Jahre haben sie sich nicht gesehen und Mallory glaubt, dass sie sich für immer verloren haben. Doch gleich am ersten Tag an der neuen Highschool kreuzt Rider ihren Weg – ein anderer Rider, mit Geheimnissen und einer Freundin. Das Band zwischen Rider und Mallory ist jedoch so stark wie zuvor. Als Riders Leben auf eine Katastrophe zusteuert, muss Mallory alles wagen, um ihre eigene Zukunft und die des Menschen zu retten, den sie am meisten liebt …
Eine unvergessliche, dramatische und romantische Liebesgeschichte von der SPIEGEL-Bestsellerautorin, die mitten ins Herz trifft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 669
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
DIE AUTORIN
Foto: © Vania
Jennifer L. Armentrout schreibt Romane für Jugendliche und Erwachsene und wurde bereits vielfach ausgezeichnet. Ihre Bücher klettern immer wieder auf Platz 1 der New York Times-Bestsellerliste und ihr Spiegelbestseller Obsidian wird derzeit verfilmt. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrem Hund Loki in West Virginia. Wenn sie nicht gerade liest oder schlechte Zombie-Filme anschaut, arbeitet sie an ihrem neuesten Roman.
Mehr zur Autorin auch auf www.jenniferarmentrout.com
Mehr zu cbt auf Instagram @hey_reader
Von der Autorin sind außerdem bei cbt erschienen:
Die Dämonentochter-Reihe
Verbotener Kuss (Band 1)
Verlockende Angst (Band 2)
Verführerische Nähe (Band 3)
Verwunschene Liebe (Band 4)
Verzaubertes Schicksal (Band 5)
Jennifer L. Armentrout
MORGEN
LIEB ICH DICH
FÜR IMMER
Aus dem Amerikanischen
von Anja Hansen-Schmidt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe März 2017
© 2016 by Jennifer L. Armentrout
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel
»The Problem with Forever« bei Harlequin Teen.
© 2017 für die deutschsprachige Ausgabe by
cbt Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Aus dem Amerikanischen von Anja Hansen-Schmidt
Lektorat: Monika Hofko
Umschlaggestaltung: Geviert, Grafik & Typografie,
Andrea Hollerieth unter Verwendung mehrerer Motive von
© shutterstock (Aleshyn_Andrei/Tasiania/Olga Zakharova)
he · Herstellung: AnG
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-20002-2V006
www.cbt-buecher.de
Für alle, die noch auf der Suche nach ihrer Stimme sind,
und für die, die sie bereits gefunden haben.
Prolog
Der Stapel mit den staubigen leeren Schuhkartons war höher und breiter als ihr schmaler Körper, und er schwankte, als sie den Rücken dagegenpresste, die knochigen Knie bis zur Brust hochgezogen.
Atmen. Immer schön atmen. Atmen.
So geräuschlos wie nur möglich drückte sie sich in den hintersten Winkel des schmutzigen Schranks. Sie saugte ihre Unterlippe zwischen die Zähne und zwang sich, die staubige Luft einzuatmen. Tränen traten ihr in die Augen.
Wie hatte ihr das nur passieren können? Miss Becky hatte recht, sie war wirklich ein böses Mädchen.
Dabei hatte sie doch nur die schmutzige, fleckige Dose mit dem aufgedruckten Bär vom Küchenschrank herunterholen wollen, in der die Kekse versteckt waren, die so seltsam schmeckten. Eigentlich war es ihr nicht erlaubt, sich ohne zu fragen einen Keks oder etwas zu essen zu nehmen, aber ihr Bauch hatte schon ganz wehgetan vor Hunger, und Miss Becky war wieder einmal krank auf dem Sofa gelegen und hatte geschlafen. Und sie hatte den Aschenbecher doch nicht hinunterwerfen wollen, sodass er in winzige Stücke zerbarst. Ein paar davon waren so spitz wie die Eiszapfen, die im Winter vom Dach herabhingen, andere so klein wie Krümel.
Sie hatte doch nur einen Keks nehmen wollen.
Ihre schmalen Schultern zuckten zusammen, als etwas gegen die Wand auf der anderen Seite des Schranks krachte, und sie biss sich noch fester auf die Lippe. Ein metallischer Geschmack breitete sich in ihrem Mund aus. Morgen würde ein Loch im Putz klaffen, so groß wie Mr Henrys riesige Hand, und Miss Becky würde weinen und wieder krank sein.
Das leise Quietschen der Schranktür hallte in ihren Ohren wie ein Donnerschlag.
Oh nein, nein, nein …
Er durfte sie nicht finden hier drin. Der Schrank war ihr Zufluchtsort, wenn Mr Henry wütend auf sie war oder wenn er …
Sie erstarrte und riss erschrocken die Augen auf, als eine Gestalt, etwas größer und breiter als sie, in das staubige Dunkel glitt und sich vor sie hinkniete. Sie konnte sein Gesicht nicht deutlich erkennen, aber ihr Bauch und ihr Herz wussten sofort, dass er es war.
»Es tut mir so leid«, hauchte sie.
»Ich weiß.« Seine Hand legte sich beruhigend auf ihre Schulter. Er war der einzige Mensch, bei dem es sie nicht störte, wenn er sie berührte. »Du musst hier drinbleiben, kapiert?«
Miss Becky hatte einmal gesagt, er sei nur ein halbes Jahr älter als sie mit ihren sechs Jahren, aber er kam ihr viel größer und älter vor, weil er der einzige sichere Anker in ihrer Welt war.
Sie nickte.
»Du darfst auf keinen Fall rauskommen«, sagte er und drückte ihr die rothaarige Puppe in die Hand, die sie bei ihrer Flucht aus der Küche verloren hatte. Sie hatte sich zu sehr gefürchtet, um Velvet zu holen, auch wenn sie ganz verzweifelt deswegen war, weil er ihr diese Puppe vor vielen, vielen Monaten geschenkt hatte. Sie wusste nicht, wo er Velvet aufgetrieben hatte, aber eines Tages hatte er einfach mit ihr dagestanden, und seitdem gehörte die Puppe ihr, ihr ganz allein.
»Du bleibst hier drin. Egal, was passiert.«
Sie drückte die Puppe an sich, zwischen Knie und Brust geklemmt, und nickte noch einmal.
Er richtete sich auf und erstarrte, als ein zorniges Gebrüll die Wände um sie herum erschütterte.
Ein eisiger Schauer lief ihr über den Rücken – es war ihr Name, der mit solcher Wut durch das Haus geschrien wurde. Ein leises Wimmern drang aus ihrem Mund, und sie flüsterte: »Ich wollte doch nur einen Keks holen.«
»Keine Angst. Ich hab dir doch versprochen, dass ich immer auf dich aufpasse. Du musst nur ganz leise sein.« Er drückte ihr beruhigend die Schulter. »Bleib ganz still hier sitzen, und wenn ich … wenn ich zurückkomme, lese ich dir was vor, okay? Von mir aus auch das Buch mit dem blöden Hasen.«
Sie konnte nur nicken, denn es war schon einmal vorgekommen, dass sie nicht still gewesen war, und die Folgen würde sie nie vergessen. Aber sie wusste auch, was passieren würde, wenn sie still blieb. Dann würde er ihr heute Abend nichts vorlesen können. Und morgen würde er nicht zur Schule gehen, und gar nichts war gut, auch wenn er immer sagte, es sei nicht so schlimm.
Einen kurzen Augenblick blieb er noch bei ihr, dann schlüpfte er aus dem Schrank. Mit einem leisen Klicken schloss sich die Zimmertür hinter ihm. Sie nahm ihre Puppe und vergrub das tränenüberströmte Gesicht in dem weichen Bauch. Ein Knopf an Velvets Brust bohrte sich in ihre Wange.
Sei ganz still.
Mr Henry fing an zu schreien.
Sei ganz still.
Schwere Schritte trampelten durch den Flur.
Sei ganz still.
Ein lautes Klatschen ertönte, dann ein dumpfer Schlag, als etwas zu Boden fiel. Miss Becky schien es wieder besser zu gehen, denn sie brüllte plötzlich ebenfalls herum. Doch hier im Schrank zählte nur das harte Klatschen einer fleischigen Faust auf einem mageren Kinderleib, das wieder und wieder zu hören war. Sie öffnete den Mund und schrie lautlos in den Bauch ihrer Puppe hinein.
Sei ganz still.
1
In vier Jahren konntesich vieles ändern.
Kaum zu glauben, dass es schon so lange her war. Vier Jahre, seit ich das letzte Mal in einer Schule gewesen war. Vier Jahre, seit ich mit jemandem geredet hatte, der nicht zu dem kleinen vertrauten Kreis von Menschen um mich herum gehörte. Vier Jahre, in denen ich mich auf diesen Moment vorbereitet hatte; trotzdem hatte ich das Gefühl, ich müsste die wenigen Löffel Müsli, die ich hinuntergewürgt hatte, in hohem Bogen wieder von mir geben.
In vier Jahren konnte sich vieles ändern. Die Frage war nur: Hatte ich mich auch verändert?
Das Klirren eines Löffels riss mich aus meinen Gedanken.
Das war schon der dritte Löffel Zucker, den Carl Rivas unauffällig in seinen Kaffee schaufelte. Und wenn er sich unbeobachtet fühlte, würde er noch zwei dazutun. Für einen Mann Anfang fünfzig war er schlank und gut in Form, trotz seiner krassen Sucht nach Zucker. In seinem Arbeitszimmer, in dem sich überall dicke medizinische Fachzeitschriften stapelten, gab es eine Schublade in seinem Schreibtisch, die aussah, als hätte er einen Süßwarenladen geplündert.
Wieder wollte er nach dem Löffel in der Zuckerdose greifen und blickte über die Schulter. Seine Hand erstarrte.
Ich grinste ihn von der Kücheninsel aus an, wo ich vor meiner vollen Müslischale saß.
Seufzend drehte er sich zu mir, lehnte sich an die steinerne Arbeitsplatte und musterte mich über den Rand seines Kaffeebechers hinweg. Seine tiefschwarzen Haare, die er aus der Stirn gekämmt trug, wurden an den Schläfen allmählich grau. Ich fand, dass ihm das zusammen mit seiner olivfarbenen Haut einen distinguierten Eindruck verlieh. Er sah gut aus, genau wie seine Frau Rosa. Na ja, in ihrem Fall war »gut aussehend« eher untertrieben. Mit der dunklen Haut und den dichten Locken, in denen kein einziges graues Haar zu sehen war, sah sie fast schon atemberaubend schön aus, was durch ihre stolze, aufrechte Haltung noch betont wurde.
Rosa hatte nie Angst, für sich oder andere einzustehen.
Vorsichtig legte ich den Löffel in die Schüssel, damit er ja nicht gegen das Porzellan klirrte. Ich vermied es, unnötige Geräusche zu machen. Das war eine alte Angewohnheit von mir, die ich einfach nicht ablegen konnte. Wahrscheinlich würde sie mich mein ganzes Leben lang begleiten.
Ich schaute von meiner Schüssel auf und stellte fest, dass Carl mich beobachtete. »Bist du sicher, dass du dafür bereit bist, Mallory?«
Mein Herzschlag stockte ein wenig bei dieser so unschuldig klingenden Frage, die in Wahrheit jedoch einem geladenen Sturmgewehr gleichkam. Ich war so bereit, wie es nur ging. Wie ein Streber hatte ich meinen Stundenplan und den Raumplan der Schule ausgedruckt. Vor ein paar Tagen hatte Carl außerdem dort angerufen und meine Spindnummer erfragt. Ich wusste also ganz genau, wohin ich gehen musste. Ich hatte den Grundriss des Gebäudes praktisch auswendig gelernt. Von vorn bis hinten. Als hinge mein Leben davon ab. So lief ich auf keinen Fall Gefahr, jemanden fragen zu müssen, wo die Unterrichtsräume lagen, und ich musste auch nicht ziellos durch die Gänge irren. Gestern war Rosa sogar mit mir zur Schule gefahren, damit ich die Strecke kennenlernte und einschätzen konnte, wie lange die Fahrt dauerte.
Eigentlich hatte ich gedacht, dass Rosa an diesem Morgen da sein würde; immerhin war es ein wichtiger Tag, auf den wir ein ganzes Jahr lang hingearbeitet hatten. Und das Frühstück war eigentlich immer unsere gemeinsame Zeit. Aber Carl und Rosa arbeiteten beide als Ärzte in einem Krankenhaus. Sie war Herzchirurgin, und sie war zu einer Notoperation gerufen worden, noch bevor ich aufgestanden war. Sie konnte also nicht wirklich etwas dafür.
»Mallory?«
Ich nickte schweigend und ließ die Hände in den Schoß sinken.
Carl stellte seine Tasse hinter sich auf die Arbeitsplatte. »Bist du bereit?«, fragte er noch einmal.
Kleine Nervenknäuel zogen sich in meinem Magen zusammen und ich hätte mich am liebsten übergeben. Etwas in mir war ganz und gar nicht bereit. Heute würde ein schwerer Tag für mich werden, aber ich musste es tun. Ich sah Carl in die Augen und nickte.
Er atmete erleichtert auf. »Kennst du den Weg zur Schule?«
Ich nickte wieder, sprang vom Barhocker und nahm die Müslischale. Wenn ich jetzt losfuhr, wäre ich eine Viertelstunde zu früh da. Vielleicht gar nicht so schlecht, überlegte ich, kippte die Müslireste in den Mülleimer und räumte die Schüssel in die Spülmaschine.
Carl trat zu mir. Er war nicht besonders groß, ungefähr einsfünfundsiebzig, aber trotzdem reichte ich ihm nur bis zur Schulter. »Du musst sprechen, Mallory. Ich weiß, du bist nervös, und dir gehen tausend Sachen durch den Kopf, aber du musst sprechen. Nicht immer nur nicken oder den Kopf schütteln.«
Du musst sprechen.
Ich kniff die Augen zu. Diesen Satz hatte ich schon eine Million Mal von meinem früheren Therapeuten Dr. Taft zu hören bekommen und auch von der Logopädin, bei der ich die letzten zwei Jahre dreimal in der Woche in Behandlung war.
Du musst sprechen.
Doch dieses Mantra widersprach allem, was mir fast dreizehn Jahre lang eingebläut worden war, denn Worte bedeuteten Lärm, und Lärm wurde mit Angst und Gewalt belohnt. Aber das war lange her. Ich hatte nicht vier Jahre intensive Therapie hinter mich gebracht, nur um weiterhin zu schweigen, und Rosa und Carl hatten nicht jede freie Minute darauf verwendet, die Albträume meiner Vergangenheit zu vertreiben, nur um dann erleben zu müssen, dass ihre Anstrengungen umsonst gewesen waren.
Die Worte waren nicht das Problem. Sie schossen durch meinen Kopf wie ein Schwarm Zugvögel auf dem Weg nach Süden. Die Worte waren nie das Problem gewesen. Ich hatte genug Worte, schon immer, aber sie aus meinem Mund zu entlassen und ihnen eine Stimme zu geben, das fiel mir immer noch sehr schwer.
Ich holte tief Luft und schluckte mit trockener Kehle. »Klar. Ja. Ich bin … bereit.«
Ein kleines Lächeln erschien auf Carls Gesicht und er strich mir eine meiner langen braunen Haarsträhnen aus dem Gesicht. Meine Haare waren eigentlich eher braun als rot, aber sobald ich in die Sonne kam, leuchteten sie knallrot wie ein Feuerwehrauto. »Du schaffst das. Davon bin ich fest überzeugt. Und Rosa auch. Du musst nur selbst ganz fest daran glauben, Mallory.«
»Danke.« Meine Stimme stockte.
Nur ein einziges Wort.
Das war eigentlich viel zu wenig. Immerhin hatten Carl und Rosa mir das Leben gerettet, im wörtlichen und auch im übertragenen Sinne. Was sie betraf, war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, auch wenn es aus den allerfalschesten Gründen so gekommen war. Unsere Geschichte hätte auch aus einer dieser Nachmittagssoaps oder aus einer der Sonntagabend-Schnulzen im Fernsehen stammen können. Ein Märchen. Deshalb würde ein bloßes Danke nie reichen für das, was sie für mich getan hatten.
Und weil sie so viel für mich getan und mir so viele Möglichkeiten eröffnet hatten, wollte ich so perfekt für sie sein, wie ich nur konnte. Das war ich ihnen schuldig. Und nur darum ging es an diesem Morgen.
Hastig griff ich nach meiner Büchertasche und nach dem Autoschlüssel, bevor ich noch zusammenbrechen und losheulen würde wie ein kleines Kind, das gerade herausgefunden hatte, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt.
Als könnte Carl meine Gedanken lesen, hielt er mich an der Tür auf. »Du brauchst mir nicht zu danken«, sagte er. »Zeig es uns einfach.«
Ich wollte schon wieder nicken, doch ich bremste mich gerade noch. »Okay«, flüsterte ich.
Da lächelte er. »Viel Glück.«
Ich öffnete die Haustür und trat auf die schmale Vortreppe in die warme Luft und den hellen Sonnenschein eines späten Augustmorgens. Mein Blick wanderte über den Vorgarten, der so gepflegt war wie die Gärten aller Häuser in Pointe, dem Viertel von Baltimore, in dem wir wohnten.
Manchmal konnte ich es immer noch nicht fassen, dass ich in so einem Haus wohnte – in einem großen Haus mit einem Garten und mit schön bepflanzten Blumenbeeten. Und in der gerade erst frisch geteerten Einfahrt daneben stand ein Auto, das mir gehörte.
An manchen Tagen kam mir das total unwirklich vor. So als würde ich jeden Moment aufwachen und säße wieder in dem …
Mit einem Kopfschütteln vertrieb ich diese düsteren Gedanken und ging zu dem zehn Jahre alten Honda Civic in der Einfahrt. Das Auto hatte ursprünglich Rosas und Carls richtiger Tochter Marquette gehört. Es war ein Geschenk zum Schulabschluss gewesen, bevor sie aufs College ging, um Medizin zu studieren wie ihre Eltern.
Ihre richtige Tochter.
Dr. Taft hatte mich immer korrigiert, wenn ich Marquette so nannte, weil er fand, es würde Rosas und Carls Gefühlen für mich nicht gerecht. Ich hoffte, dass er recht hatte, denn an manchen Tagen kam ich mir ein bisschen so vor wie das große Haus mit dem gepflegten Garten.
An manchen Tagen fühlte ich mich nicht richtig echt.
Marquette hatte es nie aufs College geschafft. Ein Aneurysma. Gerade lebte sie noch, und eine Minute später war sie tot, und niemand konnte etwas tun. Ich denke, das war das Schlimmste für Rosa und Carl – sie hatten so vielen Menschen das Leben retten können, nur nicht dem einen, der ihnen am meisten bedeutete.
Es war ein seltsames Gefühl, dass ihr Auto jetzt mir gehörte, so als wäre ich ein Ersatzkind. Carl und Rosa bemühten sich zwar, dass ich mich nicht so fühlte, und ich würde es auch niemals laut aussprechen, doch jedes Mal, wenn ich hinter dem Lenkrad saß, musste ich an Marquette denken.
Ich legte meine Tasche auf den Beifahrersitz. Mein Blick wanderte über das Armaturenbrett und landete schließlich im Rückspiegel. Meine Augen waren viel zu groß. Ich sah aus wie ein Reh, das gleich von einem Laster überfahren wird, falls ein Reh überhaupt blaue Augen haben konnte. Die Haut um meine Augen herum war blass, meine Stirn gerunzelt. Ich sah verängstigt aus.
Mist.
An meinem ersten Schultag wollte ich diesen Eindruck eigentlich vermeiden.
Ich wollte schon wegschauen, da fiel mir der silberne Anhänger ins Auge, der am Rückspiegel baumelte. Er war nicht viel größer als eine Münze. In einem ovalen Kreis war ein bärtiger Mann eingraviert, der mit einer Feder in ein Buch schrieb. Und über ihm stand HEILIGER LUKAS und darunter BETE FÜR UNS.
Lukas war der Schutzheilige der Ärzte.
Die Kette hatte Rosa gehört. Ihre Mutter hatte sie ihr geschenkt, als sie mit dem Medizinstudium anfing, und Rosa hatte sie mir geschenkt, nachdem ich ihr gesagt hatte, ich sei so weit, für mein letztes Schuljahr wieder auf eine normale Schule zu gehen. Bestimmt hatte die Kette vorher irgendwann auch Marquette gehört, doch ich hatte sie nie danach gefragt.
Ich glaube, beide, Rosa und Carl, hofften, ich würde in Marquettes Fußstapfen treten. Doch um Chirurgin zu werden, brauchte man Durchsetzungsvermögen, Selbstvertrauen und verdammt viel Mut, und keine dieser drei Eigenschaften traf auch nur ansatzweise auf mich zu.
Weil Carl und Rosa das wussten, drängten sie mich, in die Forschung zu gehen. Ihrer Meinung nach hatte ich in den Jahren, als ich von einem Hauslehrer unterrichtet worden war, die gleiche Begabung für Naturwissenschaften gezeigt wie Marquette. Auch wenn ich nicht widersprochen hatte, fand ich die Vorstellung, jahrelang an irgendwelchen Mikroben herumzuforschen, ungefähr so spannend, wie ein weißes Zimmer jeden Tag weiß zu streichen. Aber ich hatte keine Ahnung, was ich sonst machen sollte. Ich wollte nur unbedingt aufs College, weil das vor Rosa und Carl absolut nie für mich infrage gekommen wäre.
Die Fahrt zur Lands Highschool dauerte exakt achtzehn Minuten, genau wie ich erwartet hatte. Sobald der große dreigeschossige Ziegelbau hinter den Baseball- und Footballplätzen in Sicht kam, fuhr ich zusammen, als würde ein Baseball auf mich zurasen.
Mein Magen krampfte sich zusammen, und meine Hände krallten sich um das Lenkrad. Die Schule war riesig und ziemlich neu. Auf der Homepage stand, sie sei in den Neunzigern gebaut worden, und verglichen mit anderen Schulen sah sie immer noch sehr gepflegt aus.
Gepflegt und riesengroß.
Ich fuhr an den Bussen vorbei, die zu den Bushaltestellen am Kreisverkehr abbogen, und folgte einem anderen Auto um das weitläufige Gelände herum zu einem Parkplatz, der groß genug für ein Einkaufszentrum gewesen wäre. Da ich schnell eine Lücke fand und immer noch zu früh dran war, nutzte ich die Zeit für meinen täglichen Aufmunterungsspruch, ein etwas kitschiges und peinliches Ritual.
Ich schaffe das. Ich kann das schaffen.
Ich wiederholte die Sätze immer wieder, während ich aus dem Honda stieg und mir die neue Tasche über die Schulter hängte. Mein Herz hämmerte so schnell, dass ich Angst hatte, ich würde gleich ohnmächtig werden. Ich schaute mich um und betrachtete das Meer von Schülern, die über einen Fußweg zum Hintereingang der Lands High strömten. Lauter unterschiedliche Gesichter, Kleider, Farben und Figuren liefen an mir vorbei. Einen Moment lang war mir, als würde es in meinem Gehirn einen Kurzschluss geben, und ich bekam keine Luft mehr. Blicke trafen mich, manche verweilten kurz, andere schweiften gleich weiter, als würden sie mich gar nicht sehen, was mich allerdings nicht weiter störte. Ich war daran gewöhnt, ein Geist zu sein.
Meine Hand legte sich auf den Riemen meiner Tasche, mein Mund war ganz trocken, und ich zwang meine Füße, sich zu bewegen. Unauffällig reihte ich mich ein in den Schülerstrom und konzentrierte mich beim Gehen auf den blonden Pferdeschwanz des Mädchens vor mir. Sie trug einen Jeansrock und Sandalen. Richtig süße orangefarbene Römersandalen mit Riemchen. Das könnte ich ihr sagen und ein Gespräch mit ihr anfangen. Ihr Pferdeschwanz war auch ziemlich cool. Er war oben auf dem Kopf zu einer Banane eingedreht, so wie ich es irgendwie nie richtig hinbekam, auch wenn ich noch so viele YouTube-Tutorials anschaute. Immer wenn ich es versuchte, sah ich am Ende aus, als hätte ich eine schiefe Beule auf dem Kopf.
Aber ich sprach sie nicht an.
Als ich den Blick wieder hob, fielen meine Augen auf einen Jungen, der neben mir ging. Er sah noch sehr verschlafen aus und zeigte keinerlei Reaktion, sondern starrte nur auf das Handy in seiner Hand. Wahrscheinlich hatte er mich gar nicht bemerkt.
Die Morgenluft war warm, aber als ich in die kühle Eingangshalle der Schule kam, war ich dankbar für die dünne Strickjacke, die ich passend zu dem ärmellosen T-Shirt und den Jeans ausgesucht hatte.
Hinter dem Eingang teilte sich der Schülerstrom. Die Schüler der unteren Klassen, die ungefähr so groß waren wie ich, aber deutlich jünger, rannten über den rot-blauen Wikinger, der auf dem Boden aufgemalt war. Mit wippender Schultasche auf dem Rücken wichen sie den größeren, breiteren Schülern aus. Andere trotteten wie Zombies langsam und scheinbar ziellos durch die Gänge. Ich selbst bemühte mich, ganz normal durch die Schule zu gehen, was ich allerdings vorher geübt hatte.
Und dann gab es noch die Schüler, die auf andere zuliefen und sie lachend umarmten. Sicher waren es Freunde, die sich den Sommer über nicht gesehen hatten, oder vielleicht auch einfach nur besonders temperamentvolle Menschen. Jedenfalls schaute ich ihnen neidisch hinterher. Das erinnerte mich an meine Freundin Ainsley. Die war genau wie ich zu Hause unterrichtet worden, und das war immer noch so, sonst würden wir uns jetzt vielleicht auch so freudestrahlend begrüßen wie diese Schüler. Ganz normal eben.
Aber Ainsley lag wahrscheinlich noch im Bett.
Nicht, weil sie den ganzen Tag herumgammeln durfte, sondern weil unser gemeinsamer Lehrer die Sommerpause ein bisschen anders legte als die staatlichen Schulen. Sie hatte noch Ferien, aber sobald bei ihr das Schuljahr wieder anfing, würde ihr Stundenplan genauso durchgetaktet und anstrengend sein wie früher bei mir.
Ich riss mich aus meinen Gedanken und ging zu der Treppe am Ende der breiten Eingangshalle neben dem Eingang zur Schulmensa. Allein schon die Nähe zur Mensa jagte meinen Puls höher. Mein Magen zog sich zusammen.
Die Mittagspause.
Oh Gott, was sollte ich in der Pause nur machen? Ich kannte ja niemanden hier, keinen einzigen Menschen, und ich würde …
Hastig verdrängte ich den Gedanken. Wenn ich noch länger darüber nachdachte, bestand die Gefahr, dass ich mich einfach umdrehte und in meinem Auto Zuflucht suchte.
Mein Spind befand sich im ersten Stock und hatte die Nummer zwei-drei-vier. Ich fand ihn ohne Probleme und die Tür öffnete sich schon beim ersten Versuch. Ich zog einen Ordner aus meiner Tasche, den ich nur für den Nachmittagsunterricht brauchte, und legte ihn ins oberste Fach. Heute würde ich bestimmt noch jede Menge Bücher bekommen.
Der Spind neben mir flog krachend zu, ich schrak zusammen, und mein Kopf fuhr herum. Ein großes Mädchen mit dunkler Haut und lauter winzigen Zöpfchen am ganzen Kopf lächelte mich an. »Hi.«
Meine Zunge war wie gelähmt, und ich brachte nichts heraus, nicht einmal dieses eine dumme kleine Wort, bis sich das Mädchen schließlich umdrehte und ging.
Durchgefallen.
Ich kam mir so was von bescheuert vor und schlug genervt die Tür des Spinds zu. Als ich mich umdrehte, fiel mein Blick auf den Rücken eines Jungen, der in die entgegengesetzte Richtung durch den Gang ging. Sämtliche Muskeln in mir verkrampften sich.
Ich hätte nicht sagen können, warum mein Blick ausgerechnet auf ihn gefallen war. Vielleicht, weil er einen guten Kopf größer war als die Schüler um ihn herum. Wie gebannt starrte ich ihm hinterher. Er hatte lockige schwarzbraune Haare, die oben etwas länger und hinten im Nacken kurz geschnitten waren. Ich überlegte, ob ihm wohl ein paar Haarsträhnen in die Stirn fielen, und erinnerte mich mit einem wehmütigen Ziehen in der Brust an einen Jungen, den ich früher einmal gekannt hatte und bei dem das so gewesen war. Ihm waren die Haare ständig in die Stirn gefallen, auch wenn er sie sich noch so oft aus dem Gesicht gestrichen hatte. Schon bei dem Gedanken an diesen Jungen tat mir das Herz weh.
Der Schüler, dem ich nachstarrte, hatte breite Schultern unter dem schwarzen T-Shirt, sein Bizeps war muskulös, als würde er Sport machen oder körperlich arbeiten. Seine Jeans waren zerschlissen, aber nicht wie bei den teuren Marken. Ich kannte den Unterschied zwischen Markenjeans, die auf alt getrimmt waren, und Hosen, die einfach nur alt und abgetragen aussahen. Er hatte nur einen Schreibblock in der Hand, der sogar von Weitem genauso zerfleddert aussah wie seine Jeans.
Ein merkwürdiges Gefühl regte sich in mir, ein Gefühl der Vertrautheit, und während ich noch vor meinem Spind stand, ertappte ich mich dabei, wie ich an den einen hellen Lichtstrahl in einer Vergangenheit voller düsterer Schatten dachte.
Mit wehem Herzen dachte ich an einen Jungen, der mir versprochen hatte, er würde immer da sein.
Seit vier Jahren hatte ich ihn nicht mehr gesehen und nichts mehr von ihm gehört. Vier Jahre, in denen ich versucht hatte, alles auszulöschen, was mit diesem Abschnitt meiner Kindheit zu tun hatte, aber an ihn erinnerte ich mich noch ganz genau. Immer wieder dachte ich an ihn und fragte mich, was wohl aus ihm geworden war.
Wie könnte es auch anders sein?
Schließlich hatte ich nur durch ihn die Jahre in dem Haus überlebt, in dem wir aufgewachsen waren.
2
In der ersten Stunde bekam ich schnell mit, dass die beiden hinteren Sitzreihen perfekt für mich waren. Nah genug, um die Tafel noch zu sehen, aber weit genug entfernt, um von den Lehrern möglichst wenig aufgerufen zu werden.
Von da an war ich in jeder Stunde als Erste im Klassenzimmer und belegte einen Tisch ganz hinten, um in der Masse unterzutauchen, bevor mich jemand bemerkte. Keiner redete mit mir. Bis zum Beginn der Englischstunde, dem letzten Fach vor der Mittagspause. Da setzte sich ein dunkelhäutiges Mädchen mit braunen Augen auf den leeren Platz neben mir.
»Hi«, sagte sie und knallte ein dickes Heft auf den Tisch. »Ich habe gehört, Mr Newberry soll ein richtiger Arsch sein. Schau dir mal die Bilder an.«
Mein Blick huschte zum vorderen Teil des Klassenzimmers. Unser Lehrer war noch nicht da, aber an der Tafel hingen Fotos berühmter Schriftsteller. Ein paar erkannte ich, wie Shakespeare, Voltaire, Hemingway, Emerson und Thoreau, weil ich so unendlich viel Zeit zum Lesen hatte.
»Siehst du? Alles nur Männer«, fuhr sie fort und schüttelte so angewidert den Kopf, dass ihre schwarzen Locken flogen. »Meine Schwester hatte ihn vor zwei Jahren auch. Sie hat mich gewarnt und gesagt, für den kann sowieso nur jemand mit einem Schwanz etwas von literarischem Wert schaffen.«
Meine Augen weiteten sich.
»Der Unterricht wird also richtig lustig werden.« Sie grinste und zeigte dabei ihre strahlend weißen Zähne. »Ich heiße übrigens Keira Hart. Du kommst mir gar nicht bekannt vor vom letzten Jahr. Ich kenne zwar nicht jeden Schüler hier, aber du wärst mir bestimmt aufgefallen.«
Sie schaute mich erwartungsvoll an. Meine Hände wurden schweißnass. Die Frage, die sie gestellt hatte, war wirklich nicht schwer, die Antwort darauf ganz einfach. Mein Hals wurde trocken, und Hitze kroch mir den Nacken hoch, während die Sekunden vergingen.
Du musst sprechen!
Meine Zehen krallten sich in die weiche Ledersohle meiner Flipflops, und mein Hals fühlte sich ganz rau an, als ich endlich die Worte herauspresste. »Ich bin … ich bin neu hier.«
Da! Ich hatte es geschafft. Ich hatte gesprochen!
Ha! Na also! Worte waren eben doch meine Freunde.
Na gut, vielleicht war meine Begeisterung ein bisschen übertrieben. Schließlich hatte ich nur vier Worte gesprochen. Aber es war eben wirklich schwer für mich, mit fremden Leuten zu reden. So schwer wie für jemand anderen, nackt in ein Klassenzimmer zu kommen.
Keira schien meine bescheuerte Sprachstörung nicht zu bemerken. »Hab ich mir doch gedacht.« Dann wartete sie wieder, und erst begriff ich gar nicht, warum sie mich so erwartungsvoll ansah. Doch dann kapierte ich endlich.
Mein Name. Sie wartete darauf, dass ich meinen Namen sagte. Ich holte tief Luft. »Ich bin Mallory … Mallory Dodge.«
»Cool.« Sie nickte und lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück. »Ach. Da kommt er.«
Danach redeten wir nichts mehr, aber ich war ungeheuer stolz, dass ich elf Worte gesagt hatte, und zählte jedes einzelne mit, auch wenn ich ein paar davon nur wiederholt hatte. Rosa und Carl würden es sicher verstehen.
Mr Newberry hatte eine ziemlich arrogante Art, was sogar einem Neuling wie mir sofort auffiel, aber das störte mich nicht. Ich schwebte auf einer Wolke des Erfolgs.
Dann kam das Mittagessen.
Die riesige laute Mensa zu betreten war ein bisschen so, als würde ich aus meinem Körper herauskatapultiert. Mein Gehirn schrie mir zu, ich solle mir einen ruhigeren, besseren – sichereren – Ort suchen, aber ich zwang mich, hineinzugehen, indem ich einen Fuß vor den anderen setzte.
Mein Magen hatte sich zu einem Knoten zusammengeballt, während ich in der Warteschlange vor der Essensausgabe stand. Ich nahm nur eine Banane und eine Flasche Wasser. Um mich herum waren so viele Leute, so viel Lärm – lautes Gelächter, Rufe und das dauernde Summen leiser Gespräche. Ich fühlte mich total fehl am Platz. Alle saßen an langen rechteckigen Tischen zusammen. Soweit ich sehen konnte, saß niemand für sich allein. Nur ich würde allein sitzen, weil ich niemanden kannte.
Voller Entsetzen krampfte ich die Finger um die Banane in meiner Hand. Von dem Geruch nach Desinfektionsmittel und verbranntem Essen wurde mir schwindelig, ein beklemmendes Gefühl legte sich auf meine Brust und schnürte mir die Kehle zu. Ich holte Luft, aber sie schien nicht bis in meine Lunge zu dringen. In meinem Nacken kribbelte es.
Ich konnte das nicht.
Es war zu laut und zu voll in diesem kleinen Saal. Zu Hause war es nie so laut. Nie. Mein Blick huschte durch den Raum, ohne wirklich etwas zu sehen. Meine Hände zitterten so heftig, dass ich Angst hatte, ich würde die Banane fallen lassen. Der Instinkt schaltete sich ein, und meine Beine setzten sich in Bewegung. Ich hastete hinaus in einen etwas ruhigeren Gang und dann weiter, vorbei an ein paar Schülern, die, umgeben von dem schwachen Geruch nach Zigaretten, vor den Spinden herumlungerten. Ich atmete tief ein und aus, doch es half nicht. Erst als ich ein gutes Stück von der Mensa entfernt war, wurde ich ruhiger. Ich bog um die Ecke und blieb unvermittelt stehen, um nicht mit einem Jungen zusammenzustoßen, der kaum größer war als ich.
Er stolperte und sah mich aus blutunterlaufenen Augen überrascht an. Erst dachte ich, er würde nach Zigarettenrauch riechen. Doch als ich einatmete, stieg mir ein durchdringendes erdiges Aroma in die Nase.
»Sorry, chula«, murmelte er, und seine Augen wanderten von meinen Zehenspitzen bis hinauf zu meinem Gesicht. Er grinste.
Am Ende des Gangs beschleunigte ein größerer Junge den Schritt. »Jayden, wo willst du hin, Alter? Wir müssen reden.«
Der Junge namens Jayden drehte sich um und fuhr sich mit der Hand durch die kurzen dunklen Haare. »Mierda, hombre«, murmelte er.
Eine Tür ging auf, ein Lehrer kam heraus und blickte missbilligend von einem zum anderen. »Was soll das, Jayden? Willst du das Schuljahr gleich so anfangen?«
Ich fand es an der Zeit, mich zu verdrücken, denn der Gesichtsausdruck des größeren Jungen war alles andere als freundlich oder gut gelaunt. Dazu kam der zornige Blick des Lehrers, als Jayden einfach davonging, ohne ihn zu beachten. Ich eilte ebenfalls weiter, den Kopf gesenkt und ohne jemandem in die Augen zu sehen.
Am Ende landete ich in der Schulbücherei, wo ich bis zum Läuten Candy Crush auf meinem Handy spielte. Die nächste Stunde über war ich stocksauer auf mich selbst, weil ich es nicht einmal versucht hatte. So war es doch. Stattdessen hatte ich mich in der Bücherei verkrochen wie ein kleines Kind und ein blödes Spiel gespielt, das nur der Teufel erfunden haben konnte, weil ich so mies darin war.
Zweifel legten sich über mich wie eine schwere grobe Decke. In den letzten vier Jahren hatte ich so viel erreicht. Ich war nicht mehr das gleiche Mädchen wie früher. Okay, ich litt immer noch unter ein paar Komplexen, aber ich war doch viel stärker als das zerbrechliche Kind von früher, oder nicht?
Rosa würde total enttäuscht sein.
Auf dem Weg zu meiner letzten Unterrichtsstunde juckte es mich überall, und mein Herzschlag näherte sich der Infarktgrenze, denn die letzte Stunde war das schlimmste Fach, das man sich nur vorstellen konnte.
Rhetorik.
Oder auch bekannt als Kommunikationstraining. Bei der Schulanmeldung im Frühjahr war ich mir so unglaublich mutig vorgekommen, während Carl und Rosa mich nur anstarrten, als wäre ich verrückt. Sie sagten, sie könnten mich von dem Fach auch wieder abmelden, obwohl es zu den Pflichtfächern an der Lands Highschool gehörte, aber ich musste etwas beweisen.
Ich wollte nicht, dass sie sich da einmischten. Ich wollte – nein, ich musste das schaffen.
Oh Mann.
Jetzt wünschte ich, ich hätte mehr Verstand gehabt und zugelassen, dass sie alles daransetzten, um mich vor diesem Albtraum zu bewahren. Die offene Tür des Klassenzimmers starrte mir Unheil kündend entgegen, während der Raum dahinter hell leuchtete.
Meine Schritte stockten. Ein Mädchen ging an mir vorbei und musterte mich mit spöttischer Miene. Am liebsten hätte ich auf dem Absatz kehrtgemacht und wäre geflohen. Steig in den Honda. Fahr nach Hause. Bring dich in Sicherheit.
Bleib ein Angsthase.
Nein.
Ich schloss die Finger fester um den Taschenriemen und zwang mich weiterzugehen. Es war, als würde ich durch knietiefen Schlamm waten. Jeder Schritt kostete Mühe, jeder Atemzug pfiff in meinen Lungen. Die Lampen an der Decke surrten und die Gespräche um mich herum hallten unnatürlich laut in meinen Ohren. Endlich hatte ich es geschafft.
Ich schleppte mich in die hintere Reihe, ließ meine Tasche mit tauben Fingern und weißen Knöcheln zu Boden fallen und glitt auf einen Stuhl. Ich tat so, als würde ich mein Heft herausholen, und krallte die Hände um die Tischkante.
Ich saß in Rhetorik. Ich war nicht abgehauen.
Ich hatte es geschafft.
Zu Hause würde ich eine rauschende Party feiern. Eis direkt aus der Packung löffeln oder so was Ähnliches. Richtig einen draufmachen.
Weil meine Finger allmählich schmerzten, löste ich meinen Klammergriff und blickte mich um. Das Erste, was ich sah, war die breite Brust in dem schwarzen T-Shirt in der Tür, dann der wohlgeformte Bizeps. Und da war auch der zerfledderte Schreibblock, der so aussah, als würde er gleich auseinanderfallen. Gerade schlug eine Hand damit ungeduldig gegen das Bein.
Es war der Junge von heute Morgen.
Neugierig, wie er aussah, hob ich den Kopf, aber er drehte mir den Rücken zu. Das Mädchen aus dem Flur, das vorhin an mir vorbeigelaufen war, kam herein. Jetzt, da ich sicher auf meinem Stuhl saß und wieder einigermaßen atmen konnte, hatte ich Gelegenheit, sie zu betrachten. Sie war hübsch. Bildhübsch sogar, so wie Ainsley. Sie hatte ganz glatte karamellblonde Haare, genauso lang wie meine, die ihr bis über die Brust fielen. Sie war groß und unter ihrem ärmellosen Shirt lugte ein flacher Bauch hervor. Ihr Blick aus den dunkelbraunen Augen war diesmal nicht auf mich gerichtet, sondern auf den Jungen vor ihr.
Ihr Gesichtsausdruck verriet, dass er sie ansah, und als er lachte, verzogen sich ihre rosafarbenen Lippen zu einem breiten Lächeln. Das Lächeln verwandelte sie von einem hübschen Mädchen in eine Schönheit, aber da achtete ich schon nicht mehr auf sie, weil sich mir plötzlich sämtliche Haare am Körper aufstellten. Dieses Lachen … Es klang tief und voll und irgendwie vertraut. Ein Schauer lief mir über die Schultern. Dieses Lachen …
Der Junge kam rückwärts in den Raum. Neidisch sah ich, wie geschickt und ungezwungen er sich bewegte, ohne irgendwo anzustoßen. Dann wurde mir klar, dass er auf die hintere Reihe zusteuerte. In meine Richtung. Ich sah mich um. Es waren nur noch wenige Stühle frei, zwei davon zu meiner Linken. Das Mädchen folgte ihm. Sie folgte ihm nicht nur, sie berührte ihn auch.
Sie berührte ihn so, als würde sie das häufig tun.
Ihre Hand legte sich auf seinen Bauch, direkt unterhalb seiner Brust, und wanderte allmählich weiter nach unten. Sie biss sich auf die Unterlippe, als sich die goldenen Anhänger an ihrem Handgelenk dem abgewetzten Ledergürtel näherten. Meine Wangen wurden heiß. Gleich darauf entzog sich der Junge mit einem Schritt der Berührung. Seine Bewegungen waren spielerisch, als wäre dieser Tanz ein tägliches Ritual für sie beide.
Am Ende der Tischreihe drehte er sich um und ging an einem besetzten Stuhl vorbei. Mein Blick wanderte über seine schlanken Hüften, über den Bauch, den das Mädchen eben berührt hatte, und immer weiter nach oben. Dann sah ich sein Gesicht und mir stockte der Atem.
Mein Gehirn wollte nicht begreifen, was ich da sah. Es konnte das, was ich sah, einfach nicht verarbeiten. Ich starrte ihn an, zum ersten Mal sah ich ihn richtig, sah sein Gesicht, das so vertraut war und doch neu, viel erwachsener als in meiner Erinnerung, aber immer noch atemberaubend schön. Ich erkannte ihn sofort. Oh Gott, ich würde ihn überall wiedererkennen, auch wenn es vier Jahre her war und sich an jenem schrecklichen Abend, an dem wir uns zum letzten Mal gesehen hatten, mein ganzes Leben verändert hatte.
Es war völlig surreal.
Jetzt wusste ich auch, warum er mir morgens in den Sinn gekommen war. Ich hatte ihn gesehen, aber ich hatte nicht erkannt, dass er es war.
Ich konnte mich nicht bewegen, konnte nicht richtig atmen, konnte nicht glauben, dass das wirklich passierte. Meine Hände sanken schlaff in meinen Schoß. Er setzte sich auf den Platz neben mir, den Blick immer noch auf das Mädchen gerichtet, das sich auf den zweiten freien Stuhl fallen ließ. Sein gut aussehendes Profil, das damals noch längst nicht so markant gewesen war, drehte sich zur Seite, während seine Augen durch den Klassenraum und über die breite Tafel wanderten. Er sah noch genauso aus wie früher, nur größer, und seine Gesichtszüge waren … irgendwie klarer und schärfer ausgeprägt. Von den Augenbrauen, die einen Hauch dunkler waren als die schwarzbraunen Haare, und den dichten Wimpern bis zu den hohen Wangenknochen und dem unrasierten Kinn.
Er sah genauso aus, wie ich ihn mir vorgestellt hatte, als ich zwölf war und anfing, ihn richtig zu sehen, als Jungen. Es war einfach unglaublich.
Ich konnte es nicht fassen, dass er neben mir saß. Mein Herz klopfte zum Zerspringen, als seine Lippen, die voller waren, als ich sie in Erinnerung hatte, sich zu einem Lächeln bogen, und mein Bauch zog sich zusammen, als daraufhin ein Grübchen in seiner rechten Wange erschien. Auf der anderen Seite war keines zu sehen, es gab nur dieses eine. Meine Gedanken rasten zurück in die Vergangenheit, und ich konnte mich nur an ganz wenige Gelegenheiten erinnern, wo er so entspannt gewesen war. In dem Moment lehnte er sich gemächlich auf seinem Stuhl zurück, der zu klein für ihn war, und drehte langsam den Kopf zu mir. Braune Augen mit kleinen goldenen Sprenkeln richteten sich auf mich.
Augen, die ich nie vergessen hatte.
Das unbefangene, fast gelangweilte Lächeln, das ich an ihm gar nicht kannte, erstarrte auf seinem Gesicht. Sein Mund klappte auf und die hellbraune Haut wurde blass. Seine Augen weiteten sich, die goldenen Sprenkel darin schienen sich auszudehnen. Er erkannte mich. Ich hatte mich sehr verändert seit damals, aber er erkannte mich sofort. Er beugte sich zu mir. Drei Worte dröhnten aus der Vergangenheit und hallten in meinem Kopf wider.
Sei ganz still.
»Maus?«, hauchte er.
3
Maus.
Außer ihm hatte mich nie jemand so genannt. Ich hatte diesen Spitznamen so lange nicht mehr gehört, dass ich ihn schon fast vergessen hatte.
Und niemals, in einer Million Jahren nicht, hätte ich zu hoffen gewagt, dass ich ihn wiedersehen würde. Aber da saß er und ich konnte die Augen nicht von ihm wenden. Er hatte kaum mehr Ähnlichkeit mit dem Dreizehnjährigen von damals, aber er war es ganz ohne Zweifel. Die warmen braunen Augen mit den goldenen Sprenkeln waren noch da und auch die leicht gebräunte Haut, eine Erbe von seinem Vater, der vermutlich spanischer Abstammung gewesen war. Er hatte nicht gewusst, woher seine Mutter und deren Familie stammten. Einer der Jugendamtsmitarbeiter, der eine Zeit lang für uns zuständig gewesen war, meinte, seine Mutter sei wohl halb weißer, halb südamerikanischer Abstammung gewesen, vielleicht aus Brasilien, aber mehr hatte er über sie nicht erfahren.
Auf einmal sah ich ihn vor mir – den Jungen von damals, als wir beide noch klein waren und er der einzige Halt in einer Welt voller Chaos für mich war. Mit neun Jahren, damals schon viel größer als ich und trotzdem noch ein kleiner Junge, hatte er sich wieder einmal in der Küche zwischen Mr Henry und mich gestellt. Ich hatte zitternd dagestanden und meine rothaarige Puppe Velvet an mich gedrückt, die er mir kurz zuvor erst geschenkt hatte, und er hatte sich mit herausgestreckter Brust zwischen uns aufgebaut. »Lass sie in Ruhe«, hatte er geknurrt, die Hände zu Fäusten geballt. »Komm ihr ja nicht zu nahe.«
Ich riss mich los von der Erinnerung, aber es gab so viele Situationen, in denen er mich vor allem Möglichen bewahrt hatte, bis er sein Versprechen, mich immer zu beschützen, nicht mehr halten konnte und alles … alles zusammengebrochen war.
Seine Brust hob sich schwer atmend, dann sagte er mit leiser, rauer Stimme: »Bist du es wirklich, Maus?«
Aus den Augenwinkeln bemerkte ich, wie das Mädchen auf der anderen Seite uns beobachtete. Ihre Augen blickten genauso erstaunt wie meine. Meine Zunge versagte den Dienst, was in diesem Fall seltsam war, weil er … er war immer der Einzige gewesen, mit dem ich reden konnte, aber das war in einer anderen Zeit gewesen, in einem anderen Leben.
Einem Leben, das für immer Vergangenheit war.
»Mallory?«, flüsterte er und beugte sich so weit zu mir, dass ich fast meinte, er würde von seinem Stuhl zu mir herüberklettern. Das wäre typisch für ihn gewesen, er hatte nie Angst und machte immer, was er wollte. Auch früher schon. Sein Gesicht war so dicht vor mir, dass ich die blasse Narbe über der rechten Augenbraue erkennen konnte, etwas heller als die restliche Haut. Das Herz tat mir wieder weh, weil diese Narbe für einen alten Keks stand und einen zerbrochenen Aschenbecher.
Ein Junge vor uns hatte sich auf seinem Stuhl herumgedreht. »Yo.« Der Junge schnippte mit den Fingern, als er keine Antwort bekam. »Hey, Mann? Hallo?«
Er beachtete den Typen nicht und starrte mich immer noch an, als wäre ihm ein Geist erschienen.
»Dann halt nicht«, murmelte der Typ und drehte sich zu dem Mädchen, aber auch sie beachtete ihn nicht. Sie starrte uns an. Die Schulglocke läutete zum zweiten Mal, und ich wusste, dass der Lehrer hereingekommen war, weil die Gespräche im Raum verstummten.
»Erkennst du mich?« Seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern.
Seine Augen waren immer noch auf mich geheftet, und endlich sagte ich ein Wort, das leichteste, das mir je im Leben über die Lippen gekommen war: »Ja.«
Daraufhin schwenkte er auf seinen Stuhl zurück, richtete sich mit angespannten Schultern auf und schloss die Augen. »Das gibt’s doch gar nicht«, murmelte er und rieb sich mit der flachen Hand über die Brust.
Ich schrak zusammen, als der Lehrer mit der Hand auf einen Stapel Bücher auf seinem Pult schlug, und zwang mich, nach vorn zu blicken. Mein Herz schlug immer noch wie ein Presslufthammer.
»Also gut, ihr müsstet eigentlich alle wissen, wer ich bin, weil ihr ja hier in meinem Unterricht sitzt, aber für den Fall, dass ihr doch keine Ahnung habt: Ich bin Mr Santos.« Er lehnte sich an seinen Tisch und verschränkte die Arme. »Und das hier ist die Rhetorikstunde. Wenn ihr also nicht hier sein solltet, werdet ihr wahrscheinlich in einer anderen Klasse vermisst.«
Mr Santos redete weiter, aber das Blut rauschte so laut in meinen Ohren, dass ich ihn nicht hören konnte. Meine Gedanken waren zu sehr auf die Tatsache konzentriert, dass er neben mir saß. Er war da. Nach so langer Zeit saß er wieder neben mir, wie früher, nachdem wir mit drei Jahren zu denselben Pflegeeltern gekommen waren. Aber er schien nicht wirklich glücklich zu sein, mich zu sehen. Und ich wusste auch nicht recht, was ich davon halten sollte. Eine Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung brodelte in mir, vermischt mit traurigen und schönen Erinnerungen, an die ich mich klammerte und die ich doch am liebsten vergessen hätte.
Er war … Ich kniff die Augen zu und versuchte, den Kloß im Hals hinunterzuschlucken.
Bücher wurden ausgeteilt, gefolgt von einem Lehrplan. Beides lag unberührt auf meinem Tisch. Mr Santos ging die Reden durch, die wir im Lauf des Schuljahrs schreiben und halten sollten, von einem informativen Vortrag bis hin zu einer Rede, für die wir einen Mitschüler interviewen mussten. Nachdem ich mir kurz vor der Unterrichtsstunde noch fast in die Hose gemacht hatte vor Angst, dachte ich jetzt keine Sekunde mehr daran, dass ich bald vor dreißig Leuten Vorträge halten sollte.
Ich schaute starr nach vorn und stellte fest, dass auch Keira im Klassenzimmer war. Sie saß vor dem Jungen, der am Anfang der Stunde versucht hatte, mit ihm zu reden. Ich wusste nicht, ob sie mich bemerkt hatte, als ich hereingekommen war. Aber vielleicht hatte sie mich gesehen und es war ihr einfach nur egal? Warum sollte es auch anders sein? Dass sie heute Morgen im Unterricht mit mir gesprochen hatte, bedeutete nicht, dass sie meine beste Freundin werden wollte.
Meine Panikattacke in der Mittagspause kam mir vor, als wäre sie Jahre her. Ich nahm jeden Atemzug, den ich machte, genau wahr. Unwillkürlich strich ich mir die Haare hinter die Ohren und schaute zur Seite.
Mein Blick traf seinen und ich holte unsicher Luft. Als wir noch jünger waren, hatte ich seinen Gesichtsausdruck immer deuten können. Aber jetzt … Seine Miene zeigte keine Regung. War er glücklich? Wütend? Traurig? Oder genauso verwirrt wie ich? Ich wusste es nicht, aber er versuchte jedenfalls nicht zu verbergen, dass er mich anstarrte.
Die Hitze stieg mir in die Wangen und ich drehte den Kopf weg. Stattdessen schaute ich zu dem Mädchen neben ihm. Sie sah stur geradeaus, den Mund zu einem schmalen Strich zusammengepresst. Mein Blick fiel auf ihre Hände, die zu Fäusten geballt auf dem Tisch lagen. Hastig sah ich weg.
Etwa fünf Minuten vergingen, bevor ich es aufgab und erneut zu ihm hinüberspähte. Er schaute nicht zu mir, aber es war deutlich zu sehen, wie es in ihm arbeitete. Seine Kiefer mahlten, und ein Muskel in seiner Wange zuckte. Ich konnte ihn nur anstarren wie ein Idiot, mehr brachte ich nicht zustande.
Schon als er noch klein war, konnte man ahnen, dass er irgendwann umwerfend gut aussehen würde. Das hatte man an den großen Augen, dem ausdrucksvollen Mund und den feinen Gesichtszügen schon erkennen können. Manchmal war das für ihn wirklich … schlimm gewesen. Es hatte zu viel Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt. Mr Henry zum Beispiel schien es darauf anzulegen, ihn zu brechen, als wäre er aus Porzellan. Und dann waren da noch die Männer, die bei uns ein und aus gingen. Einige von ihnen hatten … sie hatten sich zu sehr interessiert für ihn.
Mein Mund war ganz trocken und ich schob diese Gedanken weg. Eigentlich hätte es mich nicht überraschen dürfen, was für ein attraktiver Junge aus ihm geworden war, aber – wie Ainsley sagen würde – er sah einfach so gut aus, dass man nicht mehr klar denken konnte.
Während Mr Santos aus Gründen, von denen ich nichts mitbekommen hatte, damit begann, Karteikarten auszuteilen, drehte sich der Junge vor uns noch einmal um und richtete seine meergrünen Augen auf ihn. »Sehen wir uns nach der Schule?«
Ich konnte nicht anders. Mein Blick huschte zu ihm. Er hatte die Arme vor der Brust verschränkt und nickte nur kurz.
Der Junge warf einen kurzen Blick auf Mr Santos und schaute dann noch einmal nach hinten zu ihm. »Wir müssen unbedingt mit Jayden reden.«
Jayden? So hieß doch der Junge, mit dem ich im Gang fast zusammengeprallt wäre.
Das Mädchen sah die beiden mit schräg gelegtem Kopf an.
»Ich weiß, Hector«, erwiderte er kurz angebunden. Wie tief seine Stimme war. Kurz darauf drehte er den Kopf wieder in meine Richtung.
Ich wurde rot und schaute weg, doch vorher sah ich noch, wie Hector mich neugierig musterte. Den Rest der Stunde übte ich mich darin, immer wieder einenverstohlenen Blick auf ihn zu werfen. Ich musste ihn ansehen, um mich zu vergewissern, dass er tatsächlich neben mir saß. Allerdings war ich nicht besonders gut darin, es heimlich zu tun. Das Mädchen neben ihm, das ihn beim Hereinkommen ins Klassenzimmer so vertraut angefasst hatte, ertappte mich jedenfalls mehrmals dabei.
Die Minuten vergingen und mein Magen zog sich immer mehr zusammen. Angst umkreiste mich wie eine Viper und lauerte darauf, mit ihrem tödlichen Gift anzugreifen.
Meine Kehle schnürte sich zu wie in einer stählernen Schraubzwinge, bis sie mir den letzten Rest Luft aus den Lungen gequetscht hatte. Ein eiskaltes Brennen kroch meinen Nacken hoch und schwappte über meine Schädeldecke. Mein nächster Atemzug stockte und da spürte ich es kommen – dieses sturzflutartige Gefühl, die Kontrolle zu verlieren.
Atmen.
Ich musste atmen.
Ich bohrte meine Fingernägel in die Handfläche und brachte meine Brust dazu, sich gleichmäßig zu heben und zu senken. Zugleich zwang ich mein Herz, langsamer zu schlagen. In meinen Therapiestunden hatte Dr. Taft mir eingebläut, dass ich in solchen Momenten nicht wirklich die Kontrolle über meinen Körper verlor. Das passierte alles nur in meinem Kopf, ausgelöst von einem lauten Geräusch oder von einem Geruch, die mich urplötzlich in die Vergangenheit zurückversetzten. Manchmal konnte ich gar nicht genau sagen, wodurch diese Reaktion hervorgerufen wurde.
Doch diesmal wusste ich es.
Der Auslöser saß direkt neben mir. Die Panik war echt, weil er echt war, und die Vergangenheit, für die er stand, war nicht nur ein Produkt meiner Fantasie.
Was sollte ich zu ihm sagen, wenn die Schulglocke läutete und die Schule aus war? Seit jenem Abend waren vier Jahre vergangen. Wollte er überhaupt mit mir reden? Und was wäre, wenn nicht?
Oh Gott.
Vielleicht hatte er ja gar nicht darauf gehofft oder überhaupt daran gedacht, mich wiederzusehen. Er hatte … Er hatte viel durchgemacht, für mich und wegen mir. In unseren zehn Jahren zusammen hatte es gute Momente gegeben, aber es gab auch eine Menge schlechter Momente. Eine Riesenmenge.
Und es wäre … Also, es wäre schon echt mies, wenn er aufstehen und ohne ein Wort aus dem Klassenzimmer gehen würde, aber irgendwie wäre es vielleicht sogar besser. Wenigstens wusste ich jetzt, dass er lebte und offenbar körperlich unversehrt war. Außerdem schien er mit dem Mädchen, das neben ihm saß, sehr vertraut zu sein. Vielleicht war sie sogar seine Freundin. Und das bedeutete doch, dass er glücklich sein musste, oder? Glücklich und gesund. Nachdem das geklärt war, konnte ich dieses Kapitel meines Lebens offiziell für beendet erklären.
Dabei hatte ich die ganze Zeit gedacht, dieses Kapitel sei längst beendet. Und nun war es doch wieder aufgeschlagen worden, und zwar ganz vorn auf der ersten Seite.
Als es läutete, schaltete sich mein Schutzmechanismus ein, so wie früher. Mir war gar nicht bewusst, was ich da tat. Ein alter Instinkt hob den Kopf wie ein schlafender Drache, ein Instinkt, gegen den ich vier Jahre lang erfolgreich angekämpft, dem ich mich an diesem Tag aber schon einmal ergeben hatte.
Ich stand auf, nahm mein Buch und schnappte meine Tasche. Mit klopfendem Herzen huschte ich um meinen Tisch herum, den Blick starr nach vorn gerichtet, um möglichst vor ihm aus dem Klassenzimmer zu flüchten. Meine Sandalen patschten auf den Boden, als ich durch den Gang hetzte, mich an langsameren Schülern vorbeidrängte und dabei das Schulbuch blindlings in meine Tasche stopfte. Wahrscheinlich sah ich aus wie eine Irre. Ehrlich gesagt fühlte ich mich auch so.
Ich rannte aus dem Schulhaus in die heiße Sonne. Mit gesenktem Blick folgte ich dem Weg zum Parkplatz und ballte meine zitternden Hände zu Fäusten, weil ich das Gefühl hatte, das Blut würde sich in den Handgelenken stauen. Meine Fingerspitzen kribbelten.
Der silberne Honda leuchtete vor mir auf und ich holte zitternd Luft. Ich würde nach Hause fahren und ich würde …
»Mallory.«
Mein Puls raste, als ich meinen Namen hörte, und mein Schritt stockte. Ich war keine drei Meter von meinem Auto entfernt, von meiner Zuflucht, trotzdem drehte ich mich langsam um.
Er stand neben einem roten Geländewagen, der morgens noch nicht da gewesen war und den ich auf meiner wilden Flucht gar nicht bemerkt hatte. In der Sonne schimmerten seine Haare eher braun als schwarz, seine Haut wirkte dunkler, seine Gesichtszüge schärfer. Es gab so viele Fragen, die ich ihm auf einmal gern gestellt hätte. Was hatte er in den letzten vier Jahren gemacht? War er endlich von jemandem adoptiert worden? Oder wanderte er von einer Pflegefamilie zur nächsten?
Und – wichtiger noch – war er in Sicherheit?
Nicht alle Heime waren schlecht. Nicht alle Pflegeeltern waren schrecklich. Carl und Rosa zum Beispiel, die waren einfach nur toll. Sie hatten mich adoptiert, aber davor hatten dieser Junge und ich nicht so viel Glück gehabt. Wir waren bei grässlichen Leuten untergebracht gewesen, die es irgendwie geschafft hatten, als Pflegeeltern zugelassen zu werden. Die Sachbearbeiter des Jugendamts waren chronisch überlastet und finanziell schlecht ausgestattet, auch wenn die meisten sich dennoch viel Mühe gaben. Trotzdem taten sich immer wieder Lücken im Netz auf und wir waren auf die denkbar schlimmste Weise durch eine dieser Lücken gerutscht.
Die meisten Pflegekinder blieben nicht länger als zwei Jahre im System oder in einer Familie, dann kehrten sie irgendwann wieder zu ihren Eltern zurück oder wurden adoptiert. Keiner außer Mr Henry und Miss Becky hatte uns beide haben wollen, und ich begriff immer noch nicht, warum die beiden uns erst bei sich aufgenommen und uns dann so schlecht behandelt hatten. Die Jugendamtsmitarbeiter wechselten im Rhythmus der Jahreszeiten. Die Lehrer in der Schule hätten eigentlich sehen müssen, was wir zu Hause durchlitten, aber keiner hatte Lust, seinen Job zu riskieren, um uns zu helfen. Die Verbitterung darüber, in einem überlasteten und kaputten System so lange misshandelt und übersehen worden zu sein, klebte immer noch an mir wie eine zweite Haut, die ich wohl nie mehr loswerden würde.
Aber alles hatte eine gute und eine schlechte Seite. Hatte er endlich die gute Seite gefunden?
»Echt jetzt?«, sagte er und seine Finger krampften sich um den zerfledderten Schreibblock in seiner Hand. »Nach allem, was war, und nachdem ich vier Jahre lang keine Ahnung hatte, was aus dir geworden ist, tauchst du auf einmal in dieser beschissenen Rhetorikstunde auf und rennst dann weg? Vor mir?«
Ich atmete scharf ein und ließ die Arme sinken. Meine Tasche rutschte mir von der Schulter und landete auf dem heißen Asphalt. Der Schreck fuhr mir in die Glieder, aber tief in mir drin war ich nicht überrascht, dass er mir gefolgt war. Er rannte nie weg. Er versteckte sich nie. So etwas hatte immer nur ich getan. Wir waren wie Yin und Yang, schon immer. Meine Feigheit gegen seinen Mut. Seine Stärke gegen meine Schwäche.
Aber so war ich nicht mehr.
Ich war keine Maus mehr.
Ich war kein Feigling.
Ich war nicht schwach.
Er machte einen Schritt auf mich zu und blieb dann kopfschüttelnd stehen. Sein Atem ging stockend. »Sag doch was.«
»… was?« Ich musste das Wort förmlich aus mir herauspressen.
»Meinen Namen.«
Ich verstand nicht recht, wieso er das wollte, und ich wusste auch nicht, wie es sich anfühlen würde, den Namen nach so langer Zeit wieder auszusprechen, aber trotzdem holte ich tief Luft. »Rider.« Ein weiterer zitternder Atemzug. »Rider Stark.«
In ihm arbeitete es sichtlich, und einen Herzschlag lang bewegte sich keiner von uns. Ein heißer Windhauch wehte mir ein paar Haarsträhnen ins Gesicht. Dann ließ er seinen Block fallen, und ich war überrascht, dass der nicht zu Staub zerfiel. Mit zwei großen Schritten überwand er den Abstand zwischen uns und stand vor mir. Er war inzwischen viel größer als ich, sodass ich ihm kaum bis zur Schulter reichte.
Dann waren seine Arme um mich.
Mein Herz explodierte, als er mich mit seinen starken Armen an sich zog. Erst stand ich da wie erstarrt, dann schlang ich die Arme um seinen Hals. Die Augen fest geschlossen klammerte ich mich an ihn und atmete seinen sauberen Geruch und den leichten Hauch von Rasierwasser ein. Das war er, auch wenn sich seine Umarmung ganz anders anfühlte, stärker und fester. Er hob mich vom Boden hoch, einen Arm um meine Taille, die andere tief in meinen Haaren vergraben, und meine Brüste stießen gegen seine überraschend harte Brust.
Wow.
Diese Umarmung war auf jeden Fall anders als damals, als wir zwölf waren.
»Himmel, Maus, du hast ja keine Ahnung, wie …« Seine Stimme war rau und voller Gefühl. Er setzte mich ab, hielt mich aber weiterhin fest. Ein Arm lag immer noch um meine Taille, mit der anderen Hand fasste er in meine Haare und schloss die Faust darum. Sein Kinn ruhte auf meinem Scheitel, während meine Hände an ihm hinabglitten. »Ich dachte, ich seh dich nie wieder.«
Ich legte meine Hände auf seine Brust und die Stirn dazwischen und spürte seinen schnellen Herzschlag. Um uns herum waren Leute, wahrscheinlich beobachteten uns einige Schüler sogar, aber das war mir egal. Rider war warm und fest. Echt. Lebendig.
»Scheiße, Mann, dabei hatte ich heute gar nicht vor, in die Schule zu gehen. Wenn ich nicht gekommen wäre …« Er löste seine Hand aus meinen Haaren, nahm eine Strähne und ließ sie durch die Finger gleiten. »Deine Haare sind jetzt ganz anders. Du bist gar kein Rotfuchs mehr.«
Ein ersticktes Lachen entfuhr mir. Als Kind waren meine Haare ein feuerrotes Gewirr aus Knoten und widerspenstigen Locken gewesen. Zum Glück hatte sich die Farbe – mit Unterstützung eines Friseurs – inzwischen etwas abgeschwächt. Aber die Knoten und die Locken waren immer noch eine Pest, vor allem, wenn die Luft sehr feucht war.
Rider trat eine halben Schritt zurück, ich schlug die Augen auf und stellte fest, dass er mich betrachtete. »Sieh mal an«, murmelte er. »Du bist ja richtig erwachsen geworden.« Er ließ meine Haare los und fuhr mir mit dem Daumen leicht über die Unterlippe. Bei dieser unerwarteten Berührung lief mir ein leichter Schauer über den Rücken. »Und du bist immer noch so still wie eine Maus.«
Ich erstarrte. Maus. »Ich bin keine …« Doch die Worte erstarben in dem inneren Feuer, weil sein Daumen weiter über meine Wange wanderte. Sein Finger war schwielig und rau, aber die Berührung war ganz zart.
Mein Blick wanderte hinauf zu seinen Augen. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihn jemals wiedersehen würde, aber da stand er. Oh mein Gott, da stand Rider, und auf einmal stürmten die Gedanken auf mich ein. Ich bekam nur ein paar davon zu fassen, aber Erinnerungen kamen hoch, wie wenn die Sonne über einem Berggipfel aufgeht.
Eines Nachts war ich aufgewacht und hatte mich vor den lauten Stimmen gefürchtet, die aus dem dunklen Erdgeschoss heraufdrangen. Ich war ins Nebenzimmer geschlüpft, wo Rider lag, und er hatte mich zu sich ins Bett kriechen lassen. Dann hatte er mir mein Lieblingsbuch vorgelesen, das er immer nur »die blöde Hasen-Geschichte« genannt hatte. Ich musste jedes Mal weinen, wenn ich die Geschichte hörte, aber er las sie mir trotzdem vor, um mich von dem Gebrüll abzulenken, das durch das kleine schäbige Reihenhaus hallte. Damals war ich fünf gewesen und von da an war Rider zum Rettungsanker meines Lebens geworden.
Plötzlich trat er zurück und nahm meinen rechten Arm. Er drehte ihn um und schob den Ärmel der dünnen Strickjacke hoch. Verwundert sagte er: »Das verstehe ich nicht.«
Mein Blick folgte seinem zu der Stelle, wo er mich am Handgelenk festhielt. An der Innenseite meines Ellbogens war die Haut ein etwas dunkleres Rosa, genau wie an den Unterarmen und an beiden Handflächen, aber das fiel kaum auf.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: