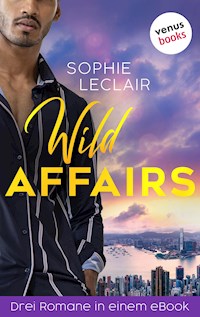4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein sinnlicher Kampf um Macht und Leidenschaft: Der prickelnde Liebesroman „Mumbai Liaison“ von Sophie Leclair jetzt als eBook bei dotbooks. Als ihr Vater verstirbt, steht die Britin Helen vor einer großen Herausforderung: Sie soll dessen Produktionsfirma in Mumbai leiten. Dabei gerät sie mit dem Bollywoodstar Arun aneinander, der zugleich Helens Leidenschaft entfacht. Auch Arun kann den betörenden Reizen seiner Gegnerin nicht lange widerstehen und schon bald tragen sie ihren Kampf nicht mehr nur mit Worten aus, sondern setzen ihre Verführungskünste als Waffe gegeneinander ein. Doch kann Helen dem Mann mit den schwarzglühenden Augen vertrauen? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der prickelnde Sommerroman „Mumbai Liaison“ von Sophie Leclair wird Fans von April Dawson und Audrey Carlan begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch:
Als ihr Vater verstirbt, steht die Britin Helen vor einer großen Herausforderung: Sie soll dessen Produktionsfirma in Mumbai leiten. Dabei gerät sie mit dem Bollywoodstar Arun aneinander, der zugleich Helens Leidenschaft entfacht. Auch Arun kann den betörenden Reizen seiner Gegnerin nicht lange widerstehen und schon bald tragen sie ihren Kampf nicht mehr nur mit Worten aus, sondern setzen ihre Verführungskünste als Waffe gegeneinander ein. Doch kann Helen dem Mann mit den schwarzglühenden Augen vertrauen?
Über die Autorin:
Sophie Leclair, gebürtige Österreicherin mit südfranzösischen Wurzeln, wuchs in Wien auf und studierte dort Romanistik. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in der Nähe von München und unterrichtet an der Universität. Neben dem Schreiben entdeckte Sophie Leclair das Reisen als große Leidenschaft, weshalb ihre Romane auch in exotischen fernen Ländern spielen.
***
Neuausgabe Oktober 2016
Dieses Buch erschien bereits 2008 unter dem Titel Die Mondperle bei MIRA® TASCHENBÜCHER in der Cora Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg
Copyright © der Originalausgabe 2008 MIRA® TASCHENBÜCHER
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Stefano Emder (Palast), Guryanov Andrey (Paar)
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-494-8
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Mumbai Liaison an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://instagram.com/dotbooks
http://blog.dotbooks.de/
Sophie Leclair
Mumbai Liaison
Erotischer Roman
dotbooks.
1. Kapitel
»Er ist tot, Jack.«
»Wer?«, keuchte die Stimme in ihrem Rücken rau.
»Mein Vater.« Helen ließ das Handy sinken. »Hören wir auf, jetzt klappt es bei mir sowieso nicht mehr.«
Jack Daniels, wie die gleichnamige Whiskymarke aus Tennessee, nur weniger anregend und magenerwärmend, hielt sich ihr Handy ans Ohr. Am anderen Ende der Leitung war nur noch das ungeduldige Tuten des Besetztzeichens zu hören. Seufzend legte er auf, warf das Handy aufs Bett und rollte sich zur Seite. Wenn Helen meinte, sie bekomme keinen Orgasmus mehr, würde er sich vollkommen umsonst ins Zeug legen. Als ob ein paar Lustschreie mehr oder weniger jetzt noch etwas daran ändern könnten. Durch Enthaltsamkeit würde sie ihren Vater jedenfalls nicht wieder zum Leben erwecken.
»Willst du darüber reden?«, erkundigte er sich pflichtbewusst und sah ihr dabei zu, wie sie gedankenverloren ihre Kleider aufsammelte. Dabei streckte sie ihm ihr Hinterteil unabsichtlich, aber um nichts weniger verführerisch entgegen. Wenn sie die schwarze Spitze, die letzte gefallene Bastion auf dem Bettvorleger, aufhob, würde sie ihm erfreulich nahe kommen. Ahhh ... Schon schwangen Londons außergewöhnlichste Möpse direkt vor seine Nase. Hoch und spitz machten sie den Kurven jenes Playmates Konkurrenz, dessen Poster in seinem Spind im Fernsehsender hing. Hm ...
Unterdessen hatte sie sich gebückt und schlüpfte nun in den schwarzen Spitzenslip, wobei sie ihm den Rücken zuwandte. Ihre Pobacken, zwei straffe glatte Rundungen am Ende wohlgeformter langer Beine, in Griffweite vor ihm.
Dazwischen wölbte sich das Himmelreich auf Erden, rosig, nass und angeschwollen von ihrer hitzigen Vereinigung. Sofort sah er eine reelle Chance. Wozu aufgeben, schließlich gab es eine befriedigendere Therapie gegen Kummer, und reden konnten sie ja auch noch danach. Aufs Höchste erregt, sprang er aus dem Bett und presste sich von hinten an sie. Doch obwohl er sie an den Hüften packte, schaffte sie es, in ihre Jeans zu steigen, sie hochzuziehen und seinen flink dazwischendrängenden Mitstreiter beiseitezuschieben.
»Danke für dein Mitgefühl«, sagte sie in Bezug auf sein weniger handgreifliches Angebot von vorhin. Als Jack seine Hände auf ihre Brüste legte, hielt Helen inne. Anstatt die Gürtelschnalle ihrer Jeans zu schließen, betrachtete sie seine langen Finger, die sich langsam zu ihren Knospen vorarbeiteten. Alles an ihm war lang und wohlgeformt. Ahhh ... ihre Brustwarzen waren ungemein sensibel, warum mussten sie denn nur so empfindlich sein? Aber eine kurze Flucht, ein kleiner Rausch, das war vielleicht nicht einmal verkehrt, um sich abzulenken und die widerstreitenden Gefühle für einen Moment zu verdrängen. Sie hasste es, von irgendetwas überrollt zu werden. Jack hatte recht, das hier war im Moment besser.
Sie stöhnte und seufzte, und dann sagte sie eine ganze Weile gar nichts mehr.
***
Ihr Herz schlug immer noch schnell, als sie sich aus seiner Umarmung befreite. »Sei mir nicht böse, Jack, aber ich möchte jetzt gern allein sein.«
»Kein Problem«, lächelte Jack. Er hatte abgefeuert, und auch Helen hatte einen kurzen, heftigen Höhepunkt gehabt. Kein Sternenflug und nicht wirklich befriedigend, aber angesichts der Umstände mehr, als er erwarten konnte. Wo er doch zunächst gedacht hatte, es zu versuchen wäre völlig sinnlos. Was wollte er also mehr? Offensichtlich nahmen die Gedanken an den Tod ihres Vaters nun ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. Zumindest war das etwas, worauf die Hübsche nicht vorbereitet war. Große Gefühle ausgeschlossen, er wusste Bescheid. Helen hatte aus ihrer Abneigung dem Vater gegenüber nie einen Hehl gemacht. Aber nun warteten die Haushaltsauflösung und die üblichen Laufereien auf sie. Gewiss würde die Fahrt über den Styx da drüben mit großem Pomp inszeniert werden.
Langsam wandte sich Helen um. Auf ihrem Antlitz spiegelte sich etwas, das Jack berührte. Mitfühlend hauchte er ihr einen Kuss auf die leuchtend rote Mähne. Der Tod des Alten war ihr nie und nimmer gleichgültig.
Jack begab sich ins Bad, und Helen schlurfte, ein T-Shirt überstreifend, in die Küche. Stilmäßig passte nun ein Whisky, fand sie. Ein Glenkinchie aus den schottischen Lowlands stand auf der Anrichte. Jetzt ging es darum, die sich plötzlich auftuende innere Leere zu bekämpfen, und was war dafür besser geeignet als Whisky? Ihr Vater war der letzte Vertreter der nun endgültig ausgestorbenen Rasse britischer Kolonialherren von anno dazumal gewesen, jene Gin- und Whiskytrinker mit der obligaten Havanna zwischen den Zähnen. Ganz wie Churchill, mit demselben Charisma, nur dass er dessen Alter nicht erreicht hatte. Mit dem zehnjährigen honigfarbenen Malt ließ sie sich auf dem gleichfarbigen Ledersofa nieder und sank in dicke Rohseidenkissen. Gerade als sie das Glas an die Lippen setzte, erschien Jack in der Tür. Ohne ihn zu beachten, schloss Helen die Augen und genoss den ersten Schluck. Sie spürte, wie der Whisky ihren Magen erreichte, sich dort ausbreitete, in ihre Eingeweide sickerte und an ihrem Rücken wieder emporkroch. Es war genau das, was sie jetzt brauchte.
Stirnrunzelnd beäugte Jack die halb volle Flasche. »Soll ich nicht doch noch bleiben?« Eine psychische Katastrophe schien sich anzubahnen.
Aus tiefblauen Augen streifte ihn ein unergründlicher Blick. Sie schüttelte den Kopf und stellte das Glas ab, dann stützte sie ihr eigenwilliges Kinn auf ihre Rechte und starrte mit Philosophenmiene ins Leere. Wenn sie für den Rest des Abends bei diesem Getränk blieb, würde sie wohl bald in jenes dumpf-trübe Brüten versinken, das Betrunkene für Tiefgang hielten. Auf Zehenspitzen schlich er aus der Wohnung.
Eine Weile starrte Helen auf die Tür, die sich leise hinter ihm geschlossen hatte. Jack war Moderator einer vorabendlichen Health-Sendung, sehr beliebt, sehr sportlich, dunkler Typ. Das machte allerdings noch keinen Latin Lover aus ihm. Die besaßen wirklich Temperament und konnten zudem singen. Jack konnte das nicht. Er hatte weder etwas von einem Intellektuellen an sich, noch war er besonders humorvoll, sah allerdings umwerfend gut aus. Fans zwischen fünfzig und achtzig legten bisweilen seine offizielle Telefonleitung lahm. Der begeisterte Baseballspieler tourte mit dem Team Elevens immer wieder hochleistungssportlich durch England, deshalb hatten Drogen in seinem Leben keinen Platz. Ansonsten kokste beinahe jeder in der Londoner Szene. Sie tat das nicht, aber aus anderen Gründen als er. Seit Jahren schlief sie nur noch mit Männern, die clean waren. Da war die Auswahl nicht sehr groß. Jack Daniels mit seinen rehbraunen Augen, dem Dreitagebart, seinen strammen Schenkeln und den Muskelsträngen über knappen Shorts war solch ein Mann. Einer fürs Bett, nicht mehr und nicht weniger. Niemand, den sie heute zurate ziehen wollte. Nein, die Entscheidung musste sie selbst treffen. Sie und der Glenkinchie, und zwar heute Nacht. Freitag würde das Begräbnis stattfinden. An dem Tag, an dem sie mit der Spitze der BBC ins Geschäft kommen wollte.
Seufzend griff Helen nach dem geschliffenen Glas. Sie kippte den restlichen Inhalt hinunter, wobei sie das Licht der gusseisernen Stehlampe durch die Facetten des Schliffs hindurch betrachtete. Ihr Vater wäre in dieser Situation nicht abgeflogen. Was hatte ihm die Familie schon bedeutet? Nichts. Nach fünfzehn Jahren Tyrannei hatte er ihre zartbesaitete Mutter ins Grab gebracht, danach wechselten die Haushälterinnen jährlich, weil keine es ihm recht machen konnte. Mit neunzehn war sie schließlich selbst von Zuhause geflohen, um sich ihren Berufswunsch zu erfüllen und seinen patriarchalischen Kuppelversuchen zu entgehen. Nein, eigentlich trauerte sie nicht um ihren Vater, sondern um die verpasste Gelegenheit, mit ihm ins Reine zu kommen. Sie hasste unerledigte Dinge. Und das Kapitel Johnatan Madox war für sie noch lange nicht erledigt gewesen. Verdammt. Großzügig schenkte sie sich nach. Vor zwei Monaten war sie von einem renommierten Londoner Notar benachrichtigt worden, dass sie nun offiziell Miteigentümerin einer indischen Filmproduktionsfirma war. Ihre daraufhin an den Vater gesandten Briefe waren unbeantwortet geblieben. Ihn anzurufen, war nach fünfzehn Jahren Schweigen auch keine Option. Nicht im Traum hätte sie daran gedacht, dass ihr Vater etwas von seinem nahenden Tod gewusst haben könnte. Immerhin war sie mit seiner Schwester, ihrer Tante Crystel, in Kontakt, und auch diese hatte offensichtlich nichts geahnt. Jedenfalls hatte sie es nicht erwähnt, als sie sie soeben von seinem plötzlichen und überraschenden Ableben unterrichtet hatte. Herzversagen. Also bitte keine Selbstvorwürfe, ermahnte sie sich und nahm einen kräftigen Schluck aus dem erneut gefüllten Glas. Und dennoch. Sie hasste unerledigte Angelegenheiten. Aber damit würde sie künftig wohl leben müssen.
Nicht gerade eine nette Vorstellung. Sie griff zu ihrem Handy und wählte die Nummer ihrer Freundin Gloria. Es war zwar schon spät, aber Väter starben nun mal nicht alle Tage. Nach langem Läuten meldete sich eine verschlafene Stimme am anderen Ende der Leitung in Kensal Green. Hugh war am Apparat.
»Nein, weck sie nicht auf. Richte ihr aber bitte aus, dass ich sie morgen dringend sprechen muss. Und entschuldige die späte Störung, Hugh. Gute Nacht.«
Eine Weile nippte sie am Glas, dann stand sie auf, um sich Erdnüsse und Oliven zu holen. Vielleicht hätte ihr Vater mit der Zeit ja noch weitere Zeichen gesetzt. Andererseits war sie seine einzige Erbin. Ihre geschiedene Tante Crystel war kinderlos geblieben. Nachdem sie sich Vorjahren als bisexuell geoutet hatte, hörte sie für ihren Bruder von einem Tag auf den anderen auf zu existieren. Als Persona non grata war ihr zunächst der Umgang mit der pubertierenden Nichte beinahe unmöglich gemacht worden. Die Erinnerung an so manche pikante Szene zauberte ein Schmunzeln in Helens fein modellierte Züge.
Sie seufzte. Mit einem kräftigen Schluck Malt spülte sie das Gemisch aus Erdnüssen und Oliven hinunter und betrachtete versonnen das Glas in ihrer Hand.
In den Jahren nach dem Tod ihrer Mutter hatte sich so etwas wie eine Hassliebe zwischen ihrem Vater und ihrer Tante entwickelt, die sich im Alter jedoch abschwächte. Irgendwann war Crystel zu ihrem Bruder gezogen, und seitdem führte sie mehr oder weniger ungezwungen den Haushalt in Malabar Hill. Zumindest hatten die Haushälterinnen nicht mehr jährlich gewechselt. Vermutlich hatte ihr Vater die hässlichste englischstämmige Schrulle engagiert, um Tante Crystel nicht in Versuchung zu führen. Er war nicht nur Puritaner gewesen, sondern auch Rassist.
»Pass auf«, hatte er sie immer wieder gewarnt. »Die verwenden die linke Hand als Klopapier.« Er meinte die Hindus und deren Gepflogenheiten beim täglichen Geschäft. Nur dort, wo der Tourismus blühte, gab es in Indien anstelle des Lochs im Boden ein WC mit Sitz, und wenn man noch mehr Glück hatte, sogar Papier. In diesem Punkt hatte er recht gehabt. Schmunzelnd nahm Helen einen weiteren Schluck. Das kräftige malzige Aroma vertrug sich ausgezeichnet mit den Erdnüssen, fand sie. Ein wenig zu gut vielleicht. Seufzend leerte sie das Glas und rappelte sich hoch, um sich einen Tee zu brauen.
Noch war die Entscheidung nicht gefallen, noch musste sie einen klaren Kopf bewahren. Nur wie sie jetzt merkte, war es dazu womöglich schon zu spät. Zumindest versuchte sie sich so zu bewegen, als hätte sie soeben den Fünfuhrtee zu sich genommen. Mit einem nach Vanille-Aroma duftenden Darjeeling in einer bauchigen Tonkanne kehrte sie – erstaunlich geradlinig – zum Sofa zurück.
Was hatte sich ihr Vater eigentlich dabei gedacht, so unverhofft aus ihrem Leben zu verschwinden? War das seine allerletzte Bosheit gegen sie? Wenn sie zu seinem Begräbnis fuhr, würde das für sie nur Unannehmlichkeiten bedeuten. Innerhalb von zwei Tagen musste sie packen und noch einmal die Großmutter besuchen, ihr Termin bei der BBC würde platzen, und die Leute von der Produktionsabteilung des Privatsenders, für den sie gerade ein Drehbuch schrieb, musste sie noch morgen oder übermorgen treffen ...
Johnatan Madox, du bist den Aufwand nie und nimmer wert. Andererseits war der Hass gegen ihren Vater mit den Jahren immer schwächer geworden. Sie wunderte sich beinahe über diese Erkenntnis, während sie den heißen Tee schlürfte. Und leise, ganz allmählich, machte sich ein anderes Gefühl in ihr breit, nistete sich in ihrem Herzen ein und schwoll an, bis ihre Brust zu bersten drohte. Ein Gefühl, das sie fünfzehn Jahre lang nicht zugelassen hatte. Kostbar nach all der unterdrückten Sehnsucht nach Bombay, ihrem einstigen Zuhause. Es war das Glücksgefühl, endlich wieder in ihre alte Heimat zurückkehren zu können.
Bilder, die immer bunter wurden, zogen an ihrem geistigen Auge vorbei. Die Blütenpracht der Kassie, des indischen Goldregens, der jetzt im Februar ihren Garten in ein Meer aus Gelb verwandelte, und die Mango- und Korallenbäume, die bald leuchtend rot in voller Blüte stehen würden. Der hohe Banyanbaum in der Auffahrt ihres elterlichen Hauses, in dem sich stets der eine oder andere Eisvogel mit schillernd türkisem Gefieder oder ein Wiedehopf mit eleganter schwarz-weißer Haube fand. Dann stellten sich auch akustische Erinnerungen ein. Straßenlärm vermischte sich mit populären Filmmelodien, die aus Kassettenrekordern dröhnten, während von Tempeln und Straßenschreinen religiöse Lieder herüberwehten. Irgendwo erklang festliche Musik mit kräftigem Trommelwirbel anlässlich einer Hochzeit und in einem Durchgang die traurigen Töne einer Sehnai.
Wenn sie so weiterträumte, sah es nicht gut aus für ihre zukünftige Karriere als Exklusivschreiberin der BBC. Bedächtig erhob sie sich, um das Bad aufzusuchen. Schon kroch ihr der Malt in die Glieder, doch wider Erwarten blieb der Raum samt allem Interieur unbewegt. Dann sank sie wieder zurück aufs Sofa, kuschelte sich in ihre Patchworkdecke und nahm einen letzten Schluck von Schottlands Lowlands.
Natürlich kannte sie das offizielle Bombay, das sich neuerdings Mumbai nannte und die größten Slums ganz Asiens beherbergte, kannte sie die Hitze, die Feuchtigkeit, den chronischen Platzmangel und die Abgase. Doch diese furchtbaren Zustände der Neunzehnmillionenstadt und deren jeden unbedarften Touristen abschreckende Hektik verbannte sie aus ihren Gedanken. Denn dort, inmitten dieser ungeheuren Menschenmassen, gab es jemanden, der sie durchaus reizen könnte. Zumindest fand sie ihn als Schauspieler so faszinierend, dass sie ihn gerne kennenlernen würde: Arun Raat, den Geschäftsführer der Firma ihres Vaters. Sie kannte alle seine Filme, wie sie auch alle Filme der Madox Production kannte, die Tante Crystel ihr jeweils als Director’s Cut umgehend nach London geschickt hatte. Bevor Arun in die Filmproduktion eingestiegen war, hatte er sich sehr erfolgreich vor der Kamera einen Namen gemacht. In den Neunzigern war der smarte Märchenprinz und Herzensbrecher aus Indien selbst in Londons Filmszene der Liebling einer beachtlichen weiblichen Fangemeinde gewesen. Seinen letzten Film hatte er vor vier Jahren gedreht. Mit fünfunddreißig Jahren. Daraufhin hatte der attraktive Mann plötzlich die Seiten gewechselt. Sein bislang einziger Film als Regisseur war zwar kein echter Blockbuster geworden, doch hatte sie ihn besser gefunden als alles, was in letzter Zeit in Bollywood gedreht worden war. Arun war kein geckenhafter Hohlkopf. Im Gegenteil.
Vermutlich steckte durchaus etwas in seinem hübschen Köpfchen – sonst hätte ihr Vater ihn kaum als Geschäftsführer eingestellt. Seufzend löschte sie die Kerze im Stövchen.
Irgendwann in der Nacht erwachte sie aus beunruhigender Schwärze. Imponierend rasch fand sie ihr exzellentes topografisches Wissen bestätigt. Hier war ihr Sofa, auf dem sie ausgestreckt lag, und dort oben hing der verschnörkelte Kronleuchter, den sie erst kürzlich auf einem Vorstadt-Flohmarkt erstanden hatte. Ihr Zustand war also keineswegs kritisch. Das Lächeln auf ihren Lippen, mit dem sie in neuerlichen Schlaf sank, verriet, dass die Sache mit Bombay entschieden war.
Gleich in aller Frühe suchte sie das Reisebüro nahe ihrer Wohnung auf und ergatterte einen Abendflug für den nächsten Tag mit Ankunft in Mumbai am Freitag, dem vierten Februar um sieben Uhr morgens. Sie rief ihre Tante an und bat sie, ihr den Chauffeur zum Flughafen zu schicken. Die Einäscherung war für zwölf Uhr auf dem St. Cristopher Cementery der nach anglikanischem Vorbild gegründeten Church of South India angesetzt. Mit den Leuten des Privatsenders Sky konnte sie telefonisch ein Treffen für den Morgen des nächsten Tages, einem Donnerstag, vereinbaren. Nun blieben noch ihre Großmutter und die weitaus unangenehmere Aufgabe, den Boss der Fernsehfilmproduktion der BBC davon zu überzeugen, dass das Begräbnis ihres Vaters in Indien ein ausreichender Grund war, das Treffen mit ihm zu verschieben. Wie sich herausstellte, bestand die nächste Möglichkeit erst wieder im April.
Vom BBC-Hauptquartier aus nahm sie die Northern Line der U-Bahn nach Morden in den Süden Londons und von dort den Bus, um bei ihrer Großmutter ein köstliches Mittagessen zu verspeisen, dem ein zwangloses Teekränzchen mit Kuchen folgen würde. Sicherheitshalber hatte sie gleich in der Frühe ihr Kommen angemeldet.
»Dann ist das alte Scheusal also endlich tot«, brummte Elsa Albert, als sie den Grund für Helens Besuch erfuhr. »Geschieht ihm recht, dass er all sein Geld nicht mehr genießen kann.« Die schlichte, aber herzensgute Frau hatte sich nie mit ihrer Meinung über den Schwiegersohn zurückgehalten. »Er hat meine Annie auf dem Gewissen, Kind.«
»Ich weiß, Großmutter, ich kann mich noch gut an Mamas Kummer erinnern.« Wie damals, als sie eine Fehlgeburt gehabt und er ihr vorgeworfen hatte, dass die weiblichen Mitglieder seiner Familie weniger taugen würden als die indischen Dienstmädchen mit Mist zwischen den Zehen. »Aber sie war nicht nur für diesen Egoisten zu gut. Weißt du, was ich glaube?« Neugierig schaute Helen in die Töpfe auf dem Herd. »Also ich denke, Mutter war zu gut für diese Welt, ehrlich. Jeder hätte sie ausgenutzt.«
Die alte Dame seufzte und zog eine Schulter hoch, während sie weiter Petersilie hackte. Schon duftete es im ganzen Haus nach kräftiger Bouillon und Großmutters sagenhaften Fleischklößen in Rahmsoße. Bis beides auf den Tisch kam, überlegte Helen, was ihr noch für die Reise fehlte.
***
Den Nachmittag nutzte sie für diverse Einkäufe. Ein schlichtes schwarzes Kleid und eine neue Handgepäcktasche von Louis Vuitton standen ganz oben auf ihrer Liste, außerdem ein Paar neue Schuhe. Sie hatte ein Faible für Schuhe, und so war jeder Anlass willkommen, ihr Arsenal zu vergrößern. Da noch kaum Sommerkleidung erhältlich war, fand sie in der kurzen Zeit nur ein kleines Schwarzes. Knielang, tailliert und dekolletiert, war es für ein Begräbnis allerdings ausgesprochen gewagt. Zumindest den Ausschnitt wollte sie durch ein schwarzes Seiden- oder Chiffontuch ein wenig entschärfen. Schließlich besorgte sie noch Repellents, eine Packung Vitamin-B-Dragees und Resochin-Tabletten, um der Anopheles-Mücke von vornherein keine Chance zu geben. Denn mit Malaria war nicht zu spaßen, immerhin galt die Erkrankung nach wie vor als eine der häufigsten Todesursachen auf dem Subkontinent. Auch in Mumbai, obwohl die Stadt erstklassige medizinische Versorgung bot.
Nach Geschäftsschluss nahm sie die Bakerloo-Linie bis Kensal Green. Sie freute sich auf ein Wiedersehen mit ihrer Freundin Gloria, der sie ihre Neuerwerbungen gleich vorführen wollte. Das letzte Wegstück Richtung Queens Park lief sie zu Fuß. Es war nicht weit und sie genoss es, die frische, klare Luft einzuatmen. Die ersten Jahre ihrer Ehe, erinnerte sich Fielen, hatte Gloria mehr Zeit in diesem Park zugebracht als bei sich zu Hause. Selbst bei Wind und Wetter hatte sie es vorgezogen, ihre drei kleinen Racker auf englischem Rasen anstatt auf dem teuren Parkett ihrer Mietwohnung herumtoben zu lassen.
Als sie aus dem Fahrstuhl trat, sah sie Gloria vor ihrer eigenen Wohnungstür stehen und klingeln.
Als sie Helen bemerkte, stieß sie einen Freudenschrei aus, umarmte ihre Freundin und küsste sie.
»Ich habe mich ausgesperrt«, verkündete Gloria lachend, dann wurde sie ernst. »Geht es dir gut?« Sie spielte auf den Tod ihres Vaters an.
»Ja, es geht«, meinte Helen und folgte ihr in die Wohnung. »Du siehst umwerfend aus.« Sollte sie noch einmal, in einer anderen Inkarnation, auf die Welt kommen, wollte sie Glorias Haut haben. Ihre Freundin war von südländischem Typ, eine Latina, rassig, glutäugig und dunkelhaarig. Nach der Geburt der drei Kinder war sie ein bisschen in die Breite gegangen, aber das tat ihrem Temperament keinen Abbruch.
Die Wohnung sah aus, als wären sie soeben erst eingezogen, obwohl sie hier schon seit mehreren Jahren wohnten. In jedem der Zimmer standen Schachteln mit Frühstückstellern darauf, lagen Spielzeuge, Fahrräder und Schultaschen über den Boden verstreut. Und mittendrin machte es sich Gloria, in Strümpfen und buntem Kaftan, bequem, nahm heiter und gelassen die neben ihr stehende Tasse Rooibos-Tee auf und nippte daran. Ihre drei Kinder im Alter von vier, sechs und acht Jahren sprangen nackt und mit Schokolade und Farben beschmiert durchs Zimmer, wobei sie Chips und Popcorn aus herumliegenden Tüten stibitzten.
»Es wird höchste Zeit, dass sich jemand um diese Monster kümmert!«, rief Gloria laut in Richtung Arbeitszimmer. »Seht ihr nicht, dass ich Besuch habe?« Und zu Helen gewandt: »Hugh hat versprochen, sie ans Bett zu binden, wenn du kommst.«
Lieb von ihm, aber leider hat er es nicht wahr gemacht, dachte Helen gehässig. Also mussten sie sich in diesem Chaos unterhalten, wie so oft, wenn sie Gloria, die leidenschaftliche Theaterspezialistin, zu Hause aufsuchte. Während des Studiums war sie die engagierteste von ihnen gewesen. Aber sie hatte es ja nicht abwarten können, alles für den erstbesten Immobilienheini wegzuwerfen, der ihr über den Weg lief. Und jetzt musste sie jedesmal ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sich zu den Vorstellungen davonschlich.
»Oh Gloria«, sagte Helen später, nachdem sie ein Taxi bestellt hatte, »ich werde dich so vermissen!« Auch wenn das ein wenig übertrieben war, würde ihr Gloria doch fehlen. Sie war wie ein ruhender Pol, irgendwo am Rande ihres Lebens. Aber längst hatte Helen über sich selbst herausgefunden, dass sie nicht dieser schwesterliche Typ war wie andere damals in ihrer Gruppe. Und deshalb hatte sie auch nicht weiter darüber nachgedacht, ob enge Verbindungen zu anderen Frauen tatsächlich eine Bereicherung darstellten.
***
Am späten Abend packte sie die Koffer. Das Treffen mit Jeff Cooper, dem Produzenten des Privatsenders Sky, sowie dem verantwortlichen Redakteur, dem Regisseur des Films und dem Hauptdarsteller Clive Oulen war für den nächsten Morgen um neun Uhr angesetzt. Bis alles gepackt war, vergingen einige Stunden, und ihr blieb nur wenig Schlaf.
Am nächsten Morgen war sie wie üblich spät dran und rief ein Taxi. Ob es einigermaßen harmonisch verlaufen wird?, fragte sie sich auf dem Weg. Vielleicht, wenn man von den Starallüren eines Möchtegernsternchens auf der britischen Leinwand absah. Damit meinte sie nicht Clive Oulen. Aber möglicherweise kam Kitty Meade, die Besetzung für die weibliche Hauptrolle, ohnehin nicht. Das Meeting fand nicht im Hauptquartier des Senders statt, sondern im »Marble Arch«, dem Londoner Viersternehotel, in dem sich Filmstars und PR-Leute die Klinke in die Hand gaben.
»Das Skript ist großartig, Helen«, empfing sie Cooper um neun Uhr im Foyer und lenkte sie in Richtung Lift. »Sind Sie nervös? Clive findet es toll. Er wird Ihnen gefallen.«
Davon war sie überzeugt. Er galt als großer Verführer vor dem Herrn. Sorgen machte sie sich eher über die weibliche Besetzung. »Wenn ich Clive Oulen im Bett kennenlernen könnte, wäre ich nicht annähernd so nervös.« Das würde alles einfacher machen. Mit Oulens Zustimmung wäre ihr Manuskript durch und Kitty Meade wäre draußen.
»So?« Cooper lachte anzüglich.
Sie wusste, wie man mit den Typen in der Branche umging. Es fiel ihr nicht schwer. Sie hatte klein angefangen und sich allmählich in die Riege der gefragtesten Drehbuchautorinnen hineingeschrieben. Sie kannte Londons Szene und sie kannte Londons Gosse.
»Warum sind Sie dann nervös?«, fragte Cooper und warf ihr von der Seite einen lauernden Blick zu. Dann nickte er Helens Agent Knightly zu, der vor den Liften zu ihnen stieß und sich an ihre andere Seite schob.
»Ich will das Manuskript nicht umschreiben, Jeff, weil es wirklich gut ist. Egal, was die da drinnen sagen werden.«
Kevin Knightly, der wandelnde Kompromiss, grub seine dicken Finger in ihren Arm. Schweigend fuhren sie hinauf in den dritten Stock. Der Sender hatte Oulen am Ende des dezenten, in noblem Elfenbeinton gehaltenen Flurs untergebracht. Ihr würde man für eine Übernachtung vermutlich nur eine Besenkammer finanzieren, aber er wohnte dort für neunzig Pfund die Nacht hinter goldverzierten Türen. Oulen war nur auf Promotiontour in der Stadt, mittlerweile drehte er mehr in Hollywood als in London und spielte hier kaum noch Theater.
»Ich kann es gar nicht erwarten, diesen legendären Casanova kennenzulernen«, legte Helen ein Schäufchen nach. Sie war sauer wegen Kitty Meade, aber die durfte sie nicht direkt angreifen.
Kevin hüstelte.
»Sehen Sie nicht so schwarz, Helen«, beschwichtigte Cooper und ging voraus. »Oulen mag Frauen und Frauen mögen ihn…«
»Und er mag Kitty Meade?« Es sollte wie nebenbei klingen.
»Aber ja!« Cooper wollte das wohl selbst gerne glauben. »Miss Meade passt wunderbar für diese Rolle. Sie sollte vielleicht doch etwas ... nun ... humorvoller sein – die Rolle, meine ich.«
Er wollte also tatsächlich diese Schmierenkomödiantin. Kommt nicht infrage!, schäumte Helen. Aber sie hatte wohl keine Wahl. Es musste offenbar Kitty Meade sein, das Betthäschen des Regisseurs. Der Flop war garantiert. Ihr so herrlich subtiler und geistreicher Part würde durch die haarsträubende Dilettantin geradezu ins Lächerliche gezogen werden.
Selbst Kevin schnaubte verächtlich hinter Coopers Rücken. »So ein Quatsch«, flüsterte er ihr keuchend zu.
»Gehen diese blöden Türen überhaupt noch mal auf?«, ärgerte sich unterdessen der Produzent lauthals. Jemand auf der anderen Seite konnte sich offenbar nicht entscheiden, ob er ziehen oder drücken sollte.
»Und außerdem«, fuhr Kevin raunend fort, »hätte ich mir nicht den Arsch dafür aufgerissen, das Skript für dich an Land zu ziehen, wenn mir nicht daran gelegen wäre, deine spitze Feder einzubringen, Helen. Oulen ist unser Garant für den Erfolg.«
Na hoffentlich, dachte sie.
Eine breite Flügeltür ging auf, und Helen betrat den Salon der Stars. Auf dem Rokokotischchen lagen eine Umhängetasche von Gucci und ein Diplomatenköfferchen von Hermès. Champagner auf Eis und gelbe Tulpen komplettierten das Bild. Eine Dunkelhaarige, die nach elegantem Straßenstrich
aussah, telefonierte soeben mit dem Zimmerservice. Vermutlich war sie eine Leihgabe des Senders.
Nach der allgemeinen Begrüßung bedankte sich Helen dafür, dass man das Meeting kurzfristig hatte vorverlegen können. Sie nannte auch den Grund für ihre plötzliche Abreise, woraufhin das Grinsen in den Gesichtern der Anwesenden für eine halbe Minute einfror.
»Tut mir wirklich leid, Helen«, brummte der Regisseur, und auch Oulen murmelte sein herzliches Beileid.
Man reichte ihr ein Glas Champagner. Zwei Blondinen in hohen weißen Schlangenlederstiefeln flatterten nervös im Raum herum und versorgten alle mit Brut.
»Können wir anfangen?« Helen warf einen auffordernden Blick in die Runde und blieb dann bei Oulen hängen. »Eine blonde Vollbusige ..." – das Wort »Barbiepuppe« konnte sie sich gerade noch verkneifen, obwohl es ihr verführerisch auf der Zunge lag – »... ist eine komplette Klischeebesetzung.« Vielleicht würde sie Oulen so gegen Kitty aufstacheln können. Natürlich musste er keine Angst davor haben, von den Brüsten der Meade an die Wand gespielt zu werden. Aber vielleicht lag ihm ja doch etwas an einem guten Drehbuch. Vermutlich hatte er es soeben erst überflogen.
»Setz nicht gleich das Brecheisen an, Helen«, flüsterte Kevin, schon leicht transpirierend, an ihrer Seite. In seinen Händen hielt er ein Foto von Kitty Meade.
Die Frau war eine Katastrophe, nicht nur auf der Leinwand, stöhnte Helen. Rein aus Interesse hatte sie sich eine unbedeutende Nebenrolle von ihr angesehen. Sie musste eine himmlische Bläserin sein oder irgendein anderes Kunststück beherrschen, denn außer großen Titten, dracularot lackierten Fingernägeln und einem netten spitzen Fuchsgesichtchen
hatte sie nichts entdeckt, was der Regisseur hätte anziehend finden können. Ausgenommen ihr Alter. Der Mann war gewiss schon erfolgreicher Regisseur gewesen, als Kitty noch ihre Windeln schick fand.
Auf Helens Bemerkung hin wurde Coopers Blick kühl und der des Regisseurs gefror zu Eis. Immerhin war Letzterer so höflich, die Reaktionen der anderen abzuwarten. Wäre Kitty dort gewesen, wären ihre ähnlich einer balinesischen Tempeltänzerin geschminkten Augen vermutlich nervös zwischen ihrem Gönner, Oulen und Helen hin- und hergehuscht.
Träge führte Oulen sein Glas an den Mund. »Klischeebesetzung«, wiederholte er murmelnd und nickte. Er lächelte Helen an, als ob sonst niemand im Zimmer wäre.
Oh diese Zähne!, schwärmte Helen. Er sah gut aus, und dieses selbstironische Grinsen machte ihn in Nahaufnahme nur noch attraktiver. Clive Oulen lehnte in einem Berg von Seidenkissen am Kopfende eines übergroßen Bettes und hatte seine Absätze in die elfenbeinfarbene Satindecke gebohrt. Seine Grübchen, die Furchen auf der Stirn und die Fältchen um die tiefblauen Augen bewahrten ihn vor unerträglicher Schönheit. Er war schmaler gebaut, als sie sich vorgestellt hatte, vor allem an den Schultern.
»Das ist also die berühmte Miss Madox«, sagte er und stand mit elegantem Schwung auf. Aus einer Pralinenpackung auf einem größeren Rokokotischchen vor dem Fenster wählte er ein Sahnebonbon aus und schob es sich genussvoll zwischen die Zähne. Erst dann fiel ihm ein, die Bonbonniere auch den anderen anzubieten, die in einem Halbkreis um sein Bett herumsaßen. Er war zweifelsohne der Star, und das spielte er gekonnt aus. »Das Drehbuch zu ›Lennie‹«, meinte
er versonnen kauend, »gefällt mir. Ich jedenfalls habe keine Änderungswünsche oder Verbesserungsvorschläge.« Er sah ziemlich unschuldig in die Runde.
Hervorragend!, freute sich Helen, aber schon ergriff Kevin Knightly das Wort. »Es gibt also so gut wie keine Probleme, jedenfalls keine größeren.« Er rieb sich die Hände und verlagerte dabei seine Fettmassen in seinem schwarzen Samtanzug.
»Bis auf ein paar winzige Details.« Der Regisseur wandte sich zu Oulen um. »Miss Meade wird die Nachbarin geben, aber etwas ... äh ... unschuldiger, etwas ... frischer ...«
»Hm.« Oulen schien darüber nachzudenken.
»Von welchem Drehbuch redet ihr hier eigentlich?«, fragte Helen spitz.
»Wenn Helen irgendetwas ist, dann flexibel, ein richtiger Schatz. Nicht wahr, Helen?« Kevin zwinkerte der in engem Rock und Kaschmirpulli neben ihm sitzenden Drehbuchautorin zu.
»Unschuldiger. Frischer«, äffte Helen. »Denkt jemand dabei vielleicht an Gracie Allen? Oder an ›Laugh-In‹? Goldie Hawn ist darin nicht bloß irgendein blondes Dummchen, sie ist das ultimative blonde Dummchen!« Helen sah sich um. »Nein, diese Nachbarin ist weder unschuldig noch besonders witzig. Sie ist geheimnisvoll, zurückhaltend, subtil und leicht ironisch. Das ist ja das Spannende an der Geschichte zwischen den beiden. Ich bin mir sicher, dass Mr. Oulen das glänzend hinbekommt. Mr. Oulen?« Deutlicher konnte sie nicht werden. Verdammt! Die balinesische Tempeltänzerin sollte sich auf Waschmittelwerbung im Fernsehen beschränken, die zahlten auch gut.
»Ich hätte jetzt gerne einen Kaffee«, erwiderte Oulen.
Offensichtlich war es das Einzige, was dem Hauptdarsteller dazu einfiel. Immerhin, er bestellte keinen Drink um halb zehn Uhr vormittags. Das sprach für ihn. Espresso hatte auch eindeutig weniger Kalorien. Eine der beiden Blondinen löste sich aus dem Hintergrund und telefonierte mit dem Zimmerservice, worauf Oulen sich mit einer nonchalanten Geste bedankte.
»Nun, Helen«, mischte sich Cooper ein, um den mit dem Regisseur längst ausgehandelten Deal zu bekräftigen, »die Rolle der Nachbarin spielt nun einmal Miss Meade. Ich denke, Sie werden dem einfach Rechnung tragen. Schneidern Sie Kitty die Rolle sozusagen auf den Leib!«
»Recht schwierig, wenn man gar nicht weiß, was davon echt ist.«
»Helen!« Knightly sprang mit der Kaffeekanne in den Ring.
»Die wichtigere Rolle spielt ohnehin unser fabelhafter Mr. Oulen«, bemerkte Cooper ungerührt und mit arrogantem Grinsen.
»Miss Madox«, meldete sich der Redakteur von Sky zum ersten Mal zu Wort, »bis wann können wir mit dem fertigen Drehbuch rechnen?«
»Ich denke, die winzigen Details kann ich in einer Woche geändert haben.« Helen grinste zuckersüß zu Cooper hinüber. Sie würde nicht viel ändern. Nicht genug jedenfalls. »Wenn das Übrige passt, schicke ich euch das Skript unter dem Arbeitstitel ›Lennie‹ wie vereinbart in zwei Wochen.«
»Wo wir gerade bei den Details sind«, grübelte der Regisseur, »im dritten Kapitel sollten wir den Ort der ersten Begegnung ändern, und die Szene am Schluss auf der Brücke ...«
Herrgott!, stöhnte Helen und verdrehte die Augen. Es würde sie eine weitere Stunde kosten, bis alle ihren Senf dazugegeben hatten und sich einig waren.
Um zwölf Uhr raste sie schließlich genervt mit einem Taxi zurück in ihre Wohnung. Sie räumte Bad und Küche auf, bestellte, an einem Müsliriegel kauend, ihre wöchentliche Raumpflegerin bis auf Weiteres ab und sagte danach alle Termine für Freitag, Samstag und die kommende Woche ab. Dann leerte sie sämtliche Abfalleimer in Müllsäcke, räumte den Kühlschrankinhalt in eine Plastikwanne um und läutete nebenan bei Mrs. Mereweather. Ihre Nachbarin stand am Herd und lud sie hartnäckig zu einer Portion Krabben in Gingerale-Teig ein, die bereits fertig gebacken waren. Helen hasste Krabben. Doch um die gute Frau nicht ganz zu vergrämen, was schließlich ihre Pflanzen auszubaden hätten – denn Mrs. Mereweather nahm solche Dinge durchaus persönlich, das hatte sie schon einmal mit dem Weihnachtsgebäck erlebt –, stimmte Helen einer kleinen Schüssel Salat zu. Da konnte ja nicht viel schiefgehen. Dachte sie. Vielleicht hätten die Engländer früher, als sie noch Land für die Krone zusammenrafften, einfach nur ihre Köchinnen vorausschicken sollen. Die Kapitulation der Gegner wäre schneller erfolgt und grausames Blutvergießen so vermieden worden. An Blumenkohl mit Tofudressing stirbt es sich bestimmt angenehmer. Den im Kühlschrank auf Mr. Mereweather lauernden Nachtisch schlug sie jedoch erfolgreich aus und entkam damit nur knapp einem zweiten Attentatsversuch der begeisterten Hobbyköchin, die in völliger Verkennung ihrer Fähigkeiten die Leute einfach nur kulinarisch beglücken wollte. Die Spezialität des Hauses, eine Sojagelee-Kreation mit Birnen, würde heute nur einen Menschen verzweifeln lassen. Blieben der Kaffee und ein Stück Kuchen vom Vortag. Das Gebäck war eine Erfahrung, die jeder einmal im Leben machen sollte, damit er in Extremsituationen weiß, es kann immer noch schlimmer kommen. Doch sie musste sich zusammennehmen. Wichtig war jetzt nur, dass Mrs. Mereweather das Pflanzengießen und das Entleeren des Postfaches übernahm.
Wieder zurück in ihrer Wohnung, drehte sie die Heizkörper zu und zog sich um. Vor die Entscheidung gestellt, zwölf Stunden first dass über Frankfurt oder Paris unterwegs zu sein oder nonstop, aber in der Economyclass, direkt von London aus zu fliegen, hatte sie sich für den direkten Linienflug mit Jet Air entschieden. Die bequemsten Jeans waren also angesagt.
Plötzlich läutete ihr Handy. Jack konnte sich in letzter Minute doch nicht freimachen, also würde das Gepäckschleppen in Londons Untergrundbahn den unfreiwilligen Höhepunkt des Tages bilden. An sich war das kein Problem, denn die Piccadilly Line fuhr bis Heathrow. Lästig waren nur die zwei Koffer. Sie würde sich also ein Taxi bis zur U-Bahnstation nehmen. Wieder läutete das Handy. Diesmal war es Gilbert Scott. Das Handy zwischen Schulter und Wange geklemmt, schleppte sie den Müllsack zum Lift und hinunter ins Parterre.
»Aber nein, ich bin schon auf dem Weg zu dir«, sagte er am anderen Ende der Leitung. »In zehn Minuten stehe ich vor der Tür!«
Der gute Scotti. Warum habe ich nicht gleich an ihn gedacht?, überlegte Helen, während sie zu ihrem schwarzen Pulli die passende Kette wählte. Er war immer da, wenn sie ihn brauchte. Seit über zehn Jahren. Seit der Zeit ihres Studiums und den ersten mageren Jahren danach, in denen sie die Abende lieber bei Freunden wie ihm – er hatte reiche Eltern – und in Kneipen verbracht hatte, weil es dort wärmer gewesen war als in ihrer zugigen Studentenbude. Mittlerweile hatte sie eine nette Penthouse-Wohnung im vierten Stock eines viktorianischen Hauses am Rande eines Parks, über dessen Baumwipfel hinweg sie in die untergehende Abendsonne blicken konnte. Wenn sie denn mal schien und sie selbst zu Hause war – was allerdings häufiger vorkam. Ja, die Wohnung hatte sogar einen kleinen Balkon, der im Hochsommer exakt von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr von der Sonne beschienen wurde. Das reichte völlig für einen Nachmittagskaffee mit Kuchen und eine Runde gesundes Bräunen. Die Wohnung in der Rabbi Talor Street erfüllte sie jedenfalls mit einem gewissen Stolz, denn die selbst für Londoner Verhältnisse hohe Miete konnte sie allein mit ihrer Drehbuchschreiberei aufbringen. Das war nicht immer so gewesen. Das Klingeln der Türglocke schreckte sie aus ihren Gedanken.
Gilbert bestand darauf, sie bis zum Check-in-Schalter zu begleiten. Seine Heiterkeit verflüchtigte sich auf dem Weg dorthin zusehends, als sich immer mehr Turban tragende Männer in langen weißen Hemden unter die Reisegäste mischten. »So ein Nachthemd unter einem Mantel sieht doch echt bescheuert aus«, nörgelte er. Gilbert Scott trug Lederhosen in Sonderanfertigung, und unter seinem Webpelzmantel blitzten weiße Rokokoärmel hervor. So neu und exklusiv seine Kleidung auch sein mochte, immer sah er aus, als hätte er sich auf der Müllkippe eingekleidet, was vermutlich an seiner massigen Gestalt lag; mit seinen Schultern hätte er einen Brückenpfeiler verdunkeln können. Dennoch wirkte er nicht wie ein abgehalfterter Koloss. Sein nussbraunes Haar war stets glatt und im Nacken ordentlich zusammengebunden, während die tief liegenden braunen Augen Launenhaftigkeit ausstrahlten. Gilbert Scott war als Maskenbildner ziemlich erfolgreich. Und er war schwul wie die Hälfte seiner Kollegen in der Szene.
»Ohne Mantel würden sie wohl frieren. Deshalb werden wir jetzt schön zusammenrücken. Vor allem in der Economyclass«, erwiderte Helen mürrisch.
Gilberts braune Augen wurden groß und rund wie Haselnüsse. »Nein! Sag bloß, Schatz. Du hast doch nicht etwa die Sardinenversion ...«
»Genau. Kein First-Class-Ticket. Die Maschine war ausgebucht.« Mit einem schiefen Lächeln zuckte Helen die Schultern.
Gilbert pfiff durch die Zähne. Dann tanzte er wie ein Waschbär auf der Stelle. »Und mit wem werde ich in Zukunft so angeregt lunchen können?«, fragte er schließlich.
»Mit all denen, mit denen du es bisher auch getan hast.«
»Ich sagte ›angeregt‹!«
London war das Zentrum ritueller Dekadenz. Und lunchen in London war Scottis Lieblingsbühne des Verfalls. Zwar konnte man am Telefon besser Ränke schmieden oder Freunde und Bekannte durchhecheln. Aber man musste auch hin und wieder essen gehen, und die Finessen des Einkommenssteuersystems ermunterten die Besserverdienenden, sich mittags in Jamie Olivers »Fifteen« oder im »Blue Elephant« zu treffen, um absetzbaren Hummer, Lachs oder Sushi zu verspeisen. »Nett von dir, Scotti«, meinte sie schlicht. Auch wenn sie nicht gerade in völliger Armut aufgewachsen war, konnte sie sich nur schwer daran gewöhnen, für einen Lunch in diesem hysterischen Ambiente fünfzig Pfund hinzublättern, auch wenn sie nur selten in die Verlegenheit kam, selbst zahlen zu müssen. Früher, während ihres Studiums und in den anschließenden mageren Jahren, hatte ein Lunch in der Stadt für sie aus einem Thunfischsandwich bestanden.
»Musst du wirklich fliegen? Ich meine, er ist ja schon tot.« Gilbert bleckte seine kräftigen gelblichen Zähne.
»Ich fahre doch nur einen Grillenhupfer weit weg, Gil«, beschwichtigte Helen.
»Klar, Bombay liegt ja quasi um die Ecke.« Er schob sich ein Kräuterbonbon zwischen die Zähne. »Ein Neunstundenflug ist kein Grillenhupfer, Helen.«
Das war ihr vollkommen bewusst. Die Frage war natürlich auch, wie lange sie dort zu bleiben gedachte. Sie wusste es nicht. Eigentlich wollte sie nur die Beerdigung hinter sich bringen und die Angelegenheiten der Filmfirma regeln. Aus der Werft, als deren Eigentümer ihr Vater das erste große Geld gemacht hatte, hatte er sich längst zurückgezogen. Aber sie hatte nicht die geringste Ahnung, was sie erwartete. Auch deshalb war er beunruhigt.
»Ich brauche dich wohl nicht daran zu erinnern«, maulte er, »wie es dir ergangen ist, nachdem du von dort weg und in die Zivilisation gekommen bist.« Die tief sitzende Verachtung, die sich in seinen Zügen spiegelte, sagte ihr, dass er wohl nie den Drang verspüren würde, mit Bollywoods Maskenbildnern ins kollegiale Gespräch zu kommen.
»Ist gut, Scotti. Mittlerweile kann ich selber auf mich aufpassen.«
»Bist du dir da ganz sicher? Was sagt denn Gloria dazu?«
Plötzlich interessierte ihn, was ihre Freundin dazu sagte! Gil hatte nie verstanden, warum sie Berufliches und Geschäftliches mit Gloria Swanson besprach. Nun, es gab nicht allzu viele neidlose und zugleich intelligente Menschen, die sich auch nach drei Monaten noch genau erinnerten, wo sie eine wichtige Rezension falsch abgelegt hatten. Oder die gut gelaunt ihre überfallartigen Besuche, welche oft bis weit nach Mitternacht dauerten, aushielten, obschon sie selbst stets um zehn Uhr ins Bett gingen. Und außerdem konnte Gloria lügen. Viel überzeugender sogar als sie selbst, was ihr schon bei manch überfälligem Skript aus der Bredouille geholfen hatte. »Gloria? Die sieht das als meine Pflicht«, log sie.
»So.« Eine bogenförmig gezupfte Braue, die ihrem Gegenüber etwas Exzentrisches verlieh, schob sich arrogant nach oben. Mit links hievte Gilbert einen fünfundzwanzig Kilo schweren Koffer auf das Förderband. Bevor er nach dem zweiten griff, vergewisserte er sich: »Du hast die Nagelfeile doch nicht ins Handgepäck getan, oder, Helen?«
***
Drei Stunden später saß sie in der Boeing Richtung Mumbai. In der ersten Klasse wurde jetzt bestimmt ein opulentes Abendessen serviert und anschließend Tee gereicht. So ein Sweet Chai, ohne Schwarztee, wäre jetzt fein gewesen. Danach hätte sie gewiss ein paar Stunden Schlaf gefunden oder einen Film angesehen oder Musik gehört. Hier ging gar nichts. In den beengten Verhältnissen der Economyclass war an Schlaf nicht zu denken, und zu allem Überfluss war in ihrer Reihe offenbar die gesamte Elektronik ausgefallen. Helen schielte zu ihren Nachbarn hinüber. Ein Wegdämmern in deren Gesellschaft war alles andere als einladend. Um dem Ganzen nachzuhelfen, schob sie sich zu dem hier gereichten dünnen Tee eine Tablette Diphenhydramin in den Mund. Igitt, wie bitter das Zeug war! Fünfzig Milligramm genügten ihr für einen sanften Schlummer. Das war nicht immer so gewesen. Wegen des Gewöhnungseffekts des Medikaments waren während der harten Phase am Anfang ihrer Karriere selbst zur Ruhigstellung immer höhere Dosen nötig geworden. Vor Jahren, als sie Nächte durchgeschrieben und nur noch dann geschlafen hatte, wenn es ihr ins Konzept passte, hatte sie die Erfahrung gemacht, dass ab zweihundert Milligramm halluzinogene Zustände eintraten. Leider waren diese mit teilweise peinlichem Realitätsverlust einhergegangen, weshalb sie schließlich mit dem Zeug aufgehört hatte. Irgendwann war sie dann so erfolgreich gewesen, dass sie es sich leisten konnte, sich die Arbeit einzuteilen und so ein mehr oder weniger geregeltes Leben zu führen. Langsam spürte sie, wie ihre Glieder müde wurden.
Nachdem sie damals nach London abgehauen war, hatte sie lange Zeit das Gefühl gehabt, als wäre ihr mit Bombay ein Organ ihres Körpers abhandengekommen. Irgendetwas fehlte ihr in London. Etwas, das nicht ausschließlich gut, ja nicht einmal lebensnotwendig war, aber eben einen Aspekt ihres Lebens darstellte. Sie konnte es nicht in Worte fassen. Vielleicht in Bilder. Bombay war lauter und schmutziger als London. Außerdem brutaler, in jeder Hinsicht, bis hinein in die hohe Politik. Aber es war auch entschieden dynamischer und erfinderischer. Unwillkürlich musste sie lächeln. Wann immer sie in London von den Dabbawallahs, den Essenskurieren, erzählte, war ungläubiges Köpfeschütteln die Folge. Ähnlich, aber nicht ganz so sonderbar wie die Essenszustellung, funktionierte die »öffentliche« Wäscherei, bei der ebenfalls diensteifrige Wallahs – Indiens billigste Arbeitskräfte – das Waschen und Bügeln für Hunderte von Haushalten übernahmen.
Irgendwo, begraben unter den Betonmassen des heutigen Mumbai, lag diese Stadt, die so viel Raum in ihrem Herzen einnahm, eine bunte aufstrebende Stadt am Meer, ein Inselstaat der Hoffnung in einem uralten Land. Immer wieder seit dem Tod ihres Vaters kreisten ihre Gedanken um die Frage: Gab es noch eine Heimkehr für sie? Langsam dämmerte sie ein.
***
Erst als die dunkelhäutige Stewardess der Jet Air Helen lächelnd bat, den Gurt für den Landeanflug auf den Chhatrapati Shivaji International Airport anzulegen, wachte sie wieder auf. Erwartungsvoll spähte sie zu dem viel zu kleinen Fenster, das zudem zu weit entfernt war. Jetzt, in der Dunkelheit, wären die Umrisse Bombays aus der Luft ohnehin nur undeutlich zu erkennen gewesen: eine weit vorgeschobene Landzunge mit einer weiten Bucht am Ende. Von der Lage her war es eine schöne Stadt. Ringsum von Meer umgeben, die Palmen standen am Strand, und Buchten, Bäche, Flüsse und Hügel bildeten ein einzigartiges Relief.
Später, an Land, sah es anders aus. Durch die getönten Scheiben der schwarzen Mercedes-Limousine hindurch betrachtete sie auf der einen Seite der Straße die stehenden Gewässer in der Umgebung des Flughafens und auf der anderen die »Dörfer« innerhalb der Stadt: Slumgebiete, so weit das Auge reichte. Schnell wurden auch die übrigen vier Sinne herausgefordert, sofern man nicht wie sie das Privileg hatte, von einem Chauffeur in einem Wagen mit Klimaanlage abgeholt zu werden. Der durch die offenen Fenster dringende Verkehrslärm mischte sich dann mit Abgasen und heißer tropischer Luft sowie dem Gestank von Fischen, die allerorts unter freiem Himmel auf Gestellen trockneten. Davor musste man auf dem überfüllten Flughafen die unvermeidliche Berührung durch braune schweißfeuchte Körper über sich ergehen lassen und später die brennende Schärfe der Pfeffersoße auf dem Pan-puri-Brot, das man sich zum Frühstück kaufte.
Doch Helen hatte sich weder am Wechselschalter der State Bank of India für eine Börse voll Rupien anstellen noch sich und ihr Gepäck in ein schwarzgelbes Fiat-Taxi quetschen müssen, um dann in glühender Hitze durch die Innenstadt zu laufen und am Ende ein überteuertes Flohnest zu ergattern. Ihr reichten schon die langwierigen Zoll- und Einreiseformalitäten. Fremdartig klang das Stimmengewirr aus Bambaiyya – Bombay-Hindi – und Englisch in ihren Ohren, als sie sich endlich durch das Gedränge der Ankunftshalle kämpfte. Etwas aufgelöst erspähte sie einen etwa fünfzigjährigen Mann im hochgeschlossenen beigefarbenen Anzug, der eine Tafel mit der Aufschrift »Madox« in die Höhe hielt. Bevor sie sich zu erkennen gab, amüsierte sie sich über seinen doch ein wenig geringschätzigen Blick, mit dem er die weiblichen britischen Fluggäste musterte. Die meisten Inder verstanden nur schwer, weshalb reiche Sahibs aus dem Westen in derart zerlumpten Kleidern herumrannten und darin die niedrigsten Kasten der Gesellschaft nachahmten.
Kaum hatte sich Ashish hinter das Steuer geklemmt, legte er den ebenfalls beigefarbenen, zum restlichen Outfit passenden Turban mit einem erleichterten Seufzer auf den Beifahrersitz. Dann gab er Gas. Irgendwann fuhren sie auf den Western Express Highway.
»Von wegen ,Express««, stöhnte Helen. Sie konnte sich nicht erinnern, auf dem Highway jemals so viel Verkehr erlebt zu haben. Selbst hier war die morgendliche Rushhour zu spüren. Richtung Southern Mumbai wurde der Verkehr immer dichter. Sie würden wohl noch eine Stunde unterwegs sein. Das fing ja gut an!
Manchmal kommentierte Ashish die Gegend oder das, was sich in den fünfzehn Jahren seit ihrer Abreise verändert hatte, wobei sie über den Rückspiegel kommunizierten, in dem sie seine von buschigen Brauen beschatteten schwarzen Augen sah. Links erspähte sie die Universität, der Auslöser für den endgültigen Bruch mit ihrem Vater. Hier hätte sie nach seinem Willen Jura studieren sollen. Aber gerade damals wollte Helen zurück zu den familiären Wurzeln und in London studieren. Zunächst hatte sie mehr an Theater als an Film gedacht: Dramaturgie, Theaterwissenschaft, die Bretter, die die Welt bedeuten. Und wo hätte sie dafür eine bessere Ausbildung bekommen können als in London? Doch ihr Vater hatte es ihr strikt verboten, wobei sie bis heute nicht wusste, was an ihrer Idee ihm verhasster gewesen war: London oder das Theater. Sie tat es trotzdem, gegen seinen Willen. Die Konsequenzen waren ihr schon damals klar gewesen. Ein Machtmensch wie Johnatan Madox würde ihr das nie verzeihen. Jetzt war ihr Vater tot, und an seinen Platz war eine große Leere in ihrem Herzen getreten.
Helen ertappte sich dabei, wie sie in die Ferne starrte. Dann nahm sie die am Fenster vorüberziehende Landschaft wieder wahr. Vor ihnen erkannte sie den Mahim Creek, ein kleiner, dafür umso übler riechender Fluss, eingerahmt von den unvermeidlichen Slums, die aus bunt bepinselten Wellblechhütten bestanden. An deren Wänden wurde schrill für Waschmittel und Zitronenlimonade geworben, wie damals auch, nur mittlerweile etwas weitläufiger.
»Immer öfter werden diese ›Colonies‹ ohne jede Vorwarnung von Planierraupen platt gewalzt«, erklärte Ashish und hielt sich symbolisch die Nase zu, »nur um weiter draußen erneut zu entstehen.« Seine von einem dichten schwarzen Schnurrbart auf Distanz gehaltenen Hängebacken wackelten bei seinen Worten.
Nichts Neues also, dachte Helen. All die Jahre über hatte sie es in der in Indien und London gleichzeitig erscheinenden Asian Age und im Special Report des Guardian mitverfolgt: Bombay war nicht nur die europäischste der indischen Städte mit der freiesten Presse Asiens, sondern auch der Ort mit den größten Slums. Es waren diese Gegensätze, die Bombay von westlichen Städten unterschied und an die sie sich nun wieder gewöhnen musste. Würde ihr das gelingen? Nun, für die kurze Dauer ihres Aufenthalts sollte sie damit zurechtkommen.
Allmählich näherten sie sich den ihr vertrauteren Gegenden mit der Pferderennbahn und den berühmten Dhobi Ghats, Mumbais origineller Open-Air-Wäscherei. Auf einem riesigen Areal mit Hunderten von Betonbecken ließen Tausende Bewohner ihre Wäsche waschen. Dann ging es vorbei am Willingdon Golf Club. Linker Hand erstreckten sich der exklusive Vorort Breach Candy, der ein Stück südlich des Mahatma-Gandhi-Museums gelegen war, und der Konzertveranstaltungsort Bharatiya Vidya Bhavan, den sie so oft besucht hatte. Vor ihnen schob sich eine Blechlawine quälend langsam vorwärts. Immer längere Staus von Maruti-Kleinwagen bestimmten offensichtlich das neue Chaos im Straßenbild. Nach einem Blick auf die Longines an ihrem Handgelenk fluchte Helen. Es war bereits zehn Uhr vorbei. Tante Crystel würde schon nervös sein. Nun, vielleicht nicht gerade nervös, aber sie würde ungeduldig auf sie warten und dabei ununterbrochen rauchen. Helen hasste Zigarettenrauch im Haus. Aber sie würden eine Lösung dafür finden. Mit ihrer Tante hatte sie immer reden können, obwohl diese ein sehr eigenwilliger, schräger Vogel war.
Im Schritttempo näherten sie sich Malabar Hill. Hoch oben standen, durch eine große Mauer und einen dichten Vorhang aus Grünpflanzen vor neugierigen Blicken geschützt, die sieben düsteren Türme des Schweigens. Auf ihren Dächern bestattete das Volk der Parsen ihre Toten, damit Aasgeier die Knochen säuberlich vom Fleisch befreiten und somit einer Verschmutzung der vier heiligen Elemente Luft, Wasser, Erde und Feuer vorbeugten. Manchmal rutschte den Vögeln jedoch ein Finger aus den Schnäbeln, weswegen das alte Wasserreservoir überdacht worden war und man darauf die Gärten angelegt hatte.
Hinter den Hängenden Gärten bog Ashish in die Jagmohandas Marg ein. In Helen wurden Kindheitserinnerungen wach. Viele der eleganten Palais und Kolonialvillen der Reichen von Bombay erkannte sie wieder. Malabar Hill, gelegen auf einer kleinen Landzunge am Ende der Back Bay, war die nobelste Wohngegend der Stadt und schien sich seit ihrem Weggang nicht verändert zu haben. Langsam rollte der Wagen in die Auffahrt des elterlichen Anwesens.
Der alte knorrige Peepalbaum stand immer noch in der Einfahrt. Sein Formenreichtum überwältigte sie, und nur ungern erinnerte sie sich an die vielen Ameisen, die immer um ihn herumgelaufen waren. Auf der anderen Seite bewachte der hohe Banyanbaum die Zufahrt, und schon ertappte Helen sich dabei, wie sie nach einem der türkis gefiederten Eisvögel Ausschau hielt, die sich immer in seinem Blattwerk versteckt hatten. Dann erblickte sie vor blendend weißen Mauern die gelbe Blütenpracht der Kassie und davor, in dem Rondeau, um das Ashish den Wagen nun im Schritttempo herumlenkte, standen burgunderrote und lachsfarbene Rosen. Es war ein einziger Farbenrausch. Rosenrabatten und Goldregenbüsche fanden sich auch zwischen den Wildorchideen und den in Elefantenform getrimmten Hecken der gepflegten Parkanlage, die sich zu beiden Seiten des mit Granitsteinen gepflasterten Vorplatzes erstreckten.
Dahinter erstrahlte in blendendem Weiß ein kleiner Traum in Bombay-Gotik. Erker und neugotische Türmchen flankierten eine weiße Marmorkuppel im Mogulstil, in Anlehnung an das im indosarazenischen Mischstil errichtete Prince of Wales Museum, das wohl sehenswerteste Bauwerk aus der britischen Kolonialzeit. Und so hatte sich auch sein Besitzer gesehen: In seiner Werft wie in seinem Haus hatte Johnatan Madox wie ein Kolonialherr über ein Völkergemisch von Untergebenen geherrscht, in dem Englisch oft die einzige Möglichkeit war, sich zu verständigen.
***
Winkend erschien Tante Crystel in der offenen Eingangstür. Helen sprang hinaus, noch bevor Ashish ihr den Wagenschlag öffnen konnte.
»Hallo, meine Kleine! Willkommen zu Hause!«, rief die in einen schwarzen Hosenanzug gekleidete schlanke Frau, die alles unternommen hatte, um ihr Alter möglichst vergessen zu machen. Ihr schicker fransiger Kurzhaarschnitt in mehreren Rottönen war noch das Natürlichste an ihr.
»Hallo, Crystel! Du siehst umwerfend aus!« Das stimmte. Die Frau hatte zwar seit Kurzem ihren sechzigsten Geburtstag nicht mehr vor sich, wirkte aber um Jahre jünger. Zu leben begonnen hatte sie, ihren eigenen Angaben zufolge, an dem Tag, als sie das erste Mal nach New York zu Mama Gena und ihren Liebesgöttinnen gepilgert war. Seit damals bezeichnete sie sich selbst als »göttliche Schwester«. In der »School of Womanly Arts« lernte sie dann ihre eigenen Wünsche kennen und begann, diese in den Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen. Dennoch war das exzentrische Leben nicht spurlos an ihr vorübergegangen. Crystel liebte die Nächte, die Kunst und die Frauen, genoss das Geld ihres Bruders, seitdem sie zu ihm gezogen war und seinen Haushalt führte, und das gute Leben, das es ermöglichte. Hatte ihr Bruder sie schon zu Lebzeiten nicht dazu bewegen können, ihre Gewohnheiten zu ändern, so schien sein Tod dies erst recht nicht bewirkt zu haben. Immer wenn Crystel nervös war, rauchte sie. Das kannte Helen von ihren Telefonaten. Nun sah es ganz so aus, als ob ihre Tante die Zeremonie nur mit einem Dutzend Glimmstengeln zwischen den etwas knochigen Fingern überstehen würde. Anscheinend hatte ihr der Bruder doch mehr bedeutet, als sie zugeben wollte.
Andeutungsweise hauchte Helen Küsschen auf Crystels galamäßig gepuderte Wangen. »Ich kann es noch gar nicht fassen, wieder zu Hause zu sein!« Ihre ausholende Geste schloss die Villa und die gesamte Stadt mit ein.
»Komm, Kind, du musst dich unbedingt ... zurechtmachen. So kannst du doch nicht auf dem Begräbnis deines Vaters aufkreuzen!« Genau genommen konnte sie überall aufkreuzen, dachte Crystel, selbst in Lumpen. Keine Frage, ihre Nichte war eine ungemein attraktive Frau!
Das sagt ausgerechnet sie!, empörte sich Helen und trat in die Halle. Die Gnädige sah aus, als wäre sie zum Tee mit Sonia Gandhi verabredet. Aber wen erwarteten sie tatsächlich zum Begräbnis? Würde er kommen? Nun, sie würde sich sofort duschen und herrichten. Nein, sie würde später nicht heulen und das ganze Make-up zerstören. »Sag mal, Crystel«, entschlüpfte es ihr, »hat sich auch Vaters Geschäftsführer angekündigt?«
»Raat meinst du?«
Wen denn sonst, Herrgott! Helen nickte. »Wie ist er?« »Hm.« Crystel blieb stehen. »Hochintelligent. Unglaubliches Charisma.«
Das war nichts Neues. Vermutlich wirkte er auf alle Frauen so, dachte Helen. Also Vorsicht, nur ja keine Ambitionen in diese Richtung. Er war nur der Geschäftsführer von Madox Production, nicht mehr und nicht weniger.
»Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob er kommt.« Die schmal gezupften Brauen im Gesicht ihrer Tante hoben sich, und ein Lächeln kräuselte ihre feingeschnittenen, dunkel bemalten Lippen. »Nimm dich in Acht. Er ist ein Casanova, das kannst du dir bestimmt denken!«
Oh ja, doch, das konnte sie. Dafür reichte ihre Fantasie durchaus.
Crystel machte eine ausholende Handbewegung. »Das alles gehört nun dir, meine Prinzessin.« Dann ging sie voran. »Auch die Filmfirma und ein paar Aktien der Werft.«
»Ich werde wohl einiges davon verkaufen, ich kann das Geld gut gebrauchen. London ist schrecklich teuer.«
Doch nun war gewiss nicht der richtige Zeitpunkt, um über die Aufteilung des Erbes zu sprechen, fand Helen. Staunend folgte sie ihrer Tante in den linken Flügel des Hauses und hinauf in dessen ersten Stock. Manches hatte sich verändert, und zwar zum Guten. Die Tante hatte immer schon Geschmack bewiesen. Stöhnend schleppte Ashish die Koffer hinter den beiden her.
Das tief dekolletierte kleine Schwarze war für ein Begräbnis viel zu gewagt, daran änderte auch der gekonnt um den Hals drapierte Seidenschal nicht viel. Neben ihrer Tante kam sie sich dennoch wie Aschenbrödel vor. Aber das würde wohl so ziemlich jeder Britin diesseits des Ozeans so gehen.
Gemeinsam mit der Haushälterin, Mrs. Bloomingdale, und der sehr jungen, hübschen Rose, Crystels Küchenhilfe und Aufräumerin, verließen sie das Haus.
Wäre der Gärtner, den sich die Familie mit anderen Anrainern teilte, greifbar gewesen, hätte Crystel selbst den Inder aus der dienenden Kaste der Shudras dazu verpflichtet, sie zu begleiten, um wenigstens ein halbes Dutzend Trauergäste für die Einäscherung ihres Bruders zu versammeln. Freunde hatte er keine gehabt, und die Nachbarn waren verreist. Wie würde sie dastehen vor den Angestellten der Firma? Die Halle würde beschämend leer sein. Sie hasste schlecht besuchte Veranstaltungen.
Langsam schob sich die schwarze Limousine in die Napean Sea Road. Helen saß im Fond des Wagens zwischen Mrs. Bloomingdale und Rose, die offenbar Mädchen für alles war, wie sie nun aufgrund der begehrlichen Blicke ihrer Tante befürchtete. Zum Glück lag der St. Christopher Cementery nicht weit entfernt zwischen Cumballa Hill und dem noblen Breach Candy nördlich von Malabar Hill. Würde er kommen?, fragte sich Helen erneut und blickte aus dem Fenster. Gelegentlich erhaschte sie einen Blick auf das glitzernde Meer im Westen der Insel.
Er war nicht da. In der Einäscherungshalle wartete ein halbes Dutzend versnobter aufgeputzter Christbäume in Crystels Alter, die offensichtlich den heutigen Anlass mit Weihnachten und Silvester verwechselt hatten. Man schien sich untereinander zu kennen, wie Helen am Smalltalk feststellen konnte, nachdem sie den Damen vorgestellt worden war.
Kein einziger Mann war anwesend. Sollten dies hier etwa alles Verflossene ihrer Tante sein? Es sah fast danach aus.
Knapp vor zwölf Uhr gesellten sich der Anwalt der Familie und ein paar Angestellte der Firma zu der Trauergemeinde hinzu.
»Helen, dies hier ist David Blomberg, unser süßer Helfer in Not«, stellte Crystel den Anwalt vor.
Süß sieht er nicht gerade aus, dachte Helen. Nicht einmal nett. Sie blickte in ein Gesicht wie ein Frottierlappen. »Angenehm, Mr. Blomberg.«
»Ich bin außerordentlich erfreut, Sie kennenzulernen, Miss Madox.« Man sah ihm die Freude allerdings nicht an. »Mein Beileid. Ich denke, wir werden in nächster Zeit häufiger miteinander zu tun haben.« Nicht einmal diese Aussicht zauberte irgendeine menschliche Regung in seine maskenhaft starren Gesichtszüge. Er hatte eine leise, kultivierte Stimme, der ebenso wenig zu trauen war wie aufgezuckertem Wein. Gewiss war er ein toller Anwalt – wenn er auf derselben Seite stand wie man selbst.
Geschlossen steuerte nun auch das kleine Häuflein Angestellter auf die Familie zu und wurde bei dieser Gelegenheit gleich der Tochter und Firmenerbin vorgestellt. Miss Claire Woods, die Sekretärin ihres Vaters, eine schlanke Frau Anfang vierzig, reichte ihr als Erste die Hand. Ihr Händedruck fühlte sich an, als würde man einem toten Fisch die Hand geben.
»Mein Beileid, Miss Madox. Ich kannte Ihren Vater ... recht gut.« Sie senkte züchtig den Blick.
Helen wusste die Geste zwar richtig zu deuten, konnte es sich aber beim besten Willen nicht vorstellen. Ihr Vater, dieser Puritaner, war für sie zeitlebens ein geschlechtsloses Wesen gewesen, und außerdem war ihr nicht bekannt, dass er die letzten Jahre an einer derartigen Geschmacksverirrung gelitten hätte. Allerdings zierte ein beeindruckend steiles Vorgebirge den schmalen Brustkorb von Miss Woods. Ob es echt war? Vermutlich, denn die Augen, in die Helen blickte, waren absolut ungeschminkt. »Danke, Miss Woods, dass Sie gekommen sind.« Sie war entsetzt über das geschmacklose rosafarbene Rouge in dem bleichen, von einem rotgoldenen Haarschleier umrahmten Gesicht, bei dem sich ihr unweigerlich Bilder präraffaelitischer Madonnen aufdrängten.
Nach Miss Woods lernte sie noch zwei Produktionsleiter, ein Skriptgirl, die Cutterin, die Regieassistenz und Mr. Lai kennen, einen namhaften Regisseur, der etliche Filme der Madox Production gedreht hatte. Nichts, was einen vom Hocker riss, wenn man an britische Produktionen oder an die großen Hollywood-Blockbuster gewöhnt war, und vom Inhaltlichen her auch nicht mit ihren eigenen Arbeiten vergleichbar. Aber durchaus nett. Typische Masala-Filme eben. Nur wo blieb der Held? Es war jetzt zwölf Uhr und von ihm keine Spur.
Dezent zog sich Chotta Lai zurück, und sie stand wieder allein. Himmel!, fluchte sie. Die Zeremonie würde beginnen, und sie würde ungeachtet ihres Gefühlsdefizits zu heulen beginnen und am Ende wie eine rotäugige, kajalverschmierte Horrorbraut dastehen.
Da verdunkelte ein Schatten den Eingang. Nur unmerklich, aber sie registrierte ihn dennoch. Einen Moment später trat er vor sie. Fast bescheiden. Wie eine Raubkatze, die sich ihrer Beute sicher war und nur noch auf den geeigneten Moment zum Zupacken wartete. Mit diesem unergründlichen Lächeln in seinen bronzefarbenen Zügen, das ihr von der Leinwand her so vertraut war, nur war es hier etwas ernster, der Situation angepasst, ohne dabei heuchlerisch zu wirken. Ihr Herz schlug wie wild und ihre Handflächen wurden feucht. Das hier war nicht die Leinwand.
Arun Raat verneigte sich. Der Blick aus seinen schwarzen Augen traf sekundenlang den ihren. »Weiß würde Ihnen besser stehen, Madam.«
Sie wusste seine Anspielung auf die Tatsache, dass trauernde Söhne und Hindu-Witwen Weiß trugen, durchaus zu deuten. »Weder Weiß noch Schwarz, ich bin keine praktizierende Katholikin. Aber Schwarz macht mich eindeutig schlanker.« Wie zufällig verrutschte ihr Seidentuch. Mal sehen, wie er darauf reagierte.
Mit dreister Anerkennung wanderte sein Blick von ihrem Kinn abwärts, verfing sich in ihrem Dekolleté und strich dann über ihre Rundungen. Alles an ihnen war echt, garantiert kein Silikon. Hoffentlich merkte er das. Aber ein Mann wie er würde so etwas ohnehin auf den ersten Blick sehen.