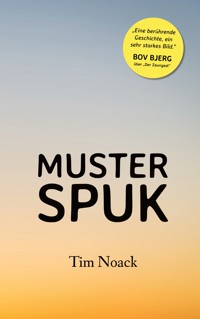
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Eines Tages geht plötzlich das Licht aus. Nach einer Weile bemerkst du, dass du gar nicht hier bist, dass du gar nicht jetzt bist. Wo bist du abgeblieben? In welcher Zeit steckst du fest? Wer bist du überhaupt? Und was hast du die ganze Zeit übersehen? Dein Wecklauf mit dem Leben führt dich mitten durch den Musterspuk. - Geschichten, Gedichte, Gedanken und Schwungseiten
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gewidmet dem, was uns alle verbindet.
Inhalt
Der Zaungast
Heinrichs ABC
Der Schmetterlingsgarten
Die Lukenwächterin
Das Schattenmännchen
Traumautos
Das weiße Schiff
Die Boxerin
Sterne sehen
Am Ende vom Teich
Das Gedicht vom Einzelwicht
Fässer
Unbekannt vermisst
Mein Land
Tattoo
Das Feld
Ein Dialog mit dem Leben
Groß sein
Welches W?
Die einzige Bedingung
Trotzdem
Der Raum im Trauma
Der Mentor
Nach der Einsamkeit
Die Hamsterfrage
Passage
Der beste Zeitpunkt
Zögerlich
Das Puzzle in der Wundertüte
Verwunderung über die Wunde
Regentropfen und Sonnenstrahlen
Psychoedukation
An tapfere Taucher
Ahnungs- und selbstlos
Der Herrenmensch
Finstere Zäsur
Klarstellung
Würdigung
Lob der Genügsamkeit
Mein Lieblingsbild
Der Vater von Charles
Mehr als Geben
Geschenkschmerzen
Vom Leuchten
Das Traumaband
Die leisen Stimmen
Die Erlaubnis
Im Mühltal
Wer rastet, der kostet
Buchse und Stecker
Vom Suchen und Finden
Friedensverantwortung
Das Prickelbarometer
Finger weg!
Orientierung
Die Werkzeugmachergilde
Plädoyer für eine Retransformation
Heute
Arm und reich
Notizen an mich
Eine mutige Maus
Drei Worte Ermutigung
Verriegelt und verrammelt
Das Expresskarussell
They see me rollin’
Polyglotter Fail
Die Buchhandlung
Hör nicht auf die Stimme
Nebelkriecher
Ideendämmerung
Entwurzelt?
Der einzige Auftrag
Grenzen und Geigen
Sternthemen
Papier, Stein und Schere
Bezahlte Therapie
Klärendes zur Jauche
Selbstbeschenkung
Eigenwilliger Zuspruch
Mut zur Weite
Wegelohn
Herzwaage
Gedanke 83642
Frage
-e-i-o-u
The Fog
Impuls
leiden heißt
Wissen und fühlen
Ein zerknülltes Blatt
Nicht änderbar
Gerechtigkeitsglaube
Vom Schwungschreiben
Dank an die Community
Eine Annahme
Frage und Antwort
Unsere Wahl
Schatten an der Wand
Gebrauchsanleitung Leben
Irgendwann ist jetzt
Ja, wissen sie denn nicht, dass Weihnachten ist?
Zwei weihnachtliche Gedanken
Wegweiser
Trugschmuck
Verwechslungsgefahr
Kleiderordnung überdenken
Ausgehungert
Zu Besuch im Musterbruch
Reise zum Frieden
Alternative
Der Halmaspieler
Meine Menschenwünsche
Krieg oder Freundschaft
Mittel zum Zweck
Vom Betongießen
Eingeschläfert
Kernfrage
Schlüssig
Gegenbewegung
Tun und Sein
Vorschlag
Keine Reise
So wird ein Schuh draus
Es ist noch nicht so weit
Abstandshalter
Wurzel, Quelle, Kern
Stabilisierung
Untauglicher Baugrund
Logik der Anteile
Leere Teller
Preisvergleich
Wunde in Wallung
Gefälle
Sandsack
Kernwärts
All In
sanft und klar
Der letzte Tag
Blick auf die Sache
Eine großartige Familie
Wie peinlich – zum Glück!
Gegen die Wand laufen
Dankbarkeit für Dunkelheit
Wie Ruhe einkehrt
Der letzte Narzopath
s-Störung
Als ich am Boden lag
Damokles 2.0
Nicht, aber doch
Ein weiser Mensch an diesem Ort
Quell
Der Zaungast
Eines Tages vergaßen meine Eltern, mich vom Kindergarten abzuholen. Der kringelige Zaun vor dem Gebäude hatte einen ausladenden Steinsockel. Ich setzte mich darauf, wartete und blickte in Richtung der Bahnschranken, hinter denen mein Wohngebiet lag. Die kleine Kunstledertasche zum Umhängen, in der ich eine Brotbüchse und eine Trinkflasche aufbewahrte, ruhte auf meinem Schoß. Mit meinen Augen und Fingern folgte ich den dunklen Rillenmustern, die sich unregelmäßig und scheinbar ziellos über die Oberfläche zogen.
Alle Kinder, Eltern und Kindergärtnerinnen waren bereits nach Hause gegangen. In der einsetzenden Dunkelheit konnte ich die Spielgeräte hinter dem Zaun nur noch schemenhaft erkennen: ein Kletterturm in Raketenform, zwei knarzende Holzwippen, von denen eine seit jeher kaputt gewesen war, sowie ein kleines Karussell in lustigem Rot und Gelb. Am liebsten mochte ich das Holzauto, das sich mitten im großen Sandkasten befand. Es hatte zwei Sitzbänke und als Lenker eine glattgegriffene Holzscheibe, die sich drehen ließ. Mit diesem Wagen durchfuhr ich die Straßen unserer Stadt. Rechts neben mir saß meine Freundin Romi mit ihrer kastanienbraunen Herzchenweste. Die Rückbank musste freibleiben für alle Schätze, die wir einzusammeln gedachten. Ich kann mich an keinen Satz erinnern, den Romi und ich gewechselt haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals einen Satz gewechselt haben. Doch unser Ziel schien dasselbe. Romi legte beim Fahren immer ihren Arm um meine Schulter. Das war schön.
Mit der Zeit haben sich einige Nähte meiner Tasche aufgelöst, wodurch sie sich in eine Art Unterlage oder Teller verwandelt hat. Ab und zu legen Passanten Münzen oder Essen darauf. „Meine Güte, wie groß der Junge geworden ist!“, sagen die Vorbeigehenden, wenn sie mich noch von früher kennen.
Ich lehne beim Sitzen mit dem Rücken am Zaun. Meine Sitzfläche ist schmal geworden, aber es geht. Hin und wieder recke ich den Kopf und blicke mich um. Hinter der anderen Seite des Kindergartengeländes liegt ein verwilderter Abhang, an dem ich im Frühjahr Weißdornsträucher blühen sehe.
Ich mag das Pflaster auf dem Bürgersteig. Es gibt helle und dunkle Steine. Die hellen bilden den Hintergrund und die dunklen formen mit wenigen Linien einen Blütenkelch. Hat man das Muster einmal erkannt, sieht man, wie es sich stetig wiederholt. Das Auge folgt dem Muster bis zu der Stelle, an der das Pflaster endet und durch einen Sandweg ersetzt wird. Der Kindergarten liegt am Stadtrand, noch jenseits der Bahnschranken. Im Laufe der Jahre hat sich die Pflasterung von der Stadtmitte immer weiter ausgedehnt. Früher, als ich noch mit dem Holzauto fuhr, gab es vor dem Kindergarten nur eine Sandpiste. Ab und zu frage ich Eltern, die gerade ihre Kinder abgegeben haben, ob in der ganzen Stadt dasselbe Muster verlegt ist.
Heute Nachmittag saß eine Weile ein Kind neben mir. Es starrte fasziniert auf meine Kunstledertasche, auf meinen Kunstlederteller. Ich schenkte ihm eine der Münzen. Über der Zahl auf dem Geldstück war ein winziges „A“ eingeprägt. Wir beide rätselten über seine Bedeutung. Dann wurde das Kind abgeholt. Ich beobachtete fasziniert, wie es aufstand und losging.
Wie ich hörte, ist meine Kindergärtnerin verstorben. Jedes Mal, wenn ich sie kommen sah, versteckte ich mein Gesicht hinter dem Zaunpfeiler. Ich vermute, dass sie mich trotzdem immer gesehen hat und schäme mich jetzt dafür. Die Leute sagen, sie sei noch nicht einmal 50 gewesen, als sie fortging. Ich weinte lange.
Nachts ist es hier am Zaun sehr still. Kann sein, dass es an der Schneedecke liegt. Früher haben sich die nahegelegenen Bahnschranken mehrmals pro Tag geräuschvoll geöffnet und geschlossen. Dann ragten sie nur noch regungslos in die Höhe, wie zwei überdimensionierte Mikadostäbchen. Später hat man sie komplett demontiert. Ich nehme an, dass die Schienen mittlerweile von Gestrüpp überwuchert sind. Als ich früher zum Kindergarten gegangen bin, habe ich meine Füße immer so gesetzt, dass die Schienen nicht berührt werden. Vollständiges Überdecken mit den Schuhen war auch in Ordnung – aber so ein halbes, angerissenes, unvollständiges Betreten des Metalls durfte nicht sein. Mein Bruder und ich haben einmal Münzen auf die Gleise gelegt. Als der Zug heranrauschte, sind wir in Panik die Böschung hinuntergekullert. Meine Beine waren zerkratzt, meine weiß-braune Strickjacke war mit Kletten übersät. Die flachgepresste Münze habe ich neulich in einer Geheimtasche meiner Hose gefunden. Sie glänzt fahl im Mondlicht.
Als wir zu viert Pilze sammeln waren, entdeckte mein Vater eine Lichtung, auf der Dutzende Pfifferlinge im Kreis wuchsen. „Das ist ja ein richtiger Hexenring!“, rief er schallend durch den Wald. Seinen prallgefüllten Flechtkorb mitsamt Messer habe ich noch vor Augen. In seiner Hochstimmung berichtete er uns von der verheerenden Giftwirkung des Grünen Knollenblätterpilzes. Sein Blick war dabei vor Faszination ganz verklärt.
Die Mutter von Tobias aus dem Nachbarhaus berichtet mir von der Scheidung meiner Eltern. Mein Vater sei in die Hauptstadt gezogen. Wo auch immer das sein mag. Ich stelle mir vor, wie er dort von einer jubelnden Menschenmenge begrüßt wird. Laternen sind mit Girlanden geschmückt. Frauen mit bunten Blumensträußen winken ihm freudig-erregt zu. Er hat immer gesagt, dass er zu Höherem berufen sei.
Ich frage mich, wie mein Bruder nun ohne Vater klarkommt. Ich freue mich für meine Mutter und meinen Bruder, dass sie jetzt die Schläge nicht mehr erdulden müssen. Nun, da es in der Nacht keinen Lärm mehr gibt, können beide sicher ruhiger schlafen.
Tobias’ Mutter setzt sich neben mich, streicht mir mit der Hand über den Kopf und beginnt zu schluchzen. Verwirrt versuche ich, sie zu trösten. Sie hat ein gutes Herz, irgendetwas scheint sie zu bedrücken.
Ihr Sohn rief mir häufig „Jimmy Glitschi Kartoffelfresser!“ hinterher, während er wild mit den Armen zappelte und Grimassen schnitt. Kartoffeln schmecken mir, doch meine Leibspeise sind Eierkuchen.
Mitten in der Nacht erwache ich mit dem Geruch von Bohnerwachs auf Holzstufen in der Nase. Unsere Hausnummer war durch 13 teilbar. Die Eingangstür des Hauses bestand aus silbrigverwittertem Holz, der Eingangsbereich war mattgelb gefliest. Manchmal musste ich beim Hoch- oder Runtergehen jede einzelne Stufe dreimal mit meinen Füßen berühren. Sonst hätte es nicht gegolten.
Nachdem Panzerkolonnen mit dumpfem Dröhnen durch unsere Straße gerollt waren, entstanden jedes Mal weiße Rillenmuster auf den Pflastersteinen. Als ob eine riesige Kinderschar lauter kleine Kreidestriche gezogen hätte. Mit dem nächsten Regen verschwanden die Linien wieder. Eingehüllt in den tröstlichen Duft von Straßenstaub, der vom Regen aufgewirbelt wird, schlafe ich ein.
Die Leute sagen, meine Heimatstadt sei ein kleines Juwel. Die Bewohner lieben die altertümlichen Häuser, verwinkelten Gassen und schattigen Parks. Ich stelle mir den großen Baum im Stadtpark vor und freue mich für alle Menschen, die hier Wurzeln schlagen dürfen. Ich wünsche ihnen von Herzen, dass sie nicht zu Höherem berufen sein mögen.
Mein Sitzplatz auf dem Steinsockel fühlt sich poliert und geschmeidig an, wenn ich mit der Hand darübergleite. Durch die Zaunkringel schaue ich den Kindern beim Toben zu. Die Holzwippen wurden durch Metallausführungen ersetzt, doch eine von ihnen ist defekt und mit einem Absperrband umwickelt. Die Kletterturmrakete ist davongeflogen. Man hat sie durch eine bodenständige Kletterwand ersetzt. Der Sandkasten ist noch da. In seiner Mitte steht ein fadenscheiniges Holzauto. Sein Lenker ist abgefallen, das Auto dient nun als Boot. Die Kleinen segeln johlend durch ein Meer aus Sand.
Das Gehwegpflaster reicht inzwischen bis zu der Stelle, an der der alte Geheimweg nach links abzweigt. Früher haben die Pflasterer im Knien gehämmert. Klock, klock, klock. Heute sehe ich, wie schreiende Männer eine scheppernde Maschine vor sich herschieben. Der Lärm ist selbst aus der Entfernung ohrenbetäubend. Wenn man weiß, wie man den rissigen Trampelpfad gehen muss, gelangt man bis zum Fluss. Die Weiden am Ufer haben mir niemals Angst eingejagt. Einmal war ich allein am Wasser unterwegs und beschloss spontan, durch den Fluss zu schwimmen.
Auf dem Hinweg erwischte mich keiner der Strudel. Alle haben uns stets vor den Strudeln gewarnt. Man soll sich bereitwillig herunterziehen lassen und dann vom Grund kräftig schräg nach oben abstoßen. Einer meiner Onkel war vor zig Jahren als Junge ertrunken. Er konnte nicht schwimmen. Eines Tages behauptete er überraschend, jetzt schwimmen zu können. Er sprang in einen Fluss und ging unter. Seine Brüder standen stumm am anderen Ufer und sahen zu. Der Onkel kam so bald nicht wieder zum Vorschein. Erst später, doch da atmete er nicht mehr. So wurde es vom Vater berichtet. Er pflegte sein Leben in kleine Geschichten zu verpacken. „Auf die passende Pointe kommt es an“, betonte er stets. Was auch immer er damit meinte. Einmal hat er Fliegenpilz in den Familieneintopf gegeben. Er wollte mal sehen, wie wir darauf reagieren: „Ihr habt anschließend 24 Stunden geschlafen.“
Auf dem Rückweg, kurz vor dem Ziel, wurde mir plötzlich sonnenklar, dass ich nun ertrinken würde. So geht das also, dachte ich. Als ob es mich nichts anginge. Als ob es jemand anderem widerfahren würde. Das Wasser war schlammbraun und muffig. Schließlich strampelte ich in wilder Verzweiflung mit den Füßen. Meine Schienbeine stießen schmerzhaft gegen spitze Kiesel. Ich kniete am Ufer.
Der Strand bot eine reiche Auswahl an flachen Steinen. Ich suchte ein paar passende heraus und schlug meinen Rekord im Flippern. Dann schwor ich mir, niemals auf unbedachte, unnötige, überflüssige, empörende oder verletzende Weise zu sterben.
Aus einer Unterhaltung zweier Mütter im Eingangsbereich des Kindergartens schließe ich, dass mein Vater in einer hochrangigen hauptstädtischen Einrichtung als leitender Arzt tätig ist. Der Wind trägt mir die Wortfetzen „grandios“, „Habilitation“ und „Toxikologie“ zu. Was auch immer das bedeuten mag.
Echos von Musik dringen an meine Ohren. Vorn am Bahnübergang sehe ich einen Bus mit jungen Menschen vorbeifahren, die aus voller Kehle singen. Zwischen ihnen leuchtet der feuerrote Haarschopf meiner Mutter durch ein Fenster. Das Gemisch aus Motorengeräusch und Gesang begleitet mich noch eine Weile.
Seit Wochen habe ich weder Kinder noch ihre Eltern gesehen. Das Eingangstor zum Kindergarten ist mit einer dicken Kette verschlossen. Der Wind bürstet brüchige Blätter über den Boden. Der Zaun, an dem ich lehne, ist lange nicht mehr gestrichen worden und rostet. Der Putz auf der Wetterseite des Gebäudes beginnt zu bröckeln. Dort war früher die Küche. Ich denke an Kinder in Hausschuhen, die Schlange stehen, um Teller mit Milchnudeln in Empfang zu nehmen. Romi steht vor mir. Eine Kindergärtnerin passt neben dem Ausgabefenster auf. Sie sagte mal zu uns: „Frauen bekommen Kinder, dafür müssen Männer zur Armee. Das gleicht sich aus.“
Vor dem Mittagessen war immer Beschäftigung. Die Jungs stürzten sich auf die Kiste mit Spielsoldaten aus Hartgummi. Wer den Kommandeur mit der Pistole erwischte, durfte der Anführer sein. Meine Lieblingsfigur war ein kleiner Polizist mit sonnigem Lächeln. Wir nannten ihn den Schutzmann.
Auf das Mittagessen folgte immer die Mittagsruhe. Mehrfach verschlief ich die Kaffeezeit. Die Kindergärtnerinnen sagten, sie brachten es nicht übers Herz, meinen tiefen Schlaf zu stören. Doch tatsächlich glaube ich, dass ich unweckbar war. Ich träumte wiederholt von einem Riesen, der aus der Ferne heranstapfte und sich dann wie ein dunkles Zelt über mich stülpte. Beim Augenöffnen setzte bereits die Abenddämmerung ein. Ich fühlte mich angenehm betäubt. Die anderen Kinder waren schon fort.
Als ich eines Morgens aufwache, sitzt mein Bruder neben mir: „Weißt du es schon? – Mutter ist gestorben. Stell dir vor, die Ärzte hatten ihr noch vier Monate gegeben und sie hat genau noch vier Monate gelebt.“
In den darauffolgenden Wochen habe ich häufig Kopf- und Rückenschmerzen. Gelegentlich tauchen in der Straße junge Menschen auf, deren Gesichter mir flüchtig bekannt sind. Während sie sich in einigem Abstand von mir unterhalten, zeigen sie hin und wieder in meine Richtung. Dann gehen sie.
Jemand hat eine angeknickte Postkarte auf meinen Teller gelegt. Die Vorderseite zeigt eine windzerzauste Kiefer vor einem weißroten Leuchtturm auf einer kleinen Insel. Auf der Rückseite steht als Absender mein Vater und ein krakelig-wirrer Text, der sich mir nicht erschließt. Er handelt von Familiengeistern, einem Feuer, mit dem mein Vater gespielt hat und einem „Gerinnsel-Gewinsel“. Von einem Moment auf den anderen fühle ich mich beengt. Wie von einer Schraubzwinge, die mich innerlich zu zerdrücken versucht. Wie von jemandem, der sich auf meinen Brustkorb setzt und meine Arme auf dem Boden festpinnt. Wie von einem Kissen, das mir gewaltsam aufs Gesicht gepresst wird. Doch dann sehe ich die lieblichen Muster, die der milde Abendsonnenschein aufs Pflaster wirft. Mir wird ganz warm ums Herz. Für den Bruchteil eines Wimpernschlags meine ich zu verstehen, was mir die Muster auf dem Gehweg sagen wollen.
Baulärm, ich schrecke hoch. Lautes Krachen, ich zucke zusammen. Der Zaun an meinem Rücken vibriert. Die giftgrüne Fabrikhalle auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist nicht mehr da. Kurz vor dem Abriss waren ihre Fenster als Zielscheiben verwendet worden. Auf dem Fußweg vor mir fehlen einige Pflastersteine, doch die feinen Blütenkelchmuster sind trotz der Lücken noch erkennbar.
Ein rauchgrauer Mann mit Glatze und Vollbart steht vor mir und spricht mich schroff an. Ich blicke auf, muss gegen die Sonne blinzeln, erkenne ihn aber wieder. Einmal bin ich mit meiner Spielkameradin Britta zu einer Kneipe in der Altstadt geradelt. Von dort wollte ich meine Eltern nach Hause holen. Der Mann saß bei ihnen am Tisch, rauchte Pfeife mit Vanillearoma und trank Pfefferminzlikör, von dem er mir großzügig anbot. „Dein Vater hat sich das Leben genommen. Wir haben seine Wohnung räumen und die Spritzen entsorgen lassen. Es wurde nichts von dir oder für dich gefunden. Der Nachlassverwalter hat mich beauftragt, dir dies mitzuteilen. Dein Vater war zu Höherem berufen.“
Praktisch über Nacht hat sich das Kindergartengebäude in Luft aufgelöst, nur Teile des Zauns und die kaputte Wippe sind übriggeblieben. Daneben liegt ein gewaltiger Schutthaufen. Ich drücke mich fester denn je an das kringelige Metall in meinem Rücken. Es ist wichtig, Rückendeckung zu haben, denke ich. Auch wenn sie lückenhaft und winddurchlässig ist.
Das neue Bürogebäude wurde mit einer großzügigen Glasfront gestaltet. Weißdornsträucher flankieren den hellen Neubau. Aus den Räumen im obersten Stockwerk reicht der Blick sicher bis weit über den Bahnübergang hinaus. Vor dem Haus, direkt über dem Sandkasten mit dem Holzboot, ist ein Parkplatz entstanden. Ich kneife die Augen zusammen und versuche, die gleißend weißen Parkplatzmarkierungen genau in die rostbraunen Zaunkringel einzupassen.
Ich träume von fröhlichem Kindergeschrei, erschrecke und erwache in eine dunkle Stille. Beim Abstützen ertastet meine Hand einen Gegenstand auf dem Zaunsockel.
Der Tag dämmert und ich finde ein Album neben mir. Ich betrachte Kinderfotos aus der Ära des Holzautos. Ich ziehe ein Bild aus der Folie. Seine Oberfläche ist glatter als ich meine Sitzfläche jemals durch den Kontakt mit meinem Körper polieren könnte. Die Aufnahme zeigt zwei Kinder, von denen eines eine kastanienbraune Weste mit Herzchenmuster trägt.
Eine Frau tritt aus dem Bürogebäude und geht zielstrebig auf die Überreste des Zauns zu. Sie kniet sich vor mich hin, sodass wir uns direkt in die Augen schauen können. Sie sagt mit wohlwollender und ermunternder Stimme: „Komm, steh auf und geh. Ich weiß, dass du es kannst!“ Ich tue etwas, vom dem ich nicht ahnte, dass es für mich vorgesehen ist: ich erhebe mich und stolpere unsicher einige Schritte seitwärts. Vom Sitzen bin ich etwas eingerostet, die Beine knicken mir weg. Die Frau fängt mich auf, stützt mich und führt mich zu ihrem Auto. Ich lege meinen Arm um Romis Schulter.
Heinrichs ABC
Heinrich weiß, dass er sich entscheiden kann. Seine Mutter sagte immer: „Wir haben eine Wahl.“ Heinrich sagt sich immer, dass es A, B und C gibt. Das hat er als Kind mal im Fernsehen gesehen. Das hat er nie vergessen. Manchmal glaubt er, dass er träumt, aber er hat sich für A entschieden. Wofür B und C stehen, hat er vergessen. Er kommt nicht mehr drauf.
Wenn Heinrich morgens zur Arbeit geht, muss er eine Tür in einem grünen Holztor passieren. Auf dem Schild über dem Tor steht „Transporte und Materialservice“. Wenn Heinrich die Augen zusammenkneift und nur die Anfangsbuchstaben liest, weiß er, dass er sich für Traum A entschieden hat. A wie Arbeit. Meist klopft er alte Säcke aus, faltet sie und stapelt sie. Zuckersäcke sind okay, aber die Mehlsäcke hasst er. Alles staubt voll und Heinrich muss niesen.
Mit Schulle kann man gut auskommen, der geht niemandem auf den Sack. Schulle hat sich die Augenlider mit Augen tätowieren lassen. Wenn er seine Augen schließt, sind sie immer noch geöffnet. Schulle hat alles im Blick.
Der Dietz ist ein Aas. A wie Aas. Ständig weiß er alles besser und kriecht dem Alten in den Arsch. Heinrich ist es egal, so lange er mit Schulle in Ruhe Säcke stapeln kann.
Wenn Heinrichs Vater nach Hause kam, kriegte Mutter erstmal eins in die Fresse. Und dann wurde gefragt, was los ist. Heinrich half mit, den Abendbrottisch zu decken. Der Vater setzte sich polternd hin und blickte Heinrich scheel über den Küchentisch an: „Na, was ausgefressen, du kleine Ratte?“
Eines Tages klingelte ein fremder Mann. Als der Vater die Tür öffnete, kriegte er erstmal eins in die Fresse. Und dann wurde nicht gefragt, was los ist. Stattdessen packte Mutter wortlos ihre Koffer. Währenddessen wartete der fremde Mann geduldig auf der Schwelle. Wenn der Vater sich aufrappeln wollte, drohte ihm der fremde Mann geduldig mit dem Finger: „Na, na, na!“ Da kniete sich der Vater wieder brav auf den Boden. Mutter hatte ihre Wahl getroffen.
Heinrich hat Mutter später noch ein paar Mal auf der Straße gesehen. Sie hat immer versucht, die blauen Flecken im Gesicht wegzuschminken. Heinrich hat die Stellen trotzdem sofort erkannt. Irgendwann muss Mutter weggezogen sein. Heinrich hat sie dann nie mehr gesehen.
Heinrich geht nur zur Firma, wenn er Geld braucht. Er hat sich für Traum A entschieden. A wie Alkoholgeldbeschaffungsmaßnahme. Wenn Heinrich genug gearbeitet hat, zahlt der Alte ihn aus. A wie Alter. Der Alte gibt das Geld nur in Beutelchen raus, legt die Kohle nie direkt auf die Hand. Mit dem Beutelchen schlurft Heinrich zur Kneipe an der Ecke und träumt seinen Traum. Heinrich erzählt, dass er früher für vier Bier nur so viel wie für zwei Brote bezahlt hat. Heinrich erzählt, dass er damals sogar etwas Trinkgeld geben konnte. Wenn er dasitzt und trinkt, denkt er über Traum B und C nach, aber er kann sich nicht erinnern, wofür B und C stehen. Er zerbricht sich den Kopf, aber er kommt nicht drauf.
Vaters Wochenende begann immer mit einem Frühschoppen. Zur Feier des Tages zog er den kleinen Couchtisch ganz nah an das Wohnzimmersofa heran und goss sich einen Angostura ein. A wie Angostura. Dann saß der Vater da, starrte trübsinnig aus dem Fenster und trank die ganze Flasche leer. Wenn die Flasche leer war, war der Frühschoppen beendet.
Schulle sagt, dass Heinrichs Vater ein Vollidiot war: „Niemand trinkt Angostura pur. Niemand.“ Heinrich hat kurz überlegt, ob er Schulle sein Bier über den Kopf kippen soll. Dann war es ihm aber zu schade drum. Schließlich ist Bier nicht mehr so billig wie früher.
Wenn der Vater getrunken hatte, wusste man nie, ob er rührselig wird oder zuschlägt. Manchmal am Wochenende nahm der Vater Heinrich mit zum Kiosk. Einmal war Straßenfest. Heinrich sammelte den ganzen Tag wie im Rausch Gläser und löste Pfand ein. In manchen Gläsern war noch Bier. Es schmeckte bitter. Aber man konnte sich daran gewöhnen.





























