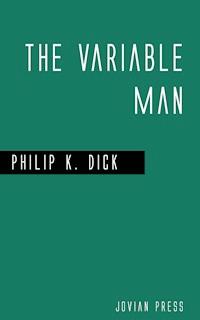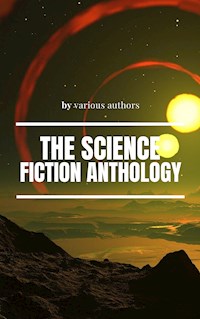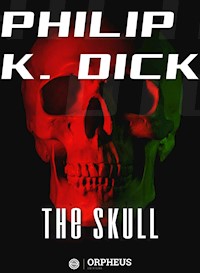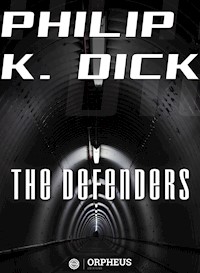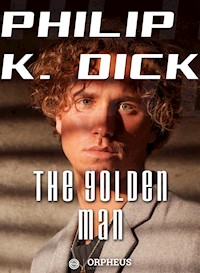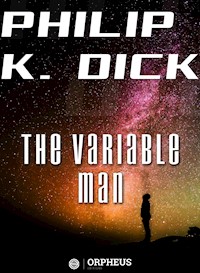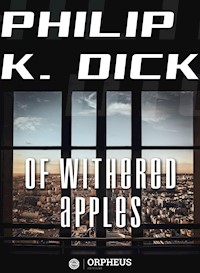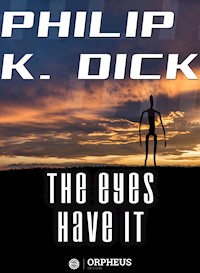9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Die Welt nach dem Atomkrieg: Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges entwirft Philip K. Dick in seinem 1965 entstandenen Roman das Bild einer zerstörten Gesellschaft, in der die Überlebenden darum kämpfen, Menschlichkeit und Normalität wiederzuerlangen. ›Nach der Bombe‹ bietet auch 50 Jahre nach seinem Erscheinen hellsichtige Antworten auf die immer wieder aktuelle Frage »Was wäre wenn …«. »Es sind Dicks innere Widersprüche, die seine Genialität ausmachen, und diese Neigung zu Paradoxien durchzieht den gesamten Roman.« Aus dem Nachwort von Jonathan Lethem
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 423
Ähnliche
Philip K. Dick
Nach der Bombe
Aus dem Amerikanischen von Friedrich Mader
FISCHER E-Books
Mit einem Nachwort von Jonathan Lethem
Inhalt
Eins
Früh an einem strahlenden, sonnenklaren Vormittag kehrte Stuart McConchie den Gehsteig vor Modern TV Sales & Service. Er hörte die Autos auf der Shattuck Avenue und die eilig klappernden Absätze der Sekretärinnen, die auf dem Weg ins Büro waren, und er freute sich über die Geräusche und Gerüche einer neuen Woche, die einem Verkäufer die Chance zu guten Geschäften bot. Er dachte an sein zweites Frühstück, ein heißes Brötchen und Kaffee, so gegen zehn. Er dachte an die zurückliegenden Beratungsgespräche mit Kunden, die vielleicht alle schon heute zum Einkaufen wiederkommen würden, und an sein überquellendes Auftragsbuch. Beim Fegen trällerte er ein Lied aus dem neuen Buddy-Greco-Album und überlegte, wie es wohl wäre, ein weltberühmter Popstar zu sein und im Harrah’s in Reno oder in den sündhaft teuren, exklusiven Clubs in Las Vegas aufzutreten, die er noch nie gesehen, von denen er aber schon so viel gehört hatte.
Er war sechsundzwanzig Jahre alt und war bereits mehrmals, immer am Freitagabend, von Berkeley aus auf dem zehnspurigen Highway nach Sacramento und dann über die Sierras nach Reno gefahren, wo man spielen und Frauen aufreißen konnte. Als Angestellter von Jim Fergesson, dem Besitzer von ModernTV, bekam er ein Grundgehalt plus Provisionen, und weil er ein Verkaufsass war, verdiente er ziemlich gut. Außerdem liefen die Geschäfte in diesem Jahr ohnehin hervorragend. 1981 war wieder so ein Boomjahr, in dem Amerika stärker und mächtiger wurde und alle Leute mehr Geld nach Hause brachten.
»Morgen, Stuart.« Ein Mann mittleren Alters ging mit einem Nicken an ihm vorbei – Mr. Crody, auf dem Weg zu seinem kleinen Juwelierladen auf der anderen Straßenseite.
Nach und nach machten nun alle Geschäfte und Büros auf – es war nach neun –, und auch Dr. Stockstill erschien, Psychiater und Spezialist für psychosomatische Beschwerden, um seine gutgehende Praxis in dem gläsernen Bürohochhaus zu betreten, dessen Bau die Versicherungsgesellschaft mit einem Teil ihrer Überschüsse finanziert hatte. Dr. Stockstills teurer ausländischer Wagen war auf dem Parkplatz abgestellt – die Tagesgebühr von fünf Dollar konnte er sich problemlos leisten. Gleich darauf traf seine hübsche, langbeinige Sekretärin ein, die einen Kopf größer war als er. Und nicht lange, dann kam auch schon der erste Spinner dahergeschlichen und näherte sich schuldbewusst und verstohlen der Praxis.
Eine Welt voller Spinner, dachte Stuart, der das Ganze auf seinen Besen gestützt beobachtete. Psychiater verdienen ein Schweinegeld. Wenn ich zu einem Psychiater müsste, würde ich den Hintereingang nehmen, da könnte mich niemand sehen und auslachen. Vielleicht machen das ja auch einige, vielleicht hat Stockstill tatsächlich einen Hintereingang. Für die Verrückteren oder besser für die, die sich nicht zum Gespött der Leute machen wollen, die einfach nur ein Problem haben, die sich zum Beispiel Sorgen machen wegen der Strafaktion in Kuba, die eigentlich gar nicht verrückt sind, sondern nur – beunruhigt.
Auch er war beunruhigt, weil er immer noch damit rechnen musste, zum Kubakrieg einberufen zu werden, der wieder einmal in den Bergen feststeckte – und das trotz der neuen Splitterbomben, mit denen man die Schlitzaugen überall erwischen konnte, auch wenn sie sich noch so tief eingruben. Er machte dem Präsidenten keinen Vorwurf – was konnte denn der Präsident dafür, wenn sich die Chinesen unbedingt an ihren Pakt halten mussten? Das Dumme war nur, dass von den Kämpfen mit den Schlitzaugen fast kein Soldat ohne Virusinfektion nach Hause kam. Und der Virus ging wirklich auf die Knochen – dreißigjährige Kriegsheimkehrer sahen aus wie vertrocknete Mumien. Stuart McConchie konnte sich nur schwer vorstellen, wie er nach so einer Tortur wieder in seinen Beruf zurückkehren und Fernseher verkaufen sollte.
»Morgen, Stu.« Die Stimme einer jungen Frau ließ ihn aufschrecken. Es war die kleine, dunkeläugige Kellnerin vom Edy’s. »Schon so früh am Tagträumen?« Sie ging mit einem Lächeln auf den Lippen an ihm vorbei.
»Ach was.« Eifrig machte er sich wieder ans Kehren.
Auf der anderen Straßenseite blieb Dr. Stockstills Patient gerade stehen, um sich eine Zigarette anzuzünden und sich vorsichtig umzuschauen. Der Mann stand ganz im Zeichen von Schwarz: Augen und Haare waren schwarz – nur die Haut schimmerte hell –, und er war in einen nachtdunklen Mantel gehüllt. Stuart sah sein hohlwangiges Gesicht, den starren Blick und den Mund. Vor allem den Mund. Er war verkniffen, und trotzdem hing die Haut schlaff herab, als hätten innerer Druck und Anspannung schon vor langer Zeit Zähne und Kiefer weggeschliffen. Diese Anspannung stand ihm in das unglückliche Gesicht geschrieben – Stuart wandte rasch den Blick ab.
Ob es einem wohl so erging, wenn man verrückt war? Dass man einfach von innen her zersetzt wurde, wie aufgefressen von … Er hatte keine Ahnung, wovon. Von der Zeit vielleicht. Oder von Wasser. Etwas Langsames, das nie aufhörte. Im Kommen und Gehen der Patienten vor der Praxis des Psychiaters hatte er diesen Zerfall schon öfter gesehen, aber noch nie so schlimm, noch nie so weit fortgeschritten wie in diesem Fall.
Drinnen im Modern TV läutete das Telefon, und Stuart lief schnell in den Laden. Als er kurz darauf wieder auf die Straße blickte, war der Mann in Schwarz verschwunden, und der Tag hatte sein verheißungsvolles Leuchten und den Geschmack von Schönheit zurückgewonnen. Mit leichtem Schaudern griff Stuart wieder nach dem Besen.
Den kenne ich doch, dachte er dann. Ganz sicher. Irgendwo muss ich sein Bild gesehen haben. Oder er war schon mal im Laden. Entweder ein Kunde – einer von den alten Stammkunden, vielleicht sogar ein Freund von Fergesson – oder irgendein Prominenter.
Nachdenklich kehrte er weiter.
Dr. Stockstill wandte sich an seinen neuen Patienten. »Eine Tasse Kaffee, Tee oder Cola?« Dann warf er einen kurzen Blick auf die Notiz, die ihm Miss Purcell auf den Schreibtisch gelegt hatte. »Mr. Tree. Sind Sie zufällig verwandt mit der berühmten englischen Schriftstellerfamilie? Iris Tree, Max Beerbohm …«
»Natürlich ist das nicht mein richtiger Name, das können Sie sich doch denken.« Mr. Tree sprach mit starkem Akzent, außerdem klang er ungeduldig, ja gereizt. »Er ist mir im Gespräch mit Ihrer Sekretärin eingefallen.«
Stockstill sah seinen Patienten fragend an.
»Ich bin weltberühmt«, erklärte Mr. Tree. »Es überrascht mich, dass Sie mich nicht erkennen. Sie müssen ein Einsiedler sein oder noch was Schlimmeres.« Mit zittriger Hand fuhr er sich durch das lange schwarze Haar. »Es gibt Tausende, ja Millionen von Menschen auf der Welt, die mich hassen, die mich vernichten wollen. Da muss ich natürlich Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Deswegen habe ich Ihnen einen erfundenen Namen genannt.« Er räusperte sich und zog hastig an seiner Zigarette, die er so hielt, dass die Glut fast die Handfläche berührte.
Mein Gott, dachte Stockstill, jetzt erkenne ich den Mann. Es ist der Physiker Bruno Bluthgeld. Und er hat recht: Zahllose Leute, hier und im Ostblock, würden ihn gern in die Finger bekommen – nach seiner Fehlberechnung, damals 1972. Nach dem verheerenden radioaktiven Niederschlag infolge eines Atomtests in der Stratosphäre. Ein Test, der eigentlich vollkommen harmlos sein sollte – das hatte Bluthgeld mit seinen Zahlen im Voraus bewiesen.
»Ist es wichtig für Sie, dass ich Ihre wahre Identität kenne?«, fragte Stockstill. »Oder sollen wir lieber bei ›Mr. Tree‹. bleiben? Es liegt ganz bei Ihnen, für mich ist beides in Ordnung.«
»Machen wir einfach weiter«, knurrte Mr. Tree mit zusammengebissenen Zähnen.
»Also gut.« Stockstill machte es sich in seinem Sessel bequem und scharrte mit dem Stift über das Papier auf seinem Klemmbrett. »Was führt Sie zu mir?«
»Wenn man in einen ganz gewöhnlichen Bus – ein Bus, in dem vielleicht zehn Leute sitzen, die man nicht kennt –, wenn man in so einen Bus nicht einsteigen kann, hat das etwas zu bedeuten?«
»Schon möglich.«
»Ich habe das Gefühl, dass mich die Leute anstarren.«
»Aus einem bestimmten Grund?«
»Weil mein Gesicht entstellt ist.«
Ohne sich etwas anmerken zu lassen, hob Stockstill den Blick, um seinen Patienten näher zu betrachten. Er sah einen schwarzhaarigen, untersetzten Mann Mitte vierzig, dessen Bartstoppeln sich dunkel gegen die ungewöhnlich helle Haut abzeichneten. Er sah die tiefen Schatten der Erschöpfung und Anspannung unter seinen Augen und den Ausdruck der Verzweiflung in seinem Blick. Der Physiker hatte unreine Haut, und er brauchte dringend einen Haarschnitt. Sein Gesicht war gezeichnet von innerer Not … aber es war nicht entstellt. Bis auf das deutlich sichtbare Leid war es ein ganz normales Gesicht, das in einer Gruppe von Menschen keine besondere Aufmerksamkeit erregt hätte.
»Sehen Sie diese Flecken?« Mr. Tree deutete auf Wangen und Kiefer. »Die hässlichen Stellen, die mich von allen anderen unterscheiden?«
»Nein.« Eine derartige Offenheit war womöglich nicht ganz ungefährlich, doch Stockstill ließ es darauf ankommen.
»Aber sie sind da! Auf der Innenseite der Haut natürlich – trotzdem sehen die Leute diese Flecken und gaffen. Ich kann nicht mehr im Bus fahren, nicht mehr ins Theater oder in ein Restaurant gehen. Ich kann in San Francisco keine Oper mehr besuchen, kein Ballett, kein Konzert, nicht einmal mehr einen Nachtclub. Wenn ich es überhaupt bis hinein schaffe, muss ich sofort wieder gehen, weil mich alle anstarren. Und sich über mich das Maul zerreißen.«
»Was sagen die Leute denn?«
Mr. Tree blieb stumm, also fuhr Stockstill fort: »Sie haben mir doch gerade erzählt, dass Sie weltberühmt sind – ist es da nicht ganz normal, dass die Leute tuscheln, wenn eine weltberühmte Persönlichkeit hereinkommt und unter ihnen Platz nimmt? Außerdem sind Sie nicht ganz unumstritten, darauf haben Sie ja selbst hingewiesen. Da gibt es natürlich Anfeindungen und vielleicht auch abfällige Bemerkungen. Aber das ist doch für jeden, der in der Öffentlichkeit steht …«
»Das meine ich nicht«, unterbrach ihn Mr. Tree. »Mit solchen Dingen muss ich selbstverständlich rechnen. Ich publiziere und trete im Fernsehen auf, da ist so etwas ganz normal, wie Sie sagen. Aber das hier – das hat mit meinem Innenleben zu tun, mit meinen geheimsten Gedanken.« Er starrte Stockstill unverhohlen an. »Die Leute lesen meine Gedanken und können mir dann in allen Einzelheiten erzählen, was in mir vorgeht. Sie haben Zugang zu meinem Gehirn.«
Paranoia, dachte Stockstill. Obwohl man natürlich erst noch genauere Untersuchungen anstellen muss – vor allem der Rohrschachtest ist wichtig. Könnte auch weit fortgeschrittene Schizophrenie sein oder das Endstadium einer Krankheit, die er schon von Geburt an hat. Oder …
»Manche Leute können die Flecken auf meinem Gesicht genauer erkennen und folglich meine Gedanken besser lesen als andere«, sagte Mr. Tree nun. »Die Fähigkeiten sind da ziemlich verschieden. Einige merken fast nichts, andere können sich sofort ein Bild von meinem Stigma machen. Zum Beispiel als ich vorhin zu Ihrer Praxis gegangen bin, da hat drüben auf der anderen Straßenseite ein Schwarzer den Gehsteig gekehrt. Er hat mit seiner Arbeit aufgehört und mich ganz ungeniert angegafft. Zum Glück war er zu weit weg, um mich auszulachen. Aber er hat es gesehen. Ganz typisch für Leute aus der Unterschicht übrigens, das ist mir aufgefallen. Sie sehen mehr als gebildete oder kultivierte Menschen.«
»Warum ist das wohl so?« Stockstill machte sich Notizen.
»Das müssten doch eigentlich Sie wissen, wenn Sie etwas von Ihrem Fach verstehen. Die Frau, die Sie mir empfohlen hat, hält Sie jedenfalls für sehr kompetent.« Mr. Tree beäugte ihn skeptisch, als wollte er ausdrücken, dass er von diesen Fähigkeiten bisher noch nichts wahrgenommen hatte.
»Ich muss zuerst noch mehr über Ihre persönliche Geschichte wissen. Sie sind also von Bonny Keller zu mir geschickt worden? Wie geht es ihr denn? Ich habe sie, glaube ich, seit letzten April nicht mehr gesehen. Hat ihr Mann seine Stelle als Lehrer an dieser Schule auf dem Land aufgegeben, wie er es vorhatte?«
»Ich bin nicht hierhergekommen, um mit Ihnen über George und Bonny Keller zu plaudern. Ich bin in einer verzweifelten Lage, Doktor. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie versuchen, mich endgültig zu vernichten. Sie verfolgen mich jetzt schon so lange … Bonny hält mich für krank, und ich habe großen Respekt vor ihrer Meinung.« Mr. Trees Stimme wurde jetzt fast unhörbar. »Also habe ich ihr versprochen, dass ich zumindest mal einen Versuch mit Ihnen machen werde.«
»Leben die Kellers noch oben in West Marin?«
Mr. Tree nickte.
»Ich habe dort ein Sommerhaus. Ich bin begeisterter Segler und fahre auf die Tomales Bay raus, wann immer sich die Gelegenheit bietet. Haben Sie es schon mal mit Segeln probiert?«
»Nein.«
»Okay, sagen Sie mir, wann und wo Sie geboren sind.«
»1934 in Budapest.«
Mit geschickten Fragen verschaffte sich Stockstill einen detaillierten Überblick über die Lebensgeschichte seines Patienten. Die genaue Kenntnis dieser Fakten war entscheidend für seine Aufgabe: die Krankheit zu diagnostizieren und, falls möglich, zu heilen. Zuerst die Analyse, dann die Therapie.
Ein weltweit bekannter Mann, der in dem Wahn lebte, von Fremden angestarrt zu werden. Wie ließen sich in diesem Fall Realität und Phantasie voneinander trennen? Welchen Maßstab sollte er dafür anlegen?
Stockstill wurde klar, wie einfach es war, etwas Pathologisches in diesen Fall hineinzulesen. Einfach und verlockend. Ein von allen gehasster Mann … Und ich bin der gleichen Meinung wie sie, gestand er sich ein, wie die Leute, von denen Bluthgeld – oder vielmehr Tree – redete. Schließlich bin auch ich Teil der Gesellschaft, Teil einer Zivilisation, die wegen der grandiosen Fehlberechnungen dieses Mannes an den Rand der Vernichtung gebracht wurde. Es hätte passieren können – es könnte noch immer eines Tages passieren –, dass meine Kinder einen grauenvollen Tod erleiden, nur weil sich dieser Mann in seiner grenzenlosen Selbstüberschätzung für unfehlbar hält.
Doch da war noch mehr als Selbstüberschätzung. Schon in der Zeit vor dem Atomunglück hatte Stockstill gespürt, dass Bluthgeld etwas Schräges an sich hatte. Er hatte ihn bei Interviews im Fernsehen beobachtet, hatte ihn bei Tagungen erlebt, als er seine fanatischen antikommunistischen Tiraden vom Blatt las – und er war zu dem vorläufigen Schluss gelangt, dass Bluthgeld von einem abgrundtiefen Hass gegen die Menschheit erfüllt war, der zumindest auf einer unbewussten Ebene stark genug war, um das Leben von Millionen Unschuldiger aufs Spiel zu setzen.
Kein Wunder, dass der damalige FBI-Chef Richard Nixon so entschieden vor »militanten Amateur-Antikommunisten in wissenschaftlichen Kreisen« gewarnt hatte. Auch Nixon war schon lange vor dem tragischen Irrtum 1972 beunruhigt gewesen. Die grassierende Paranoia mit ihrer explosiven Mischung aus Verfolgungs- und Größenwahn war dem versierten Menschenkenner nicht entgangen – wie vielen anderen auch.
Und sie sollten recht behalten.
»Ich bin nach Amerika gekommen«, sagte Mr. Tree gerade, »um den kommunistischen Agenten zu entgehen, die mich ermorden wollten. Schon damals waren sie mir auf den Fersen … und auch bei den Nazis stand ich auf der Abschussliste. Ich wurde von allen Seiten gejagt.«
»Ich verstehe.« Stockstill machte sich weitere Notizen.
»Und sie verfolgen mich noch immer. Aber letztlich werden sie scheitern.« Mr. Tree zündete sich eine neue Zigarette an. »Denn Gott ist auf meiner Seite. Er hat oft mit mir gesprochen. Er kennt meine Not und hat mir die Weisheit gegeben, die ich brauche, um meinen Verfolgern zu entgehen … Zurzeit arbeite ich in Livermore an einem neuen Projekt, dessen Ergebnisse endgültig sein werden, was unseren Feind betrifft.«
Unser Feind. Wer soll das sein?, dachte Stockstill. Sind nicht Sie dieser Feind, Mr. Tree? Ein Mann, der hier vor mir sitzt und seine paranoiden Wahnvorstellungen herunterleiert? Wie sind Sie überhaupt in diese hohe Position gelangt? Wer ist dafür verantwortlich, dass Sie so viel Macht über das Leben von Menschen haben? Und dass Sie diese Macht nach der Tragödie von 1972 behalten durften? Wenn jemand unser Feind ist, dann sind Sie es, Mr. Tree, Sie und die Leute, in deren Auftrag Sie handeln.
Und nun erweisen sich all unsere Ängste als gerechtfertigt. Sie sind geisteskrank – das beweist Ihr Erscheinen hier. Oder etwa nicht? Nein, nicht unbedingt. Vielleicht sollte ich Ihren Fall abgeben, vielleicht ist es unethisch von mir, Sie zu behandeln. Angesichts meiner Gefühle ist es mir doch gar nicht möglich, Ihnen unvoreingenommen und sachlich zu begegnen. Ich kann nicht wirklich wissenschaftlich objektiv sein, weshalb sich meine Analyse und Diagnose unter Umständen als falsch erweisen wird.
»Warum sehen Sie mich so an?«, krächzte Mr. Tree.
»Wie meinen Sie?«
»Mein entstelltes Gesicht stößt Sie ab, nicht wahr?«
»Nein. Das ist es nicht.«
»Also meine Gedanken? Sie haben sie gelesen und sind so angewidert davon, dass es Ihnen lieber wäre, ich hätte Sie nicht aufgesucht?« Mr. Tree erhob sich und ging unvermittelt zur Tür. »Guten Tag.«
»Warten Sie.« Stockstill eilte ihm nach. »Machen wir wenigstens noch den biographischen Teil zu Ende. Wir haben doch gerade erst angefangen.«
Mr. Tree musterte ihn von oben bis unten. »Ich vertraue Bonny Keller. Ich kenne ihre politische Einstellung – sie gehört nicht zu den kommunistischen Verschwörern, die mich um jeden Preis töten wollen.« Ein wenig gefasster nahm er wieder Platz, doch seine Gestik verriet Wachsamkeit. Er würde sich in Stockstills Gegenwart keinen Augenblick entspannen, das war dem Psychiater klar. Er würde sich nicht rückhaltlos öffnen, nicht wirklich aus sich herausgehen. Er würde misstrauisch bleiben – und das wohl nicht zu Unrecht.
Beim Einparken sah Jim Fergesson, der Besitzer von Modern TV, dass sein Verkäufer Stuart McConchie vor dem Laden stand und, statt den Gehsteig zu fegen, vor sich hin träumte. Er folgte McConchies Blick und sah, dass sich der Verkäufer nicht etwa über den Anblick einer vorbeikommenden Frau oder eines ungewöhnlichen Autos freute – Stu stand auf Frauen und Autos, das wäre also ganz normal gewesen –, sondern hinüber auf die andere Straßenseite schaute, dorthin, wo gewöhnlich Patienten die Praxis des Psychiaters betraten. Das war nicht normal. Und was ging das McConchie überhaupt an?
»He, Stuart.« Fergesson steuerte mit schnellen Schritten auf den Ladeneingang zu. »Lassen Sie das. Irgendwann sind Sie vielleicht auch mal krank – und was würden Sie dann sagen, wenn Ihnen irgend so ein Idiot nachgafft, nur weil Sie zum Arzt müssen?«
»Schon gut.« Stuart wandte sich seinem Chef zu. »Da ist gerade jemand reingegangen, so ein Promi, mir fällt bloß nicht ein, wer.«
»Nur ein Neurotiker beobachtet andere Neurotiker.« Fergesson betrat den Laden und ging zur Kasse hinüber, um sie für den Tag mit Kleingeld und Scheinen zu füllen. Warte nur, dachte er, bis du siehst, wen ich als neuen Fernsehmechaniker eingestellt habe. Da wirst du erst Augen machen!
»Hören Sie, Stuart, Sie kennen doch den Jungen ohne Arme und Beine, der hier immer auf seinem Wagen vorbeikommt. Sie wissen schon, der Phokomelus mit den mickrigen Flossen – seine Mutter hat damals zu Beginn der 60er dieses Medikament genommen. Der hier immer rumhängt, weil er Fernsehmechaniker werden will.«
Stuart stützte sich weiter auf den Besen und bewegte sich nicht. »Sie haben ihn also eingestellt.«
»Ja, gestern, als Sie auf Verkaufstour waren.«
McConchie schien nicht gerade erfreut. »Das ist schlecht fürs Geschäft.«
»Warum? Niemand wird ihn zu Gesicht bekommen, er arbeitet unten in der Reparaturabteilung. Außerdem muss man auch solchen Menschen Arbeit geben. Sie können schließlich nichts dafür, dass sie keine Arme und Beine haben. Schuld sind diese deutschen Pharmafirmen.«
Nach einer kurzen Pause erwiderte Stuart: »Erst stellen Sie mich ein, einen Schwarzen, und jetzt einen Phoko. Sie sind wirklich bemüht, Gutes zu tun, Mr. Fergesson, das muss man Ihnen lassen.«
Fergesson wurde ärgerlich. »Ich bin nicht nur bemüht, sondern ich tue wirklich was. Ich träume nicht einfach in den Tag hinein wie Sie. Ich bin ein Mensch, der einen Entschluss fasst und dann handelt.« Er öffnete den Ladensafe. »Er heißt übrigens Hoppy. Und er fängt heute Vormittag an. Sie sollten mal sehen, wie er mit seinen elektronischen Händen Sachen bewegt. Ein echtes Wunder moderner Wissenschaft.«
»Hab ich schon gesehen.«
»Und was haben Sie daran auszusetzen?«
Stuart machte eine unbestimmte Geste. »Ich … ich finde es unnatürlich.«
Fergesson funkelte ihn böse an. »Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Ich will keine Sticheleien gegen den Jungen. Bei der kleinsten Bemerkung von Ihnen oder von einem anderen Angestellten …«
»Schon gut.«
»Sie langweilen sich, und Langeweile ist schlecht, weil es bedeutet, dass Sie sich nicht richtig anstrengen. Sie ruhen sich aus, und zwar auf meine Kosten. Wenn Sie wirklich hart arbeiten würden, hätten Sie keine Zeit, hier herumzuhängen und sich über bedauernswerte Kranke lustig zu machen, die zum Doktor müssen. Ich verbiete Ihnen, auf dem Gehsteig herumzustehen. Wenn ich Sie noch mal dabei erwische, fliegen Sie hochkant raus.«
»Jesus, wie soll ich denn dann hinein- und hinauskommen, zum Beispiel wenn ich etwas essen muss? Und wie komme ich überhaupt in den Laden? Durch die Wand vielleicht?«
»Kommen und gehen können Sie, aber herumgelungert wird nicht.« Fergesson wandte sich ab.
»Verdammt!« Stuart warf ihm einen giftigen Blick nach, doch Fergesson achtete nicht weiter auf seinen Verkäufer, sondern schaltete die Lichtdekoration im Schaufenster an. Der Tag konnte beginnen.
Zwei
Meistens rollte der Phokomelus Hoppy Harrington so gegen elf Uhr vormittags zu Modern TV Sales & Service, schob sich mit seinem Wagen in den Laden und hielt vor der Verkaufstheke. Wenn Jim Fergesson da war, bat er ihn, den Technikern unten im Keller bei den Reparaturarbeiten zusehen zu dürfen. War Fergesson außer Haus, rollte Hoppy bald wieder davon, weil er genau wusste, dass ihn die Verkäufer nicht nach unten ließen und ihn höchstens mit dummen Bemerkungen ärgerten. Doch das machte ihm nichts aus. Zumindest hatte Stuart McConchie den Eindruck, dass es ihm nichts ausmachte.
Wenn er allerdings genauer darüber nachdachte, kam er zu dem Ergebnis, dass er Hoppy überhaupt nicht verstand. Hoppys scharf geschnittenes Gesicht mit den wachen Augen, seine schnelle, nervöse Sprechweise, die oft in Stottern überging … Er verstand seine Beweggründe nicht. Warum wollte Hoppy ausgerechnet Fernseher reparieren? Was war daran so toll? Wenn man den Phoko unten im Keller so sah, konnte man diese Arbeit für die erhabenste aller Aufgaben halten. In Wirklichkeit jedoch war die Reparaturarbeit schwer, schmutzig, und man verdiente noch nicht mal besonders gut dabei. Aber Hoppy war wild entschlossen, er wollte unbedingt Fernsehmechaniker werden. Und nun hatte er es geschafft – weil Fergesson darauf erpicht war, es allen Minderheiten der Welt recht zu machen. Als strikter Verfechter der Gleichberechtigung für alle Menschen war er Mitglied in der »Freiheitsunion«, im »Verein zur Förderung farbiger Mitbürger« und in der »Liga zur Wahrung der Rechte Behinderter«. Letztere war nach Stuarts Auffassung allerdings nichts weiter als eine internationale Lobby-Organisation mit dem Ziel, den Opfern der modernen Medizin und Wissenschaft – allen voran den zahllosen Leidtragenden der Bluthgeld-Katastrophe von 1972 – angenehme Posten zu verschaffen.
Und was bin dann eigentlich ich? Stuart saß oben im Büro und durchforstete gerade sein Auftragsbuch. Ich meine, wenn jetzt schon ein Phoko hier arbeitet … Da bin ich wahrscheinlich auch ein Strahlungsopfer, und meine Hautfarbe ist so was wie ein Zeichen dafür, dass mich die Radioaktivität erwischt hat. Der Gedanke bedrückte ihn.
Es gab einmal eine Zeit, überlegte er, vor zehntausend Jahren, da waren alle Menschen auf der Erde weiß, und dann hat irgendso ein Irrer hoch droben am Himmel eine Atombombe gezündet, und einige von uns haben dabei schwere Verbrennungen abbekommen, die nicht mehr vergingen und langfristig die Gene veränderten. Und deswegen sind wir heute schokobraun …
Während er so am Grübeln war, kam sein Kollege Jack Lightheiser herein, nahm gegenüber von ihm Platz und steckte sich eine Corona-Zigarre an. »Hab gehört, Jim hat diesen Jungen eingestellt.« Er paffte vor sich hin. »Dir ist doch klar, warum er das gemacht hat? Ist eine super Werbung für ihn. Die Zeitungen in San Francisco werden sich überschlagen, und Jim liebt es, wenn sein Name in der Zeitung steht. Ziemlich cleverer Schachzug, das muss man ihm lassen. Das erste Einzelhandelsgeschäft an der East Bay, das einen Phoko einstellt.«
Stuart knurrte.
»Jim hat ein ziemlich idealistisches Bild von sich selbst«, fuhr Lightheiser fort. »Er will nicht nur irgendein Händler sein, sondern ein moderner römischer Patrizier, dem es auf das Gemeinwohl ankommt. Schließlich ist er ja gebildet – er hat einen Magister aus Stanford.«
»So was zählt doch heute nichts mehr.« Stuart hatte seinen Magister an der University of California erworben, 1975 war das – und was hatte es ihm gebracht?
»Damals hat es schon noch was gezählt. Er hat seinen Abschluss 1947 gemacht – als GI ist er vom Staat gefördert worden.«
Vor dem Ladeneingang unter ihnen tauchte nun ein Rollwagen auf, in dem eine schlanke Gestalt an einer Steuerkonsole saß. Stuart stöhnte. Lightheiser sah ihn fragend an.
»Eine Nervensäge, der Kerl«, schimpfte Stuart.
»Nicht mehr, wenn er erst zu arbeiten anfängt. Der Junge besteht nur aus Gehirn, sein Körper ist lediglich ein Anhängsel. Er hat unglaublich viel Verstand. Und er ist ehrgeizig. Mann, der ist erst siebzehn und hat nur eins im Kopf – aus der Schule rauszukommen und zu arbeiten. Wirklich bewundernswert.«
Die beiden beobachteten Hoppy, wie er mit seinem Wagen zur Treppe rollte, die hinunter in die Reparaturabteilung führte.
»Wissen die Jungs unten schon Bescheid?«, fragte Stuart Lightheiser.
»Ja. Jim hat sie gestern Abend eingeweiht. Sie tragen es mit Fassung, könnte man sagen. Du weißt ja, wie Fernsehmechaniker sind: Sie meckern zwar herum – aber das hat nichts zu bedeuten, weil sie sowieso immer was zum Meckern haben.«
In diesem Moment hörte Hoppy die Stimme des Verkäufers und hob ruckartig den Kopf. Sie sahen in sein hageres, bleiches Gesicht. In seinen Augen schwelte es geradezu. Er stammelte: »Hallo, ist Mr. Fergesson da?«
»Nein.« Stuart gab seiner Stimme einen wenig einladenden Ton.
»Mr. Fergesson hat mich eingestellt.«
»Aha.« Weder Stuart noch Lightheiser trafen Anstalten aufzustehen. Sie blieben am Schreibtisch sitzen und blickten auf den Phoko hinunter.
»Kann ich runter in den Keller?«
Lightheiser zuckte mit den Achseln.
»Ich geh mal kurz auf einen Kaffee.« Stuart stemmte sich hoch. »In zehn Minuten bin ich wieder da. Kannst du für mich inzwischen die Stellung halten?«
»Klar.« Lightheiser nickte und zog an seiner Zigarre.
Als Stuart nach unten kam, war der Phoko immer noch da, er hatte sich noch nicht an den schwierigen Abstieg in den Keller gemacht.
»Ein echter 72er«, zischte ihm Stuart im Vorbeigehen zu.
Der Phoko wurde rot und stotterte: »Ich bin 1964 geboren. Das hat nichts mit der Atomexplosion zu tun.« Und als Stuart durch die Tür hinaus auf den Gehsteig trat, rief ihm Hoppy mit bebender Stimme nach: »Das war dieses Medikament, das Thalidomid. Das weiß doch jeder.«
Ohne ein Wort zu erwidern, marschierte Stuart in Richtung Café.
Es war ziemlich mühsam für den Phokomelus, seinen Wagen die Treppe hinunter in den Keller zu manövrieren, wo die Mechaniker arbeiteten. Er umklammerte das Geländer mit den künstlichen Greifarmen, die ihm der Staat freundlicherweise zur Verfügung gestellt hatte, und ließ sich langsam nach unten. Doch im Grunde taugten diese Greifarme nicht viel. Sie waren ihm schon vor Jahren eingesetzt worden und inzwischen nicht nur zum Teil verschlissen, sondern auch hoffnungslos veraltet, wie er aus der aktuellen Fachliteratur wusste. Eigentlich war der Staat ja verpflichtet, seine Hilfsmittel regelmäßig durch modernere Modelle zu ersetzen – das war im Remington Act so festgelegt worden –, und er hatte sogar dem kalifornischen Senator Alf M. Partland einen Protestbrief geschrieben, bisher allerdings noch keine Antwort erhalten. Aber er war geduldig. Er hatte schon häufig in verschiedenen Angelegenheiten Briefe an Kongressabgeordnete geschickt, und es war nicht selten, dass die Reaktion erst mit großer Verspätung kam. Oder auch völlig ausblieb.
In diesem Fall jedoch stand das Gesetz auf seiner Seite, und es war nur eine Frage der Zeit, bis einer der Verantwortlichen einlenken und Hoppy geben musste, was ihm zustand. Hoppy war zwar geduldig, aber locker lassen wollte er auf keinen Fall. Sie mussten ihm helfen, ob sie nun Lust dazu hatten oder nicht. Diese Hartnäckigkeit hatte er von seinem Vater gelernt, einem Schafzüchter oben in Sonoma Valley – er hatte ihm beigebracht, stets zu fordern, worauf man ein Recht hatte.
Er hörte jetzt das Plärren von Fernsehern; die Mechaniker waren an der Arbeit. Er zögerte kurz, dann öffnete er die Tür und sah zwei Männer an einer langen Werkbank, die mit Instrumenten, Messgeräten, Einstellskalen, Werkzeug und zerlegten Fernsehgeräten übersät war. Sie schenkten ihm keinerlei Beachtung.
»Hör mal«, sagte einer der beiden dann plötzlich zu ihm, so dass Hoppy erschrak. »Auf körperliche Arbeit schauen die Leute doch herab. Warum probierst du nicht was Intellektuelles, warum gehst du nicht zurück zur Schule und machst einen Abschluss?« Der Mechaniker drehte sich um und starrte ihn fragend an.
Nein, dachte Hoppy. Ich will … mit meinen Händen arbeiten.
»Du könntest doch Wissenschaftler werden«, mischte sich der andere Mechaniker ein, ohne seine Arbeit zu unterbrechen. Den Blick auf den Spannungsmesser gerichtet, überprüfte er gerade einen Schaltkreis.
»Ja, wie Bluthgeld«, erwiderte Hoppy.
Der Mechaniker lachte verständnisvoll.
»Mr. Fergesson hat gesagt, dass Sie mir was zum Arbeiten geben würden. Irgendetwas Leichtes zum Reparieren, für den Anfang. In Ordnung?« Hoppy wartete – er hatte Angst, dass sie nicht reagieren würden. Doch dann deutete einer von ihnen auf einen Plattenwechsler. »Was ist damit?« Hoppy warf einen Blick auf den Reparaturschein. »Was auch immer, das krieg ich hin, ganz sicher.«
»Feder gebrochen«, sagte der Techniker. »Schaltet nach der letzten Platte nicht ab.«
»Alles klar.« Hoppy hob den Plattenwechsler mit seinen beiden Greifarmen hoch und rollte damit zum anderen Ende der Werkbank, wo ein freier Platz war. »Ich arbeite hier.«
Die Mechaniker hatten offenbar nichts dagegen, also schnappte er sich eine Zange. Das ist einfach, dachte er. Hab ich alles zu Hause geübt. Er konzentrierte sich auf das Gerät, behielt aber die zwei Mechaniker weiterhin im Auge. Ich habe sehr viel geübt, und jedes Mal wird es besser. Genauer. Berechenbarer. Eine Feder ist ein kleiner Gegenstand, kleiner geht es fast nicht. Und so leicht, dass es sie beinahe davonweht. Ich sehe dich, ich sehe, wo du gebrochen bist. Metallmoleküle, die sich nicht mehr berühren … Er hielt die Zange so vor die Stelle, dass der Mechaniker neben ihm nichts erkennen konnte, und tat so, als würde er die Feder packen und herausziehen.
Als die Sache erledigt war, bemerkte er, dass ihm jemand heimlich über die Schulter blickte. Er drehte sich um und sah Jim Fergesson, seinen Arbeitgeber, der keinen Ton sagte, sondern nur mit den Händen in den Hosentaschen dastand und ein komisches Gesicht machte.
»Fertig«, erklärte Hoppy nervös.
»Darf ich mal sehen?« Fergesson griff nach dem Plattenwechsler und hob ihn in das grelle Neonlicht.
Hat er mich beobachtet?, fragte sich Hoppy. Hat er verstanden, was passiert ist, und wenn ja, was denkt er jetzt? Macht es ihm etwas aus? Interessiert es ihn überhaupt? Ist er … schockiert?
Alle schwiegen, während Fergesson das Gerät in Augenschein nahm. »Wo hast du denn die neue Feder her?«, fragte er dann.
Hoppys Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: »Die lag hier auf dem Boden.«
Es war alles in Ordnung. Fergesson hatte vielleicht etwas bemerkt, aber nichts verstanden. Der Phokomelus atmete auf. Die Freude über das gelungene Manöver und ein Gefühl der Überlegenheit verdrängten die Angst. Er grinste die beiden Mechaniker an und sah sich dann nach dem nächsten Gerät um, das er reparieren konnte.
»Macht es dich nervös, wenn dich die Leute beobachten?«, fragte Fergesson.
»Nein, Mr. Fergesson. Die Leute können mich anstarren, so viel sie wollen. Ich weiß ja, dass ich anders bin. Ich werde schon seit meiner Geburt angestarrt.«
»Ich meine bei der Arbeit.«
»Nein.« Hoppys Stimme klang laut – vielleicht ein wenig zu laut – in seinen Ohren. »Bevor ich einen Wagen bekommen habe, bevor ich vom Staat überhaupt etwas zum Fahren gekriegt habe, hat mich mein Vater in einer Art Rucksack mit sich herumgeschleppt. Hinten auf dem Rücken, wie ein Wickelkind.« Er lachte ein wenig unsicher.
»Aha.«
»Ja, das war in Sonoma Valley. Da bin ich aufgewachsen. Wir hatten Schafe. Einmal hat mich ein Hammel gerammt, und ich bin durch die Luft geflogen wie ein Ball.« Wieder lachte er.
Die beiden Mechaniker hatten ihre Arbeit unterbrochen und blickten ihn an. Es dauerte eine Weile, bis einer von ihnen den Mund aufmachte. »Da bist du ja sicher ganz schön gerollt. Nach der Landung, meine ich.«
»Klar«, erwiderte Hoppy, und dann lachten sie alle: er selbst, Fergesson und die zwei Mechaniker. Offenbar stellten sie sich vor, wie der siebenjährige Hoppy Harrington, der weder Arme noch Beine hatte und nur aus Kopf und Rumpf bestand, über den Boden kugelte und vor Angst und Schmerzen quiekte. Trotzdem war es lustig, das wusste er. Er hatte es extra so erzählt, dass man einfach lachen musste.
»Na, da bist du ja jetzt mit deinem Wagen viel besser dran.« Fergessons Stimme klang freundlich.
»Sicher. Aber ich werde mir trotzdem einen neuen bauen, nach meinen eigenen Plänen – vollelektronisch. Ich hab einen Artikel über Gehirnsteuerung gelesen, in der Schweiz und Deutschland machen die das schon. Da wird der Wagen direkt mit dem motorischen Zentrum im Gehirn verknüpft, und es gibt keine Verzögerung mehr. Man kann sich sogar schneller bewegen als … ein normaler physiologischer Organismus.« Um ein Haar hätte er gesagt: als ein Mensch. »In zwei Jahren hab ich ihn fertig, und er wird noch besser sein als die Modelle aus der Schweiz. Dann kann ich diesen Müll von der Regierung endlich wegschmeißen.«
»Du lässt dich nicht unterkriegen, Hoppy. Das schätze ich an dir.«
Hoppy wusste nicht, was er auf Fergessons geradezu feierlich vorgetragene Feststellung antworten sollte. Er brachte nur ein verlegenes Stottern zustande. »D-danke, Mr. Fergesson.«
Einer der beiden Mechaniker gab ihm nun einen FM-Tuner. »Frequenzabwanderung. Schau mal, ob du die Justierung wieder hinkriegst.«
»Okay.« Hoppy nahm das Gerät mit seinen Metallgreifern in Empfang. »Mach ich. Hab zu Hause schon öfter Radios justiert, da hab ich Erfahrung.« Diese Art von Arbeit fiel ihm tatsächlich besonders leicht, er musste sich dabei kaum konzentrieren. So etwas war ihm mit seinen Fähigkeiten wie auf den Leib geschnitten.
Als sie das Datum auf dem Kalender an der Küchenwand las, fiel Bonny Keller ein, dass Bruno Bluthgeld heute seinen Termin bei ihrem Psychiater hatte, Dr. Stockstill in Berkeley. Inzwischen hatte er seine erste Therapiestunde sicher schon hinter sich, hatte die Praxis verlassen und war auf dem Weg zurück nach Livermore, zu seinem Büro im Strahlungslabor, dem Labor, in dem sie selbst vor einigen Jahren, bis zu ihrer Schwangerschaft, gearbeitet hatte. Und wo sie Bluthgeld 1975 auch kennengelernt hatte. Inzwischen war sie einunddreißig und lebte in West Marin. Ihr Mann George war stellvertretender Rektor am hiesigen Gymnasium, und sie war sehr glücklich.
Nun, sehr glücklich vielleicht nicht unbedingt. Einigermaßen glücklich. Sie ging immer noch zur Psychoanalyse, aber nicht mehr dreimal die Woche wie früher, sondern nur noch einmal. Und sie kannte sich mittlerweile in vielerlei Hinsicht recht gut, wusste Bescheid über ihre unbewussten Triebe und ihre systematischen Verzerrungen der Wirklichkeit. Die Analyse hatte ihr in sechs Jahren sehr geholfen – doch geheilt war sie nicht. Im Grunde gab es so etwas wie eine Heilung auch nicht, weil die »Krankheit« das Leben selbst war und eine kontinuierliche Entwicklung (oder vielmehr eine entwicklungsfähige Anpassung) stattfinden musste, um einen psychischen Stillstand zu vermeiden.
Einen derartigen Stillstand wollte sie auf keinen Fall. Zurzeit beschäftigte sie sich intensiv mit Oswald Spenglers »Der Untergang des Abendlandes«, das sie im Original las. Sie hatte zwar erst fünfzig Seiten geschafft, aber die Mühe lohnte sich. Und wer von ihren Bekannten konnte schon von sich behaupten, das Buch auch nur in der englischen Übersetzung gelesen zu haben?
Ihr Interesse an literarischen und philosophischen Werken aus dem deutschen Kulturkreis war vor Jahren durch ihren Kontakt zu Bruno Bluthgeld erwacht. Sie hatte Deutsch zwar drei Jahre lang am College studiert, die Sprache aber nicht als wichtigen Bestandteil ihres Erwachsenenlebens betrachtet. Und so waren – wie vieles andere, was sie mit großer Sorgfalt erlernt hatte – ihre Deutschkenntnisse in Vergessenheit geraten, nachdem sie ihr Studium abgeschlossen und eine Arbeit gefunden hatte. Bis Bluthgeld mit seiner charismatischen Persönlichkeit viele ihrer akademischen Interessen sowie ihre Liebe zu Musik und bildender Kunst wieder neu belebt, ja sogar verstärkt hatte. Dafür war sie ihm sehr dankbar.
Nun aber war Bluthgeld krank, und fast alle in Livermore wussten das. Der Mann litt unter starken Gewissensqualen, und diese Qualen waren seit dem tragischen Irrtum von 1972 immer schlimmer geworden. Dabei war allen klar, zumindest allen, die damals in Livermore gearbeitet hatten, dass es nicht allein sein Fehler gewesen war. Es war nicht seine persönliche Schuld, er hatte diese Schuld nur aus eigenem Entschluss auf sich genommen und war deshalb krank – und von Jahr zu Jahr immer kränker – geworden.
Viele hochqualifizierte Leute sowie die besten Geräte und die fortschrittlichsten Computer der damaligen Zeit waren an der folgenschweren Berechnung beteiligt gewesen – die nach dem Kenntnisstand von 1972 nicht als fehlerhaft bezeichnet werden konnte, sondern nur im Hinblick auf die größeren, seinerzeit noch unerforschten Zusammenhänge. Anstatt wegzudriften, waren die riesigen radioaktiven Wolken vom Gravitationsfeld der Erde angezogen worden und in die Atmosphäre zurückgekehrt. Damit hatte niemand gerechnet, am allerwenigsten die Belegschaft von Livermore. Heute wusste man natürlich viel mehr über die sogenannte Jamison-French-Schicht, und sogar Zeitschriften wie Time und US News konnten die Gründe für die Tragödie anschaulich erklären. Aber eben erst neun Jahre später.
All das erinnerte Bonny an das Ereignis des Tages. Sie hätte es beinahe verpasst. Schnell ging sie zum Fernseher im Wohnzimmer und schaltete ihn ein. Ob sie schon gestartet sind? Sie sah auf die Uhr. Nein, erst in einer halben Stunde. Der Bildschirm wurde hell, und die Rakete tauchte auf. Außerdem Wartungspersonal, technische Geräte, Gabelstapler. Allerdings herrschte auf dem Boden kaum Bewegung – vermutlich waren Walt Dangerfield und seine Frau noch gar nicht an Bord.
Die ersten Auswanderer zum Mars … Wie Lydia Dangerfield wohl in diesem Augenblick zumute war? Die große, blonde Frau wusste sicher ganz genau, dass die Chancen, heil auf dem Mars anzukommen, nach Computerberechnungen nur bei ungefähr sechzig Prozent lagen. Auf dem roten Planeten warteten zwar eine hervorragende Ausrüstung sowie gigantische Ausgrabungen und Bauten auf sie, doch was nützte das alles, wenn sie auf dem Weg dorthin eingeäschert wurden? Immerhin, der Ostblock würde sich beeindruckt zeigen – insbesondere nach seinem fehlgeschlagenen Versuch, auf dem Mond eine feste Kolonie einzurichten. Die Russen waren erstickt oder verhungert, so genau wusste das niemand. Auf jeden Fall existierte die Kolonie nicht mehr. Sie war genauso geheimnisvoll verschwunden, wie sie entstanden war.
Im Grunde jedoch war Bonny entsetzt über die Strategie der NASA, statt einer größeren Gruppe nur ein einziges Ehepaar zum Mars zu schicken. Instinktiv spürte sie, dass man damit ein Scheitern geradezu heraufbeschwor – wenn man nicht für eine größere Zufallsstreuung sorgte. Viel besser wäre es, wenn ein paar Leute von New York aus und ein paar von Kalifornien aus losfliegen würden, dachte sie, während sie den Technikern bei der abschließenden Inspektion der Rakete zusah. Um auf Nummer Sicher zu gehen. Man sollte nicht alles auf eine Karte setzen, das ist falsch … Doch die NASA hatte es schon immer so gemacht – von Anfang an immer nur ein Astronaut und das Ganze als Riesenspektakel. Als Henry Chancellor 1967 mit seiner Raumstation verglühte, konnte es die ganze Welt am Fernseher mitverfolgen. Die Öffentlichkeit war überwältigt von Trauer und Bestürzung, und das warf die Weltraumforschung des Westens um mindestens fünf Jahre zurück.
»Wie Sie sehen können«, erklärte der NBC-Moderator gerade mit leiser, eindringlicher Stimme, »werden soeben die letzten Vorbereitungen getroffen. Wir rechnen jeden Augenblick mit dem Eintreffen von Mr. und Mrs. Dangerfield. Bis dahin, verehrte Zuschauer, wollen wir zu Ihrer umfassenden Information noch einmal kurz erläutern, welche gewaltigen Anstrengungen unternommen wurden, um zu gewährleisten …«
Blablabla. Bonny Keller schaltete den Fernseher wieder aus. Ich kann mir das nicht ansehen, dachte sie.
Andererseits, was sollte sie sonst tun? Herumsitzen und die nächsten sechs Stunden Fingernägel kauen – eigentlich die nächsten zwei Wochen? Die einzige Alternative wäre gewesen, sich nicht daran zu erinnern, dass heute das erste Paar startete. Aber für Vergesslichkeit war es jetzt zu spät.
In ihren Gedanken bezeichnete sie die Dangerfields gern als das erste Paar – wie Figuren aus einer altmodischen, sentimentalen Science-Fiction-Story. Eine Neuauflage von Adam und Eva … Nur dass Walt Dangerfield in Wirklichkeit rein gar nichts von einem Adam an sich hatte. Wenn er neugierigen Reportern gegenüberstand, wirkte er mit seinem trockenen, bissigen Humor, seiner leicht stockenden, fast sarkastischen Art zu reden nicht wie der erste, sondern eher wie der letzte Vertreter seiner Gattung. Bonny bewunderte ihn. Dangerfield war alles andere als ein naiver Grünschnabel. Kein junger blonder Befehlsempfänger mit Bürstenhaarschnitt, der sich blindlings in die neueste Mission der Air Force stürzte. Nein, Walt war eine echte Persönlichkeit, und das war ganz sicher auch der Grund, warum ihn die NASA ausgesucht hatte. Seine Gene quollen vom Erbe einer viertausendjährigen Menschheitsgeschichte geradezu über. Walt und Lydia sollten eine Terra Nova gründen – und dafür sorgen, dass irgendwann auf dem Mars etliche kleine, kluge Dangerfields herumlaufen und in der für Walt typischen, leicht schnoddrigen Art intellektuelles Zeug von sich geben.
»Stellen Sie sich das einfach wie einen langen Freeway vor«, hatte Dangerfield einmal auf die Frage nach den Gefahren dieser Reise ins All erwidert. »Eine Million Meilen, mit zehn Spuren. Und stellen Sie sich vor, es ist vier Uhr früh, und Sie sind ganz allein auf der Straße, keine anderen Autos weit und breit. Kein entgegenkommender Verkehr, keine langsamen Lastwagen … Wie heißt es doch so schön: Kein Grund zur Sorge.« Und dann sein sympathisches Lächeln.
Bonny beugte sich vor und stellte den Fernseher wieder an. Auf dem Bildschirm erschien das runde Brillengesicht von Walt Dangerfield. Er trug bereits seinen Raumanzug, nur den Helm hatte er noch nicht aufgesetzt. Lydia stand schweigend neben ihm, während Walt die Fragen der Journalisten beantwortete. Dabei dehnte er die Worte mit einer langsamen Bewegung des Kiefers, als müsste er die Fragen erst gründlich durchkauen.
»Ich habe gehört«, sagte er gerade, »dass es in Boise, Idaho, eine KAD gibt, die sich Sorgen um uns macht.«
Er blickte auf, als jemand weiter hinten im Raum fragte: »Eine KAD?«
»Ja, so hat der große, inzwischen leider verstorbene Herb Caen zu Kleinen Alten Damen gesagt … Wissen Sie, die gibt es wirklich überall. Vermutlich wartet schon eine auf uns auf dem Mars, und wir werden in derselben Straße wohnen wie sie. Jedenfalls, die betreffende KAD in Boise ist ein bisschen nervös wegen Lydia und mir, wenn ich es richtig verstanden habe. Sie hat Angst, dass uns etwas passieren könnte. Deswegen hat sie uns diesen Talisman geschickt.« Etwas unbeholfen wegen der großen Handschuhe seines Raumanzugs hielt er ihn in die Kamera. Durch die Reihen der Reporter ging ein amüsiertes Raunen. »Hübsch nicht? Und ich will Ihnen auch nicht vorenthalten, wofür er gut ist. Er hilft gegen Rheuma.« Die Reporter lachten. »Falls wir dort oben auf dem Mars Rheuma kriegen … Oder Gicht? Ich glaube, sie hat Gicht geschrieben in ihrem Brief.« Er warf seiner Frau einen fragenden Blick zu. »Es war doch Gicht?«
Ein Talisman gegen Meteore und Strahlung ist wahrscheinlich noch nicht erfunden worden, dachte Bonny. Sie war traurig, wie bei einer schlimmen Vorahnung. Oder war es, weil heute Bruno Bluthgelds Termin beim Psychiater war? Konnte das der Grund für ihre trübseligen Gedanken sein? Gedanken über Tod und Strahlung, über Fehlberechnungen und schreckliche Krankheiten …
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bruno wirklich an paranoider Schizophrenie leidet. Es ist lediglich eine Verschlechterung seines Gemütszustands, und mit angemessener psychiatrischer Hilfe – und vielleicht noch ein paar Tabletten dazu – kommt er bestimmt wieder in Ordnung. Eine endokrine Störung, die sich auf den Körper auswirkt – und bei solchen Beschwerden vollbringen sie doch inzwischen wahre Wunder. Es ist kein Persönlichkeitsdefekt, keine psychotische Veranlagung, die durch Stress zum Ausbruch kommt.
Aber eigentlich weiß ich es nicht. Bruno musste uns ja erst erzählen, dass sie sein Trinkwasser vergiften, bevor George und ich gemerkt haben, wie krank er ist. Bis dahin hatten wir ihn nur für ein bisschen deprimiert gehalten.
Insofern konnte sie sich auch gut ein Medikament für ihn vorstellen, das die Hirnrinde stimulierte oder die Tätigkeit des Zwischenhirns hemmte – also das westliche Pendant zu einer Arznei aus der zeitgenössischen chinesischen Kräuterheilkunde –, das jedenfalls den Stoffwechsel in seinem Gehirn veränderte und alle Wahnvorstellungen wie Spinnweben zerriss. Dann wird wieder alles gut sein, sagte sie sich. George und ich werden mit Bruno abends wieder Blockflötenmusik von Bach und Händel spielen. Die beiden Männer an zwei echten Holzblockflöten aus dem Schwarzwald und sie am Klavier. Das Haus erfüllt von Barockmusik und dem Duft von selbstgebackenem Brot. Und eine Flasche Buena Vista aus der ältesten Weinkellerei Kaliforniens …
Auf dem Fernsehschirm erging sich Walt Dangerfield jetzt in geistreichen Bonmots – eine Art Mischung aus Voltaire und Will Rogers. »O ja, wir rechnen damit, dass wir auf dem Mars viele fremde Lebensformen entdecken werden.« Bei diesen Worten ruhte sein Blick auf dem großen und ziemlich merkwürdigen Hut einer Journalistin, wie um zu bekunden, dass er schon auf die erste fremde Lebensform gestoßen war. Wieder lachten die versammelten Reporter. »Ich glaube, es hat sich bewegt.« Er deutete auf den Hut und sah dabei seine Frau an, die seinen Blick ruhig und gelassen erwiderte. »Er verfolgt uns, Schatz.«
Während sie die beiden so beobachtete, wurde Bonny klar, dass er Lydia wirklich liebte. Ob George wohl je solche Gefühle für mich empfunden hat wie Walt Dangerfield für seine Frau? Ehrlich gesagt, kann ich es mir nicht vorstellen. Wenn es so wäre, dann hätte er nie in meine zwei therapeutischen Abtreibungen eingewilligt … Dieser Gedanke machte sie noch trauriger. Sie wandte sich um und entfernte sich einige Schritte von dem Fernseher.
Sie sollten George auf den Mars schießen! Oder besser gleich uns alle zusammen, George und mich und die Dangerfields. George kann dann ja eine Affäre mit Lydia anfangen – falls er das Zeug dazu hat –, und ich kann mit Walt ins Bett gehen. Ich wäre bestimmt keine schlechte Partnerin für ihn bei diesem großen Abenteuer, da bin ich mir sicher.
Wenn doch nur irgendetwas passieren würde, irgendetwas. Meinetwegen dass Bruno anruft mit der Nachricht, er ist geheilt. Oder dass Dangerfield auf einmal kalte Füße bekommt und doch nicht fliegt. Oder dass die Chinesen den Dritten Weltkrieg anfangen. Oder dass George endlich wirklich diesen fürchterlichen Vertrag mit der Schule kündigt, wie er es längst versprochen hat. Irgendetwas einfach. Vielleicht sollte ich meine Drehscheibe herauskramen und wieder töpfern – mich in sogenannte Kreativität stürzen, anale Spielerei oder was auch immer. Genau, ich könnte einen lasziven Krug machen. Ich könnte ihn entwerfen, in Violet Clatts Ofen brennen und dann unten in San Anselmo an Creative Artworks verkaufen, an diesen Schickimicki-Laden, der letztes Jahr nichts von meinem Modeschmuck wissen wollte. Aber einen lasziven Krug würden sie bestimmt nehmen – wenn es ein guter lasziver Krug ist.
Im Modern TV hatte sich gleich am Eingang eine kleine Menschenmenge versammelt, um in dem überdimensionalen Stereofernseher dort den Flug der Dangerfields mitzuerleben, der überall auf der Welt ausgestrahlt wurde. Stuart McConchie hielt sich mit verschränkten Armen im Hintergrund.
Walt Dangerfield bewies gerade wieder einmal seinen trockenen Humor. »Der Geist des großen Arbeiterführers John L. Lewis würde sich bestimmt freuen, wenn er wüsste, was Anfahrtskosten wirklich ausmachen können. Wenn er nicht gewesen wäre, würden sie mir für die Reise wahrscheinlich so um die fünf Dollar zahlen – mit der Begründung, dass die eigentliche Arbeit doch erst nach der Ankunft beginnt.« Sein Gesichtsausdruck war jetzt allerdings ernster – es war an der Zeit, die Rakete zu betreten. »Bitte denkt daran – wenn uns was passiert, wenn wir uns verirren, sucht uns nicht. Bleibt lieber zu Hause. Irgendwo werden Lydia und ich schon wieder auftauchen.«
Die Reporter konnten den Dangerfields gerade noch viel Glück wünschen, als schon Offizielle und Techniker kamen und das Ehepaar langsam zur Rakete schoben. Gleich darauf war nichts mehr von ihnen zu sehen.
Stuart wandte sich Lightheiser zu, der sich neben ihn gestellt hatte. »Jetzt dauert es nicht mehr lang.«
»Ganz schöner Trottel, dass er fliegt.« Lightheiser kaute auf einem Zahnstocher herum. »Der kommt nicht mehr zurück, das haben die von Anfang an gesagt.«
»Warum sollte er denn zurückwollen? Was ist so toll hier?« Stuart war ziemlich neidisch auf Walt Dangerfield. Wie gern hätte er an seiner Stelle vor den Kameras gestanden, er, Stuart McConchie, vor den Augen der ganzen Welt.
In diesem Moment kam Hoppy Harrington die Treppe vom Keller herauf und rollte mit seinem Wagen nach vorn zur Eingangstür. »Haben sie ihn schon hinaufgeschossen?« Nervös zappelnd schielte er zum Bildschirm hinüber. »Er wird garantiert verbrennen. Es wird wie damals 65 sein. Ich selbst kann mich natürlich nicht daran erinnern, ich war ja erst …«
»Halt bloß die Klappe«, zischte Lightheiser. Der Phokomelus lief rot an und verstummte. Dann sahen sie zu – jeder mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt –, wie das letzte Wartungsteam mit einem Kran vom Bug der Rakete geholt wurde. Bald musste der Countdown beginnen. Die Rakete war vollgetankt und überprüft – und jetzt stiegen auch die zwei Raumfahrer ein. Ein Raunen ging durch die kleine Gruppe vor dem Fernseher.
Später, irgendwann am Nachmittag, würden sie dann für ihr Warten belohnt werden – wenn die Dutchman IV endlich abhob. Etwa eine Stunde lang sollte die Rakete die Erde umkreisen, und Millionen Zuschauer würden ihren Weg am Bildschirm mitverfolgen. Dann würde schließlich eine Entscheidung fallen, jemand unten in der Bodenstation würde mit einem Knopfdruck die letzte Phase einleiten, und die Rakete würde ihre Umlaufbahn verlassen und sich von der Erde entfernen. Die Menschen hatten dergleichen natürlich schon öfter gesehen, es lief eigentlich immer ganz ähnlich ab. Nur dass die Besatzung dieser Rakete eben nie zurückkehren würde. Das war es schon wert, einen Tag vor dem Fernseher zu verbringen.
Stuart dachte jedoch ans Mittagessen. Danach konnte er ja gleich wieder zurückkommen und sich die Sache weiter anschauen. Heute lief in der Arbeit sowieso nichts, keinen einzigen Fernseher würde er heute verkaufen. Das hier war einfach wichtiger, das durfte er sich nicht entgehen lassen. Schließlich könnte ich es sein, der dort oben rumfliegt, dachte er. Vielleicht wandere ich ja später auch aus. Wenn ich einmal genug verdiene, um zu heiraten. Dann kann ich mit meiner Frau und meinen Kindern dort oben auf dem Mars ein neues Leben anfangen. Aber natürlich erst, wenn sie eine richtige Kolonie aufgebaut haben.
Er stellte sich vor, angeschnallt in der Kapsel neben einer unglaublich attraktiven Frau zu liegen. So wie Walt Dangerfield und seine Frau. Die beiden waren echte Pioniere, Gründer einer neuen Zivilisation auf einem fremden Planeten … Dann knurrte sein Magen, und obwohl er weiterhin das Bild der hoch aufragenden Rakete vor Augen hatte, konnte er nicht verhindern, dass sich seine Gedanken irdischeren Dingen zuwandten: Suppe und Sandwiches, Steak und Apfelkuchen mit Eiscreme. Was eben so im Fred’s Fine Foods serviert wurde.
Drei
Als Stuart McConchie das Lokal weiter oben an der Straße betrat, bemerkte er zu seinem Ärger hinten am Tresen Hoppy Harringtons Wagen. Und nicht nur das: Hoppy verspeiste gerade in aller Seelenruhe seine Mahlzeit, als käme er schon seit Ewigkeiten hierher. Gottverdammt, dachte Stuart, der macht sich hier einfach breit. Diese Phokos machen sich überall breit! Und ich hab nicht mal mitgekriegt, wie er den Laden verlassen hat.
Dennoch setzte sich Stuart an einen Tisch und griff nach der Speisekarte. Von dem lasse ich mich doch nicht verjagen, sagte er sich, während er nachsah, welches Tagesmenü es gab und was es kostete. Es war Monatsende – und Stuart war praktisch pleite. Irgendwie wartete er ständig auf seinen vierzehntägigen, von Fergesson persönlich überreichten Gehaltsscheck, und der nächste war erst am Ende der Woche fällig.
Während er seine Suppe löffelte, drang die schrille Stimme des Phokos an Stuarts Ohr. Offenbar erzählte Hoppy gerade irgendeine Geschichte. Aber wem eigentlich? Connie, der Kellnerin? Stuart drehte den Kopf zur Seite und sah, dass sowohl Connie als auch der Koch Tony neben Hoppys Wagen standen und dem Phoko zuhörten. Und keinem von beiden war etwas von Widerwillen anzumerken.
In diesem Moment erkannte Hoppy Stuart und rief ihm ein »Hallo!« zu. Stuart nickte nur und widmete sich wieder seiner Suppe.